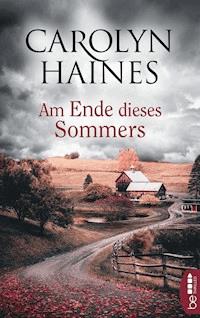
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Südstaaten-Krimis
- Sprache: Deutsch
Der unschuldige Blick eines Kindes - und Fremde, die Unheil bringen ...
Jexville, Mississippi, Sommer 1963: Die Ankunft von Fremden stört das ruhige und sichere Leben auf dem Land. Eine geheimnisvolle Sekte lässt sich im Dorf nieder, eine weiß verschleierte Frau irrt durch die Nacht und ein Baby verschwindet. Für die dreizehnjährige Rebekka ist all das anfangs ein einziges großes Abenteuer. Doch schon bald wird aus dem Spiel tödlicher Ernst ...
Ein aufrüttelnder Kriminalfall und ein ergreifender Coming-of-Age-Roman: Rebekkas Geschichte beschwört die drückende Atmosphäre eines Südstaaten-Sommers herauf und bleibt dabei spannend bis zur letzten Seite. Für alle Leser von Harper Lees "Wer die Nachtigall stört".
Weitere Südstaaten-Krimis von Carolyn Haines als eBook bei beTHRILLED: Das Mädchen im Fluss, Im Nebel eines neuen Morgens und Der Fluss des verlorenen Mondes.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 807
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
DANKSAGUNG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
Über dieses Buch
Der unschuldige Blick eines Kindes – und Fremde, die Unheil bringen ...
Jexville, Mississippi, Sommer 1963: Die Ankunft von Fremden stört das ruhige und sichere Leben auf dem Land. Eine geheimnisvolle Sekte lässt sich im Dorf nieder, eine weiß verschleierte Frau irrt durch die Nacht und ein Baby verschwindet. Für die dreizehnjährige Rebekka ist all das anfangs ein einziges großes Abenteuer. Doch schon bald wird aus dem Spiel tödlicher Ernst … Ein aufrüttelnder Kriminalfall und ein ergreifender Coming-of-Age-Roman: Rebekkas Geschichte beschwört die drückende Atmosphäre eines Südstaaten-Sommers herauf und bleibt dabei spannend bis zur letzten Seite.
Über die Autorin
Carolyn Haines (*1953) ist eine amerikanische Bestsellerautorin. Neben den humorvollen Krimis um Privatermittlerin Sarah Booth Delaney hat die ehemalige Journalistin u.a. auch hochgelobte Südstaaten-Romane geschrieben, die auf sehr atmosphärische Weise die Mississippi-Gegend im letzten Jahrhundert porträtieren. Für ihr Werk wurde Haines mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Harper Lee Award. In Mississippi geboren, lebt die engagierte Tierschützerin heute mit ihren Pferden, Hunden und Katzen auf einer Farm im Süden Alabamas.
Homepage der Autorin: http://carolynhaines.com/.
CAROLYN HAINES
Am Endedieses Sommers
Aus dem amerikanischen Englisch vonChrista Schuenke
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
SUMMER OF THE REDEEMERS
Originalverlag: DUTTON Penguin Books USA Inc., New York
© 1994 by Carolyn Haines
© für die deutschsprachige Ausgabe 1997/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock: STILLFX; © iStock: Richard McMillin | KanKAnavee
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-5638-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für meine Eltern Roy und Hilda Haines,
meine Großmutter Hulda Nyman McEachern,
meine beiden Brüder David und Andy
und für Venus,
den besten Hund, den ein Mädchen je hatte.
DANKSAGUNG
Wenn man ein Buch schreibt, kommt vieles zusammen, und vielen gebührt Dank. Zuerst möchte ich meiner Agentin Marian Young danken, die mein Manuskript mit großem Sachverstand gelesen und klar die Richtung erkannt hat, die ich einschlagen musste. Der Deep South Writers’ Salon, bestehend aus Rebecca Barrett, Renee Paul, Stephanie Rogers, Susan Tanner und Jan Zimlich, gab mir die feste, unerschütterliche Unterstützung, die ich so nötig brauchte. Elaine Koster und Audrey LaFehr von Dutton sowie Anne Williams von Headline habe ich es zu verdanken, dass der Weg vom Manuskript zum Buch eine echte Freude war. Und ganz besonders danke ich meinen stets zu Streichen aufgelegten Kindheitsfreundinnen, ohne die ich dieses Buch nie hätte schreiben können. Diana, Marie, Becky, Debby und Janey – es gab eine Zeit, da ließ uns die Freiheit der Fantasie gemeinsam die aufregendsten und wundervollsten Abenteuer erleben. Ein besonderes Dankeschön geht an Rebekka Freeman, die leider nicht mehr unter uns weilt. Wer sie kannte, wird sie vermissen.
KAPITEL 1
Maebelle VanCamp Waltman verschwand an einem Oktobertag von der Kali Oka Road, einem Tag, an dem der Duft der Kudzutrauben in dichten Schwaden über der Kreideschlucht aufstieg. Es war ein träger, scheinbar endlos währender Nachmittag, erfüllt von jenem goldenen Herbstlicht, das man nur in Mississippi antrifft.
Ich stand bis zu den Hüften in der kleinen Grube, die ich gerade schaufelte, als ich den schrillen Schrei vernahm, den Agatha Waltman ausstieß, als sie entdeckte, dass sie ihr Baby nicht bloß verlegt hatte, sondern dass es wirklich verschwunden war. Ein gellender Schrei, ein wütender und zugleich angstvoller Schrei, der vom Haus der Waltmans bis hinunter in die eine Viertelmeile entfernte Schlucht zu hören war. Ich kümmerte mich nicht mehr um den Ton, den ich mit solcher Mühe ausgebuddelt hatte, sondern schnappte mein Fahrrad und raste heimwärts, und auf dem Weg spürte ich, wie unter meiner Zunge, dort, wo man die Angst schmecken kann, noch das Echo jenes Schreis vibrierte. Ich wusste vom ersten Augenblick an, was passiert war. Ohne etwas Genaueres zu wissen, ohne auch nur ein einziges Detail zu kennen, begriff ich, was dieser lang gezogene, verzweifelte Klagelaut zu bedeuten hatte.
Und ich wusste, dass ich schuld war.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom Verschwinden des Babys an der roten, von brachen Maisfeldern gesäumten Lehmstraße entlang bis hinab zum Cry Baby Creek, einem kleinen Fluss am Ende der Kali Oka Road. Dort hatte man vor über zehn Jahren das andere Baby gefunden. Ich strampelte aus Leibeskräften, ich flitzte hinter unserem Grundstück vorbei, durch den Wald und den Pekangarten bis zum Haus und war doch nicht so schnell wie das Gerede der Leute. Mama Betts erwartete mich schon an der Fliegentür.
»Die kleine Waltman ist entführt worden«, sagte sie.
»Maebelle?« Ich sah die Kleine vor mir, gerade acht Monate alt, mit ihren braunen Augen und dem wuscheligen roten Lockenschopf. Ein richtig fröhliches Baby, wenn auch ein bisschen zart für ihren hochtrabenden Namen.
»Effie ist in die Stadt gefahren, aber wenn sie wiederkommt, möchte sie mit dir zu den Waltmans rübergehen.«
Mit brennenden Fingerknöcheln drückte ich gegen die Fliegentür und wollte sie aufstoßen, aber meine Arme zitterten und versagten mir den Dienst. Ich strich mit den Fingern über die Gaze. »Nein, das kann ich nicht.«
»Alice braucht dich.«
Ich spürte Mama Betts’ bohrenden Blick, ich merkte, dass sie mich beobachtete und sich ihren Teil dachte. Endlich öffnete ich die Tür und ging an ihr vorbei zum anderen Ende der ringsum mit Fliegenfenstern versehenen Veranda an der Rückseite des Hauses. Mama Betts’ sanfte Stimme zwang mich stehen zu bleiben.
»Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass Evie Baxter entführt worden ist. Die ganze Straße weiß das noch, aber keiner will sich daran erinnern. Sogar den Namen von der armen Kleinen haben sie vergessen.«
Mama Betts konnte sich an alles erinnern, was seit der Jahrhundertwende in Chickasaw County passiert war.
»Das war doch das Neugeborene, was man im Cry Baby Creek gefunden hat, nicht wahr?« Ich kannte die Geschichte bruchstückhaft aus den Gesprächen der Erwachsenen, die ich mitbekommen hatte, und aus den geflüsterten Ermahnungen von Mama Betts. Mein Bruder und ich hatten oft bei Nacht unten an dem Flüsschen gesessen und gelauscht, ob wir den Geist des armen ermordeten Babys hören würden. Und einmal, in einer sternklaren Nacht, als wir die Hoffnung schon beinahe aufgegeben hatten, da hatten wir es tatsächlich gehört. Das mitleiderregende Weinen eines hilflosen, verzweifelten Geschöpfs hatte mir Schauer den Rücken runtergejagt.
»Wie die Leute von dieser Kirche hier an der Kali Oka Road ihre Zelte aufgeschlagen haben, da hab ich gleich gewusst, das gibt Ärger«, sagte Mama Betts. »Ich hab’s allen erzählt, wie’s früher war und dass die Vergangenheit der Gegenwart ihren Stempel aufdrückt, aber auf mich hört ja keiner.«
»Dieses erste Baby, wie hat man das eigentlich gefunden, Mama Betts?« Aus dem Hof kam Gebell, und ich ging in die Ecke der Veranda, von der aus ich nach meiner Hündin schauen konnte. Mein Aufbruch aus der Schlucht war so überstürzt gewesen, dass ich gar nicht darauf geachtet hatte, ob Picket bei mir war. Aber schließlich war Picket immer bei mir. Es war schlichtweg unmöglich, sie abzuhängen.
»Das andere Kleine, das hat man im Cry Baby Creek gefunden, zwischen den Baumwurzeln am Ufer. Wenn die Wurzeln nicht gewesen wären, wär’s mit der Strömung in den Pascagoula River geschwemmt worden und dann geradewegs in den Golf von Mexiko.«
Mama Betts hatte blaue Augen, genau wie ich, und der Blick, mit dem sie jetzt auf meine Reaktion wartete, war fast wie eine Berührung. Sie wartete darauf, dass ich mich umdrehte, aber das tat ich nicht. »Zwischen den Wurzeln?« Ich sah alles genau vor mir. Die Weiden, die am Ufer wuchsen und wie ein Baldachin über einem Teil des Flusses hingen. Ein Paradies für Schlangen, und bei Niedrigwasser musste das tote Baby zwischen diesen Wurzeln gelegen haben wie in einem richtigen kleinen Nest.
»An dem weißen Taufkleidchen hing ein Stück Zickzacklitze, die sich im Gestrüpp verfangen hatte. Das Wasser stand flach, und die Strömung konnte das Baby nicht mitreißen. Wenn die Litze nicht gewesen wär, wär’s niemals rausgekommen, dass sie tot ist. Dann hätten sie einfach behaupten können, die Kleine sei verschwunden.«
Die Eiche neben unserem Haus verlor bald ihr Laub. Überall lagen Eicheln verstreut – ein richtiges Festessen für die grauen Eichhörnchen. Weiter hinten reckten die Pekanbäume ihre dichten Kronen in den Himmel. In diesem Jahr würde es eine gewaltige Ernte geben, hatte Daddy gesagt. Wir würden Leute einstellen müssen, um alle Nüsse aufzulesen.
»Hab ich dir nicht immer gesagt, du sollst dich fernhalten von diesen Leuten da unten an der Straße?«, sagte Mama Betts. »Von diesen Fanatikern.«
»Ja, Großmutter.«
»Und von dieser Verrückten. Von der auch. Hab ich’s dir nicht gesagt?«
»Nadine hat nichts damit zu tun.« Ich hörte mein Herz schlagen. Es hämmerte in meinen Ohren. Nadine Andrews war anders als die anderen – eine alleinstehende Frau mit einer Scheune voll teurer Dressurpferde und ein paar Marotten. Aber das mit Maebelle, das war eine Sache für sich. Eine ziemlich unheimliche Sache.
»Wir werden ja sehen. Aber ich hab dich gewarnt.«
»Ja, Großmutter, ich weiß.« Ich konnte kaum sprechen. Sie hatte mich gewarnt, hatte gesagt, ich sollte mich nicht einmischen in die Dinge, die in diesem Sommer 1963 in der Kali Oka Road vor sich gingen. Sie hatte von unguten Einflüssen geredet und dabei dreimal kurz mit dem Kopf genickt, was bedeutete, dass sie es ernst meinte. Es läge etwas in der Luft, hatte sie gesagt, etwas Schlimmes.
Maebelle VanCamp Waltman war weg.
Niemand würde mich verstehen, aber irgendwie wusste ich, dass das meine Schuld war. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte Maebelle süß und selig in ihrem Bettchen schlafen können, in dem Zimmer, das sich Alice mit vier von ihren Schwestern teilte.
Wenn ich erklären soll, wie ich das meine, fange ich am besten mit dem Anfang an, dem Anfang dieses Sommers. Denn das war die Zeit, als die unguten Einflüsse in der Kali Oka Road zu wirken begannen. Oder vielleicht war es auch einfach nur die Zeit, als die alten Verbrechen wieder lebendig wurden. Mama Betts hat immer gesagt, man soll die Vergangenheit ruhen lassen. Die Vergangenheit ist nie so großartig, wie wir sie in Erinnerung haben, hat sie gesagt, und wenn sie uns irgendwann einmal heimsucht, dann hätten wir nichts zu lachen.
In jenem Sommer ereigneten sich zwei Dinge. Das mit den Leuten von der Blut-des-Erlösers-Gemeinde und das mit Nadine Andrews. Sich von den Gemeindeleuten fernzuhalten war nicht schwer. Gruselig und trostlos sahen sie aus, diese langhaarigen Gestalten in ihrer grauen Tracht. Ich gebe zu, sie haben meine Neugier angefacht, und so brachte ich in jenem Sommer viele Nachmittage damit zu, ihnen nachzuspionieren. Aber das mit Nadine war etwas anderes. Immer wenn Mama Betts oder Mama mich aus den Augen ließen oder ich sie abschütteln konnte, radelte ich zu Nadine, und nichts auf der Welt hätte mich daran hindern können, und wenn die Erlöser mir mit dem Fegefeuer gedroht hätten. Die Erlöser fand ich bloß spannend, Nadine aber zog mich magisch an.
Als Nadine in das Haus zog, das früher der Familie McInnis gehört hatte, erklärte Mama Betts sie kurzerhand für verrückt. Kein Mensch, der seine fünf Sinne beisammenhätte, würde auf den Gedanken kommen, dort einzuziehen, schon gar nicht allein, bloß mit lauter Katzen, Hunden und Pferden.
Sie meinte natürlich, keine Frau. Keine Frau, die ohne Mann war. Keine alleinstehende Frau von vierundzwanzig Jahren mit blondiertem Haar, engen Hosen und Stiefeln, keine Frau, die sich, wenn sie im Sattel saß, aufführte, als ob sie sich für Jacqueline Kennedy hielt, aber in einem Haus wohnte, das man, wie Mama Betts sagte, schon von der Straße aus riechen konnte.
Auch ich fand Nadine ungewöhnlich, allerdings nicht aus den gleichen Gründen wie Mama Betts. Bei mir waren es schlicht und einfach die Pferde. Sie hatte die herrlichsten Pferde, die ich je gesehen hatte. Tiere mit schimmerndem Fell, die mutwillig die Köpfe in den Nacken warfen.
Auf einmal waren sie da, diese Pferde, die genauso aussahen wie die, von denen ich immer geträumt hatte, waren da, keine Meile von der Kali Oka Road entfernt. Sicher, Mama Betts wusste über die Vergangenheit Bescheid, ich aber hatte sogleich den Wink des Schicksals erkannt.
Nadine kam fast zum gleichen Zeitpunkt in die Kali Oka Road wie die Erlöser. Na ja, genau genommen waren die Erlöser eher da. Sechs alte gelbe Schulbusse voll, und die Frauen und Kinder starrten mit unbewegten, todernsten Gesichtern durch die Fenster, als sie an unserem Haus vorbeifuhren. Das war ein böses Omen. Schon den ganzen Frühling über hatte man in der Kali Oka Road gemunkelt, das Grundstück am Ende der Straße, auf dem die alte Kirche stand, die seit Evie Baxters frühem Tod geschlossen gewesen war, sei verkauft worden.
Immer wenn in der Kali Oka ein Grundstück den Besitzer wechselte, gab es Gerüchte und Spekulationen. Die Leute hingen mit Leib und Seele an ihrer Scholle. Ihr Grund und Boden war ihr ganzer Stolz. Für Fremde gab es hier keinen Platz.
Die Kali Oka bestand aus Farmland, das größtenteils noch immer im Besitz der Familien war, die sich gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts im Zuge der Wiederbesiedelung der südöstlichen Teile des Staates Mississippi hier niedergelassen hatten. Jexville hatte zweitausend Einwohner und stabile Verhältnisse. Keine Kriminalität. Keine Probleme.
Jexville war auch das wirtschaftliche Zentrum des County, und doch lag es für mich in diesem Sommer gleichsam auf einem anderen Stern. Südlich der Stadt erstreckte sich die Kali Oka Road wie ein langes Band aus rotem Lehm, das die Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpfte. Von der letzten Sekte, die uns beehrt hatte, war die Erinnerung an Mord und Totschlag geblieben und das mitleiderregende Weinen eines sterbenden Babys, das man noch immer in klaren Sommernächten entlang des Flusses hören konnte. Noch immer spukte Evie Baxters Geist dort unten an dem gewundenen kleinen Flüsschen. Mama Betts hat gesagt, als die kleine Evie Baxter in das kalte Wasser des artesischen Brunnens geworfen wurde, habe sich der Schicksalsspruch erfüllt, der über dem Fluss verhängt gewesen sei. Wenn außer demjenigen, der sie getötet hatte, noch jemand dort gewesen wäre und ihr Jammern und Weinen gehört hätte, könnte sie noch leben. So aber habe sie die letzten Minuten ihres Lebens zum schwarzen Herzen ihres Mörders schreien müssen.
All das geschah, als das Grundstück am Ende der Straße der Für-Christus-leben-Gemeinde gehörte. Die Lebensgemeinde, wie sie bei den Bewohnern der Kali Oka Road hieß, hatte die Kirche und das Pfarrhaus gebaut und dort in einer Kommune gelebt. Dieses Wort, das ich von Mama aufgeschnappt hatte, ließ Mama Betts’ Blut in Wallung geraten, weshalb sie jedes Mal, wenn sie es aussprach, kreisrunde Augen machte und sich gebärdete, als ob sie damit den Leibhaftigen heraufbeschwor.
Wie dem auch sei, nach dem Mord an Evie Baxter flohen die Leute von der Lebensgemeinde vor dem Zorn der Anwohner, sie verließen die Gegend, und die Kirche blieb leer. Als die Erlöser dort einzogen, nahm niemand groß Notiz davon, und trotzdem glaube ich, dass Nadine, als sie mit ihren neun Pferden, vierzehn Katzen und fünf Hunden bei uns ankam, entschieden mehr Aufsehen erregt hätte, wenn die Erlöser ihr nicht schon vorher die Show gestohlen hätten.
Es war einer der heißesten Sommer, an die sich die Leute in der Kali Oka erinnern konnten. In den ersten ein, zwei Wochen fuhren Alice und ich Fahrrad, passten auf Maebelle V., die kleine Schwester von Alice, auf und versuchten verzweifelt, uns nicht tot zu schwitzen. Am Anfang sah es so aus, als würde es ein typischer Kali-Oka-Sommer werden. Daddy war nach Missouri an die Universität gefahren, aber das war etwas, worüber wir mit niemandem redeten. Mama war in der Kali Oka Road groß geworden, doch bei Daddy lagen die Dinge etwas anders. Er war ein Nordstaatler. Ständig bekam er irgendwelche Stipendien oder Gastprofessuren und reiste von einer Universität zur nächsten. Aber weil Arly und ich darüber mit keinem reden sollten, interessierte ich mich nicht weiter dafür, was er eigentlich machte. Wir sagten einfach, er würde den Sommer über außerhalb arbeiten, und der größte Teil unserer Freunde gab sich damit zufrieden. In der Kali Oka gab es viele Väter, die außerhalb arbeiteten – auf den Bohrinseln oder auf der Schiffswerft in Pascagoula.
Mama schrieb Kinderbücher. Auch darüber redeten wir nicht. Es war kein Geheimnis, aber Mama sagte, anderen Leuten könnte das auf die Nerven gehen, und darum sei es besser, nicht darüber zu reden. Vielleicht hatte die Anziehungskraft, die Nadine auf mich ausübte, damit zu tun, dass es in unserer Familie so viele Geheimnisse gab. Nicht einmal unsere Namen stimmten. Mama Betts hat immer gesagt, damals, als sie meine Mama nach der alten irischen Heimat Erin Clare genannt habe, da sei sie von Feen verzaubert gewesen. Das habe sich auf Mamas Verstand ausgewirkt, und darum sei Mama auch eine richtige Hellseherin geworden und ein solcher Wirrkopf, dass sie von Rechts wegen Effie heißen müsste. Sich Geschichten für Kinder ausdenken, das könne sie, aber wenn sie einen Topf mit Klößen auf dem Feuer hätte, den würde sie vergessen. Wenn Mama Betts der Geduldsfaden riss, sagte sie immer, wenn Mama »in einen Satz versunken« sei, dann könne um sie herum das Haus abbrennen.
Das andere Extrem konnte sie genauso in Rage bringen. Meinen Daddy nannte sie immer einen Detailfanatiker, weil er so pingelig war und jede noch so winzige Kleinigkeit wissen wollte. Ich glaube, deshalb hatte er auch den Spitznamen »der Richter«, obwohl er eigentlich Walter Arlington Rich III. hieß. Alle sagten Richter zu ihm, und dabei hatte er gar nichts mit dem Gericht in Jexville zu schaffen und war auch nicht etwa Jurist. Er war Universitätsdozent und schrieb Artikel für Zeitschriften, die die Leute im Wohnzimmer auf dem Couchtisch liegen haben, ohne je darin zu lesen. Er und Mama hatten sich bei einem Schriftstellertreffen kennengelernt, und seine Familie war immer noch sauer, dass er nach Mississippi gegangen war. Mama Betts hat immer gesagt, die glauben, bei uns geht man noch mit der Schippe in den Wald, wenn man sein Geschäft machen will. Daddys Detailbesessenheit und seine Familie konnten Mama Betts manchmal ganz schön auf die Palme bringen.
Bleibt noch Arly, der eigentlich Arlington hieß und wegen dieses Namens mindestens einmal pro Schuljahr in eine Prügelei verwickelt wurde. Und ich heiße Rebekka nach der Bibel und Brighton nach jemandem aus Daddys Verwandtschaft, aber alle nennen mich Bekka, weil Rebekka in den Sechzigerjahren für Mamas Geschmack zu hochtrabend war. Ach ja, und Mama Betts. Die hieß in Wirklichkeit Beatrice O’Shawnessy McVay, aber jeder sagte Mama Betts zu ihr, außer ihren ältesten Freundinnen, die nannten sie Beatrice. Die dürften das, hat sie immer gesagt, die hätten nämlich schon ganz morsche Knochen, und die würden womöglich zu Bruch gehen, wenn sie sie verprügelte.
Diese ganzen Geheimnamen, die in unserem großen alten Haus herumgeisterten, haben wohl ihren Teil dazu beigetragen, dass es mich so sehr gelüstete, Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Mama Betts hat immer gesagt, ich könnte manchmal schon gar nicht mehr unterscheiden, was wahr ist und was nicht. Wenn die Wahrheit und ich zusammen die Kali Oka Road hinuntergehen würden, hat sie immer gesagt, würde keiner von uns den anderen erkennen. Mama meinte, ich hätte halt eine blühende Fantasie und Mama Betts solle mich in Ruhe lassen. Daddy wollte »Details« über meine »Lügen« wissen. Vor Mama Betts musste ich mich ganz besonders hüten, wenn ich ausbüchste, um Nadine und die Pferde zu sehen. Denn Mama Betts war diejenige, die meine Jeans nach Pferdehaaren absuchte und prüfte, ob sie nach Leder und Schweiß rochen. Sie kannte mich wahrscheinlich am besten. Sie wusste, wie zäh ich kämpfen konnte, wenn ich etwas unbedingt wollte. Wenn ich nicht so trotzig versucht hätte, meinen Willen durchzusetzen, wäre Maebelle V. vielleicht nicht verschwunden.
KAPITEL 2
7. Juni 1963
Der Deckenventilator saugte die Luft an, die zum Küchenfenster hereinwehte. Mama Betts und ich putzten Erdbeeren für einen Kuchen, und Effie las uns etwas vor.
Mama Betts stand am Ausguss. Ihr Messer huschte mit solcher Geschwindigkeit hin und her, dass ich innehielt und ihr zusah. Ihre linke Hand war gekrümmt und knotig von der Arthritis, doch das störte sie nicht bei der Arbeit. Und während ich so dastand und guckte und Effie zuhörte, steckte ich mir eine Erdbeere in den Mund, deren warme Süße auf meiner Zunge explodierte. Mama war gar nicht glücklich darüber, dass ich mit einem scharfen Messer hantierte, aber Mama Betts hatte entschieden, ich sei alt genug. Effie las die letzte Seite vor.
»Na, wie gefällt euch das?« Sie legte die Seiten ordentlich zu einem Stapel zusammen. Ihre Stimme klang einschmeichelnd, aufgeregt und ein klein wenig ängstlich.
»Eine Frau, die so schön darüber schreibt, dass man die Kinder erwachsen werden lassen muss, sollte sich eigentlich auch selbst daran halten.« Mama Betts ließ ihr Messer scheppernd in den Ausguss fallen. Sie trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch ab und ging zum Tisch, wo meine Mama saß mit ihren ungebürsteten dunklen Locken und ihrer Brille, die ihr auf die Nasenspitze gerutscht war. »Eine schöne Geschichte ist das, Effie. Du wirst von Mal zu Mal besser.« Sie küsste ihre Tochter aufs Haar.
»Es geht doch nichts über ein gesundes Vorurteil«, sagte meine Mama und sah hoch zu Mama Betts, und eine ganz leichte Röte überzog ihre Wangen. »Du findest einfach alles toll, was ich mache, und wenn’s der größte Müll ist.«
»Jedenfalls würde ich sagen, dass ich es toll finde. Aber ich hab Glück, ich muss nicht lügen. So, und was hältst du davon, wenn du mir jetzt, wo du fertig bist mit deinem Meisterwerk, mal den Teig ausrollen würdest?«
»Ja, ja, ein Mann arbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, aber für Effie Rich reißt die Arbeit nie ab.« Sie legte den Papierstapel ordentlich auf den Küchentisch.
»Und du Bekka, wie hat es dir gefallen?«
»Toll.«
»Eigentlich habe ich das für kleinere Kinder geschrieben, aber du warst ja schon immer meine beste Leserin.«
»Ich würde mir bloß wünschen, dass sich die Dinge im wirklichen Leben auch so regeln lassen wie in deinen Büchern.« Ich putzte die letzte Erdbeere, spülte sie ab und steckte sie in den Mund. »In deinen Büchern hat immer jeder für jeden Verständnis.« Erst gestern Abend hatte Mama mir meine Bitte abgeschlagen, übers Wochenende mit einer Freundin und deren Familie an den Golf fahren zu dürfen. Sie würde die Leute nicht gut genug kennen, hatte sie erklärt. Es könnte ja sein, dass sie nicht richtig auf mich aufpassten. Die Strudel im Golf seien mörderisch. Letzten Sommer sei ein junges Mädchen vom Strand verschwunden. Oder es könnte regnen, und die Straßen wären glatt und gefährlich. Schließlich wisse sie nicht, was für ein Autofahrer dieser Mr Nyman sei. Ich könnte ja von Fidel Castro entführt werden oder von einem der Kennedy-Brüder, die in ihren Augen nicht minder anrüchig waren als der Kommunist aus Kuba. Die Liste hatte kein Ende. Und unterm Strich kam immer dasselbe raus: nein.
Die Luft, die zum Küchenfenster hereindrang, war heiß und stickig. »Ich geh mal raus«, sagte ich.
Als ich am Tisch vorbei zur Hintertür ging, sah ich, dass Mama Betts Effie die Hand auf die Schulter gelegt hatte. Ich trat ins Freie.
»Du darfst das Kind nicht so gängeln«, sagte Mama Betts leise. »Bekka ist dreizehn. Nicht mehr lange, dann …«
Den Rest des Satzes verschluckte die Fliegentür, die krachend hinter mir ins Schloss fiel. Ich ging hinüber zu der alten immergrünen Eiche und setzte mich auf eine ihrer mächtigen Wurzeln. Als Arly und ich noch klein waren, hatten wir oft hier gespielt, hatten Straßen aus Modder gebaut und zwischen den Wurzeln Geheimverstecke angelegt und richtige Städte. In den gepflegten Gärten in der Stadt waren alle Bäume von Gras umgeben. Unser Garten seitlich des Hauses, in dem die Eiche, die Magnolien und die Zedern standen, war sauber und ordentlich geharkt und bildete mit seinem braunen Sand einen Kontrast zum roten Band der Kali Oka Road, die keine fünfzig Meter von unserem Vordereingang entfernt vorbeiführte.
Seit dreizehn Jahren war die Kali Oka Road meine Straße, mein Zuhause, wo mir jeder Winkel vertraut war. Ich war die ganzen fünfzehn Meilen mit dem Fahrrad abgefahren, von der Stelle, wo sie auf den Highway Nummer 346 führte, bis hinunter zum Kirchhof gleich hinter dem Cry Baby Creek, wo sie in einer Sackgasse endete. Ich kannte jeden Graben und jeden Acker, jeden Brombeerstrauch und jeden Pflaumenbaum am Straßenrand. Jeder wusste, wo wessen Grundstück zu Ende war. Dass Marvin Shoals an den Wochenenden, wenn er betrunken war, seine Frau, die Connie hieß, verprügelte, gehörte genauso zum Leben der Straße wie die Tatsache, dass das dritte Kind von Carrie Sue Parker am Rhesusfaktor gestorben war. Ich konnte die Zeichen der Vergangenheit und der Gegenwart ebenso deuten wie die Fährten der Tiere, die in der Nacht die Kali Oka Road bevölkerten. Ich konnte selbst Arly auf die Schliche kommen, ganz egal, wo er sich verkrochen hatte, ich brauchte nur der Reifenspur seines Fahrrads im Sand zu folgen.
Die Kali Oka Road war meine Welt. Eine Welt, die mir immer mehr als genug gewesen war, bis zu jenem Sommer.
Ein Heer von schwarzen Ameisen marschierte über die Wurzeln der alten Eiche. Sie waren nicht bissig, und deshalb war es noch nie jemandem eingefallen, etwas gegen sie zu unternehmen. Außerdem hatte Daddy gesagt, es sei »lehrreich«, sie zu beobachten. Sie waren ständig am Arbeiten. Ein ehrgeiziger Offizier zerrte einen kleinen Kieselstein oder einen vertrockneten Brotkrümel, der doppelt so groß war wie er selbst, über drei Wurzeln hinweg nach Hause. Die Lehre, die Arly und ich daraus ziehen sollten, lautete, dass Arbeit und Disziplin etwas Gutes sind.
Ich wollte dem Ameisenhäuptling zu einem kleinen Abenteuer verhelfen und legte ihm ein Stöckchen in den Weg. Er wich und wankte nicht, er kletterte einfach drüber. Als ich gerade überlegte, ob ich einen Luftangriff starten und ihm seine Beute entreißen sollte, hörte ich auf der Straße ein Auto. In der Kali Oka Road musste niemand Angst haben, dass Diebe ihn ausraubten und unerkannt entkamen. Jedes Auto, jeder Truck wurde mit Argusaugen beobachtet. Wir wussten genau, wem welcher Wagen gehörte, und sobald sich hier ein fremdes Fahrzeug blicken ließ, herrschte höchste Alarmbereitschaft.
Diesmal kamen mir die Motorengeräusche nicht bekannt vor. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis mir klar wurde, dass das kein einzelner Wagen sein konnte; außerdem hörte es sich nach etwas Größerem an. Ungefähr so wie der Schulbus, der Arly und mich jeden Morgen abholte. Nur dass dieser hier schnell fuhr.
Die Fliegentür schlug zu, und Effie trat mit Mama Betts auf die Veranda. Sie sahen aus, als ob es höchste Zeit gewesen war, dass sie ihre Unterhaltung beenden und ein bisschen frische Luft schnappen konnten. Beide waren rot im Gesicht und hielten bewusst Abstand – nur ein paar Zentimeter zwar, doch diese kleine Kluft verriet, dass sie sich gestritten hatten.
Als der erste Bus auftauchte, standen wir da, jeder an seinem Fleck, und guckten. Es war eine alte, schmutzig gelbe Klapperkiste. Die Stelle, wo normalerweise der Name der Schule hingehörte, war übertüncht, und statt dessen standen dort, von Hand gemalt, die Worte BLUT DES ERLÖSERS. Dahinter war ein Kreuz, von dem Blut tropfte. Und über dem Namen staubige Fenster mit grauen Gesichtern dahinter. Größtenteils Frauen und Kinder. Und ein paar ausgemergelte Männer. Sie starrten uns an. Etwa so, wie Arly und ich früher immer die Kühe auf den Feldern angestarrt hatten. Mehr oder weniger gedankenlos. Ich überlegte, ob das vielleicht so eine Art Gefangene waren. Wie die Menschen in den Güterzügen im Zweiten Weltkrieg, die in die Gaskammern geschickt wurden. Diese Leute hier sahen auch nicht glücklicher aus. Ehe ich noch recht wusste, was ich tat, war ich vorn an der Fliegentür und stand neben meiner Mama und Mama Betts.
Der zweite Bus rollte heran, dann der dritte, der vierte, der fünfte. Und schließlich der sechste, der in eine mächtige Staubwolke eingehüllt war.
»Heuschrecken«, sagte Mama Betts so leise, dass man es kaum verstehen konnte.
Die Gesichter in den Fenstern des letzten Busses waren nicht zu erkennen, wohl aber der Schriftzug BLUT DES ERLÖSERS. Und das bluttriefende Kreuz, das ein wenig nach rechts geneigt war, als ob der Maler geschludert hätte.
»Carrie Sue sagt, ihr Mann hat in Jexville gehört, dass jemand das Grundstück, wo die Kirche steht, gekauft hat.« Mama Betts wischte sich die Hände an der Schürze ab.
»Der Sommer wäre ja auch zu friedlich gewesen«, sagte meine Mama und schob sich die Brille hoch.
»Ich geh rüber zu Alice.« Ich wollte wissen, ob sie die Busse auch gesehen hatte und was sie davon hielt.
»Aber in einer Stunde bist du wieder hier«, sagte Mama. »Und nimm Picket mit.«
Picket war eine Kreuzung aus Collie und Schäferhund und hätte jedem, der sich mir auf drei Meter näherte, den Kopf abgerissen. Ich hielt es für überflüssig, Mama daran zu erinnern, dass ich nie ohne Picket fortging. Sie war meine zweitbeste Freundin, gleich nach Alice Waltman.
»Und dass ich nicht erst kommen und dich holen muss!«, rief Mama, als ich hinters Haus ging, wo mein Fahrrad stand. Ich brauchte nur ein kurzes Stück durch den Pekangarten und einen kleinen Wald zu fahren. Wenn ich die Straße nahm, dauerte es länger, und außerdem war es auf dem roten Lehm entschieden heißer.
Im Unterschied zu den meisten Nachbarn bauten wir auf unserem Land nichts an. Wir hatten den Pekangarten und ein bisschen Wald, das war alles. Daddy sagte immer, er lebe auf dem Land, um dort zu wohnen, nicht um zu arbeiten. Nicht dass er etwas gegen die Landarbeit hätte, nur sei er ja nie zu Hause, und im Übrigen habe er nun mal kein Händchen für Pflanzen. Und außerdem müssten auch die wilden Tiere etwas haben, wo sie sich verkriechen können, meinte er. Auf freiem Feld käme garantiert irgendein Idiot und würde sie abknallen. In unserem Wald könnten sie sich wenigstens verstecken. Daddy meinte immer, jedes Lebewesen muss einen Unterschlupf haben.
Ich liebte den Wald. Wenn ich es nicht so eilig gehabt hätte, mit Alice zu reden, wäre ich stehen geblieben und hätte ein bisschen an der Quelle gespielt, der wir unsere Wünsche anvertrauten und an der wir einander unsere größten Geheimnisse erzählten. Doch die sechs Busse mit den Leuten von dieser Gemeinde ließen mir keine Ruhe. Ich brannte darauf, mit Alice zu reden.
Unser Grundstück grenzte an das der Waltmans, das nur etwas mehr als einen mickerigen Morgen groß war und hauptsächlich aus Sand und einem verwilderten Garten bestand. Alice saß auf einer Schaukel – einem schmalen Brett an zwei Ketten. Sie hatte Maebelle im Arm und wiegte sich sachte hin und her.
Sie saß mit dem Rücken zum Wald – die perfekte Gelegenheit, sich heimlich anzuschleichen und sie zu erschrecken, aber ich hatte Angst, dass sie schreien würde und das Baby fallen ließ. Maebelle VanCamp war zwar nicht unerwartet gekommen, aber Alice und ich hatten trotzdem wenig für sie übrig. In der Hierarchie der Waltmans war Alice die Fünftgeborene, und weil ihre Mutter fand, mit dreizehn Jahren sei man alt genug, um Kindermädchen zu spielen, hatte sie ihr die alleinige Verantwortung für Maebelle VanCamp übertragen. Mrs Waltman war schon wieder schwanger, und die älteren Geschwister mussten sich um die Kinder kümmern, die nach Alice geboren waren.
Da die Kali Oka Road nur einen Steinwurf weit vom Haus der Waltmans entfernt war, wusste ich, dass Alice die Busse gesehen haben musste.
»Komm, wir radeln runter ans Ende der Straße.« Ich griff nach dem Schaukelbrett und gab ihr und Maebelle einen kleinen Schubs.
»Und was mach ich mit der hier?«, fragte Alice und zeigte auf ihre Schwester.
»Wir können sie ja im Wald liegen lassen.«
Alice lachte. »Ja, und dann erstickt sie, oder es kommt irgendein Idiot und schleppt sie weg. Und ich hab dann den Ärger.«
»Vielleicht merkt’s ja gar keiner.«
Wir mussten beide lachen. Das war so ein Witz zwischen uns. Bei den vielen Kindern, die die Waltmans hatten, würde es gar nicht auffallen, wenn eins fehlte, sagten wir immer aus Spaß.
»Glaubst du, die ziehen in die Kirche von der Lebensgemeinde ein?«, fragte Alice. Sie schüttelte den Kopf, um eine lästige Mücke zu verscheuchen, die ihr unbedingt ins Auge fliegen wollte. Die strohblonden Ponyfransen wehten ihr um die Sommersprossennase.
»Sieht so aus. Carrie Sues Mann hat in Jexville gehört, dass sie das Grundstück gekauft haben, hat Mama Betts heute erzählt.«
Alice nickte. »Da werden die Leute hier aber nicht begeistert sein. Ganz und gar nicht. Nach den Erfahrungen, die sie damals mit der anderen Gemeinde gemacht haben.«
»Glaubst du, die hier gründen auch wieder eine Kommune?« Ich war stolz auf das Wort, über das sich immer alle so aufregten.
»Kommune? Was ist das denn?«
»Na, wo alle zusammenwohnen, so was Ähnliches wie eine Sippe.«
Alice fand diese Vorstellung absolut idiotisch. »Von denen hat anscheinend keiner neun Geschwister, sonst würden sie nicht wie eine Sippe leben wollen.«
»Wir können das Baby ja in meinen Fahrradkorb legen.« Alice, die immer noch auf der Schaukel saß, stieß sich leicht mit den Zehenspitzen ab. Maebelle VanCamp schlief weiter. Ihr rosiges Gesicht lag an Alice’ flacher Brust.
»Weißt du, warum Mama sie VanCamp genannt hat?«, fragte Alice.
Ich hatte verschiedene Theorien. Mein zweiter Vorname war Brighton, was so etwas wie eine Familientradition war, hatte Mama Betts gesagt, aber sie hatte es mit so einem komischen Unterton gesagt, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob sie nicht flunkerte. »Weil ihr der Name gefallen hat?«
»Als sie mit Maebelle schwanger war, hat sie die ganze Zeit so einen Heißhunger auf VanCamp’s Bohnen mit Schweinefleisch gehabt. Sie konnte an gar nichts anderes denken, und als sie dann gefragt wurde, wie das Baby heißen sollte, war das Erste, was ihr in den Sinn kam, VanCamp. Daddy hat sie überredet, noch das Maebelle davorzusetzen.«
»Hört sich an wie aus einem Märchenbuch.«
»Hoffentlich denkt sie beim nächsten Kind nicht an Cornflakes. Oder kannst du dir ein Schwesterchen vorstellen, das Kellog’s heißt?«
»Oder Ton!« Ich musste lachen.
»Ton! Wie kommst du denn auf Ton?«
Ihr Lachen hatte das Baby geweckt. Maebelle wandte mir ihre erdbraunen Augen zu und starrte mich an, als ob sie ebenfalls auf meine Antwort wartete.
»Mama Betts hat gesagt, die schwarzen Frauen essen manchmal Ton aus der Kreideschlucht, wenn sie schwanger sind. Das ist ein ganz schreckliches Gelüst, hat sie gesagt, und dass die Ärzte die Frauen davon abbringen wollen, weil dadurch den Babys das Blut rausgesaugt wird oder so.«
Alice hatte plötzlich aufgehört zu lachen. »Das ist ja entsetzlich, Bekka. Warum essen die denn das Zeug, wenn es doch das Blut raussaugt aus ihren Babys?«
»Weil sie nicht dagegen ankönnen. Sie müssen es einfach essen, weißt du?«
»Wenn das nächste ein Junge ist, dann werde ich Mama auf keinen Fall erlauben, ihn Ton zu nennen. Das verspreche ich dir.«
»Maebelle ist wach. Hol dein Fahrrad, und dann fahren wir runter ans Ende der Straße.« Ich machte ein paar Schritte zum Wald hinüber, wo Picket und mein Rad warteten.
Alice warf einen kurzen Blick über die Schulter. Ihre Mutter war nicht am Fenster zu sehen. »Aber fahr ganz langsam, und pass gut auf.« Sie hob das Baby an, um abzuschätzen, ob es schwer genug war, um im Korb nicht zu arg durchgerüttelt zu werden.
»Na klar, und wir fahren auch gleich wieder zurück. Mama hat gesagt, ich soll in einer Stunde zu Hause sein. Du kannst bei uns Abendbrot essen, dann macht sich deine Mutter keine Gedanken, wo wir gesteckt haben. Mama Betts backt mal wieder ihren Erdbeerkuchen.«
»Ist gut.« Sie gab mir das Baby und flitzte hinters Haus, um ihr Fahrrad zu holen. Eine Minute später war sie wieder da. Sie schob das Rad, und ich ging mit Maebelle auf dem Arm neben ihr her in den Wald. »Eigentlich sollte ich das nicht tun …«
»Ich muss wissen, was diese komischen Erlöser da unten machen. Vielleicht wollen die irgendwas anbeten – « Ich hielt inne. In religiösen Dingen war Alice manchmal merkwürdig. Ich wollte ihr keine Angst einjagen, denn sonst wäre sie womöglich nicht mit zum Cry Baby Creek gekommen, um auszukundschaften, was das für Leute waren.
»Anbeten? Was denn anbeten?«
»Das wollen wir ja gerade rauskriegen.«
Ich nahm mein Fahrrad und machte Maebelle vorn im Korb ein richtiges kleines Nest zurecht. Es war ein tiefer Korb, aus dem sie nicht herausfallen konnte. Das Einzige, was mich beunruhigte, war, dass die Straße an manchen Stellen ein bisschen holperig war, aber dann konnte ich ja absteigen und das Rad schieben, damit ihr nichts passierte.
Wir radelten durch den Wald, fuhren hinten an unserem Haus vorbei und bogen etwa eine halbe Meile von unserem Tor entfernt in die Kali Oka Road ein, und Picket lief die ganze Zeit neben uns her. Alice war genauso aufgeregt wie ich. Wir brannten beide darauf, zu erfahren, was unsere neuen Nachbarn trieben.
KAPITEL 3
Die Brücke über dem Cry Baby Creek war aus Holz. Der Fluss selbst war ungefähr dreieinhalb Meter breit und hatte bernsteinfarbene Untiefen und ein paar abschüssige Stellen. Hier und da hatten sich Baumstämme verklemmt, über die das Wasser tosend und gurgelnd wie ein Gebirgsbach hinwegfloss.
Alt und hinfällig war diese Brücke und gefährlich. Sie führte nur zu dem Kirchengrundstück, das allerdings seit zehn Jahren unbewohnt gewesen war, weshalb sich niemand die Mühe gemacht hatte, die Brücke auszubessern. Die eine Seite des Flusses war völlig zugewachsen – ein prima Versteck für Alice, Maebelle und mich. Das Baby schlief fest. Wir hockten an der Uferböschung und spähten durch die Geißblatthecke.
Links von dem alten Pfarrhaus parkten die Busse, einer neben dem anderen. Die Gemeindemitglieder, allem Anschein nach zum größten Teil Erwachsene, streiften umher, schauten in den Himmel oder in die Baumkronen und hierhin und dorthin, nur untereinander sahen sie sich nicht an. Einen Verantwortlichen schien es nicht zu geben.
Jetzt, wo sie nicht mehr hinter den schmutzigen Busfenstern verborgen waren, kamen sie mir noch unheimlicher vor. Besonders die Kinder. Sie erinnerten mich an Bäume im Winter – starr, trist und schläfrig, als ob ihre Gesichter und ihr Geist in Erwartung des Frühlings vor sich hin dämmerten. dass diese Kinder Fußball oder Verstecken spielten, konnte ich mir nicht vorstellen. Und dabei hatte ich die, die richtig klein waren, noch gar nicht entdeckt.
»Gruselig«, flüsterte Alice.
»Zombies.«
»Was die wohl hier wollen?«
Mir fiel keine Antwort ein, doch dann hatte ich auf einmal die wildesten Visionen. Ich malte mir aus, wie sie sangen und beteten und mit Schlangen herumhantierten, und dank meiner blühenden Fantasie wurden sie mir immer unheimlicher – und zogen mich immer mehr in ihren Bann. »Ob die Kinder in unsere Schule kommen? Mama Betts sagt, in Mississippi muss man nicht zur Schule gehen. Wir sind der einzige Staat ohne Schulpflicht, hat sie gesagt.«
»Zu uns in die Schule? Bestimmt nicht«, sagte Alice, die auf einen Ellbogen gestützt dalag und im anderen Arm das Baby wiegte. »Die alte Gemeinde hatte ihre eigene Schule, hat meine Mama jedenfalls erzählt. Sie würde sich natürlich nie trauen, das laut zu sagen, aber ich hab sie mit der alten Mrs Shoals darüber tuscheln hören, dass die Lebensgemeinde ihre Babys für Geld verkauft hat.« Und dann senkte Alice die Stimme und fügte flüsternd hinzu: »Die Mädchen, die die Babys gekriegt haben, waren fast so was wie Sklavinnen.«
»Die Babys verkauft?« Das hörte sich unglaublich an. Wer würde denn ein Baby kaufen?
»Ja, wie junge Hunde oder Pferde. Die Mädchen aus der Gemeinde haben ein Kind gekriegt, und das haben sie dann an Leute verkauft, die selber keine bekommen konnten.« Alice kitzelte Maebelle und wurde dafür mit ein paar kräftigen Fußtritten und einem zahnlosen Grinsen belohnt. »Ich hätte nichts dagegen, wenn wir ein paar von unseren verkaufen würden.«
»Alice!« Ich tat schockiert, aber ich wusste ja, dass sie es nicht ernst meinte. »Guck mal.« Jetzt standen mehrere Männer beisammen und redeten miteinander und zeigten mal in diese, mal in jene Richtung. Wir konnten nicht genau verstehen, was sie sagten, aber es kamen Wörter vor wie Kinderkrippe und Wohnräume und Pflichten. Sie riefen einer der Frauen etwas zu, und die Frau nickte und ging in das alte Pfarrhaus.
»Die wissen anscheinend nicht, was sie machen sollen.«
Ein paar von den Männern gingen zu den Bussen und fingen an, die Koffer auszuladen.
»Die bleiben hier.« Alice richtete sich auf, damit sie besser sehen konnte. »Die wollen alle zusammen in der Kirche schlafen.«
Sie hatte recht. Die Männer brachten die Koffer in die Sakristei. Es gab nur die Kirche und das Pfarrhaus. Nach meiner Schätzung mussten das fünfzig bis sechzig Familien sein. Während die Männer ausluden, hatten die Frauen eine Kette gebildet und reichten die Koffer weiter. Es war unheimlich, weil niemand lachte oder sprach.
»Komm, wir verschwinden, sonst sehen sie uns noch.« Alice krabbelte nach unten und kroch aufs Ufer zu. Und Maebelle, die ihr fast aus dem Arm gerutscht wäre, wimmerte kurz auf.
Die Erlöser-Gruppe, die uns am nächsten war, drehte sich zu uns um. Ich blieb an der Böschung hocken und hoffte inständig, dass mich die Geißblatthecke verdeckte. Ich machte Alice ein Zeichen, dass sie sich im Schutz der Sträucher halten sollte, falls einer nachgucken kam.
Wieder muckte Maebelle auf. Mir lief der Schweiß über die Wange. Eine Frau mittleren Alters und zwei Mädchen schauten zu uns rüber. Die Frau trat vor und kniff forschend die Augen zusammen. Zum ersten Mal wurden die Gesichter der Mädchen etwas lebendiger. Die eine hatte braune Haare, die ihr glatt über den Rücken fielen. Ihre Mutter trug das Haar hochgesteckt, ungefähr so wie die Mädchen auf der Highschool manchmal, aber bei ihr wirkte das ganz anders.
Ihr Blick fixierte mich. Mir stockte der Atem. Sie drehte sich um und rief etwas nach hinten. Einer der Männer kam auf sie zu.
»Lauf!« Ich befreite mich aus der Geißblatthecke und ließ mich die Böschung hinuntergleiten. Alice kam unter der Brücke hervor. Ohne auf unsere Schuhe zu achten, wateten wir durch das seichte Wasser. Wir hatten nur noch Angst ums nackte Leben.
»Lauf, Alice!« Ich kletterte vor ihr am anderen Ufer hoch, damit ich ihr mit dem Baby helfen konnte. Maebelle brüllte wie am Spieß, sie tat gerade so, als ob wir sie entführen wollten.
»He! Ihr da!«, rief der Mann.
»Lauf!«, schrie ich. Ich hatte Maebelle auf dem Arm und rannte zum Waldrand, wo wir unsere Räder stehen gelassen hatten. Alice war hinter mir, sie japste nach Luft.
Aus dem Wald kam ein braunweißer Pfeil geschossen und jagte direkt auf die Brücke zu, die über die Bucht führte, wo der dünne Mann war, der uns verfolgte.
»Picket!« Ich warf Alice das Baby zu und schaute zurück zur Kirche. Der Mann war auf der Brücke stehen geblieben. Sein Gesicht war wutverzerrt. Picket hatte sich mit angriffslustig gesträubtem Fell und gefletschten Zähnen vor ihm aufgebaut. Wenn er nur einen Schritt näher gekommen wäre, hätte sie ihm ins Bein gebissen. Doch der Mann beachtete die Hündin gar nicht, er starrte Alice und Maebelle hinterher.
»Picket! Kommst du her!«
Sie hörte nicht auf mich. Alle ihre Sinne waren einzig und allein auf den Mann konzentriert. Picket witterte seine Wut genauso, wie ich sie ihm vom Gesicht ablesen konnte. Nichts auf der Welt hätte sie daran hindern können, mich zu beschützen. Mehrere andere Männer hatten sich um die beiden geschart. Ein junger Bursche rannte in die Kirche und kam mit einem Gewehr zurück. Er gab es einem der Männer.
»Picket!« Ich hörte die Angst in meiner Stimme. Die wollten meinen Hund erschießen.
»Bekka!« Ich wollte zur Brücke rennen, doch Alice packte mich am Arm. »Nicht, Bekka!«
Meine Finger fanden das Halsband in Pickets dichtem Fell, ich zerrte sie fort. Ihre Krallen scharrten über den hölzernen Brückenboden, sie war stocksteif, aus ihrer Kehle kam ein wütendes Knurren. Als ich über die Brücke war, schaute ich hoch zu dem Mann. Ein grausiges Lächeln lag auf seinem Gesicht.
»Das ist ein toter Hund«, sagte er leise. Der Mann mit dem Gewehr legte an und zielte.
Picket wog fast zwanzig Kilo, aber das war mir in dem Moment egal. Ich nahm sie auf den Arm und rannte los.
»Das hier ist ein Privatgrundstück«, rief der Mann uns nach. »Lass dich ja nicht wieder hier blicken, sonst wird es dir leid tun. Wir hetzen dir den Sheriff auf den Hals, dir und dem Köter da!«
Diesmal wurde Maebelle ziemlich unsanft in den Korb gepackt. Alice hielt mir mein Rad hin und holte dann ihr eigenes. Während wir wie die Wilden in die Pedale traten und Picket neben uns herrannte, kam der Mann über die Brücke geschlendert.
»Wem gehört eigentlich dieses Baby?«, rief er. »So geht man doch nicht mit einem Kleinkind um!«
Meine Fahrradkette sirrte. Maebelle hatte leise, aber ausdauernd zu schreien angefangen. Die Bewegung des Rades schien sie etwas zu beruhigen, und ich dachte überhaupt nicht daran, ihretwegen das Tempo zu drosseln. Jedenfalls nicht solange wir die Erlöser nicht abgehängt hatten.
Als wir den Schatten eines Maulbeerbaums erreichten, der wild an P. C. Harless’ Zaun wuchs, waren Alice und ich völlig durchgeschwitzt.
»Die sind verrückt«, sagte Alice, während sie Maebelle aus dem Korb nahm und auf ihrem Arm wiegte. »Ist ja gut, Kleines«, säuselte sie leise. »Eia, eia, Baby.« Aber es fehlte nicht viel, und sie hätte selbst geweint.
Wir wussten beide, dass wir eben um ein Haar gewaltig in der Patsche gesessen hätten, aber keine von uns hatte Lust, darüber zu reden. Andererseits konnten wir auch nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre. »Sieht so aus, als ob die da alle zusammenwohnen wollen. Wenn meine Mama das mitkriegt, dass die da ‘ne Kommune machen, die dreht durch.«
»Meine Mama sagt, wenn Daddy den ganzen Tag zu Hause wäre, dann hätte ich nicht nur zehn Geschwister, sondern zwanzig«, sagte Alice und schnitt Maebelle eine Fratze. »Das würde ich nicht aushalten.«
»Denkst du, ich? Und die da haben auch nicht gerade glücklich ausgesehen. Die meisten von denen sind rumgelaufen wie Gespenster.« Die Leute waren wirklich unheimlich gewesen. Nicht ein einziges Lachen, keine Begeisterung. Als ob man ihnen alle Lebenssäfte abgezapft hätte. Wie leer gesaugt. »Bis sie das Gewehr geholt haben.«
»Du hast schon recht, das sind Zombies.« Alice nahm das Baby an die Schulter. »Komm, wir fahren heim. Mama wartet bestimmt schon, dass ich ihr beim Abendbrotmachen helfe.«
Aha, sie hatte also nicht mehr vor, bei uns zu essen. Die Sache war uns zu sehr an die Nieren gegangen. Wir brauchten beide Zeit, um darüber nachzudenken. »Vielleicht können wir morgen schwimmen gehen.«
Alice warf mir einen raschen Blick zu. »Aber nicht im Cry Baby Creek.«
»Wieso denn nicht?«
»Du willst bloß wieder diesen Erlösern nachspionieren. Ums Schwimmen geht’s dir doch gar nicht.« Ihre Sommersprossen stachen von der weißen, bleichen Haut ab. »Nach allem, was heute passiert ist, willst du noch mal dahin? Du hast keinen Funken Verstand, Bekka Rich.«
»Klar, ich will schwimmen gehen, und dann will ich mich noch ein bisschen um die Kirche herum umsehen. Wenn wir Maebelle nicht mitnehmen müssten – «
»Und deinen Hund! Wie’s aussieht, habe ich das Baby morgen auch dabei und übermorgen und überübermorgen, bis die Schule wieder anfängt.«
Jammern nützte nichts. Alice machte das alles genauso wenig Spaß wie mir. Und trotzdem, dass ich in der Kali Oka Road nicht mehr so glücklich war, hing in erster Linie damit zusammen, dass Alice ständig Kindermädchen spielen musste. Meine Freundin fehlte mir, und ich litt darunter, dass wir viel weniger Zeit füreinander hatten als früher.
»Vielleicht kann sich Julie Ann um sie kümmern.«
»Hmm.« Alice legte Maebelle wieder in meinen Fahrradkorb und gab das Zeichen zum Aufbruch. Ich wusste so gut wie sie, dass Julie Ann sich nie und nimmer um das Baby kümmern würde. Julie war zwei Jahre älter als Alice, aber sie war etwas Besonderes. Sie litt an Asthma und war schwach auf der Brust, und darum konnte sie im Haushalt keine Pflichten übernehmen. Neue Kleider wurden immer nur für Julie gekauft, und erst wenn Julie aus ihnen herausgewachsen war, durften die anderen Kinder sie auftragen. Die Geschwister, die älter als Julie waren, mussten noch mehr arbeiten und bekamen noch weniger Zuwendung. Bei den Waltmans drehte sich alles nur um Julie. Und außerdem war sie die beste Stickerin in ganz Mississippi. Sie tat den ganzen Tag nichts anderes, als so lange feine Fäden durch ein Stück Stoff zu ziehen, bis ein Bild entstanden war.
Am Waldrand ließ Alice ihr Fahrrad stehen und nahm das Baby. Ich fuhr nach Hause und war zurück, bevor die Stunde, die Mama mir gegeben hatte, um war.
»Na, wie war’s unten an der Kirche?«, fragte Mama Betts, als ich das Fliegengitter aufstieß. Sie stand in der Küchentür.
»Gruselig.« Es hatte sowieso keinen Sinn, ihr etwas vorzumachen. »Die laufen rum wie Gespenster, die Leute.«
»Halt dich fern von diesen Menschen, Bekka. Die führen nichts Gutes im Schilde.«
»Ich seh sie mir ja bloß an. Da ist doch nichts dabei.«
»Und wenn sie nun mit dir reden wollen, was machst du dann? Die Taubstumme spielen, oder wie?«
»Die wollen nicht mit mir reden. Die wollen nichts mit uns zu tun haben.«
»Haben sie euch fortgejagt?«
Mama Betts war einfach zu klug. Irgendwie schaffte sie es immer, einen so lange auszuquetschen, bis man ihr alles haarklein erzählt hatte, genauso wie sie die Zitronen für ihre Kuchen ausquetschte, bis sogar die Schale ganz trocken war.
»Nicht direkt«, murmelte ich. Wenn sie das mit Picket und dem Gewehr rauskriegte, dann konnte ich mich auf was gefasst machen.
»Aber sie waren auch nicht gerade erbaut, euch zu sehen, stimmt’s?«
»Nicht direkt.«
Sie lachte. »Effie hat deinen Dad angerufen und ihm alles erzählt. Er hat gesagt, wir sollen dich ja an die Kandare nehmen, sonst willst du am Ende noch bei denen mitmachen, und das ist schließlich kein Zirkus.«
»Ruft Daddy zurück?« Ich war jedes Mal sauer, wenn Mama mit ihm telefonierte, wenn ich nicht zu Hause war. Irgendwie hatte ich dann immer das Gefühl, um etwas ganz Schönes betrogen worden zu sein.
»Heute Abend. Er will mit dir reden.«
»Und mit Arly nicht?«
»Mit Arly auch.«
»Wo steckt der eigentlich? Ich hab ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen. Weiß er schon von den Erlösern?«
»Aber sicher. Er ist ja wie ein Wilder die Straße runtergelaufen und hat dich gesucht.«
»Der hätte uns gerade noch gefehlt. Es hat schon gereicht, dass Maebelle die ganze Zeit geheult und geschrien hat.«
»Ihr hattet das Baby mit?«
Ihr Ton machte mir schlagartig klar, dass ich nahe daran gewesen war, mich gewaltig in die Nesseln zu setzen. »Wir sind bloß hin- und wieder zurückgefahren. Das Baby fährt gern Fahrrad.«
»Wenn ihr so weitermacht, kriegt die Kleine noch einen Hirnschaden. Ich weiß, Mrs Waltman hat viel zu viel um die Ohren, und sie soll ja schon wieder schwanger sein, aber ich kann mir nicht denken, dass sie erlauben würde, dass – «
»Für das Baby ist Alice zuständig. Mrs Waltman hat andere Sachen im Kopf.«
Mama Betts stemmte die Hände in die Hüften. Freche Antworten konnte sie nicht leiden. »Ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist, Bekka, aber es gibt eine Menge Kinder, die schwerer arbeiten müssen als Alice. Ist vielleicht ganz gut, dass Alice mit dem Baby beschäftigt ist, sonst würdet ihr zwei in diesem Sommer womöglich noch Schwierigkeiten kriegen. Du brauchst das gar nicht abzustreiten. Ich sehe doch, wie es funkelt in deinen blauen Teufelsaugen.«
KAPITEL 4
Das Wasser im Fluss war eisig kalt – trotz der brütenden Junisonne und obwohl wir auf unseren Rädern ins Schwitzen gekommen waren. Der Cry Baby Creek ist von artesischen Quellen gespeist, die frisch und eisig aus der harten Lehmerde kommen. An manchen Stellen ist der Grund aus reinem Lehm und rutschig wie eine Speckschwarte. Gerade waren Alice, die die kleine Maebelle in einem eigens für sie gemachten Tragetuch vorm Bauch trug, damit sie die Hände frei hatte, und ich an einer dieser Stellen vorbeigekommen. Wir wollten zur Senke, unserem Lieblingsplatz, wo die schnelle Strömung eine knapp anderthalb Meter breite und etwa zweieinhalb Meter tiefe Rinne ins Flussbett gegraben hatte, die ungefähr fünfzehn Meter lang war und dann in einem stillen kleinen See endete. Der Weg dorthin war die reinste Achterbahn; wir jauchzten vor Vergnügen und hatten gleichzeitig Angst. Picket, die neben mir lief, war darauf erpicht, die Eichhörnchen am Ufer zu jagen.
»Geh du vor, dann kannst du mir Maebelle abnehmen«, sagte Alice und setzte sich auf eine kleine Lehmbank neben dem herabstürzenden Wasser.
Als ich in das eisige Wasser stieg, hielt ich den Atem an, teils wegen der plötzlichen Kälte, teils aus Angst. Um mich herum brodelte das Wasser, es stieß mich und zerrte an mir und griff nach meiner Haut und meinem Badeanzug, der wie eine zweite Haut war. Es wollte mich haben, und das machte mir Spaß und Angst zugleich.
»Geh!«, drängte Alice. »Geh!« Die Sonne, die an beiden Seiten des Ufers durch die Bäume brach, sprenkelte ihre Haut mit immer größeren Sommersprossen.
Juchzend stieß ich mich von den Steinen ab und rannte hinunter in die tosende Wasserrinne. Ich wurde untergetaucht und wieder hochgeschleudert, stolperte über Felsbrocken und drehte mich mit den Strudeln, und dann, nach zwanzig Sekunden, hatte ich die Stille des offenen Sees erreicht. Seine lehmigen Ränder boten kaum Halt, aber trotzdem schaffte ich es, ins Flache zu kommen.
Alice winkte mich zurück zum oberen Rand der Senke. »Du hast ausgesehen wie ein rosa Korken«, sagte sie.
Ich war mit dem Badeanzug gegen eine Klippe gekommen, und der gelbe Lehm hatte sich in den rosafarbenen Nylonstoff hineingefressen. Ich würde einen blauen Fleck an der Hüfte kriegen, aber das war dieser Augenblick, in dem ich voll und ganz der Gnade des Wassers ausgeliefert gewesen war, mir wert. Alice reichte mir Maebelle und ging dann selbst ins Wasser. Kreischend stürzte sie sich mit einem Kopfsprung in die Fluten, was noch gefährlicher war. Ich konnte sie nicht mehr sehen, und ein paar unerträglich lange Sekunden lang hatte ich Angst, dass sie mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen war. Als sie wieder auftauchte, war sie knallrot von wollüstiger Angst und vom Luftanhalten.
»Warum ist Arly nicht mitgekommen?«, fragte sie, als sie sich ins Flache hievte.
»Ich hab ihn nicht drum gebeten.« Wenn der gewusst hätte, dass wir uns zu den Erlösern schleichen wollten, hätte er uns garantiert verpetzt. Wenn Arly sich etwas davon versprach oder wenn er meinte, mir damit eins auswischen zu können, war er durchaus in der Lage, den Mund zu halten, aber sonst plauderte er alles aus. »Mama, weißt du eigentlich, dass Bekka unten an der Kirche rumgeschnüffelt hat?« Ich konnte es schon hören.
»Aber wir gehen nicht wieder zu diesen Erlösern«, sagte Alice, die meine Gedanken erraten hatte. »Auf keinen Fall. Die machen mir Angst. Wer weiß, was sie nächstes Mal tun.«
»Du kannst ja hierbleiben.« Ich hatte mir meinen Plan schon zurechtgelegt. Ich wollte den Fluss hinunterwaten und die Leute von der Ostseite her beobachten. Der Cry Baby Creek machte eine Art Bogen um die Kirche und das Pfarrhaus. Die Brücke lag südlich der Kirche, aber von dort stromaufwärts zog sich der Fluss in einer scharfen Kurve nach Norden. Diese Kurve war der perfekte Ausguck. Dort würde uns keiner vermuten.
»Pass bloß auf, Rebekka Rich, deine Mama und deine Großmutter werden dir ordentlich das Fell gerben.«
»Die kriegen das doch gar nicht mit, außer wenn du es ihnen erzählst.«
»Oder wenn Picket wieder auf einen von diesen Erlösern losgeht.«
»Picket können wir ja bei den Fahrrädern anbinden.«
»Und wenn sie nun anfängt zu jaulen?«
»Das macht die nicht.«
»Und Maebelle V.? Meinst du nicht, dass die schreit?«
»Vielleicht schreit sie ja auch nicht.«
»Und wenn doch?«
»Dann hauen wir eben ab. Und außerdem, kann ja sein, dass denen das Kirchengrundstück gehört, aber der Fluss, der gehört ihnen nicht. Die Brücke ist mit öffentlichen Geldern gebaut worden, also ist der Fluss öffentliches Eigentum.«
»Wer sagt das?«, fragte Alice spöttisch.
»Mein Daddy.« Natürlich hatte Daddy das nie gesagt, aber es hörte sich nach einem fundierten Argument an. Ich schaute Alice in die Augen und lächelte triumphierend.
»Na schön.« Sie legte sich das Baby an die Schulter. Maebelle V. grinste und giggelte und hatte rote Backen wie eine richtige kleine Abenteuerin.
»Siehst du, Maebelle will auch hin. Die will auch wissen, was das für Wilde sind, die sich da unten an der Straße breitgemacht haben.«
»Na klar«, sagte Alice und gab ihrer Schwester einen Kuss auf die Nase. »Ich glaube eher, die will ihr Fläschchen kriegen und ’ne Runde schlafen.«
»Na gut, dann hol das Fläschchen raus.«
Während Alice Maebelle fütterte, rief ich Picket. Die Hündin war klug genug, um zu wissen, dass ich etwas mit ihr vorhatte. Manchmal nahm ich Shampoo mit zur Bucht und badete sie. Sie blieb zögernd oben an der Uferböschung stehen, schaute zu mir herunter und wedelte mit dem Schwanz. Sie hatte mich sehr wohl gehört und durchaus begriffen, was ich wollte. Sie hatte bloß keine Lust zu gehorchen. Daddy sagte immer, Picket sei klüger als wir alle zusammen, und das glaubte ich ihm.
»Komm, wir gehen nach Hause«, versuchte Alice es wieder. »Wirklich. Wir waren doch gestern erst da unten. Die müssen sich doch erst mal in Ruhe einrichten. In nächster Zeit gibt’s da bestimmt nicht viel zu sehen. Wir können uns ja am Sonntag noch mal hinschleichen und ein bisschen beim Gottesdienst zuhören. Vielleicht schreien und kreischen und trommeln sie ja.«
»Oder stellen irgendwas mit Schlangen an.«
»Huuuh.«
Alice dachte, ich mache bloß Spaß. »Das tun diese komischen religiösen Sekten manchmal.« Als Effie und Mama Betts sich gestern Abend unterhalten hatten, hatte ich aufmerksam zugehört. Und ich war sehr stolz auf das Wort Sekte, das ich dabei aufgeschnappt hatte.
»Und wozu soll das gut sein?«
»Damit beweisen sie, dass sie Glauben haben. Die glauben, dass Gott sie beschützt und sie die Giftschlangen anfassen können, ohne dass ihnen was passiert. Ein Glaubensbeweis ist das.«
»Und wenn sie nun gebissen werden?«
»Na ja, dann war ihr Glaube wohl nicht stark genug.«
»Und wenn sie sterben? Kommen sie dann in die Hölle?«
So tief war Effie nicht vorgedrungen. »Direkt ins Fegefeuer.«
»Komm, wir gehen lieber nach Hause. Vielleicht halten die ihre Schlangen hier unten an der Bucht.«
»Klapperschlangen macht Wasser nicht viel aus, und die nehmen nur Klapperschlangen. Durch das Geräusch wird die Sache ja erst richtig gruselig, wenn sie die ganzen Klapperschlangen haben und ihre Tambourins schlagen. Und dann holen sie die Zuber raus und fangen an, sich gegenseitig die Füße zu waschen.«
»Ich glaub dir kein Wort, Rebekka Rich, du willst mich wohl auf den Arm nehmen?«
Ich hatte mich gefährlich weit vorgewagt, und nun war es höchste Zeit, dass ich den Rückzug antrat, damit Alice nicht auf dumme Gedanken kam. »Vielleicht, vielleicht auch nicht«, sagte ich lächelnd. »Aber wo wir schon mal hier sind, können wir doch wenigstens mal gucken gehn. Maebelle ist ja fürs Erste ruhiggestellt, jetzt, wo sie ihr Fläschchen gekriegt hat, und wir müssen sowieso noch etwas warten, bevor wir wieder zurückfahren können. Sonst kommt ihr bei dem ganzen Geholper noch die Milch hoch.«
»Aber bloß mal ganz kurz gucken, und dann muss ich heim.«
Zum Glück kam Picket gerade die Böschung heruntergetrabt. Ich kriegte sie am Halsband zu fassen und holte einen Strick aus der Tasche, den ich extra mitgebracht hatte, um sie anzubinden, damit ihr nichts passieren konnte. Ich tat es und hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen dabei. Sie sah mich an, als ob ich sie geschlagen und angespuckt hätte, aber trotzdem band ich sie an einen großen, schattenspendenden Magnolienbaum. Sie würde nicht heulen. Mein Verrat hatte sie zu Tode beleidigt, sie würde keinen Laut von sich geben. Daddy hatte mal gesagt, einen Hund, den man festbinden oder anketten müsste, so einen Hund würde er nicht haben wollen. Ein Lebewesen darf man nicht an die Leine legen, sagte er immer. Dass ich Picket angebunden hatte, widersprach allen Grundsätzen, die meine





























