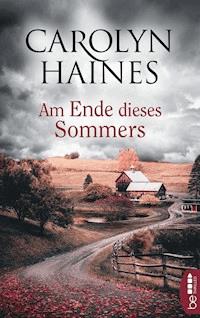4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Südstaaten-Krimis
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau auf der Suche - und die dunkle Seite der amerikanischen Südstaaten ...
Mississippi im Sommer 1926: Die sechzehnjährige Mattie zieht in das beschauliche Südstaaten-Städtchen Jexville. Die neuen Nachbarn erscheinen ihr ebenso trostlos und verstaubt wie die von der Sonne ausgedörrten Lehmstraßen. Und sie begegnen der lebenslustigen jungen Frau mit Misstrauen. Doch dann geschehen geheimnisvolle Dinge am Fluss ...
Lynchjustiz, Rache und Mord auf der einen Seite, Freundschaft und Liebe auf der anderen - das sind die Themen dieses atmosphärisch dichten Kriminalromans von einer der großen Erzählerinnen des amerikanischen Südens.
Weitere Südstaaten-Krimis von Carolyn Haines als eBook bei beTHRILLED: Am Ende dieses Sommers, Das Mädchen im Fluss und Im Nebel eines neuen Morgens.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Danksagung
Zitat
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Über dieses Buch
Eine junge Frau auf der Suche – und die dunkle Seite der amerikanischen Südstaaten ...
Mississippi im Sommer 1926: Die sechzehnjährige Mattie zieht in das beschauliche Südstaaten-Städtchen Jexville. Die neuen Nachbarn erscheinen ihr ebenso trostlos und verstaubt wie die von der Sonne ausgedörrten Lehmstraßen. Und sie begegnen der lebenslustigen jungen Frau mit Misstrauen. Doch dann geschehen geheimnisvolle Dinge am Fluss ...
Über die Autorin
Carolyn Haines (*1953) ist eine amerikanische Bestsellerautorin. Neben den humorvollen Krimis um Privatermittlerin Sarah Booth Delaney hat die ehemalige Journalistin u.a. auch hochgelobte Südstaaten-Romane geschrieben, die auf sehr atmosphärische Weise die Mississippi-Gegend im letzten Jahrhundert porträtieren. Für ihr Werk wurde Haines mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Harper Lee Award. In Mississippi geboren, lebt die engagierte Tierschützerin heute mit ihren Pferden, Hunden und Katzen auf einer Farm im Süden Alabamas.
Homepage der Autorin: http://carolynhaines.com/.
Carolyn Haines
Der Flussdes verlorenenMondes
Aus dem amerikanischen Englisch vonLore Pilgram
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Titel der amerikanischen Originalausgabe: TOUCHED
erschienen bei Dutton Penguin Books USA Inc., New York
Copyright © 1996 by Carolyn Haines
Copyright © für die deutschsprachige Ausgabe 1998/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock: STILLFX | Redfisherstudio | vzwer | Ivan Azimov 007
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-5640-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Diana Hobby Knight –
ein Kind des Singenden Flusses
und einer Stadt,
die seit langem ausgestorben ist.
Ihr untrügliches »Ortsgefühl«
hat ihr Leben geprägt.
Danksagung
Mein Dank gilt einmal mehr dem Deep South Writers Salon: Rebecca Barrett, Alice Jackson Baughn, Renee Paul, Susan Tanner, Stephanie Vincent und Jan Zimlich, und ein ganz besonderes Dankeschön gebührt Pam Batson. Ohne ihrer aller Hilfe gäbe es dieses Buch nicht.
Unendlich wertvolle und stets wunderbar freundliche Unterstützung gewährten mir Janet Smith und die Mitarbeiter der George County Regional Library, die mir geholfen haben, mich in den unzähligen Wirren der Zeit zurechtzufinden und Material aufzuspüren.
Der historischen Genauigkeit halber muss gesagt werden, dass der transportable Elektrische Stuhl in Mississippi in den zwanziger Jahren noch nicht benutzt wurde; die offizielle Hinrichtungsmethode war der Tod durch den Strang. Erst in den vierziger Jahren wurde der Einsatz des transportablen Elektrischen Stuhls zur Vollstreckung der Todesstrafe gesetzlich zugelassen. Der Stuhl wurde dann jeweils in die County gebracht, in der die Verurteilung erfolgt war. Diese und unzählige andere Fakten konnte ich mit Hilfe der Bibliothek und ihrer Mitarbeiter ermitteln.
Meine Lektorin Audrey LaFehr und meine Verlegerin Elaine Koster ließen mir Zeit bei der Arbeit an diesem Buch und ermutigten mich immer wieder weiterzuschreiben. Sie waren es auch, die mir den Anstoß gaben, zur Recherche nach Jexville zu gehen. Vielen Dank.
Alles, was ein Schriftsteller außer Phantasie und dem Drang zu schreiben braucht, damit ein Buch entstehen kann, verdanke ich meiner Familie. Meine Großmutter und meine Mutter haben mich durch ihr Beispiel gelehrt, was stark sein heißt, und mein Vater hat mir gezeigt, was es heißt zu lieben. Und spät in der Nacht, wenn ich schrieb, hauchte die Stimme meiner Mutter den Seiten leise flüsternd Leben ein.
Apostelgeschichte
(28: 3 – 6)
3: Da aber Paulus einen Haufen Reiser
zusammen raffete und legte es aufs Feuer,
kam eine Otter von der Hitze und fuhr
Paulus an seine Hand.
4: Da aber die Leutlein sahen das Thier an
seiner Hand hangen, sprachen sie unter-
einander: Dieser Mensch muss ein Mörder
seyn, welchen die Rache nicht leben lässet,
ob er gleich dem Meer entgangen ist.
5: Er aber schlenkerte das Thier ins Feuer,
und ihm widerfuhr nichts Uebels.
6: Sie aber warteten, wenn er schwellen
würde oder tot niederfallen. Da sie aber
lange warteten und sahen, dass ihm
nichts Ungeheures widerfuhr, verwandten
sie sich und sprachen, er wäre ein Gott.
KAPITEL 1
In den stickig heißen Zonen im Südosten von Mississippi ist der Juli nur eine Art Vorankündigung. Die letzte tröstliche Frische der Juninächte ist vorbei, und sonnenflirrend naht der August. Die Tage werden lang und heiß, und es ist keine Linderung in Sicht. Im Schatten der Nadelwälder, wo ein wenig Kühle herrscht, lauern Moskitos und Mokassinschlangen. Einigermaßen erträglich ist es nur vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang.
Ich spüre sie noch auf der Haut, die Last eines solchen Julimorgens, wenn sich das Gras unter dem Gewicht der silbernen Tautropfen neigte und die ersten schrägen weißen Sonnenstrahlen über den kiefergrünen Horizont gekrochen kamen, um den Tag zu verbrennen, die Erde auszutrocknen. Noch heute, gut zwanzig Jahre später, kann ich mich genau daran erinnern.
Es war der 21. Juli 1926. Am Mittag brannte die Sonne gnadenlos, der Himmel war blass, ausgeblichen wie alte Spitze, und die Luft dampfte. Ich stand in meiner Küche und hatte Mühe zu atmen.
Ich faltete die Toffeeschachtel oben zusammen und band eine rote Schleife darum, die mir Elikah aus dem Frisiersalon mitgebracht hatte. Er saß am Küchentisch und sah mir zu. Er hatte gerade gegessen und schob nun den Teller weg, zufrieden mit der Mahlzeit aus Zuckererbsen, Okra und Maisbrot, die ich für ihn gekocht hatte. Eine Woche waren wir nun verheiratet, und bis jetzt hatte ihm mein Essen immer geschmeckt.
»Sag Miss Annabelle, dass ich ihr zum Geburtstag gratuliere«, meinte er, während er sich die Hosenträger hochzog, sie auf der muskulösen Brust schnippen ließ und nach seiner Jacke griff.
»Du siehst gut aus.« Ich war schüchtern in seiner Gegenwart, noch unsicher, welche Rolle ich in seinem Leben spielte. Er war der schönste Mann, der mir je begegnet war. Es tat weh, ihn anzusehen, und ich hielt es nie länger als ein paar Sekunden aus.
»Geh schon.« Er nickte in Richtung Tür. »Es wird Zeit.«
In meinem warmen grauen Flanellkleid trat ich über die Veranda hinaus in die brütende Hitze der Ein-Uhr-Sonne. Annabelle Lee Leatherwood, ein kinnloses Wunderkind von neun Jahren, das das Pech hatte, sowohl äußerlich als auch vom Charakter her seiner Mutter nachgeraten zu sein, feierte Geburtstag.
Der erste Juli 1926. Ein neuer Monat. Für mich ein neues Leben, und ich kam zu spät zur Geburtstagsfeier. Chas Leatherwood war ein einflussreicher Mann. Ihm gehörte die Futtermittel- und Saatguthandlung von Jexville. Eine Einladung zum Geburtstag seiner Tochter durfte man unter gar keinen Umständen ablehnen, und Elikah hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ich dort erscheinen musste, anständig angezogen und mit einem Geschenk.
Die Sonne blendete, doch in der Ferne, im Westen, ballten sich schon ein paar Wolken zusammen und verhießen für den Nachmittag ein Gewitter. Sie näherten sich in Gestalt von Burgen und wollweißen Drachen, doch an den Rändern waren sie bereits grimmig grau. Ich wusste, sie würden sich bald auftürmen, diese trügerisch leicht aussehenden Massen, sich von wechselnden Winden treiben lassen, so dass sie zusammenstießen und sich vermischten. Am späten Nachmittag dann würden sie mit Urgewalt aufeinander prallen, und dann, ungefähr eine halbe Stunde lang, würde der Regen in dichten Schnüren niederprasseln. Aber mindestens drei Stunden Schwüle, so rechnete ich mir aus, lagen noch vor mir, bis der Regen für kurze Zeit Linderung bringen würde. Und ich kam zu spät.
Ich hatte Toffee gemacht, als Geschenk, aber die Masse war nicht richtig fest geworden, und während ich mich beeilte, zu den Leatherwoods zu kommen, merkte ich schon, wie sie durch die bunte Papierschachtel sickerte. Die Schachtel war ekelhaft klebrig. Warm. Wie Blut.
Die Wolken im Westen wurden immer dichter, eine Wand aus lauter abenteuerlich geformten Gebilden. Sie schienen unbeweglich, harrten, gelähmt von der Hitze, des Windes. Unmittelbar bevor das Gewitter losbrach, würde die lang ersehnte Brise kommen. Doch bis dahin konnten noch Stunden vergehen.
In der großen Magnolie, die in Jeb Fairleys Vorgarten stand, stritten sich zwei Spottdrosseln. Ich blieb stehen, um ihnen zuzuhören und meinen brennenden Füßen eine Pause zu gönnen. Manch einem gingen diese Vögel auf die Nerven, ich aber liebte sie. Im Frühling waren sie richtig mutig, mitunter sogar aggressiv, wenn ihr Nachwuchs in Gefahr war. Ich erinnerte mich an eine Spottdrossel, die aus einer Kreppmyrte schoß, in der sich das Nest mit ihren Jungen befand, und meinen Stiefvater keck in die Stirn pickte. Das sollte ihr schlecht bekommen. So etwas machte niemand mit Jojo Edwards und in gar keinem Fall ein Vogel! Er brachte die Vogelmutter und ihre Kinder um und machte den Baum ein gutes Stück kürzer.
Dieses Bild hatte ich seither immer wieder vor Augen, diese Erinnerung, die auch die ganze seitdem vergangene Zeit nicht trüben konnte. Ich sehe Jojos fettes, schwitzendes Gesicht. Haßfunken sprühen aus den Augenschlitzen. Ich höre, wie die Axt in das glatte, borkenlose Holz der Kreppmyrte fährt – ein entsetzliches Geräusch, anders, als wenn der Baum eine Borke hätte. Dann ist die Axt nicht mehr da, und ich sehe den bloßen Stamm und die vielen taumelnden Blätter, die zusammen mit den Federn der toten Vögel zu Boden fallen.
Bei dieser Erinnerung brach mir erst recht der Schweiß aus, Angst stieg in mir hoch, und ich begann zu rennen. Als ich von der Canaan Street in die Paradise Street einbog, hörte ich die Musik. Nach allem, was ich in den fünf Tagen, die ich als Elikah Mills’ Frau in Jexville wohnte, mitgekriegt hatte, konnte diese Musik eigentlich nur vom Mond kommen. Die verbotenen Klänge, die an mein Ohr drangen, gingen mir direkt ins Blut. Wer besaß hier in Jexville wohl ein Grammophon? Wer wagte es, am Nachmittag von Annabelle Lee Leatherwoods Geburtstagsfeier Musik zu spielen? Das klebrige, misslungene Toffee, Jojos grausame Augen, all das war vergessen, als ich auf diese Musik zulief.
Unter meinen Schuhen wirbelte roter Staub auf und blieb am Saum meines Kleides haften, doch ich achtete nicht darauf. Im Nu war der Boden der durchgeweichten Toffeeschachtel mit einer dünnen roten Kruste überzogen. Auf der Höhe von Elmer Hintons weißem Lattenzaun zügelte ich schließlich, völlig außer Atem, meine Schritte. Es schickte sich nicht, dass eine verheiratete Frau derart durch die Straßen rannte, aber die Musik ließ mich wieder schneller werden. Ich kannte das Lied nicht, doch es war fröhlich und frech und – verboten.
Die Musik wurde immer lauter, mit jedem Schritt, und als ich mich auf der Revelation Road nach rechts wandte, sah ich dort ein selbstvergessen tanzendes Mädchen von ungefähr neun Jahren: Duncan McVay.
Ich hätte sie überall erkannt.
Ich stand auf der Straße in der glühenden Hitze, meine klebrige Toffeeschachtel in den Händen, und staunte sie an, wie vor den Kopf geschlagen. Sie trug ein ärmelloses gelbes Kleid, das gerade von den Schultern bis auf die schmalen Hüften herabfiel, um die eine breite gelbe Schärpe gebunden war. Darunter war ein kurzes Röckchen angesetzt, das kaum das Nötigste bedeckte. Sie wirkte groß für ihr Alter, und die dünnen Beine waren unablässig in Bewegung.
Im Rhythmus bewegte sie sich vor und zurück, rollte theatralisch mit den Augen und kniff sie dann lachend zusammen. Sie tanzte ganz allein, und obwohl sie genau wusste, dass alle sie anstarrten, war sie kein bisschen verlegen. Um sie herum saß bestimmt ein Dutzend Kinder. Einige von ihnen guckten erschrocken, andere neidisch. Aber es gab keines, das sie nicht beachtet hätte. Duncan McVay stand im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses – auch bei den Frauen, die neben der Treppe zum Hintereingang standen. Auch sie schauten zu ihr hin, missbilligend zwar, doch außerstande, den Blick von ihr zu lassen.
Eine der Frauen betätigte voller Eifer die Kurbel des Grammophons, was die Schallplatte schneller kreisen und das kleine Mädchen noch wilder tanzen ließ. Die Frau konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Sie ließ den Blick von dem tanzenden Mädchen zu der Gruppe der freudlosen Frauen schweifen und lächelte noch etwas breiter. Dabei kniff sie auf genau die gleiche Weise die Augen zusammen wie das Mädchen.
Die Kleine beendete ihren Tanz mit einem Freudenjuchzer und warf die Arme in die Luft. Ihre schwarzen Lackschuhe waren über und über mit dem orangeroten Staub bedeckt, den sie beim Tanzen auf der einzigen graslosen Stelle des Leatherwoodschen Gartens aufgewirbelt hatte. Sie hatte ein richtiges Loch in den Boden gestampft.
»Will denn keiner von euch Charleston tanzen?« Duncan McVay blickte einen hochgewachsenen, mageren Jungen auffordernd an. Er schlug die Augen nieder, starrte ins Gras und riss ein paar Halme aus.
»Robert? Willst du nicht mittanzen?«, drängte Duncan. »Es macht Spaß und ist ganz leicht. Mama kann die Platte noch mal neu abspielen, dann zeig’ ich’s dir.«
Robert starrte weiter zu Boden. Die anderen Kinder schwiegen, bis plötzlich eines der Mädchen kicherte.
Ohne sich umzudrehen, stand Robert auf. Er warf Duncan einen raschen Blick zu und sah, dass sie immer noch wartete, jetzt allerdings schon leicht ungeduldig.
»Ich kann nicht«, flüsterte Robert. »Wir dürfen nicht tanzen.« Er drehte sich um und ging davon, direkt an mir vorbei. Er war feuerrot im Gesicht.
Ich hatte immer noch die staubverkrustete, durchgeweichte Toffeeschachtel in den Händen, die von Minute zu Minute feuchter wurde. Die gnadenlose Nachmittagssonne brannte mir auf den Kopf und die Schultern, doch ich traute mich nicht in den Garten. Ich hatte genug über JoHanna und ihre Tochter gehört, um die beiden sofort zu erkennen. Dabei hatte ich sie mir, ehrlich gesagt, etwas anders vorgestellt – mit Teufelshörnern, mindestens.
»Ich glaube, es ist Zeit für das Eis«, rief Agnes Leatherwood mit lauter Stimme. Doch nur eines der Kinder antwortete ihr, ein dickliches kleines Mädchen, dessen unvorteilhaftes Gesicht direkt in den Hals überging, ohne dass dazwischen ein Kinn sichtbar gewesen wäre. Ärgerlich richtete es den Blick auf die Kleine im gelben Kleid.
»Ich will mein Eis«, sagte das dicke Mädchen mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Als keines der anderen Kinder aufstand, stemmte es die Arme in die Hüften. »Wer nicht sofort mit ins Haus kommt, der kriegt auch kein Eis.«
Zwei Mädchen standen auf und gingen zu ihm hinüber. Sie warteten, genau wie ihre Mütter, die sich unten an der Treppe versammelt hatten. Agnes, die das dünnere Ebenbild ihrer Tochter war, schaute zu Duncan hinüber und schien den Tränen nahe zu sein.
»Leg noch eine Platte auf, Mama.« Duncan stemmte eine Hand in ihre schmale Hüfte und blickte in die Runde. »Gibt’s denn hier nur lauter Angsthasen?«
Die nächsten zwei Mädchen standen auf und gesellten sich zu Agnes, Annabelle und den Müttern. Es folgten zwei Jungen, dann noch einer.
Die Musik hallte über den Hof, eine lebhafte Melodie, und Duncan war voll in ihrem Element. JoHanna McVay, eine Hand am Grammophon, sah ihrer Tochter beim Tanzen zu. Die Frauen standen da wie erstarrt, unfähig, ins Haus zu gehen, bevor das Lied zu Ende war.
Duncan schwitzte, ihr schwarzes, glattes, zum Bubikopf geschnittenes Haar, das das Gesicht einrahmte und die dunklen Augen voll zur Geltung brachte, schien zu dampfen.
»Noch ein Lied, dann kommst du rein und isst dein Eis«, sagte JoHanna, während sie den Apparat von neuem ankurbelte und eine langsamere Platte auflegte. Ihrem Tonfall und Verhalten nach zu urteilen, schien JoHanna das, was sich im Garten abspielte, vollkommen normal zu finden. Die anderen Frauen und die Kinder zeigten nur zu deutlich, dass sie nichts mit ihr und Duncan zu tun haben wollten, doch sie tat so, als bemerke sie es nicht. Sie setzte die Nadel auf die Platte und schickte sich an, ins Haus zu gehen. Und erst da, erst als sie sich in Bewegung setzte, nahm ich sie wirklich wahr. Ihre Art, sich zu bewegen, war das Auffälligste an ihr. Sie ging mit langen Schritten, nicht mit den angeblich typisch weiblichen Trippelschritten, zu denen man mich erzogen hatte, und doch war ihr Gang unverkennbar der einer Frau.
Während die anderen Frauen durchweg weiße Blusen und triste graue Röcke anhatten, trug JoHanna ein Kleid in einem warmen Kupferton mit goldenen Blumen, die ineinanderflossen, als ob die Farben leicht verlaufen wären. Ihre bleichen Arme waren nackt, was sehr gewagt war. Anstelle eines Kragens war das Kleid oben nur gerafft, so dass der Stoff in weichen Falten über den üppigen Busen fiel. Diese locker fließende Drapierung ließ den Hals ganz und gar und die Brust zu einem nicht geringen Teil unbedeckt. Das Kleid hing gerade bis zu den Waden herunter und hatte einen gewagten Schlitz, der es JoHanna überhaupt erst erlaubte, jene großen Schritte zu machen. Sie kam mir vor wie eine Naturgewalt. Wie der Wind. Wie die kühle Brise, die einen am Abend oder früh vor Sonnenaufgang neckte. Ihr rötlich schimmerndes, kastanienbraunes Haar war zu einem lockeren Knoten zusammengesteckt, der so aussah, als ob er sich jeden Moment auflösen würde. Und das Licht tanzte auf ihrem Haar seinen eigenen Tanz.
Als sie den Fuß der Treppe erreichte, bemerkte sie mich. Ich stand immer noch am Rand des Gartens. Aus der Schachtel tropfte die geschmolzene Toffeemasse, die das Interesse von ein paar Ameisen geweckt hatte, die gerade des Weges kamen. Rasch strömten die kleinen Insekten in Scharen herbei, angelockt vom Toffee wie ich von Duncans Tanz.
»Sie müssen die Frau von Elikah Mills sein.« JoHanna kam auf mich zu und reichte mir die Hand. »Ich bin JoHanna McVay. Willkommen in Jexville.«
Sie musterte mich aufmerksam mit ihren blauen Augen, aber nicht abschätzend, wie die anderen Frauen es getan hatten. Ihr Blick fiel auf die ausgelassenen Nähte meines grauen Kleides, das eigentlich Callie, meiner jüngeren Schwester, gehörte. Ich hatte leider nichts anderes zum Anziehen gehabt für die Reise nach Jexville, zu meiner Hochzeit. Trotzdem war es mir überall zu eng, schnürte mir die Arme ein und spannte über der Brust.
»Ich sehe, Sie haben Annabelle selbst gemachtes Toffee mitgebracht. Wie aufmerksam von Ihnen.« Sie bemerkte die klebrigen Tropfen, die vor mir auf den Boden fielen. »Machen Sie bloß schnell, dass Sie hier wegkommen, sonst stürzen sich die Ameisen auf Sie.«
Sie nahm mich am Arm und zog mich zum Haus.
»Wieso hat kein Mensch in der Stadt etwas davon gesagt, dass Sie stumm sind?«, fragte sie und sah mir in die Augen.
Ich lächelte verlegen. »Ich bin nicht stumm.«
Sie nickte. »Dachte ich’s mir doch. Das wäre doch für die ein gefundenes Fressen gewesen, das hätten sie so ausgiebig besprochen, dass selbst ich es mitgekriegt hätte.«
Ich sah zu dem Mädchen hinüber. Die Kleine tanzte immer noch. Ihr Gesicht und die Arme glänzten inzwischen von Schweiß, aber sie dachte gar nicht daran aufzuhören. Sie hatte alles um sich herum vergessen; sie war ganz versunken in die Musik und konzentrierte sich vollkommen auf die komplizierten Schritte.
»Meine Tochter Duncan«, sagte JoHanna, während sie mich zur Treppe lenkte. »Sie haben sicher schon von uns gehört. Von dem, was man Ihnen erzählt hat, dürfen Sie ungefähr ein Zehntel glauben, und das müssen Sie auch noch einmal tüchtig durchsieben, damit die Bosheiten rausfallen. Und was dann noch übrig bleibt, sind ein paar ziemlich langweilige Tatsachen.«
Ich betrachtete ihr Gesicht, und da erst bemerkte ich, dass sie älter war, als ich geglaubt hatte. Wenn sie nicht lächelte, sah man die feinen Fältchen um die Augen. Ihr kastanienbraunes Haar schimmerte rötlich, aber es hatte auch schon ein paar Silberfäden, besonders an den Schläfen. Ich schaute wieder zu Duncan hinüber.
»Sie ist neun, und ich bin achtundvierzig«, sagte JoHanna, ohne sich umzudrehen. »Als ich schwanger wurde, haben alle gesagt, es sei eine Sünde, und bei der Niederkunft hieß es, es sei eine Tragödie, weil ich schon so alt war. Das war vielleicht eine Enttäuschung für die Leute hier, dass mein alter Körper durchgehalten hat, dass ich nicht bei der Geburt gestorben bin!«
Sie lächelte, und hinter ihren Worten war eine bemerkenswerte Kraft zu spüren.
»Sie sehen aber gar nicht aus, als ob Sie zu alt sind«, platzte ich heraus, ehe ich mir recht überlegt hatte, was ich sagen wollte. Reden, ohne vorher nachzudenken, das war eine Angewohnheit, die mir bereits mehr als einmal Ärger eingebracht hatte. Ich hatte mir geschworen, es zu unterlassen, aber bisher war es mir allenfalls gelungen, mich hier und da ein wenig zu zügeln.
JoHanna legte mir die Hände auf die Schultern und lachte. »Nicht zu alt wofür? Um schwanger zu werden oder um das Kind zu bekommen?«
Ich merkte, wie ich rot wurde, was JoHanna nur noch mehr amüsierte. Sie schüttelte immer noch lachend den Kopf und führte mich in die Küche, wo Agnes Leatherwood gerade den Rührlöffel aus dem großen Eisbottich zog.
»Mrs. Mills hat ein Geschenk mitgebracht«, sagte JoHanna, während sie mich in den Raum schob.
Agnes warf einen Blick auf die aufgeweichte Schachtel und legte den Rührlöffel beiseite. »Danke, Mattie.« Sie nahm die Schachtel und stellte sie in den Ausguss. »Das war aber sehr aufmerksam von Ihnen.« Sie sah JoHanna aus dem Augenwinkel an.
»Die Toffeemasse ist nicht richtig fest geworden.« Langsam dämmerte mir, dass ich die Schachtel lieber hätte wegwerfen sollen. Die anderen Frauen starrten abwechselnd mich und die Toffeepfütze an, die sich vor mir auf dem Boden gebildet hatte.
»Zu viel Luftfeuchtigkeit, da kann sie nicht fest werden, aber trotzdem, lieb, dass Sie sie mitgebracht haben.« JoHanna ging zum Ausguss und griff nach einem Geschirrtuch. Im Nu hatte sie die klebrige Lache weggewischt.
Als sie aufblickte und sah, dass die anderen Frauen mich noch immer anstarrten, warf sie das Geschirrtuch quer durch die Küche in den Ausguss. »Wissen Sie, Agnes«, sagte sie, »es ist eine Schande, dass Sie Annabelle nicht tanzen lassen. So dick wie das Mädchen ist. Ein bisschen Bewegung würde ihr gut tun.«
JoHanna zwinkerte mir zu, und ich sah das amüsierte Funkeln in ihren Augen, bevor sie sich zu Annabelles Mama herumdrehte, die beinah platzte vor Wut.
»Annabelle ist nicht dick. Sie ist sehr zartbesaitet. Und Tanzen ist eine Sünde.«
»Völlerei auch, aber ich kenne eine Menge Leute in Jexville, die sich davon nicht abhalten lassen«, sagte JoHanna mit Unschuldsmiene, als läge es ihr völlig fern, etwa darauf anspielen zu wollen, dass die Hälfte der Frauen im Raum eher stämmig war.
»Es ist ein Skandal, wie Sie sich aufführen, JoHanna McVay. Sie werden Wills guten Namen als Geschäftsmann noch ganz und gar ruinieren.« Die Frau, die das gesagt hatte, war dick und knallrot im Gesicht.
»Will kann sehr gut alleine für seinen guten Ruf als Geschäftsmann sorgen.« JoHanna ging zum Ausguss. »Was ist denn jetzt mit dem Eis?«
Draußen war keine Musik mehr zu hören. Die Nadel des Grammophons kratzte über die Platte, und dann hörte man, wie Duncan die Kurbel drehte. Die Platte setzte sich langsam in Bewegung, begann schleppend zu spielen, wurde schneller und drehte sich schon bald wieder in beeindruckendem Tempo.
»Verteilen Sie’s schon«, sagte Agnes. Sie war immer noch wütend, traute sich aber nicht, JoHanna direkt anzugreifen.
JoHanna tauchte den großen Löffel in den Bottich und holte das Eis heraus, in dem große Pfirsichstücke waren. »Das sieht ja köstlich aus, Agnes.« Sie füllte ein Schälchen und reichte es mir.
»Duncan ist völlig überhitzt. Ich werd’s ihr bringen.« Ohne mich darum zu kümmern, wie die anderen auf meine Worte reagierten, ging ich hinaus in die heiße Sonne und warf die Fliegentür hinter mir zu. Eigentlich hätte ich das Schälchen einem von den Kindern geben müssen, die nebenan im Zimmer warteten, aber JoHanna hatte mich in Schutz genommen, deswegen wollte ich das Eis ihrer Tochter bringen.
Duncan winkte, hörte aber nicht auf zu tanzen.
Ich hielt ihr das Eis hin, das Schälchen war außen beschlagen, und das kalte Wasser rann mir über die Finger und tropfte in den Staub. Duncan lächelte mich an; ich winkte ihr, in den Schatten zu kommen und das Eis zu essen. Sie war vollkommen verschwitzt. Der Staub klebte ihr an den Beinen.
Immer noch brannte die weiß glühende Julisonne erbarmungslos, was bedeutete, dass kein Gewitter in Sicht war. Es war absolut windstill, so still, dass mir das Kratzen der Schallplatte plötzlich ausgesprochen laut vorkam. Das Stück, das jetzt gespielt wurde, war ein Ragtime-Song. Ich weiß nicht mehr, welcher, ich weiß nur noch, dass ich das Schälchen in der Hand hielt, froh, nicht mehr drinnen bei den Frauen sein zu müssen, und fasziniert von den komplizierten Schritten, die Duncan mir begeistert vorführte.
Es geschah völlig überraschend. Der Blitz kam direkt aus dem dunstverschleierten blauen Himmel. Ein greller Strahl traf die Kiefer, ein anderer Duncan. Der Garten war in bläulichweißes Licht getaucht. Eine Feuerkugel rollte an der Kiefer hinab und prallte gegen die Hauswand, wo sie explodierte.
Als ich mich nach Duncan umsah, lag sie auf dem Boden; Rauch stieg von ihr auf, und ihr gelbes Kleid hatte große Brandlöcher.
Das Eisschälchen fiel mir aus der Hand, aber meine Finger blieben gekrümmt, als würden sie es noch festhalten. Ich rang nach Luft. Mein Kleid war sowieso schon zu eng, ich hatte das Gefühl zu ersticken. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich so stand, nicht in der Lage, zu Duncan zu laufen, einzuatmen oder zu schreien. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit.
Dann stürzte JoHanna aus dem Hintereingang und über die Stufen. Sie rannte wie eine Gazelle, mit wehendem Rock, der ihr an den Beinen hochflog. Sie warf sich neben Duncan auf die Knie und schloss das Mädchen in die Arme.
Duncans Kopf sackte zurück; in ihren Augen war nur noch das Weiße zu sehen. Rauch stieg von ihren Haaren auf, die ihr in dicken Büscheln ausgefallen waren. Es roch nach verbranntem Haar, verbranntem Stoff, verbranntem Fleisch, und ich merkte, wie mir die Tränen übers Gesicht liefen.
Inzwischen waren auch ein paar von den anderen Frauen herausgekommen, während die Kinder nur neugierig durch die Fliegentür spähten. Niemand gab einen Laut von sich. Nur die Musik war zu hören, bis sich die Nadel endlich dem Ende der Platte näherte und über das Etikett in der Mitte rauschte.
»Ruft doch einen Arzt!«, vernahm ich meine Stimme und konnte selbst nicht glauben, dass ich gesprochen hatte. Als ich mich umdrehte und sah, dass sich niemand von der Stelle rührte, zeigte ich auf den Jungen, der Robert hieß. »Lauf, hol den Doktor!«
Leichenblass und mit weit aufgerissenen Augen rannte er los.
JoHanna saß im Staub, drückte Duncan an sich und wiegte sie im Arm. Sie murmelte leise vor sich hin und raunte Worte, die ich nicht verstand.
Da niemand zu ihr ging, tat ich es. Kein Zweifel, Duncan war tot, man brauchte nur in ihre verdrehten Augen zu sehen, dann wusste man es. Der Blitz hatte mit einem gewaltigen Schlag ihr Leben beendet.
Während ich noch neben JoHanna stand und krampfhaft überlegte, was ich tun sollte, wälzten sich von Westen her die Wolken heran. Es waren dieselben Wolken, die seit dem Mittag am Horizont zu sehen gewesen waren, nur dass sie mit jeder Stunde finsterer und zorniger wurden. Und doch hatten sie in der Ferne ausgeharrt, weit weg von den roten Lehmstraßen von Jexville. Jetzt aber waren sie in Bewegung geraten und kamen auf uns zu. Der Donner grollte von Sekunde zu Sekunde lauter, und aus der tiefhängenden Wolkendecke schossen böse, gezackte Blitze.
Ich kniete mich hin und legte JoHanna die Hand auf die Schulter. »Kommen Sie, wir bringen sie ins Haus«, sagte ich.
JoHanna kümmerte sich nicht um mich, sondern redete weiter leise in einem merkwürdig raunenden Singsang auf ihre Tochter ein. Damals wusste ich noch nicht, dass auch eine Katzenmutter diese Art Laute von sich gibt, wenn sie ein totes Junges leckt und es dadurch wieder zum Leben zu erwecken versucht. Kühe, Hunde und Pferde machen ebenfalls solche Laute. Alle Tiere, nehme ich an.
»Kommen Sie, Mrs. McVay, wir bringen sie hinein. Es gibt gleich ein Gewitter.« Ich fasste nach JoHannas Arm und wollte sie sachte von der Toten wegziehen. Ich sah mich um; die anderen standen immer noch wie angewurzelt da. Sie beobachteten uns, als ob wir fremdartige Wesen aus einem exotischen Land wären und lauter Dinge täten, die sie noch nie zuvor gesehen hatten.
»Will mir denn keiner helfen, sie ins Haus zu bringen?«, rief ich mit verhaltener Wut. Es machte mich rasend, wie sie dort mit blöden Gesichtern herumstanden, den Mund nicht wieder zukriegten und glotzten wie die Kühe.
»Sie ist nicht tot«, flüsterte JoHanna vor sich hin, aber ich wusste sofort, dass ihre Worte mir galten. In diesem Moment, ich schwöre es, hab’ ich gedacht, ich muss vor Mitleid sterben. Wie konnte sie nur diesen verbrannten Körper ansehen, den der Blitz durch den halben Garten geschleudert hatte, und nicht begreifen, dass er ohne Leben war?
Endlich trat Nell Anderson heran. »Der Doktor ist unterwegs, JoHanna. Kommen Sie, wir bringen Duncan ins Haus, damit er sie untersuchen kann.« Sie sprach in freundlichem Ton.
»Sie ist nicht tot.« JoHanna scheuchte Nell und mich weg. »Lasst uns doch in Ruhe. Geht schon, lasst uns in Ruhe.« Sie beugte sich noch tiefer über ihre Tochter, als wollte sie Duncan vor den Blicken der anderen schützen.
Hinter mir begann Rachel Carpenter leise zu weinen. »Jemand muss Reverend Bates holen«, sagte sie. Ich hörte, wie eines der Kinder die Fliegentür öffnete und losrannte. Ich drehte mich nicht um. Ich konnte nur an Duncan denken, die eben noch so lebendig gewesen war und sich mit Leib und Seele dem Tanzen gewidmet hatte – und jetzt war sie tot.
Ich kniete noch immer neben JoHanna. Die ersten großen Regentropfen fielen, und dort, wo sie auf den Boden trafen, just da, wo Duncan eben noch getanzt hatte, schossen kleine orangerote Staubfontänen hoch, gerade so, als würde die Erde leben und pulsieren. Der Stumpf der Kiefer zischte.
»Mrs. McVay, kommen Sie, wir bringen sie ins Haus. Es fängt an zu regnen.«
»Sie ist nicht tot.« JoHanna hörte nicht auf, das Kind zu wiegen. »Sie darf nicht tot sein.«
Ich hörte den Regen in der Magnolie hinter dem Grammophon. Er klatschte auf die glänzenden grünen Blätter. Und auf mich, aber das merkte ich gar nicht. Ich sah, wie die Tropfen auf JoHannas Schultern prasselten, dicke Tropfen, die den kupferfarbenen Stoff ihres Kleides durchnässten.
Nell Anderson kniete sich rechts neben JoHanna. »Wir müssen Will benachrichtigen. Wo ist er diese Woche?« Sie langte nach Duncans Fuß und zog ihr das Söckchen hoch. Der Schuh fehlte, war einfach davongeflogen.
»In Natchez.«
»Dann schicken wir ihm ein Telegramm.«
»Versuchen Sie’s im Claremont House. Da muss er heute irgendwann eintreffen.«
Nell weinte, und ich weinte auch. Nur JoHanna weinte nicht. Nell stand auf, um das Telegramm abzuschicken, ich aber blieb und sah zu, wie JoHanna McVay im strömenden Regen kniete und leise auf ihre tote Tochter einsprach.
Als ich mich umschaute, sah ich, dass die anderen Kinder und die Mütter entweder heimgegangen waren oder sich ins Haus zurückgezogen hatten. Nur Agnes und Annabelle Lee standen noch in der Tür und schauten zu uns herüber. Auch sie weinten.
Auf dem Boden hatten sich unterdessen große Pfützen gebildet, aber JoHanna ließ sich immer noch nicht dazu bewegen, ins Haus zu gehen. Dann kam Doc Westfall mit wehender weißer Mähne, die schwarze Arzttasche in der Hand. Er versuchte JoHanna hochzuziehen, aber sie klammerte sich an den leblosen Körper und schrie, man solle sie in Ruhe lassen. Ich sah, wie der Doktor Duncan die Finger auf den Hals legte und sie einen Moment lang dort verweilen ließ; dann drückte er der Kleinen die Augen zu. Er stand auf, sah Agnes an, schüttelte den Kopf und ging zur Tür.
Dort tuschelte er kurz mit Agnes und ging dann ins Haus.
»JoHanna, wir können nicht hier draußen im Regen bleiben.« Ich wusste, wenn sie nicht aufstand, würden sie kommen und sie ins Haus zerren. Mir war vollkommen klar, wie es nun weitergehen würde. Man würde den Leichenbestatter holen. JoHanna würde eine Spritze bekommen. Und dann würden sie Mutter und Kind mit Gewalt auseinander reißen. Ich fasste nach JoHannas Arm. »Wenn Sie noch einen Augenblick mit ihr zusammenbleiben wollen, müssen wir hineingehen.«
»Gehen Sie! Sagen Sie, man soll uns in Ruhe lassen.« Endlich sah sie mich an, und nun weinte auch sie. »Sie ist nicht tot. Das spüre ich. Sagen Sie, man soll uns in Ruhe lassen, nur noch ein paar Minuten.«
»Kommen Sie unter die Magnolie.« Viel Schutz bot der Baum zwar nicht, aber es war immer noch besser als gar nichts. Inzwischen trommelte der Regen gleichmäßig auf die Blätter. Mit vereinten Kräften hoben wir Duncan hoch und trugen sie ein paar Schritte weiter unter das Laubdach. JoHanna setzte sich auf die Erde, lehnte sich an den Baum und wiegte ihr Kind.
»Sagen Sie, man soll uns in Ruhe lassen.« Sie bettelte nicht, und sie flehte auch nicht. Sie bat.
»Nur einen Augenblick.« Ich wusste nicht, wie lange ich die anderen würde aufhalten können. Und ebenso wenig wusste ich, warum ich das Gefühl hatte, ich müsste es tun. Ich wusste nur eins: Wenn sie ihr das Kind wegnahmen, würde sie es nie mehr wiederbekommen. Ein bisschen Zeit, das war doch nicht zu viel verlangt!
Ich ging durch den Garten; mein graues Kleid triefte. Drinnen im Haus hörte ich gedämpftes Murmeln. Sie berieten, was getan werden musste und wie. Der Leichenbestatter war bereits unterwegs, und Doc Westfall zog gerade eine Spritze mit irgendeiner Flüssigkeit auf – sicher nicht für Duncan.
»Lassen Sie sie in Ruhe!«
Alle fuhren herum und sahen mich an. In ihren Gesichtern war Angst.
»Sie hat einen Schock. Das Mädchen ist tot. Wir können sie doch nicht da draußen im Regen lassen«, sagte Agnes und rang die Hände. Sie war nicht herzlos, sie konnte sich nur nicht vorstellen, dass das, was ihr vernünftig und richtig erschien, für JoHanna in diesem Moment nicht zählte.
»Lassen Sie sie. Es ist ihr Kind. Für Duncan kann man nichts mehr tun. Lassen Sie Mrs. McVay etwas Zeit.«
Solange ich lebte, hatte sich noch nie jemand um meine Meinung geschert. Vielleicht wussten sie einfach nicht, was sie machen sollten, und unter diesen Umständen war das, was ich sagte, immer noch besser als gar nichts. So standen wir eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten lang da, sahen einander an und lauschten dem Regen. Agnes kochte Kaffee und goss jedem von uns eine Tasse ein. Wir setzten uns um den Küchentisch, auf dem das ungegessene Eis langsam in den Schälchen schmolz und die Fliegen anzog.
Schließlich kam der Leichenbestatter und mit ihm der Methodistenprediger. Wir waren ein trauriges Häuflein, und niemand mochte nach hinten gehen und in den Garten schauen.
Während ich dort in der heißen Küche saß, dachte ich, dass JoHanna zwar nicht beliebt war, diese Tragödie ihr jedoch gewiss niemand gewünscht hatte. Keine Frau ist im Stande, einer anderen zu wünschen, dass ihr Kind stirbt. Wenigstens glaubte ich das damals.
Endlich hörte der Regen auf. Unterdessen war mindestens eine halbe Stunde vergangen. Mir war klar, dass man jetzt wirklich nicht mehr viel länger warten konnte. An den Gesichtern der anderen sah ich, dass sie um JoHannas Verstand fürchteten. Sie fanden es abstoßend, dass JoHanna eine Leiche im Arm halten konnte. Sie fanden, es sei das beste, die unabwendbaren Dinge so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.
»Ich werde hinausgehen und mit ihr reden.« Ich stand auf und wartete, doch anscheinend hatte niemand etwas dagegen. Während ich durch die Küche ging und aus der Tür trat, sah ich alles mit geradezu schmerzhafter Klarheit. Die Blätter der Magnolie hatten jetzt ein frisches, dunkles Jägergrün. Von der Straße war roter Staub in den Hof geschwemmt worden und hatte rings um den Baum herum lauter kleine Rinnsale aus rotem Schlamm gebildet, so dass es aussah, als wären Duncan und JoHanna auf einer Insel gestrandet. Der Himmel erstrahlte im prächtigsten Blau, einem Blau, das intensiver war als je zuvor in jenem Sommer.
JoHanna saß noch genauso da, wie ich sie verlassen hatte: All ihre Kraft und all ihre Aufmerksamkeit waren auf das Kind gerichtet. Sie strich Duncan mit den Fingerspitzen übers Gesicht und redete leise auf sie ein, so leise, dass ich kein Wort verstand. Ihr Haarknoten hatte sich gelöst; das Haar war länger, als ich gedacht hatte, und jetzt, wo es nass war, auch dunkler. Es klebte ihr an Hals und Schultern und zeichnete die Form ihrer unter dem nassen Kleid verborgenen Brüste nach.
Ich ging langsam durch den Garten, mit jedem Schritt zaghafter. Ich wollte weinen, doch ich kämpfte dagegen an. Ungefähr drei Meter vor ihr blieb ich stehen. »Es wird Zeit, dass Sie ins Haus kommen, JoHanna.«
Sie blickte auf und schwieg.
Ich hörte die Fliegentür hinter mir zufallen, und als ich mich umdrehte, sah ich Mary Lincoln und Annabelle Lee, beide neun Jahre alt. Sie kamen näher. Kurz vor uns blieben sie stehen.
»Ist sie tot?«, fragte Mary. »Ich hab’ noch nie einen Toten gesehen.«
»Ich ja.« Annabelle blickte zu Boden. »Schon ganz oft.«
»Geht wieder hinein«, sagte ich strenger als beabsichtigt. »Na hopp! Wird’s bald?«
Mary rannte blitzschnell um mich herum zum Baum. Als sie Duncan sah, erstarrte sie.
Am liebsten hätte ich sie auf der Stelle skalpiert, und ich war nahe daran, hinzulangen und es zu tun, doch da schlug Duncan auf einmal die Augen auf. Sie starrte Mary unverwandt an.
»Du darfst nicht mit offenem Mund singen, Mary, sonst ertrinkst du«, sagte Duncan.
KAPITEL 2
JoHanna schloss kurz die Augen und machte sie wieder auf. Das war die einzige Bewegung, die ich wahrnahm, bis Mary kreischend ins Haus zurückrannte, dicht gefolgt von Annabelle. Sie führten sich auf, als ob der Leibhaftige hinter ihnen her wäre. Allerdings sah Duncan tatsächlich zum Fürchten aus. Ein ähnliches Bild musste Hiob geboten haben, nachdem ihn der Herr mit seinen Plagen heimgesucht hatte. Duncans verbranntes Fleisch roch unbeschreiblich, aber sie lebte.
Sie schaute Mary und Annabelle mit starrem Blick nach, doch sie regte sich nicht. Endlich erhob sich JoHanna und richtete Duncan auf, so dass sie saß.
»Wir müssen die Brandwunden säubern«, sagte JoHanna, während sie Duncans Bein anhob und sich eine Wunde ansah, die so groß wie meine Hand war und wirklich übel aussah. »Ist Doc Westfall noch im Haus?«
Sie sprach mit mir, doch ich brachte kein Wort über die Lippen. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass Duncan am Leben war, aber sie sah mich an. Um die Augen hatte sie jetzt breite dunkle Ringe. Der Regen hatte die schwelenden kleinen Brandherde in ihrem Haar und an den Kleidern fast völlig gelöscht. Sie war beinah kahl und sah einfach entsetzlich aus. Plötzlich kam ich mir vor wie in einem Albtraum. Kein Mensch kann einen Blitzschlag überleben. Duncan musste tot sein! Ich hatte einen Schock.
»Mattie, so laufen Sie doch zum Doktor, und sagen Sie ihm, er soll rauskommen!« JoHanna drückte Duncan an sich. Ihre weißgeränderten Augen blickten hinüber zum Haus.
Doch ehe ich mich von der Stelle gerührt hatte, stürzte Doc Westfall auch schon mit seiner schwarzen Tasche aus dem Haus. Mary und Annabelle Lee mussten ihm wohl erzählt haben, was passiert war. Agnes und die letzten noch verbliebenen Geburtstagsgäste erschienen in der Tür. Sie waren ebenso bestürzt wie ich – und standen ebenso nutzlos herum.
Als Doc Westfall Duncan sah, blieb er wie vom Donner gerührt stehen, doch dann kam er näher und fing an, ihre Arme und Beine zu untersuchen. Schließlich kniete er sich neben sie ins Gras. Duncans Gesicht war leichenblass, hatte aber keine Verbrennungen. Die Kopfhaut war versengt, doch das war nicht das Schlimmste. Doc Westfall wandte sich zunächst den wirklich argen Wunden an den Beinen zu.
»Zweiten Grades hier, JoHanna.« Er sprach, während er arbeitete, musterte Duncan aber zwischendurch immer wieder verstohlen. Er berührte sie, er fühlte, dass ihre Haut warm war, und doch konnte er nicht fassen, dass sie lebte.
Niemand konnte es fassen. Außer JoHanna, die sich geweigert hatte zu glauben, dass ihre Tochter tot war.
»Kommen Sie, wir bringen sie ins Haus.« Doc Westfall schickte sich an aufzustehen.
»Nein.« JoHannas Stimme ließ ihn mitten in der Bewegung erstarren.
»Ich brauche Wasser, Desinfektionsmittel, Platz zum Arbeiten. Es sind schwere Verbrennungen.«
»Nein. In dieses Haus da gehen wir nicht. Wir gehen heim.«
»JoHanna …«
»Machen Sie es hier, Doc. Es sind die Beine und der Rücken. Ich kann die Hitze fühlen.«
»Aber man muss doch sterile …«
»Duncan wird nicht in dieses Haus gehen.« JoHanna sah hinüber zu dem keine dreißig Meter entfernten Gebäude. In ihrem Blick lag weder Zorn noch Hass, auch keine Angst. Es war der Blick eines Menschen, der vor sich auf der Straße eine Schlange bemerkt hat und sich entschließt, einen Umweg zu machen.
»Gehen Sie, und holen Sie mir Wasser und ein paar Tücher.« sagte der Doktor zu mir, ohne Duncan auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. »Aber machen Sie schnell.«
Ich beeilte mich, ins Haus zu kommen, und brachte ihm Agnes’ beste Steingutschüssel voll heißen Wassers und einen Stapel von ihren weißen Geschirrtüchern.
Kopfschüttelnd verband Doc Westfall die schlimmsten Brandwunden, wobei er JoHanna schroff erklärte, wie sie sie zu waschen und zu verbinden habe und was passieren würde, falls sie sich entzünden sollten. Er arbeitete äußerst zügig und gewandt und sprach Duncan kein einziges Mal direkt an. Die Kleine weinte nicht, doch ihr Blick war von Schmerz getrübt. Sie blickte ihrer Mutter unablässig in die Augen, was ihr offenbar Trost gab.
Vor sich auf dem Boden die blutige Waschschüssel und etliche leere Desinfektionsmittelflaschen, wandte sich der Doktor nun zum erstenmal an Duncan.
»Weißt du, wer du bist?«, fragte er. Es verwirrte ihn, dass sie so stumm war. Immerhin war sie ein Kind, und die Wunden mussten scheußlich weh tun. Wieso hatte sie nicht geschrien?
Duncan sah ihn an, ihr Gesicht ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihn verstanden hatte, doch sie antwortete nicht.
»Duncan, kannst du mich hören?«, fragte er.
Sie nickte.
»Tut dir etwas weh?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Kann sie sprechen?«, fragte er JoHanna.
»Sie hat etwas gesagt. Zu Mary.« JoHanna legte Duncan die Finger auf den Kehlkopf. »Sprich mit mir«, sagte sie sanft.
Duncan schluckte, sagte aber nichts.
»Kann sein, dass es am Schock liegt. Möglich, dass sich das in ein paar Tagen wieder gibt.« Aber Doc Westfall schien sich seiner Sache keineswegs sicher zu sein. Er fuhr sich mit den Fingern durch die weiße Mähne. »Kommen Sie morgen mit ihr zu mir in die Praxis, JoHanna. Im Moment kann ich nichts mehr für sie tun. Morgen lässt sich vielleicht schon mehr sagen.«
»Ist gut. Danke, Doc. Sie sind gut zu uns gewesen.«
Er brummte etwas und stand auf, ließ die Schlösser an seiner Tasche zuschnappen und schüttelte die nassen Hosenbeine.
JoHanna behielt Duncan auf dem Schoß, bis Doc Westfall fort war. Ich sah ihn um das Haus herum- und die Straße hinuntergehen. Er hatte offenbar keine Lust gehabt, sich drinnen von den Frauen mit Fragen bombardieren zu lassen.
»Dann wollen wir mal, Duncan.« JoHanna stand mühsam auf und reichte Duncan die Hand. Die Kleine griff danach, schaffte es aber nicht, sich hochzuziehen.
Ohne auf eine Aufforderung zu warten, trat ich hinter sie und griff ihr unter die Arme, wobei ich darauf achtete, auf keinen Fall ihren Rücken zu berühren. Sie war groß für ihr Alter, aber dünn. Ich hatte schon unzählige Futtersäcke und Wassermelonen geschleppt. Duncan wog ungefähr so viel wie zwei große Melonen, und ich hatte Mühe, sie aufzurichten. Ich versuchte, sie auf die Füße zu stellen.
Ich weiß nicht genau, ob es die Beine waren, die wegrutschten, oder ob nur die Knie einknickten, jedenfalls konnte sie sich nicht aufrecht halten. JoHanna kam mir zu Hilfe, doch nach mehreren vergeblichen Versuchen war klar, dass Duncan wirklich nicht stehen konnte.
JoHanna kniete sich hin und streckte Duncans Beine. Sie drückte leicht gegen ihre Füße und ihre Knöchel. »Spürst du das?«, fragte sie und sah Duncan dabei an.
Ich stand hinter der Kleinen und hielt sie fest. Zum erstenmal an jenem Tag sah ich in JoHannas Augen Angst. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass Duncan am Leben war. Doch sie konnte nicht dafür garantieren, dass ihr Kind keinen bleibenden Schaden zurückbehalten würde.
Duncan schüttelte den Kopf.
JoHanna drückte auf die Knie. »Und hier?«
Wieder das rasche Kopfschütteln.
JoHannas Hände wanderten hinauf zu den Schenkeln. »Hier?«
Duncan begriff. Nun nahm sie selbst die Hände zu Hilfe, tastete nach denen ihrer Mutter und drückte sich JoHannas Finger in einem Anfall von panischer Angst fest aufs Bein. Abermals schüttelte Duncan den Kopf, anfangs nur schnell, dann immer verzweifelter, und sah erst JoHanna und dann mich an. Sie öffnete den Mund, doch es kamen keine Worte über ihre Lippen.
»Los, wir setzen sie auf den Wagen«, sagte JoHanna und zeigte auf den roten Leiterwagen, der hinter der Magnolie stand. Zusammen hoben wir Duncan hoch – JoHanna hielt sie an den Beinen, ich unter den Achseln –, trugen sie hinüber zum Wagen und setzten sie vorsichtig hinein. Dann nahm JoHanna die Deichsel und machte sich auf den Weg zur Peterson Lane. Die McVays wohnten anderthalb Kilometer vor der Stadt in einer ziemlich abgelegenen Gegend.
»Wollen Sie denn nicht mit ihr zum Arzt gehen?« Ich war ganz verwirrt, dass sie die entgegengesetzte Richtung einschlug. Duncan konnte nicht laufen. Ihre Beine waren leblos.
»Wozu?« JoHanna sah die Straße hinunter, die zum Haus des Doktors führte. »Er hat getan, was er konnte.«
Ich war fassungslos. Vielleicht hatten sie ja nicht genug Geld, um noch einmal den Doktor zu holen. »Er wird Ihnen Kredit geben«, rief ich, ohne nachzudenken, und erschrak im selben Moment über meine Worte.
»Es geht nicht ums Geld«, sagte JoHanna und schlug den Weg zu ihrem Haus ein. »Doc Westfall hat getan, was er konnte.« Inzwischen hatte sie den Wagen aus dem Garten hinaus auf die Straße gelenkt.
»Soll ich mitkommen?« Ich lief bereits neben ihr her. Zurück zu der Geburtstagsfeier wollte ich nicht, und heimgehen mochte ich auch nicht.
»Nein. Wir brauchen keine Hilfe. Wenn Will das Telegramm kriegt, kommt er bestimmt gleich zurück.« Sie ging mit schnellen Schritten, und der Leiterwagen hinterließ eine schmale Spur in der weichen roten Erde.
»Kann ich irgend etwas tun?« An der Ecke zur Redemption Road blieb ich stehen, unschlüssig, ob ich mich verabschieden sollte. Elikah wartete sicher schon auf mich.
»Ja, das können Sie.« JoHanna blieb einen Moment stehen und sah mich an. »Nehmen Sie das Grammophon mit, und bewahren Sie es für Duncan auf. Bitten Sie Agnes, dass sie Ihnen einen Handwagen leiht. Sie wird froh sein, wenn sie das Ding los ist.«
»Ich werde gut darauf aufpassen«, versicherte ich. Zunächst musste ich mir jedoch überlegen, wie ich es nach Hause bekam und wo ich es vor Elikah verstecken konnte. Er hielt nichts von solchen Geräten.
Plötzlich, als hätte sie meine Bedenken erraten, drehte JoHanna sich noch einmal um und rief: »Meinen Sie, das geht?«
Ein Blick in ihre blauen Augen, und ich war mir auf einmal ganz sicher. »Ich erledige das für Sie, Mrs. McVay.«
»JoHanna«, korrigierte sie und ließ sich noch fünf Sekunden Zeit, um mich forschend anzusehen und sich davon zu überzeugen, dass ich wirklich im Stande war, ihre Bitte zu erfüllen. »Bringen Sie’s mir morgen vorbei. Bei der Gelegenheit gebe ich Ihnen Kürbis, Bohnen und Kartoffeln für Ihren Mann zum Abendbrot mit.«
»Hoffentlich wird Duncan bald wieder gesund.«
JoHanna antwortete nicht. Sie ging mit großen, energischen Schritten weiter. Solch einen entschlossenen Gang hatte ich noch nie bei einer Frau gesehen. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Da ging sie nun fort zu ihrem abgelegenen Haus, ganz allein, mit ihrer Tochter, die fast vom Blitz erschlagen worden war.
Ich erzählte Elikah nichts von dem, was geschehen war. Das war auch nicht nötig. JoHanna und Duncan waren noch nicht einmal in die Peterson Lane eingebogen, da wusste schon die ganze Stadt Bescheid. Frisch in Jexville angekommen, hatte ich mich noch darüber gewundert, wie schnell sich Gerüchte dort von einem Ende der Stadt zum anderen verbreiteten. Aber schon nach ein paar Tagen hatte ich begriffen, dass die Leute hier eine Schwäche für Klatsch und Tratsch hatten, und wenn es eine Neuigkeit gab, konnte es durchaus passieren, dass einer von Elikahs Kunden während des Haareschneidens und Rasierens aufsprang und hinüberrannte ins Café, um den Vorfall bei einer Tasse Kaffee mit den Nachbarn ausgiebig zu besprechen. Die Frauen trafen sich am Küchentisch oder an der Wäscheleine, um sich über irgendwas das Maul zu zerreißen, die Männer hingegen taten es im Café oder auf dem Friseurstuhl.
Als ich heimkam, waren schon drei Männer im Frisiersalon gewesen und hatten Elikah erzählt, was geschehen war, und er selbst war in die Schuhmacherei hinübergerannt und hatte es Axim Moses berichtet. Es herrschte allseits Einigkeit darüber, dass der Blitz Gottes Werk gewesen sei und dass Duncan McVay nur die Strafe für ihre eigene Widerspenstigkeit und für den Trotz und den Hochmut ihrer Mutter erhalten hatte. Gott hatte die beiden für ihre Sünden büßen lassen, dieser Meinung waren jedenfalls die meisten Leute in der Stadt. Wenn es überhaupt so etwas wie Mitleid gab, dann allenfalls mit dem der Weiberwillkür ausgelieferten Will McVay.
Ich brauchte eine ganze Weile, bis ich daheim ankam, denn ich musste ja noch das Grammophon verstecken. Ich hatte mir von Agnes einen Leiterwagen geliehen, war aber nicht so dumm gewesen, den Apparat mit in unser Haus zu nehmen. Elikahs Ansichten über Musik und Tanz waren sehr streng. Da ich neu in der Stadt war, hatte ich ein bisschen nachdenken müssen, doch dann war mir ein guter Platz für das Grammophon eingefallen, und ich hatte es mitsamt dem Wagen hochkant neben den Heuschober im Mietstall gezwängt. Dort war es sicher und trocken aufbewahrt, und ich musste nicht befürchten, dass es per Zufall entdeckt wurde. Zumindest nicht, wenn es nur eine Nacht dort stand. Dann rannte ich nach Hause, um für Elikah das Abendbrot herzurichten.
Abends, nach dem Essen, liebte ich es, draußen auf der Veranda zu sitzen und zu schaukeln. Das Quietschen der alten Ketten gab mir ein Gefühl von Frieden, sogar in ganz heißen Nächten.
Bei Nacht zeigte sich Jexville in seiner wahren Schönheit. Die Stadt erinnerte mich an einen Hund, der uns zugelaufen war, als ich vierzehn war. Suke war ein hässliches gelbes Tier mit kleinen Augen und räudigem Fell. Nachts aber, wenn das Geschirr gespült war und die kleineren Geschwister im Bett lagen, saß ich auf unserer kleinen Veranda, und dann kam Suke angelaufen und schob mir ihre Schnauze in die Hand. Und dort, im Dunkeln, waren wir beide die Schönsten.
Des Nachts, wenn die Sterne am Himmel standen, der Wind in den Kiefernnadeln raunte und ein kräftiger Harzgeruch in der Luft hing, war Jexville auf einmal wie verzaubert. Es gab üppige Eichen- und Magnolienhaine. Einige der neu Hinzugezogenen hatten Pecanbäume gepflanzt, die mit ihren dicken grauen Stämmen und den schlanken, feinverzweigten Ästen schon richtige kleine Wälder bildeten. Eines Tages, wenn die neue Hauptstraße gepflastert war, wenn alle Läden fertig ausgebaut waren und endlich nicht mehr der scharfe, harzige Geruch des frischen Holzes in der Luft hing, würde die Stadt selbst sicher auch nicht mehr so bedrückend hässlich sein. Nächstes Frühjahr würden hinten in meinem Gärtchen, das heute noch kahler als der Kopf eines gerupften Huhnes war, schon Blumen blühen. Und mit etwas Geduld und ein wenig Anstrengung würde auch in Jexville manches besser werden. Mit harter Arbeit ließ sich hier eine Menge ändern.
Wenn der Tag zu Ende war und die Nacht hereinbrach, konnte ich mich wieder in meine alten Träume versenken. Darin kam lauter törichtes Zeug vor, zusammengesponnen aus dem Inhalt von billigen Zeitschriften und den Aufführungen der Wandertheater, die mitunter im Opernhaus in Meridian aufgetreten waren. Ich wusste, dass alles reine Fantastereien waren, und trotzdem genoss ich es in vollen Zügen. Erst viele Jahre später begann ich darüber nachzudenken, wie es möglich ist, dass der Mensch sich verzweifelt an etwas klammert, von dem er im Grunde seines Herzens ganz genau weiß, dass es in Wirklichkeit nicht existiert.
Die Nacht verging, und als die heiße, hellrote Morgensonne spürbar wurde, war ich schon angezogen und hantierte in der Küche. Elikah war damals ein schöner Mann. Besonders stolz war er auf seinen Schnurrbart. Während ich Frühstück machte, striegelte er ihn hingebungsvoll, damit auch ja jedes Haar am rechten Platz war. In seinem gestärkten weißen Hemd und den schwarzen Hosenträgern hätte man ihn glatt für den Doktor halten können, viel eher als Doc Westfall, der immer irgendwie zerzaust und abgehetzt aussah. In Städten ohne einen eigenen Arzt, sagte Elikah oft und nicht ohne Wehmut in der Stimme, werden dessen Aufgaben nicht selten vom Friseur übernommen. Mir lief dann immer ein kleiner Schauer über den Rücken, was er mit einem Lächeln quittierte.
Sobald er seine Spiegeleier mit Maisgrütze aufgegessen hatte und das Geschirr gespült war, lief ich los, um das Grammophon zu holen. Ich hatte mir einen Weg überlegt, der außen um die Stadt herum führte und auf dem ich – was das Wichtigste war – nicht bei Janelle Baxley vorbei musste. Seit ich in Jexville angekommen war, ließ Janelle sich keine Gelegenheit entgehen, mir hinterherzuschnüffeln. Dabei hatten mir, als ich ängstlich und aufgeregt aus dem Zug gestiegen war, Janelles warme Umarmung und ihre durchdringenden blauen Augen im ersten Moment ein Gefühl von Geborgenheit gegeben. Mit ihrer Spitzenbluse und dem wie angegossen sitzenden Rock war sie mir so erwachsen und gescheit vorgekommen. Das war, bevor sie mir berichtete, Elikah habe zwar im Café jedem erzählt, ihm schwane nichts Gutes, wenn er an mich denke, aber die ganze Stadt wolle mir helfen, das zu vergessen. Es sei schließlich ganz normal, dass ein Bräutigam sich Gedanken mache, sagte sie; allerdings habe Elikah, als er zum Bahnhof gegangen sei, um mich abzuholen, extra ein Kuvert mit Geld eingesteckt, damit er mich wieder nach Hause schicken könne, falls ich keinen akzeptablen Eindruck machte.
Janelle wollte ich unter gar keinen Umständen begegnen, wenn ich das Grammophon in die Peterson Lane brachte.
Ich hatte mir eine gute Tageszeit ausgesucht und schaffte es, über die Eisenbahnschienen zu kommen, ohne auch nur einem Kaninchen über den Weg gelaufen zu sein. Sobald ich aus der Stadt heraus war, nahm ich mir mehr Zeit, ließ die Deichsel einen Moment los und ruhte mich ein wenig aus. Es war ein heißer Tag. Zu heiß für mein hässliches Matrosenkleid, aber etwas anderes hatte ich nicht anzuziehen. Schließlich hatte ich gerade erst meine kühlen Kattunhänger gegen einer Ehefrau angemessene Kleidung eingetauscht. Kein sehr vorteilhafter Tausch, wie es schien. Doch ich hielt mich nicht lange bei den Enttäuschungen des Erwachsenwerdens auf, sondern ging tapfer weiter. Laut schreiend warnte ein Häher die anderen Tiere vor mir, und sogleich raschelte es im hohen Johnsongras, das in dichten Büscheln am Straßenrand wuchs. Niemand hielt mich davon ab, meiner Phantasie freien Lauf zu lassen. Ich konnte mir einbilden, am Ende der Straße stünde ein Planwagen und die Zigeuner nähmen mich mit und brächten mir Weissagen und Singen bei. Und dann würden wir durch die Welt ziehen, und ich würde berühmt werden für meine Träume und Visionen. Wir würden übers Meer fahren, bis nach Europa, und der König und die Königin würden mich bitten, zum Tee zu ihnen zu kommen. Ein aufregendes Leben wäre das, und es war zum Greifen nah, gleich hinter der nächsten Wegbiegung flirrte es in der Hitze.
Die Peterson Lane schlängelte sich am Little Red Creek entlang, einem kristallklaren, bernsteingelb und goldfarben schimmernden Bach, der sich gemächlich durch die Wiesen und Wälder wand, um schließlich in den Sumpf am östlichen Ende von Jexville zu münden. An manchen Stellen war er so flach, dass man hindurchwaten konnte, und der reine, sandige Grund kam mir vor wie ein Abglanz der weißen Sandstrände und blauen Wellen, die ich wohl nie mit eigenen Augen würde sehen können. Hier und da bildete der Bach kleine Teiche, wenn zum Beispiel irgendwo ein Baum umgefallen war, an dem sich das Wasser staute. Dort war es dann sogar tief genug zum Schwimmen. Aber diese Stellen kannte ich nicht. Noch nicht. Bis JoHanna und Duncan mir die schönen Seiten meiner neuen Heimat zeigten.
Als ich nun zum ersten Mal zu den McVays kam, blieb ich vor dem Haus stehen und ließ mir etwas Zeit. Ich sah, dass Wäsche auf der Leine hing, unter anderem die Überreste von Duncans gelbem Kleid. JoHanna war anscheinend früh aufgestanden und hatte gewaschen.
Vor dem Haus standen sechs Eichen, weit genug entfernt, um Schatten zu spenden, ohne das Licht zu schlucken. An der Ostseite befand sich eine verglaste Veranda mit einer Schaukel. Die Veranda lag gänzlich im Schatten zweier mächtiger Bäume, einer Magnolie und einer Zeder. Der westliche Teil des Gartens lag in der Sonne. Hier hingen die Wäschestücke reglos in der windstillen Morgenluft. Etwas weiter hinten stand ein Seifenbaum, hinter dem ein schönes rotes Automobil parkte.
In Meridian hatte es massenhaft Autos gegeben. Jojo hatte sich auch eins gekauft, doch die Freude währte nicht lange. Eines Tages war es weg, und Mama hat nie erfahren, ob er es zu Schrott gefahren oder beim Spiel verloren oder ob die Bank es ihm weggenommen hatte. Und keiner hatte sich getraut, ihn zu fragen. Es war ein hässliches schwarzes Monstrum gewesen, das nach Wagenschmiere und Ärger stank. Mir hatte es nichts ausgemacht, dass es nicht mehr da war, obwohl uns das Geknatter immer vorgewarnt hatte, wenn Jojo nach Hause kam.
Doch dieses Auto, das halb versteckt hinter der Wäsche und dem Baum zu sehen war, glich den Automobilen in den Zeitschriften, die ich so gern las. Ein Auto wie von einem Filmstar. Und genau so sah JoHanna ja auch aus.
Die Sonne brannte mir auf den Kopf und holte mich wieder zurück in die Gegenwart, auf die staubige Straße, auf der ich stand. Der Weg war gar nicht so weit gewesen, und trotzdem schwitzte ich in der Julihitze. Zum Teil lag es an dem Kleid. Es war kein richtiges Sommerkleid, doch als verheiratete Frau musste ich langärmelig gehen und genug Falten im Rock haben. Vor meiner Hochzeit hatte ich immer weite Mädchenkleider getragen, obwohl ich dafür eigentlich schon zu alt war. Wir hatten kein Geld für irgendwelche Besonderheiten, und ich fand es überhaupt nicht schlimm, im Sommer leicht und bequem angezogen zu sein. Jenes blaue Kleid war vorn am Bauch etwas ausgeleiert, wohl noch von Mamas Schwangerschaft mit Lena Rae. Sie hatte es seit Jahren nicht mehr angehabt.
Nach vier Kindern hatte sie gesagt, dass sich ihre Taille wohl nicht mehr zurückbilden würde. Nach den nächsten vier war sie so aus dem Leim gegangen, dass nicht mal mehr ein Korsett helfen konnte. Und so hatte ich das blaue Kleid bekommen, als ich eingewilligt hatte, Elikah zu heiraten.
Während ich noch so zwischen Vergangenheit und Gegenwart schwebte, sah ich plötzlich, wie neben der hintersten Eiche draußen vorm Haus etwas vorüberhuschte. Der Garten war wunderbar gepflegt. Überall blühten Blumen in den schönsten Rot-, Gelb- und Violetttönen und einem bläulich schimmernden Rosa, das aussah wie der Himmel bei Sonnenuntergang. Und zwischen all den Farben war etwas vorbeigesaust, etwas Rotbraunes.
Ein Hund?
Ich hatte kein Bellen gehört, aber einige Hunde bellten eben nicht. Sie waren hinterhältig und schlichen sich heimlich an. Ich hatte keine Angst vor Hunden. Ich kam sogar recht gut mit ihnen aus. Aber ich hatte die Erfahrung gemacht, dass ein hinterhältiger Hund genauso war wie ein hinterhältiger Mensch: Kehrtest du ihm den Rücken, so war es dein Verderben. Ich ging mit meinem Handwagen weiter, bis ich bei den Bäumen angelangt war. Da der Hund nicht zu sehen war, nahm ich an, dass er sich einfach verdrückt hatte.
Auf die Federn, die mir plötzlich vor der Nase herumwirbelten, war ich ebenso wenig gefasst gewesen wie auf den sonderbaren hohen Schrei, den ich im selben Moment vernahm. Ich wich zurück und hob kreischend die Hände.
Ich fühlte, dass meine Handfläche genau in der Mitte aufgeschlitzt war, und um mich herum flogen Staub, Federn und Krallen durch die Luft. Ich kreischte abermals und versuchte, das Biest abzuwehren, stolperte aber über die Deichsel des Handwagens und fiel auf den Rücken. Der Vogel war direkt über mir, streckte mir die Krallen entgegen und schlug mit den Flügeln. Ich dachte sofort an einen Habicht oder Adler, doch während ich um Hilfe schrie, gelang es mir, das Tier etwas genauer anzusehen. Es war ein brauner Hahn.