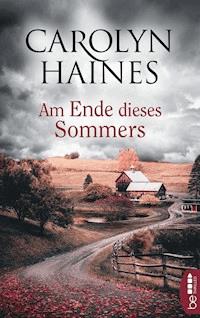4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Südstaaten-Krimis
- Sprache: Deutsch
Ein brutaler Mord lässt die saubere Fassade einer Kleinstadt bröckeln ...
Die grausame Tat erschüttert das beschauliche Städtchen in Louisiana: Über der übel zugerichteten Leiche eines Plantagenbesitzers kauert die junge Adele, offenbar geistig verwirrt. Sie ist davon überzeugt, ein loup-garou, eine Art Werwolf, zu sein. Bald bricht Panik in der Bevölkerung aus, und eine Hetzjagd auf Adele beginnt. Deputy Raymond Thibodeaux ist anscheinend der Einzige, der an Adeles Unschuld glaubt ...
Mit diesem düsteren Südstaatenroman zeichnet Carolyn Haines das psychologische Bild einer isolierten Gesellschaft, die hinterwäldlerisch und skrupellos zugleich ist.
Weitere Südstaaten-Krimis von Carolyn Haines als eBook beTHRILLED: Am Ende dieses Sommers, Das Mädchen im Fluss und Der Fluss des verlorenen Mondes.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31DanksagungÜber dieses Buch
Ein brutaler Mord lässt die saubere Fassade einer Kleinstadt bröckeln …
Die grausame Tat erschüttert das beschauliche Städtchen in Louisiana: Über der übel zugerichteten Leiche eines Plantagenbesitzers kauert die junge Adele, offenbar geistig verwirrt. Sie ist davon überzeugt, ein loup-garou, eine Art Werwolf, zu sein. Bald bricht Panik in der Bevölkerung aus, und eine Hetzjagd auf Adele beginnt. Deputy Raymond Thibodeaux ist anscheinend der Einzige, der an Adeles Unschuld glaubt …
Über die Autorin
Carolyn Haines (*1953) ist eine amerikanische Bestsellerautorin. Neben den humorvollen Krimis um Privatermittlerin Sarah Booth Delaney hat die ehemalige Journalistin u.a. auch hochgelobte Südstaaten-Romane geschrieben, die auf sehr atmosphärische Weise die Mississippi-Gegend im letzten Jahrhundert porträtieren. Für ihr Werk wurde Haines mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Harper Lee Award. In Mississippi geboren, lebt die engagierte Tierschützerin heute mit ihren Pferden, Hunden und Katzen auf einer Farm im Süden Alabamas.
Homepage der Autorin: http://carolynhaines.com/.
Carolyn Haines
Im Nebel einesneuen Morgens
Aus dem amerikanischen Englisch vonKarl-Heinz Ebnet
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Carolyn Haines
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Fever Moon«
The author has asserted her Moral Rights.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2009/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Claudia Alt, München
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock: STILLFX | Irina Mos; © iStock: Richard McMillin
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5641-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Fran und Mike Utley
1
Der kahle Pekannussbaum im Garten der Julinots reckte seine Klauen in den Himmel. Der Sturm hatte sich ohne Vorwarnung im Golf von Mexiko zusammengebraut, hatte Regen mitgebracht sowie einen ersten Anflug winterlicher Kühle und war so schnell wieder abgezogen, wie er gekommen war. Zurück blieben heimtückische Straßen und anschwellende Sümpfe, die gierig an die Ufer schlugen.
Raymond umklammerte das Lenkrad des Chevy, dessen glatte, schmale Reifen auf dem schmierigen Untergrund ständig wegzurutschen drohten. Der Vollmond brach durch die Wolkendecke und erhellte den Weg klarer als die Scheinwerfer seines Wagens, mit dem er zu einer Tragödie unterwegs war. Immer waren es Tragödien, wenn er gerufen wurde. Tod und Verlust, das waren seine vertrauten Gefährten, die er in Übersee kennengelernt hatte und denen er jetzt nicht mehr entkommen konnte.
Er drückte das Gaspedal durch. Etwas Schwerwiegendes musste vorgefallen sein, wenn er Benzin verbrauchte, das in diesen Kriegszeiten streng rationiert war. In New Iberia, Louisiana, holte man nicht die Polizei, außer es war unumgänglich.
Unbehagen beschlich ihn, als er an den Besucher zurückdachte, der ihn zu dieser Fahrt veranlasst hatte. Zwanzig Minuten zuvor war Emanuel Agee im Sheriffbüro aufgetaucht, blass, atemlos, mit klappernden Zähnen. »Beaver Creek« war alles, was er hervorgestoßen hatte – und »Schnell!«.
Dann war der Junge wieder in die Nacht verschwunden, nur die nassen Abdrücke seiner nackten Füße waren auf dem Boden des Büros zurückgeblieben. Keiner aus der Gemeinde hielt sich länger als nötig im Sheriffbüro auf, schon gar nicht, wenn Raymond anwesend war. Die Leute mieden ihn, seine Schwermut beunruhigte sie.
Aufgeschreckt von Emanuels Angst, war Raymond in den strömenden Regen hinausgetreten. Nichts hatte mehr auf die Anwesenheit des Jungen hingedeutet. Manche würden sagen, eine Todesfee oder ein böser Geist habe sich der Seele des Jungen bemächtigt und sei gekommen, um Unheil über den Deputy zu bringen. Der Regen hatte alle Spuren von Emanuel verwischt. Raymond aber wusste, dass der Junge sich in einer Seitengasse verbarg und nicht befragt werden wollte.
Raymond hatte seinen Revolver, eine Taschenlampe und seinen Hut geholt und sich auf den Weg zu dem fünf Meilen entfernten schmalen Bachlauf gemacht, in dem sich in den heißen Sommermonaten die Brassen und Flusskrebse tummelten.
Der Beaver Creek lag nur ein Stück weit hinter der Julinot-Farm. Raymond drosselte die Geschwindigkeit, als er sich der Brücke näherte. Häufig musste er bei solcher Witterung aus den angeschwollenen Bächen die Wagen ziehen, deren Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatten, um die schmalen, geländerlosen Brücken richtig einzuschätzen. Der Gedanke, möglicherweise Ertrunkene vorzufinden, erfüllte ihn mit großem Unbehagen. Frauen und Kinder waren oft die unschuldigen Beifahrer, am Steuer immer die Männer, in deren Gesichtszügen noch das Entsetzen über ihre Tat zu lesen war. Er verspürte nicht den geringsten Wunsch, so einen Unglücksfall zu sehen zu bekommen. Aber es gehörte zu seinem Job. Joe Como, der Sheriff, ließ sich nur ungern mitten in der Nacht stören. Joe, der aus politischem Ehrgeiz seinen Namen Comeaux anglisiert hatte und lieber zu einem Plausch ins Café ging. Und die Toten seinem Deputy überließ.
Er näherte sich der Brücke, die im Mondlicht deutlich zu erkennen war. Unzerstört. Es war Oktober, der Jagdmond. Milchweiß strahlte der Mond zwischen den vorüberziehenden Gewitterwolken und warf lange Schatten auf den Weg.
An der Brücke hielt er an. Von einem Unfall war nichts zu sehen, das Wasser strömte ungehindert unter den Holzbalken hindurch. Verwundert ging er zum Ufer hinunter und suchte nach Reifenspuren. Nichts, im sandigen Erdreich nur vom Hochwasser ausgewaschene Rinnen.
Erst als er wieder hochstieg, hörte er ein Geräusch, bei dem sich ihm die Nackenhaare aufstellten. Gelächter hallte durch die Bäume, es kam von allen Seiten, umzingelte ihn. Mit einer Hand am schlanken Stamm einer Sumpfzypresse blieb er stehen. Sein ganzer Körper spannte sich. In einer fließenden Bewegung zog er die Waffe aus dem Halfter, hielt sie locker in der Hand und lauschte.
Wieder das Gelächter, das von allen Seiten auf ihn eindrang, ein Laut des Wahnsinns, den er fast im Wind riechen konnte. Er folgte ihm zum Weg hinauf und wusste, dass seine Vergangenheit ihn endlich eingeholt hatte.
Hinter einer Biegung stieß er auf sie.
Lange stand er nur da und starrte auf die Frau – und auf das, was zu ihren Füßen lag. Auf das Blut, das im Mondlicht an ihren Händen und in ihrem Gesicht schimmerte und auf der unbefestigten Straße in sich schlängelnden Rinnsalen dem Weg des Regens folgte. Auf die langen, in sich verschlungenen Darmstränge, die aus dem aufgeschlitzten Unterleib des Toten quollen.
Sein Herz hämmerte. Er hatte sie oft erlebt, die ungezählten Schrecken, hatte sie selbst heraufbeschworen, aber nichts davon hatte ihn jemals so frösteln lassen wie das hier. Langsam ging er auf sie zu. Halb kauernd, argwöhnisch drehte sie sich zu ihm um. Sie besaß die Anmut eines Tiers, eines wilden Wesens, das beim Fressen gestört wurde. Ihr Kleid war zerrissen, das Weiß ihrer Oberschenkel und ihres Hinterns leuchtete auf, als sie hinter der Leiche zu ihm herumfuhr. Was ihn jedoch festhielt, war ihr Blick. Ihre Augen, dunkel wie Morasttümpel, brannten.
»Ruhig«, sagte er. »Ich bin Deputy Thibodeaux. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen wehzutun.« Er zielte auf ihr Herz. Sie war sehr mager, viel zu unterernährt, um unter normalen Umständen eine Gefahr darzustellen. Er kannte fast jeden in der Gemeinde, aber sie war ihm fremd. »Ich möchte Ihnen nicht wehtun«, wiederholte er. Zu spät bemerkte er, dass er damit den Fluch ausgesprochen hatte, der auf ihm lastete. Nie wollte er jemandem Schaden zufügen, dabei konnte er es so gut.
Die Frau lachte auf, ein freudiger Laut, in dem sich ein anderer, undefinierbarer mischte. Als er sich ihr näherte, kauerte sie sich über die Leiche und knurrte.
»Gehen Sie von der Leiche weg.« Er trat näher, entschlossen, seine Pflicht zu tun. Ihre Augen glitzerten im Licht des Mondes, als stünde sie unter seinem Bann. »Treten Sie zurück.« Er war jetzt so nah, um erkennen zu können, dass das tote Ding zu ihren Füßen Henry Bastion war, der reichste Bewohner der Gemeinde.
Die Frau sprang vor. Er zielte auf ihr Herz. Er hatte viele getötet, aber noch nie eine Frau. Sie würde die erste sein.
»Zurück!«, sagte er. »Sofort!«
Langsam richtete sie sich auf. Sie ließ die Arme sinken, richtete das Kinn zum Mond, ihr langer, schlanker Hals kam zum Vorschein, der krampfhaft zuckte, bis sich aus ihrer Kehle ein Heulen Bahn brach.
Die Fliegentür ihres kleinen Hauses schlug im Wind. Florence Delacroix hüllte sich in ihren Morgenmantel und rückte ans Feuer. Die züngelnden Flammen warfen tanzende Schatten auf ihr Gesicht, verbargen und enthüllten ihr klassisches Profil, die vollen Lippen und großen grünen Augen. Eine halbmondförmige Narbe folgte der Rundung ihrer Wange. Sie wandte sich an den Jungen, der sich neben ihr in eine Decke gewickelt hatte.
»Du hast die Leiche gesehen?«
Emanuel Agee führte die Tasse mit der dampfenden Schokolade an die Lippen und nickte. Als die Fliegentür erneut klapperte, ging sein Blick dorthin.
»Ist nur der Wind, Junge. Nur der Wind.« Er war ein hübscher Bengel, ging ihr durch den Kopf, schwarze Haare, dunkle Augen, die von Intelligenz zeugten, genau wie bei seinem Vater. »Erzähl mir, was du gesehen hast.«
»Überall auf der Straße waren seine Eingeweide. Und sie, sie hat über ihm gestanden und gelacht, und sie hat mich angestarrt.« Er blinzelte. »Glauben Sie, sie hat mich verflucht?«
»Nein, cher.« Florence musterte ihn. »Es liegt kein Fluch auf dir.« Sie fuhr ihm durchs Haar. »Henri Bastion hat sich auf einen Teufel eingelassen, dem er nicht gewachsen war.« Florence erhob sich und ging zur Ankleide, kramte in einer Geldbörse und kam mit einer Münze zurück. Sie reichte sie dem Jungen, strich ihm erneut über den Kopf, spürte, wie das feine Haar durch ihre Finger glitt. »Es war richtig, zu mir zu kommen und es mir zu erzählen.«
»Daddy hat gesagt, ich soll’s dem Sheriff sagen und dann zu Ihnen kommen. Er sagt, Sie passen schon auf mich auf.«
»Dein Daddy ist ein kluger Mann. Bei Florence bist du sicher.«
»Es war ein loup-garou«, sagte der Junge so atemlos, dass er kaum die Worte herausbrachte. »Er hat sich die Frau geholt und ist in sie geschlüpft.«
Florence ließ sich wieder vor dem Feuer nieder. »Henri Bastion hat viele Feinde gehabt, und einer davon ist so wütend geworden, dass er ihn umgebracht hat. Das ist alles.«
»Sie hat überall Haare gehabt.«
Florence betrachtete sein Gesicht, seine Augen, in denen die Angst zu sehen war. »Wirklich? Überall Haare?«
Er nickte. »Sie hat ihn umgebracht, und dann hat sie ihn fressen wollen.«
»Na, Henri würde aber einen zähen Eintopf abgeben.«
»Sie hat ihn roh essen wollen.«
»Hast du die Frau erkannt, cher?«, fragte Florence. Sie ging die Liste der Frauen in Iberia durch, die stark genug wären, einen Mann zu töten. Ihr fiel niemand ein. Henri Bastion war im besten Mannesalter. Gerüchten zufolge soll er einen Strafgefangenen, der bei ihm auf der Plantage gearbeitet hatte, mit bloßen Händen erschlagen haben. Falls er nicht verletzt oder betrunken gewesen war, hätte eine Frau gegen ihn keine Chance gehabt.
Emanuel schüttelte den Kopf. »Hab sie noch nie gesehen.« Ernst sah er sie an. »Aber sie ist nicht mehr die, die sie mal war. Sie ist ein loup-garou.«
Sie nahm dem Jungen die Tasse aus den zitternden Händen. »Willst du heute Nacht noch nach Hause oder hier bleiben? Ich würde dich ja fahren, aber Benzinmarken sind teuer.«
»Ich geh nicht nach Hause. Nicht nachts durch den Wald, wenn sich ein Dämon rumtreibt. Hätte auf dem Weg hierher schon umgebracht werden können.«
Tatsächlich zeichneten sich auf Gesicht, Hals und Händen des Jungen Kratzer ab. Er hatte sich durch Dornensträucher und Büsche geschlagen, um ja keine Zeit zu verlieren, damit der Werwolf seine Fährte nicht wittern konnte. »Dann mach dir auf dem Boden ein Lager. Bei Tagesanbruch musst du fort. Wäre nicht gut, wenn die Leute mitkriegen, dass du bei mir übernachtet hast.«
Raymond ließ der Frau, die wie gebannt den Mond anstarrte, keine Möglichkeit zur Flucht. Mit einem Satz war er bei ihr und schlug ihr die Beine weg, sie rang nach Luft und sackte zu Boden. Als er sie berührte, wusste er sofort, dass sie ernsthaft krank war. Ihre Haut brannte. Sie wand sich, strampelte wie ein wildes Tier, rollte mit den Augen und knirschte mit den Zähnen. Dann warf sie sich auf den Bauch und versuchte wegzukriechen, krallte sich im Boden fest und entblößte ihre Nacktheit ohne Scham.
»Ruhig«, sagte er und umfasste ihre zappelnde Taille. »Ich versuche Ihnen zu helfen.«
Knurrend schnappte sie nach seiner Hand. Ihre Stimme klang rau, als wäre ihr Hals wund. Ihre klauenartigen Finger bohrten sich in den feuchten Schlamm.
Raymond verbog ihr den Arm und rollte sie auf den Rücken. Sie wehrte sich mit aller Macht, doch bis auf ihren rauen Atem gab sie keinen Ton von sich. Rittlings setzte er sich auf sie, versuchte sie festzuhalten, ohne sie zu verletzen, wollte sie an den Handgelenken packen und fuhr ihr dabei mit der Hand über die feste Brust. Sie wand sich unter ihm, sträubte sich mit unbegreiflicher Kraft. Schließlich konnte er ihr die Handschellen anlegen und sprang auf.
Er hievte sie auf die Beine. Speichelfäden troffen ihr aus dem Mund und vermischten sich mit dem bereits gerinnenden Blut an ihrem Kinn. Sie wollte sich losreißen, aber er hielt sie an den Handschellen fest.
Ihr Kleid war zerfetzt, ihre Füße waren nackt. Morast und Schnitte bedeckten die Beine, eingetrocknetes Blut zog sich über ihr Gesicht und die Fetzen ihres Kleides. Sie keuchte vor Erschöpfung und hielt sich von ihm so weit fern, wie die Handschellen es zuließen. Obwohl sie völlig verstört und aufgebracht wirkte, warf sie auch jetzt noch einen langen Blick zum Mond, dessen silbriges Licht die Baumwipfel berührte.
»Sie sind verhaftet. Kommen Sie.« Er zog sie zum Wagen, was weitere Gegenwehr zur Folge hatte. Aber sie wurde schwächer. Ihr Körper besaß kein Gramm Fett zu viel, und sie glühte vor Fieber, was ihn mit großer Unruhe erfüllte.
Er drückte sie auf den Beifahrersitz und nahm sich vor ihren Zähnen in Acht. Gewöhnlich transportierte er Gefangene auf dem Rücksitz, aber die Vorstellung, sie könnte ihm ihre Zähne in den Nacken schlagen, während er am Steuer saß, gefiel ihm ganz und gar nicht.
Schließlich, als ihr Widerstand nachließ, lockerte er seinen Griff. »Wie heißen Sie?«
Sie sah an ihm vorbei zum Mond, der niedrig am samtenen Himmel stand, und lächelte. Ihr Mund ging auf, als wollte sie etwas sagen, doch dann ließ sie sich nur gegen den Sitz fallen. Fieberschauer ließen sie am ganzen Leib zittern.
Er überprüfte ihren Puls, der schwach und unregelmäßig war. Im Augenblick hatten die Kräfte sie verlassen.
Er ließ sie im Wagen und untersuchte den Toten. Abgesehen von den Bauchverletzungen war Henris Kopf fast vollständig vom Rumpf getrennt. Die Wunde war so zerfetzt, dass man noch nicht einmal ahnen konnte, wodurch sie verursacht worden war. Für Henri Bastion konnte er nichts mehr tun, außer den Coroner zu benachrichtigen.
Er setzte sich hinters Steuer, wendete den Wagen und fuhr in die Stadt zurück. Im hellen Mondlicht betrachtete er das nun schlaffe Gesicht der Frau. Er glaubte, sie schon mal gesehen zu haben, konnte sie aber immer noch nicht einordnen. Ihre blutverschmierten Gesichtszüge waren vom Fieber verzerrt. Vielleicht fiel ihm ihr Name ein, wenn sie gewaschen war.
Früher hatte er alle jungen Frauen der Gemeinde gekannt. Mit den meisten von ihnen hatte er getanzt, hatte mit ihnen gelegentlich geflirtet und diejenigen, die Lust darauf hatten, zu weitergehenden Abenteuern verführt. Die Welt war eine Abfolge von Samstagabenden gewesen, an denen das Leben so einfach war. Der Geruch von Gumbo in einem gusseisernen Topf über dem offenen Feuer, der Rhythmus einer Fiedel, eine schöne junge Frau, die ihn anblickte, in ihren Augen ein Versprechen auf die Zukunft, während sie tanzten und der Bayou Teche sanft gegen das Ufer schwappte. Er konnte sich an den brennenden Alkohol in seiner Kehle erinnern, an den Geschmack der Küsse unter dem Vollmond. Aber das alles waren die Erinnerungen eines Toten.
Er ließ die Vergangenheit hinter sich, während er über die tückischen Straßen fuhr. Jene Nächte waren vorüber. Damals hatte er Träume gehabt, Wünsche und Ziele. Der Krieg hatte alles verändert. Er hatte ihn verändert, auf eine Weise, die er nicht erklären konnte, weder seiner Familie noch allen anderen. Das Leben, das er für sich ersehnt hatte, war ihm genommen und durch etwas Dunkles, Gewalttätiges ersetzt worden. Ihm war, als hätte ihn das Schicksal genau zu diesem Augenblick auf dieser einsamen Straße geführt, zu einem grauenvollen Mord und einer Verrückten.
Das Ruckeln des Wagens lullte sie ein. Schläfrig versuchte sie, die Augen offen zu halten, lehnte sich gegen den Sitz und sah nur starr geradeaus.
»Haben Sie Henri Bastion gekannt?« Er versuchte nicht an den Toten zu denken, den aufgeschlitzten Bauch, den Kopf, der nur noch an einem Stück Wirbelsäule und einigen Muskeln und Sehnen hing.
»Der loup-garou hat Hunger.« Speichel lief ihr über das Kinn. »Ich hab ihn getötet.« Ihr Hals zuckte.
Raymond beobachtete sie, achtete auf ihre Bewegungen, ihre Bereitschaft zum Angriff oder zur Flucht. Die Legende des loup-garou war bei den Anwohnern in den Wäldern weit verbreitet. Sie hielten das Wesen für einen Teufel, der seine Gestalt wechselte und sich der Menschen bemächtigte, ob sie es wollten oder nicht. Wenn Kinder in den Sümpfen verschwanden, wurden nur selten die Behörden in Kenntnis gesetzt. Die Eltern nahmen an, ihr Kind sei vom loup-garou geholt worden. Ging man zur Polizei, würde man nur Schande über die Familie bringen. Einer aus ihren Reihen war zum Teufel übergelaufen. Es war besser, Stillschweigen zu bewahren und alles zu vergessen. Und dafür zu beten, dass das besessene Kind niemals mehr den Weg nach Hause fand.
»Haben Sie Henri Bastion gekannt?«, wiederholte er seine Frage. Eine lange Pause. Er sah zu ihr. Sie war wach und hatte den Blick auf den Mond gerichtet, der ihnen zu folgen schien. »Was hat Bastion auf der Section Line Road gemacht?«
Ihre Augen glänzten im Fieber. Sie fuhr hoch, dann sackte sie gegen die Tür. Er befühlte ihre Stirn. Sie glühte. Wenn das Fieber weiter stieg, würde es ihr das Gehirn verbrennen. Sie brauchte einen Arzt.
An der Einmündung bog er nach Süden ab, weg von der Stadt und dem Gefängnis. Nachdem sie schon bei ihm im Wagen saß, war es das Beste, sie zu Madame Louiselle zu bringen, einer traiteuse, die mit Kräutern und Gebeten die Krankheiten der Armen behandelte, die sich keinen Doktor leisten konnten. Es war keine Zeit mehr, nach Lafayette und zu einem Doktor zu fahren. Doc Fletcher, der in New Iberia ansässige Arzt, war nicht in der Stadt. Wenn Madame Louiselle das Fieber nicht senken konnte, würde die Frau neben ihm sterben.
2
Über ihm wölbten sich die dichten Baumkronen, als Raymond in den schmalen Weg zu Madame Louiselle einbog. Die Frau neben ihm lehnte mit geschlossenen Augen an der Beifahrertür. Er legte ihr die Hand auf die Stirn, eine Geste, die so zärtlich war, dass er kurz zögerte. Unter seiner Berührung zuckte sie wie ein ängstliches Tier zusammen. Sie hatte das Bewusstsein verloren und war nicht mehr ansprechbar. Fieber. Wahnsinn. Er wusste es nicht. Er konnte nur weiterfahren.
Er überquerte die nach heftigen Regenfällen oft überflutete Brücke und dankte welchem Gott auch immer, der über ihn wachte, als er die dunkle, auf Pfählen stehende Hütte erreichte.
»Madame Louiselle!«, rief er, noch während er die Frau aus dem Wagen hob und die Stufen hinauftrug. Sie wog fast nichts. Sie war groß, ansonsten aber nur Haut und Knochen. »Madame Louiselle!« Oben trat er mit dem Fuß gegen die Hütte.
Die Fliegentür ging knarrend auf, eine winzige schwarze Frau trat heraus. Sie musterte Raymond und seine Last. »Bring sie rein.« Sie trat zurück. »Hierhin.« Sie deutete auf ein Sofa, über das eine Steppdecke gebreitet war.
Raymond legte die reglose Frau ab.
»Wer ist sie?«, fragte Louiselle und zog den Stuhl neben das Sofa.
»Ich kenne sie nicht.« Raymond betrachtete eingehend Louiselles Gesicht. Madame Louiselle behandelte nur jene, die sie behandeln wollte. Sie fühlte sich nichts und niemandem verpflichtet. »Sie hat vielleicht jemanden getötet.« Fast wäre ihm noch eine Bemerkung über den vielgestaltigen Dämon herausgerutscht. »Sie glüht vor Fieber.«
Madame Louiselle berührte die Wange der Frau. »Rück die Lampe näher, cher.«
Er tat, wie ihm geheißen, und hörte, wie sie scharf einatmete.
»Ich kenne diese Frau, Raymond. Das ist Adele Hebert.« Sie legte Adele einen Finger an den Hals und tastete nach dem Puls. »Vor zwei Wochen ist sie zu mir gekommen. Ihre Zwillingsjungs hatten Fieber.« Langsam richtete sich Louiselle auf. »Ich konnte ihr nicht helfen.« Sie strich über Adeles Wangen und sah zu Raymond. »Wunderbare kleine Jungs, haben gerade das Laufen gelernt. Sind in ihren Armen gestorben, sie hat sie zwingen wollen, ihre Milch zu trinken.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin zu alt für solches Leid.«
»Zwei Wochen ist das her?« Raymond hatte nichts von einem Trauergottesdienst für zwei Kinder gehört.
»Adele«, antwortete sie, als könnte sie seine Gedanken lesen, »wollte die Leichname nicht hergeben. Sie sagte, es seien ihre Kinder, keiner hätte sie geliebt, keiner wollte sie haben, also würde sie sie selbst bestatten.« Sie seufzte und stand auf. »Ich mach ihr einen Tee gegen das Fieber. Wenn sie nicht trinkt, wird sie sich zu ihren Kindern gesellen.« Madame legte ein weiteres Mal die Finger an Adeles Hals und drückte leicht dagegen. »Und zu ihrer Schwester.«
»Ihrer Schwester?«
»Rosa Hebert.«
»Die Stigmatisierte war Adeles Schwester?« Unwillkürlich trat Raymond einen Schritt zurück. Rosa Hebert war einen tragischen, sinnlosen Tod gestorben. Man hatte die geistig Verwirrte gequält und so lange schikaniert, bis sie sich vergangenen Winter erhängte. Und hier lag jetzt also ihre Schwester – die er gefunden hatte, als sie über einem Toten kauerte, als wäre er ihre nächste Mahlzeit.
Madame streckte den Rücken durch. »Die Hebert-Familie hat zu viele Tragödien erlebt, cher. Adele hat alles verloren, was sie jemals geliebt hat.« Sie breitete eine Steppdecke über die schlafende Frau.
Raymond sagte nichts. Der Tod eines einzigen Kindes konnte eine Mutter in den Wahnsinn treiben. Adele hatte zwei Kinder und eine Schwester verloren. »Leidet sie nur unter dem Fieber, oder ist sie …«
Louiselle sah auf Adeles schweißüberströmtes Gesicht. Von der nassen Kleidung stieg Dampf auf. »Es ist mehr als das Fieber.« Sie seufzte. »Mehr werde ich nicht sagen. Nimm die Handschellen ab, und warte draußen.«
Raymond rührte sich nicht. »Sie ist meine Gefangene.«
»Das wird sie auch bleiben, nur dass sie dann tot ist, wenn du uns nicht allein lässt. Ich muss ihr die nassen Sachen ausziehen.«
»Sie ist stärker, als sie aussieht. Sehr stark vielleicht.« Als Madame darauf nicht reagierte, öffnete er die Handschellen und ging nach draußen. Die Tür ließ er als Vorsichtsmaßnahme einen Spalt breit offen.
Er zündete sich eine Camel an und blies den Rauch in die kühlen Luftwirbel, die um die Hütte strichen. Er spürte das Wetter. Die Metallsplitter in seiner Hüfte und seinem Rücken reagierten darauf, als stünden sie unter Strom, und erinnerten ihn daran, dass es für seine Zukunft keine Garantie gab. Jeder Schritt konnte sein letzter sein. Er inhalierte tief und dachte an Henri Bastions Leichnam, der am Straßenrand lag, wo jeder über ihn stolpern konnte. Er hatte weder den Sheriff noch sonst jemanden informiert. Noch nicht. Am Beaver Creek gab es keine Telefone und hier bei Madame Louiselle schon gar nicht. Sein Wagen war nicht mit einem Funkgerät ausgestattet, jedes elektronische Gerät wurde für den Krieg gebraucht. Noch nicht mal Alufolie gab es mehr. Er konnte nichts tun, außer zu rauchen und auf seine Gefangene zu warten.
Fünf Zigarettenkippen lagen aufgereiht auf der Holzbalustrade der Veranda, als Madame zu ihm heraustrat.
»Ich hab sie abgetrocknet, es geht ihr jetzt besser, cher. Das Fieber hat nachgelassen, aber ich hab keine Medikamente, damit es ganz weggeht. Sie ist dem Fieber ausgeliefert, vorerst. Sie wird es überleben – oder auch nicht. Es liegt alles in der Hand Gottes und an ihrem Willen.«
»Ich muss sie ins Gefängnis bringen.«
Sie nickte bedächtig. »Es wäre das Beste, wenn sie hierbleiben könnte, dann kann ich mich um sie kümmern.«
»Nein …«
Sie hob die Hand. »Ich verstehe, du musst sie mitnehmen. Mach Folgendes, Raymond. Halt sie trocken und warm. Gib ihr alle vier Stunden diese Kräuter. Öffne ihr wenn nötig mit Gewalt den Mund, und träufle sie ihr ein. Gib ihr Suppe. Zwing sie dazu, dass sie trinkt.«
Ihr Blick verriet, dass es noch etwas gab. »Was ist mit ihrem Verstand?«
»Ist im Fieber verglüht, möglicherweise.« Sie schüttelte den Kopf. »Es gibt einen Punkt, an dem selbst der stärkste Mensch überfordert ist. Adele hatte viel zu leiden.« Sie berührte ihn leicht am Arm.
»Hältst du sie für so stark, dass sie einen erwachsenen, gesunden Mann überwältigen kann? Er wurde regelrecht ausgeweidet. Als wäre eine Horde blutrünstiger Tiere über ihn hergefallen.«
Sie sah zu den Bäumen, die um ihr Haus im Wind rauschten. »Gutes und Böses wandelt auf Erden, Raymond. Das weißt du, du bist damit in Berührung gekommen. Keiner kann die Macht des einen wie des anderen abschätzen. Sie war voller Blut, manches davon ihr eigenes. Sie hat sich aufgeschürft, sie hat Schnittwunden, als wäre sie von einem Wagen gestreift worden. Das meiste Blut aber stammte nicht von ihr.«
Raymond warf die sechste Kippe auf den Boden. »Danke. Die County wird für deine Unkosten aufkommen.«
»Ist umsonst. Ich nehm kein Geld für die, die ich nicht heilen kann.«
Er ließ Madame auf der Veranda stehen und trat durch die Tür. Adele Hebert lag unter drei bunten Steppdecken. Ihr Gesicht, vom Blut gesäubert, war blass und hager, das lange Haar, mittlerweile getrocknet, lag wie eine dunkle Aura um ihren Kopf gebreitet. Sie sah aus, als wäre sie tot, als wäre sie eine der Figuren in einem Kirchenfenster. Ohne nachzudenken, bekreuzigte er sich, eine Gewohnheit aus seinem früheren Leben.
»Sie atmet kaum noch.« Madame berührte ihn am Arm. »Viel Unheil ist in dieser Frau, Raymond. Lass nicht zu, dass es auf dich übergreift.« Ihre Berührung verstärkte sich. »Du trägst selbst viel Unheil mit dir herum, cher. Ob du es verdient hast oder nicht.«
Raymond zuckte innerlich zusammen. Niemand sonst in der Stadt würde es wagen, so mit ihm zu reden. Er hob Adele Hebert hoch und wickelte sie in die Steppdecken. »Ich werde die Decken zurückbringen.«
Madame nickte. Sie stand in der Tür und sah zu, wie er mit der Frau auf den Armen die steile Treppe hinunterging und sie auf den Beifahrersitz setzte. Er sah keine Notwendigkeit, ihr die Handschellen anzulegen. Sie war in einen tiefen Schlummer, fast schon in Bewusstlosigkeit gefallen. Als er aufsah, bemerkte er, dass Madame bereits damit begonnen hatte, mehrere Kerzen aufzustellen. Sie reinigte ihr Heim von allem Bösen. Trotz seines fehlenden Glaubens lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken.
Das Arbeitszimmer war vollgestopft mit Büchern, die meisten davon ledergebunden. In den vergangenen zehn Jahren waren sie Vater Michael Finleys nächste Freunde gewesen, sein Trost in der Wildnis. Sie verströmten einen modrigen Geruch; er würde Colista auftragen müssen, sie wieder zu reinigen, wenn trockenes Wetter herrschte. Wenn man nichts dagegen unternahm, würde die Feuchtigkeit sie ruinieren, dabei waren manche recht alt und wertvoll.
Barfuß, in Unterwäsche eilte er über den bunten Läufer zum klingelnden Telefon. Die Morgendämmerung hatte noch nicht eingesetzt, das fordernde Läuten des Apparats konnte also nur eines bedeuten: Der Tod hatte sich angemeldet. Nur wenige in der Gemeinde Iberia konnten sich ein Telefon leisten. Er hatte diesen Luxus mit dem Hinweis darauf gerechtfertigt, dass seine Dienste oftmals unverzüglich benötigt wurden. Aber es gab Zeiten, da bedauerte er die Entscheidung seiner Vorgesetzten, seiner Bitte nachzukommen.
»Hallo«, sagte er.
»Hier ist Raymond Thibodeaux. Es ist etwas Schlimmes vorgefallen. Ich möchte Sie bitten, so bald wie möglich zur Bastion-Plantage zu fahren.«
Der Priester zögerte. Raymond hatte sich nicht mit seinem Titel vorgestellt, dennoch haftete seiner Stimme unüberhörbar die Autorität seines Amtes an. Er hatte, als er den Hörer abnahm, mit allem gerechnet, aber nicht mit Raymond. Eine dunkle Wolke hing über dem Deputy. Der Geruch des Todes haftete an ihm, seine dunklen Augen zeugten von Leid. Sogar jetzt noch, Monate nach Raymonds Rückkehr, erzählte man sich in der Gemeinde Geschichten über ihn – er soll eine der effizientesten Tötungsmaschinen der Army gewesen sein, ein Einzelgänger, der wie ein Racheengel über die Schlachtfelder gegeistert war. Oder wie jemand, der sterben wollte.
»Vater, haben Sie gehört, was ich gesagt habe?« Raymond verbarg seine Ungeduld nicht.
Der Priester sammelte sich. »Was ist geschehen?«
»Henri ist vergangene Nacht draußen am Beaver Creek umgebracht worden.«
Schlimme Ahnungen beschlichen den Priester. Böses war geschehen, wahrhaft Böses. Raymond Thibodeaux war wieder einmal der Vorbote kommenden Unheils. Es schien, als hätte Gott ihn verflucht. »Wissen Sie, wer ihn umgebracht hat?«, fragte er leise.
Raymond zögerte, bevor er darauf antwortete, als wollte er seine Worte abwägen. »Henri muss von einem wilden Tier angefallen worden sein. Ich kann Ihnen auch gleich die Wahrheit erzählen, am Morgen werden sowieso Gerüchte in der Stadt die Runde machen. Adele Hebert ist bei der Leiche aufgefunden worden. Man erzählt sich, sie sei von einem loup-garou besessen.«
Der Priester schluckte. Lebhaft stand ihm das Bild vor Augen und schien seine dunklen Ahnungen zu bestätigen: Die Sümpfe waren mit ruchlosen Wesen bevölkert. »Einem Werwolf?« Er zitterte, seine nackten Füße waren kalt. »Das glauben Sie doch nicht, oder?«
»Es spielt keine Rolle, was ich glaube. Ich mach mir Sorgen, was die Stadt glaubt. Es war ein grauenhafter Mord. Ich möchte Sie bitten, zur Bastion-Plantage zu fahren und die Familie darauf vorzubereiten. Sorgen Sie dafür, dass Mrs. Bastion dieser Werwolf-Geschichte keinen Glauben schenkt.«
Raymonds Tonfall ließ den Priester hochfahren. »Marguerite Bastion ist eine gebildete Frau und keine Närrin!«
»Vater, Ihnen und mir ist bewusst, dass es leichter ist, an das Böse zu glauben als an das Gute. Viele haben Rosa Hebert für eine Stigmatisierte gehalten. Unter anderem auch Sie, glaube ich.« Er klang ganz ruhig, weckte damit aber die persönlichen Dämonen des Priesters. Nicht sein Glaube an Rosa quälte ihn, sondern das Fehlen desselben.
»Rosa war ein Kind Gottes, auserwählt, die Male von Christi Leiden zu tragen, ein lebendiges Zeichen von Gottes Liebe und Opferbereitschaft. Sie war die Botschafterin Gottes. Der loup-garou jedoch ist nichts weiter als eine abergläubische Vorstellung zur Einschüchterung unbotmäßiger Kinder, bei denen die Eltern vor der Rute zurückschrecken. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun.«
»Aus Händen und Füßen zu bluten ist für mich irgendwie kein Zeichen von Gottes Liebe.«
Raymond wollte ihn provozieren, aber der Priester wusste seinen Ärger zu zügeln. »Raymond, ich weiß, wie sehr Sie zu leiden haben. Sie sind vom rechten Weg abgekommen.« Raymond hatte seit seiner Rückkehr aus dem Krieg keinen Fuß mehr in die Kirche gesetzt. Er lästerte und verstieß gegen Gott.
»Schön gesprochen, Vater. Trotzdem würde ich mich auch aufhängen, wenn ich jeden Freitag aus Händen und Füßen bluten würde.«
»Das ist Blasphemie.«
»Sie haben die Wunden gesehen, nicht wahr?«, sagte Raymond mit gleichgültiger Stimme. »Sie waren echt? Sie hat sie sich nicht selbst zugefügt?«
Er zögerte und wusste nicht genau, worauf Raymond hinauswollte. »Rosa war mit einer Gabe und einer Bürde gesegnet. Unter dieser Last ist sie zusammengebrochen. Sie ließ unseren Herrn im Stich und nahm sich das Leben. Es gab nichts, was ich dagegen hätte tun können.«
Einen langen Augenblick herrschte Schweigen zwischen ihnen. »Das ist nicht die Antwort auf meine Frage, sondern auf eine andere. Auf Wiedersehen, Vater, und viel Glück bei Mrs. Bastion.«
Der Priester hörte das Klicken in der Leitung. Er legte auf und trat ans Fenster. Gänsehaut zog sich über seine Beine. Bald würde das erste Licht zu sehen sein; zwecklos, wieder ins Bett zu gehen. Raymond hatte in ihm Bilder und Erinnerungen wachgerufen, die so verrucht und schneidend waren wie die Forke des Teufels.
Seine Neugier weckte den Wunsch, sofort zum Gemeindegefängnis zu fahren, seine Pflicht hingegen lenkte ihn zum Haus der Bastions. Aber nicht in der Dunkelheit. Nicht in dieser Nacht, in der ein sonderbarer feuchter Wind durch den Kamin heulte und die Vergangenheit wie eine schlafende Tote geweckt worden war. Adeles Wut über die Exkommunikation ihrer Schwester war ihm lebhaft in Erinnerung. Sie hatte ihn und die Kirche verflucht. Sie hatte ihm die Rache Gottes an den Hals gewünscht, weil er den Anweisungen seines Bischofs gefolgt war und den geheiligten Boden des Friedhofs für Rosas Leichnam nicht geöffnet hatte. Selbstmörder konnten auf geweihtem Grund nicht bestattet werden.
Adele hatte Rosa und daraufhin ihre toten Zwillinge an einer geheimen Stelle in den Sümpfen begraben. Er war nie zu ihr gegangen, um ihr seinen Rat zuteil werden zu lassen, zunächst, weil er sie nicht noch mehr erschüttern wollte, dann, weil er seine Starre nicht überwinden konnte, die ihn jedes Mal befiel, wenn er ihren Namen hörte. Selbst wenn er sie aufgesucht hätte, sie hätte nie auf ihn gehört. Ihr Schmerz und ihr Zorn hatten sie augenscheinlich in den Wahnsinn getrieben.
Ein Holzklotz knackte, als ein Windstoß durch den Kamin fegte. Funken, die ihn vage an die Gestalt einer Frau erinnerten, sprühten durch das ganze Zimmer. Eilig trat der Priester die glühende Asche aus, die auf den Läufer gefallen war. Der Kamin stellte eine Gefahr dar, die Nacht eine noch größere.
Er würde auf die Morgendämmerung warten, bis er Marguerite Bastion und ihrer Trauer gegenübertreten wollte. Bis dahin würde er darum beten, dass er seine eigenen Unzulänglichkeiten überwand, von denen es so viele gab.
3
Chula Baker schaltete in den Leerlauf und zog die Handbremse an, bevor sie ausstieg. Den Motor ließ sie laufen. Es war ein alter Wagen, der manchmal nicht mehr anspringen wollte. Das erste Licht des kühlen Oktobermorgens kroch über den östlichen Himmel, als sie die Ansammlung von Autos und Männern entdeckte, die auf der anderen Seite des Beaver Creek auf der Straße standen. Der Brief auf dem Beifahrersitz ihres eigenen Wagens bedeutete für die Lanoux-Familie nichts Gutes. Was dort die Straße blockierte, ebenfalls nicht. Der Tod kam nie allein.
Sie ging auf die Männer zu, die sie noch nicht bemerkt hatten. Ihr schweres Kleid, mit einem Gürtel um die schmale Taille gebunden, schwang um ihre nackten Beine. Seit Kriegsbeginn waren keine Strümpfe mehr zu haben, und die amtlichen Vorschriften verboten es Frauen, bei der Arbeit mit Hosen zu erscheinen. Daher trug sie in der Oktoberkühle ein langes Kleid und feste Schuhe mit dicken Socken. Arbeitstage mit achtzehn Stunden hatten ihr schnell die Sehnsucht nach hochhackigen Schuhen ausgetrieben.
»Miss Chula.« Sheriff Joe Como verstellte ihr den Weg. »Was machen Sie denn hier, cher?«
Sie musterte sein Gesicht. Obwohl es um die fünf Grad sein musste, stand ihm der Schweiß auf der Stirn. Er wich ihrem Blick aus. »Hab letzte Nacht einen Brief für die Familie Lanoux bekommen. Von der Army. Ich wollte im Unwetter nicht rausfahren, daher dachte ich mir, ich bring ihn gleich heute Morgen.«
»Es geht um Justin?«
»Ich kann fremde Post nicht lesen.« Sie dachte an den behördlichen Umschlag sowie die Hunderte anderen, die sie ausgetragen hatte. »Solche Briefe haben noch nie etwas Gutes gebracht.«
Der Sheriff spuckte einen braunen Speichelfaden auf die noch immer schlammige Straße. »Ganz Iberia verdorrt und vergeht. Die vielen jungen Männer, die drüben in Europa sterben. Und so Alte wie ich müssen für Gesetz und Ordnung sorgen.«
»Joe, Sie haben noch gut dreißig Jahre vor sich.« Sie reckte den Hals, um an ihm vorbeizusehen. »Was ist hier los?«
Er verstellte ihr die Sicht. »Ein Mord. Etwas, was Sie lieber nicht sehen wollen.«
»Mord?« So etwas passierte in New Iberia nicht. Zumindest nicht auf einer öffentlichen Straße. Wenn einer jemanden umbringen wollte, dann tat er es in den Sümpfen, wo man die Leiche den Alligatoren als Köder vorwerfen konnte. »Wer ist es?«
»Henri Bastion.«
Der Name entsetzte sie noch mehr. Henri war der wohlhabendste Bürger der Gemeinde. Sein Geld hatte ihm den fruchtbarsten Boden eingetragen, eine französische Frau aus vornehmer Abstammung und flegelhafte Kinder. Und er hatte sich damit die Angst erkauft, die alle vor ihm hatten. »Wie ist er gestorben?«
»Das versuchen wir herauszufinden.«
Sie schnaubte. »Kann doch nicht so schwer sein. Erschossen, erstochen, was?«
Nun sah der Sheriff ihr doch noch in die Augen. »Sieht so aus, als wäre er bei lebendigem Leib von einem wilden Tier gefressen worden.«
»Großer Gott, Joe. Sie sagten, er ist ermordet, nicht von einem Tier angefallen worden.« Ihr war nicht mehr danach, die Leiche zu sehen. Sie hatte Post auszutragen.
»Wir haben jemanden, der ein Geständnis abgelegt hat. Sie hält sich für einen loup-garou.«
Joe war niemand, der sich über die legendenhaften Wesen in den Sümpfen lustig machte. Sie begleiteten ihn seit seiner Kindheit, genau wie Chula. Die Gemeinde verband ein dichtes Gespinst aus abergläubischen Vorstellungen, die mit den Akadiern ins Land gekommen waren und sich mit den volkstümlichen Geschichten der Indianerstämme und der Schwarzen vermischt hatten. Ein Gerücht wie dieses konnte eine Panik auslösen.
»Ich würde nicht vom loup-garou reden, wenn ich Sheriff wäre.« Sie zog eine Augenbraue hoch. »Es reicht schon, dass der Krieg die Jungen und Männer raubt, die Frauen brauchen keinen weiteren Grund, um Angst zu haben.«
Joe nickte. »Kann nichts machen, wenn Adele Hebert es so behauptet. Sie sagt, sie hätte ihn umgebracht. Sieht aus, als hätte sie ihm im Wald aufgelauert, als er spazieren war, dann sprang sie ihn an und wollte seine Leber verspeisen.«
Chula legte dem Sheriff die Hand auf die Brust. »So etwas will ich nicht hören. Ich kenne Adele. Und ihren Bruder Clifton, den Trapper. Sie ist genauso wenig ein loup-garou wie ich, und wenn Sie das dem Falschen erzählen, weiß es nach einem halben Tag die ganze Gemeinde, und dann werden Sie wirkliche Probleme bekommen.«
Er zuckte zurück. Sie hatte ihn gekränkt. Aber bisweilen benahm sich Joe Como, als hätte ihm Gott einen mehr als unzureichenden Verstand mitgegeben. Chula Baker wusste, dass sie als hochnäsig und übermäßig gebildet galt. Sie hatte einige Zeit in Lafayette und Shreveport verbracht, Städten, die die Werte der ländlichen Gemeinden nicht achteten. Sie hatte auf dem College die Lehrerausbildung absolviert, dabei ihre Liebe für die Gelehrsamkeit entdeckt und die notwendigen Fähigkeiten erworben, um den Eignungstest für den Postdienst zu bestehen – etwas, woran mehrere Männer gescheitert waren. Von ihrer Mutter, die mit ihren zweiundsechzig Jahren noch immer für ihre spitze Zunge gefürchtet wurde, mit der sie einen Mann mitten entzweischneiden und dann im Dreck verbluten lassen konnte, hatte sie gelernt, mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg zu halten.
»Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, Miss Chula.« Joe wollte sich schon umdrehen.
»Ich will Ihnen nicht in Ihren Job dreinreden, Joe. Ich will nur nicht, dass aus irgendwelchen wilden Gerüchten ein Lynchmob entsteht.« Ihr sanfterer Tonfall fand mehr Gehör. »Die Menschen hier sind am Ende. Die meisten Familien haben einen Sohn oder Bruder oder Vater verloren. Wir haben uns hier ein Leben aufgebaut, in einer Gegend, in der andere längst umgekommen wären. Diese Sümpfe haben uns Schlimmes angetan, aber wir sind nicht gegangen. Eine Lügengeschichte über einen Werwolf könnte der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt.«
Der Sheriff nahm den Hut ab und wischte sich mit dem Ärmel seines olivgrünen Hemds über die Stirn. Sein Unwille hatte merklich nachgelassen, als er sie mit seinen braunen Augen wieder ansah. »Da haben Sie recht, cher.«
»Was sagt Doc Fletcher?« Die Sonne war mittlerweile, während Chula an Joes gesunden Menschenverstand zu appellieren versuchte, über die Baumwipfel gestiegen. Es war noch kalt, am Nachmittag aber würde es sonnig und warm werden. Kräftiger Sonnenschein war das beste Mittel, damit sich dumme Gespenstergeschichten in Luft auflösten.
»Doc war letzte Nacht auf einer Konferenz in Baton Rouge. Er wird sich die Leiche anschauen, sobald er wieder hier ist.«
Sie tätschelte Joe den Arm. »Erzählen Sie den Leuten, Sie wollen erst Docs fachkundige Meinung abwarten. Sagen Sie ihnen, es ist alles noch recht rätselhaft, aber hüten Sie sich davor, irgendwas Übernatürliches zu erwähnen.«
Sie spürte, wie er sich unter ihrer Berührung versteifte. Wieder hatte sie diese unsichtbare Linie überschritten. »Na, dann kümmere ich mich mal lieber um meinen eigenen Kram und lass Sie in Ruhe.« Sie lächelte unschuldig und nahm erleichtert zur Kenntnis, dass er das Lächeln erwiderte. »Kommen Sie mal wieder auf einen Whiskey vorbei. Clifton hat Mama letzte Woche eine neue Flasche besorgt. Es würde sie freuen, wenn Sie ihr auf ein Gläschen Gesellschaft leisten könnten.« Sie zwinkerte ihm zu. »Ganz klammheimlich, natürlich.«
»Sie haben die spitze Zunge Ihrer Mutter, cher, und Sie verstehen es, einem wie Ihr irischer Daddy zu schmeicheln.« Er runzelte die Stirn. »Was auch gut so ist, sonst würde ich glatt vorhersagen, dass Sie noch als alte Jungfer enden.«
Sie lachte laut auf, ein schallender Ton, der von der Wand aus Bäumen am Rand der unbefestigten Straße zurückgeworfen wurde. »Es gibt Schlimmeres, Joe. Ob Sie es glauben wollen oder nicht, aber es gibt Schlimmeres.«
Ihr Blick schweifte zu den Männern, die von der Straße etwas aufhoben. Als sie Raymond Thibodeaux’ muskulösen Rücken erkannte, gab es ihr einen Stich. Sie musste an die Schönheit seines Körpers denken, bevor er in den Krieg gezogen war. Als junger, fröhlicher Mann war er nach Europa gegangen, als ein Schatten seiner selbst war er zurückgekehrt. Sein dunkles Haar war von grauen Strähnen durchzogen, an manchen Tagen hinkte er und sah jeden herausfordernd an, der es wagte, ihn darauf anzusprechen. Sein Körper war voller Schrapnellsplitter. Gerüchten zufolge würde er eines Tages vollständig gelähmt sein.
Sie stellte sich in den Schatten und wartete, bis sie Henris Leichnam auf die Ladefläche des Pick-up verfrachtet hatten. Als Raymond allein war, ging sie zu ihm hinüber. »Mutter und ich würden uns freuen, wenn du zum Abendessen kommen würdest, Raymond.« Eine Einladung, oft ausgesprochen und immer abgelehnt. Andere in der Stadt mochten es hinnehmen, dass er sich absonderte, Chula hingegen konnte das nicht. Die Erinnerung an seine Küsse, seine Hände, die sie so wunderbar berührt hatten, konnte sein abweisendes Verhalten nicht auslöschen. Was sie miteinander geteilt hatten, gehörte der Vergangenheit an, nicht aber ihre Zuneigung für ihn.
»Ich hab zu tun, Chula, trotzdem vielen Dank.«
»Raymond, wir kennen uns schon lange. Ich weiß, du trauerst um Antoine, aber du kannst so nicht weitermachen. Dein Bruder würde es nicht wollen.«
In seinen dunklen Augen funkelte etwas auf. Er war also nicht ganz tot. Noch nicht. »Du hast nicht die geringste Ahnung, wovon du sprichst, Chula. Kümmere dich um deinen eigenen Kram.«
Er bückte sich, um Henris schlammverkrusteten Hut aufzuheben.
»Früher hast du es zu schätzen gewusst, wenn ich offen sage, was mir auf dem Herzen liegt.« Sie sprach sehr leise und erinnerte sich an jenen Nachmittag im Sommer, als er ihr in ihrem schattigen Garten erzählt hatte, dass er zur Army gehen würde und nach seiner Rückkehr Journalist werden wollte. »Der Krieg hat sich deinen Bruder geholt, aber du selbst bist es, der es zulässt, dass er dir auch deine Träume nimmt.«
Er starrte sie durchdringend an. Ja, es stimmte, seine einst goldbraunen Augen hatten sich fast gänzlich schwarz verfärbt. »Die Vergangenheit ist tot, Chula. Und mit ihr der Mann, den du gekannt hast. Lass das, was von ihm noch übrig ist, in Ruhe.«
Er trug den Hut zum Streifenwagen. Chula spürte den Blick des Sheriffs, der auf ihnen beiden lastete. Es wäre das Beste, wenn sie jetzt ginge, aber sie konnte nicht. Sie hatte Mrs. Thibodeaux zwei Briefe zugestellt, den ersten vergangenen November, der von Antoines Tod in einer kleinen Ortschaft berichtete, einem Dorf, das für keine der beiden Armeen von Bedeutung gewesen war. Antoine war der jüngste Sohn gewesen, der Charmeur in einer Familie, die einige attraktive Männer hervorgebracht hatte.
Ein halbes Jahr später hatte sie an einem schönen Maimorgen, an dem in den Hecken die Drosseln sangen, den zweiten Brief gebracht. Mit unbewegter Miene hatte Mrs. Thibodeaux die Tür geöffnet. Sie hatte den Umschlag aufgerissen, das Schreiben gelesen, hatte mit einem Ausdruck wütenden Schmerzes Chula angesehen und dann die Tür zugeschlagen und verriegelt.
Zwei Monate später war Raymond nach Hause zurückgekehrt. Ohne Krücken hatte er sich nicht fortbewegen können, nach einigen Wochen benutzte er einen Stock. Als er den nicht mehr brauchte, heftete er sich das Deputy-Abzeichen an die Brust.
»Raymond, es gibt Menschen, denen du nicht gleichgültig bist, wenn du es nur zulassen würdest. Ich erinnere mich …«
»Nein. Lass das Erinnern, Chula. Die Vergangenheit ist wie ein Traum. Sie existiert nur in der Erinnerung, und manchmal ist es besser, wenn man von ihr lässt.« Damit marschierte er davon.
Chula stapfte durch den zähen gelben Schlamm zu ihrem Wagen, setzte sich ans Steuer und sah zu, wie Raymond mit dem Sheriff redete.
Henri Bastion war tot, und nach allem, was sie gehört hatte, war er gewaltsam gestorben. Wie dumm. Wenn jemand schon einen gewaltsamen Tod sterben wollte, könnte er es leichter haben, wenn er zur Army ging. Es gab noch immer genügend deutsche und japanische Kugeln. Warum also hier?
Raymond stieg vor dem Gefängnis aus dem Streifenwagen und sah dem Sheriff hinterher, der dem Wagen mit Henris Leichnam zum Bestattungsinstitut folgte. Doc Fletcher würde direkt dorthin kommen, um sich den Toten anzusehen. Für Raymond die Gelegenheit, in der Zwischenzeit mit Adele Hebert allein zu sein. Er hatte ein wenig nachgeforscht. Adele, eine hart arbeitende Frau, hatte sich in die Sümpfe zurückgezogen, um dort ihre Zwillinge großzuziehen. Wer der Vater der Jungen war, wagte keiner auch nur zu mutmaßen. Hochschwanger war sie eines Tages in der Stadt aufgetaucht und hatte sich geweigert, den Namen des Vaters preiszugeben. Der Doc hatte sie mit Vitaminen und dem Ratschlag versehen, sich Ruhe zu gönnen. Nur einmal hatte sie ihn aufgesucht und dann, soweit man wusste, die Kinder allein zur Welt gebracht.
Ihre Eltern waren bereits tot; ihr Vater war in den Gewässern des Golfs ums Leben gekommen, ihre Mutter acht Jahre zuvor an einer Infektion gestorben. Es waren nicht viele Informationen, und nichts davon erklärte, warum sich Adele für einen loup-garou hielt oder warum bei ihrer Schwester die Wundmale aufbrachen. Raymond betrat das Sheriffbüro und hoffte, Adele habe sich so weit erholt, dass sie ihm seine Fragen beantworten konnte.
Pinkney Stole erhob sich vor dem Kanonenofen. Der alte Schwarze sah zu Raymond und wartete auf Anweisungen.
»Sie murmelt nur vor sich hin«, sagte er. »Redet vom Mond und so. Ergibt alles kein bisschen Sinn.«
Raymond zog einen Vierteldollar aus der Hosentasche. »Würdest du uns Kaffee holen, Pinkney? Aber lass dir ruhig Zeit. Sag Mrs. Estella, sie soll dir einen Kuchen geben.« Er warf dem Alten die Münze zu, der sie mit einem zahnlosen Grinsen auffing. Pinkney hing im Gefängnis herum, weil er sonst keinen anderen Schlafplatz hatte. Seine Anwesenheit war wie die eines alten Hundes, manchmal beruhigend, manchmal störend. Jetzt wollte Raymond mit der Gefangenen allein sein.
Adele lag auf einer dünnen Drillich-Matratze, ein Arm war mit einer Handschelle ans Bett gefesselt. Es war nicht ersichtlich, ob sie sich bewegt hatte, seitdem er sie vergangene Nacht abgelegt hatte. Das sachte Heben und Senken ihres Brustkorbs verriet ihm, dass sie atmete.
»Miss Hebert?«, sagte er leise und wunderte sich über seinen Wunsch, mit ihr so sanft wie möglich umzugehen. Nach wie vor gab es Augenblicke, in denen er von der Vergangenheit überrascht wurde und er sich unweigerlich die Frage stellte, welcher Mensch er hätte sein können. Augenblicke, die ihn immer teuer zu stehen kamen.
Als sie nicht reagierte, kehrte er mit einem Glas der von Madame Louiselle zubereiteten Medizin in die Zelle zurück. Er packte sie am Kiefer und öffnete ihr gewaltsam den Mund. Die Flüssigkeit schwappte zwischen ihren Lippen, aber sie schluckte nicht.
Aus Angst, sie könnte ersticken, wenn sie flach auf dem Rücken lag, hob er ihren Kopf an, bis sie anfing zu schlucken. Ihre Haut fühlte sich kühler an, aber sie hatte immer noch Fieber. Er tränkte ein Tuch und legte es ihr auf die Stirn, so wie es seine Mutter immer getan hatte, als er noch ein Kind gewesen war. Sie stöhnte.
Joe mochte sich einbilden, die Frau könnte von einem bösen Geist besessen sein, Raymond aber fürchtete viel Schlimmeres: Kinderlähmung. Die Krankheit geht mit hohem Fieber einher, Lähmung der Gliedmaßen bis zu Atembeschwerden können die Folgen sein. Das Gefängnis war kaum der richtige Aufenthaltsort für eine Kranke, aber kein Krankenhaus würde jemanden mit Polio aufnehmen, schon gar nicht eine mögliche Mörderin.
Er wischte ihr den Mund ab und stand auf. Er war froh, dass der Sheriff und Pinkney von seiner Fürsorge für die Frau nichts mitbekamen. In der Welt, die er sich gewählt hatte, war für Freundlichkeiten kein Platz. Dafür hatte er gesorgt.
Im Tageslicht betrachtete er Adeles Gesichtszüge, ihre tiefliegenden Augen und die leicht geschwungenen dichten, dunklen Brauen. Ihre Haut war blass, graue Stellen, die aussahen wie abheilende blaue Flecken, bedeckten die Wangen. Die Nase war ebenmäßig und scharf geschnitten. Von spanischer oder französischer Abstammung, würde er sagen. Sie hatte, wie er sich erinnerte, graue Augen mit dunklen Wimpern. Mit zehn Kilo mehr auf den Rippen wäre sie eine attraktive Frau. Als solche musste jemand sie kennengelernt und mit ihr ihre Zwillingsjungs gezeugt haben. Und dessentwegen lebte sie jetzt allein, was nicht immer der Fall gewesen war.
Ihre Lider zuckten; er musste an junge Vögel denken, die zum ersten Mal mit ihren Flügeln schlugen. Vor seinem Schlafzimmerfenster hatte ein Blauhäher ein Nest gebaut, und jedes Frühjahr hatten er und Antoine den jungen Vögeln beim Schlüpfen und Heranwachsen zugesehen. Sie hatten darauf geachtet, den Erwachsenenvogel nicht zu verschrecken, damit er die Jungen nicht verließ. Noch jetzt konnte er fast den Atem seines Bruders auf seinem Unterarm spüren, wenn sie zusammen am Fenster gestanden hatten.
Adele stöhnte abermals, und Raymond beugte sich zu ihr. »Adele?«
Sie sah ihn an und hob eine Hand, um die Augen vor dem einfallenden Sonnenlicht zu schützen. Sie versuchte sich aufzusetzen, war aber zu schwach dazu.
»Woran erinnern Sie sich?«, fragte er, während er ihr die Hand anbot, damit sie sich hochziehen konnte. Sie schwang die nackten Füße zu Boden und schien nicht zu bemerken, dass sie ein fremdes Nachthemd trug.
»An nichts.« Ihr Blick schweifte durch die Zelle. Als sie das linke Handgelenk hob und die Handschelle klirrte, schrie sie entsetzt auf.
»Sie waren vergangene Nacht auf der Section Line Road am Beaver Creek.« Sie runzelte die Stirn und versuchte seine Worte einzuordnen. »Erinnern Sie sich, einen Mann auf der Straße gesehen zu haben?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich erinnere mich an das Unwetter.« Panik huschte über ihre Miene. »Ich wollte bei meinen Kindern nachsehen …«
»Ihren Kindern?«, unterbrach er sie.
»Wollte mich vergewissern, dass sie vom Hochwasser nicht aus dem Grab geschwemmt werden.« Kurz verlor sich ihr Blick im Leeren, doch als sie ihn wieder ansah, lag etwas Herausforderndes in ihren Augen. »Dann ist der Mond hinter einer Wolke verschwunden, und ich hab mich verirrt. Ich bin hingefallen, mir ist übel geworden, und ich hab nicht mehr gewusst, wo ich hinsollte.« Sie besah sich die Schnitte und Abschürfungen an ihren Händen. »Als der Mond wieder auftauchte, war er ganz rot. Überall war rotes Licht, so hell, dass man alles sehen konnte.«
Ihre Worte berührten Raymond wie die kalten Finger eines Toten. »Letzte Nacht war Vollmond, aber er hatte keinen roten Hof. Sie haben vielleicht geträumt.«
Verwirrung breitete sich auf ihrer Miene aus. Sie war jünger, als er ursprünglich angenommen hatte. Dreiundzwanzig, höchstens. »Ich hab bei meinen Kindern gekniet, und das Licht um uns herum war rot, Gewitterwolken sind vorbeigetrieben. Ich hab zum Mond gesehen, der war so groß, so blutrot. Der Jagdmond, hat mir mein Bruder beigebracht.« Etwas Gehetztes trat in ihren Blick, ihre Gesichtszüge änderten sich. Sie verengte die Augen, hob das Kinn an, und ihre Lippen wurden zu einer dünnen Linie. Als sie weitersprach, klang ihre Stimme tief und rau. Sie zitterte am ganzen Körper. »Weggelaufen.«
»Wovor weggelaufen?« Er bemühte sich, so ungezwungen wie möglich zu klingen. Ihre Worte ließen ihn frösteln, obwohl er nicht an den loup-garou glaubte.
»Vor …« Ein Blutschwall erbrach sich aus ihrer Nase, spritzte in ihren Schoß, ergoss sich über ihre Hände, als wäre ihr Kopf explodiert. Sie verdrehte die Augen, während fortwährend das Blut herausströmte, dann fiel sie nach hinten aufs Bett.
4
Mit Adele auf den Armen stürzte Raymond an Pinkney vorbei, der gerade zur Tür hereinwollte, in jeder Hand eine Kaffeetasse, die klappernd gegen die Untertassen schlugen.
»Sag dem Sheriff, ich hab sie zu Madame Louiselle gebracht. Der Doc sagt, er kann ihr nicht helfen. Sie liegt im Sterben.«
»Großer Gott, so viel Blut.« Pinkney trat von einem Fuß auf den anderen. »Großer Gott, Allmächtiger, sie kann ja gar kein Blut mehr haben. Mein Gott, Mr. Raymond. Sie muss doch tot sein.«
Raymond rannte zu seinem Wagen und setzte sie auf den Beifahrersitz. »Vergiss nicht, es dem Sheriff auszurichten.« Er glitt hinters Steuer; Schlamm spritzte auf, als er davonfuhr. Adele hatte alles verloren – er verstand, was das bedeutete –, aber sie würde nicht ihr Leben verlieren. Nicht, solange er etwas dagegen tun konnte.
Noch war sie am Leben. Ihre Augenlider flatterten, ihre Hände zuckten kaum merklich, versuchten etwas zu ergreifen und fielen ihr wieder in den Schoß. Er hatte oft mit ansehen müssen, wie hilflose Menschen gestorben waren, diesmal aber würde der Tod nicht die Oberhand gewinnen.
»Adele?« Er wollte sie in diese Welt zurückrufen. Er dachte an die junge Krankenschwester in Europa, die ihn gepflegt hatte, nachdem neben ihm die Granate eingeschlagen war. Wie oft hatte sie an seinem Bett gesessen und ihn aufgefordert, in das Land der Lebenden zurückzukehren. Jetzt tat er dasselbe für Adele. »Bleiben Sie bei mir, Adele. Ich weiß, Sie haben Bastion nicht umgebracht.«
Als sie gegen die Beifahrertür sackte, verstummte er. Sie atmete, und im Augenblick wirkte sie friedlich.
Als er in Madame Louiselles Hof einfuhr, war die Alte beim Kräutersammeln an einem klapprigen Holzzaun, der kaum das Unkraut von ihrem Garten abhalten konnte. Sie zeigte sich nicht überrascht, auch nicht, als er die blutüberströmte Adele aus dem Wagen hob. Langsam kam sie auf sie zu, dann zog sie Adele ein Augenlid nach oben.
»Bring sie rein. Du wirst sie hier lassen müssen.«
Er widersprach nicht. Der Sheriff würde verärgert sein, aber was nützte ihnen eine tote Gefangene? Vorsichtig, darauf achtend, dass er mit ihren langen Gliedmaßen nirgends anstieß, trug er Adele die Stufen hinauf. Knochen sollten eigentlich mehr wiegen. Er hatte die bestürzende Vorstellung, dass sie irgendwie ausgehöhlt wäre.
Er legte sie auf dem Sofa ab und trat zurück. Madame Louiselle packte ihn an der Hüfte und schob ihn weg. Sie kniete sich neben Adele und berührte ihr Gesicht, zog ihr die Augenlider nach oben, öffnete ihr den Mund und besah sich die Zähne und das Zahnfleisch.
»Kannst du ihr helfen?«, fragte Raymond.
»Das Fieber verbrennt sie bei lebendigem Leib.« Sie erhob sich mit der Anmut einer Sechzehnjährigen.
»Was stimmt mit ihr nicht? Die eine Minute ist sie nahezu klar bei Verstand, die nächste redet sie nur wirres Zeug.«
Madame Louiselle ging zur Tür, drehte sich um und wartete, dass er nachkam. »Sie wird nicht aufstehen und davonrennen, Raymond. Komm raus und rede mit mir.«
Er folgte ihr nach draußen, kramte seine Camel-Packung hervor und bot Madame eine Zigarette an. Sie nahm sie, klopfte damit geziert gegen das Holzgeländer der Veranda, bevor sie sie sich zwischen die Lippen steckte. Er gab ihr Feuer und zündete sich selbst eine an.
»Glaubst du an Krankheiten der Seele?«, fragte sie.
»Du meinst Geisteskrankheiten?« Eine Reihe von Bildern zog an ihm vorbei, aufblitzende Bajonette, Schreie in der Nacht, die verkrümmten Gliedmaßen verzweifelter Soldaten, die sich in die feuchte Erde ihres Schützenlochs krallten und vor dem feindlichen Feuer Deckung suchten, das sie in den Wahnsinn trieb.
Sie musterte ihn. »Ich rede nicht davon, dass jemand den Verstand verliert. Sondern von was anderem.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht an das Böse, an so was wie den Teufel oder an Dämonen oder den loup-garou. Ich glaube an Habgier und Grausamkeit und Bosheit. Und an Schwäche. Das Schlimmste überhaupt.«