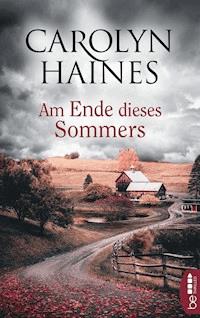4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Sarah Booth Delaney
- Sprache: Deutsch
Sarah Booth Delaney arbeitet erfolgreich als Privatermittlerin - aber mit der Liebe will es nicht so recht klappen. Ihr Hausgeist Jitty möchte das ändern und versucht, sie endlich unter die Haube zu bringen. Doch Sarah hat gerade Wichtigeres zu tun - sie muss sich um einen neuen Fall kümmern: Doreen Mallory soll ihr eigenes Kind getötet haben, und es liegt an Sarah, ihre Unschuld zu beweisen. Keine leichte Aufgabe, zumal ihre Klientin sich standhaft weigert, den Namen des Kindsvaters zu nennen. Es gibt gleich mehrere suspekte Kandidaten, von denen jeder auch der Mörder sein könnte. Schon bald entwickelt sich der Auftrag zum gefährlichsten Job, den Sarah je hatte ...
Der fünfte Fall der Cosy Crime Reihe mit Sarah Booth Delaney -spannend und humorvoll. Band 6: "Unselig sind die Friedfertigen".
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel von Carolyn HainesDie SerieÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungDanksagungen123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536AnmerkungenWeitere Titel von Carolyn Haines
Witzige Cosy-Crime-Reihe – Sarah Booth Delaney ermittelt:
Band 1: Wer die Toten stört
Band 2: Kein Friede seiner Asche
Band 3: Und führe uns in Versuchung
Band 4: Ein Jeglicher hat seine Sünde
Band 6: Unselig sind die Friedfertigen
Atmosphärische Südstaaten-Romane (Einzeltitel):
Am Ende dieses Sommers
Das Mädchen im Fluss
Der Fluss des verlorenen Mondes
Im Nebel eines neuen Morgens
Die Serie
Sarah Booth Delaney ist eine unkonventionelle Südstaaten-Schönheit mit einem Problem: Ledig, über 30 und ohne Arbeit, steht sie kurz davor, Dahlia House, den von ihr bewohnten angestammten Familiensitz, zu verlieren. Obendrein wird sie von einem streitbaren Geist heimgesucht: Jitty, das einstige Kindermädchen ihrer Ururgroßmutter und nie um einen altklugen Ratschlag verlegen.
Durch Zufall wird Sarah Privatermittlerin und versucht nicht nur, ihre Geldprobleme, sondern fortan auch Kriminalfälle im Mississippi-Delta zu lösen. Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Freundin Tinkie Richmond und der Journalistin Cece, die einmal ein Mann war. Ab den Bänden 2 und 3 gesellen sich Hund Sweetie Pie und Pferd Reveler zu ihr und sorgen für tierischen Beistand.
Klassische Spannung, trockener Humor und ein Ensemble charmant-schräger Charaktere machen die Cosy-Crime-Reihe um Sarah Booth Delaney so liebens- und lesenswert!
Über dieses Buch
Sarah Booth Delaney arbeitet erfolgreich als Privatermittlerin – aber mit der Liebe will es nicht so recht klappen. Ihr Hausgeist Jitty möchte das ändern und versucht, sie endlich unter die Haube zu bringen. Doch Sarah hat gerade Wichtigeres zu tun – sie muss sich um einen neuen Fall kümmern: Doreen Mallory soll ihr eigenes Kind getötet haben, und es liegt an Sarah, ihre Unschuld zu beweisen. Keine leichte Aufgabe, zumal ihre Klientin sich standhaft weigert, den Namen des Kindsvaters zu nennen. Es gibt gleich mehrere suspekte Kandidaten, von denen jeder auch der Mörder sein könnte. Schon bald entwickelt sich der Auftrag zum gefährlichsten Job, den Sarah je hatte …
Über die Autorin
Carolyn Haines (*1953) ist eine amerikanische Bestsellerautorin. Neben den humorvollen Krimis um Privatermittlerin Sarah Booth Delaney hat die ehemalige Journalistin u. a. auch hochgelobte Südstaaten-Romane geschrieben, die auf sehr atmosphärische Weise die Mississippi-Gegend im letzten Jahrhundert porträtieren. Für ihr Werk wurde Haines mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Harper Lee Award. In Mississippi geboren, lebt die engagierte Tierschützerin heute mit ihren Pferden, Hunden und Katzen auf einer Farm im Süden Alabamas.
Homepage der Autorin: https://carolynhaines.com/
Carolyn Haines
Und leise tönt der Grabgesang
Sarah Booth Delaneysfünfter Fall
Aus dem amerikanischen Englisch von Dietmar Schmidt
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2004 by Carolyn Haines
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Hallowed Bones«
Originalverlag: Bantam Books
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock: suns07butterfly | cristatus | MSSA | majivecka | stanley45
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5646-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Larry Martin, meinen Freund und Berater
Danksagungen
Bücher entstehen nie in luftleerem Raum, und der Schriftsteller darf sich glücklich schätzen, der eine so talentierte, mit ihm verschworene Gemeinschaft wie den Deep South Writer’s Salon an seiner Seite weiß. Mein besonderer Dank gilt Aleta Boudreaux, Stephanie Chisholm, Muriel Donald, Reneé Paul und Susan Tanner. Ich möchte auch Steve Greene danken, der mich energiegeladen mit Informationen versorgte, mir stets Ansporn war und dessen Hilfe von unschätzbarem Wert war.
Diese Buchreihe wäre nicht möglich gewesen ohne meine Agentin Marian Young. Wir haben gemeinsam wirklich einen weiten Weg zurückgelegt, Schätzchen!
Ein gutes Buch kommt zudem immer nur unter dem Einfluss eines guten Verlegers zu Stande, und deshalb habe ich an dieser Stelle auch Liz Scheier meinen Dank abzustatten.
Ich möchte in meiner Danksagung auch nicht den Künstler Jamie Youll vergessen. Ich dachte, das amerikanische Cover von Crossed Bones ließe sich nicht mehr übertreffen, aber das für dieses Buch hier ist Ihre bisher beste Arbeit!
1
Wenn kühl der Oktoberwind über die nun dürren Samenkapseln der Baumwolle streicht, finde ich mich im Spinnennetz der Zeit gefangen. Wie eine Sirene wartet die Vergangenheit darauf, mich zu umgarnen, in jedem Rascheln der Baumwollblätter, in diesem klaren Licht der Herbsttage und dem Duft nach Trauben, die der blühende Kudzu verströmt – sie verspricht zwar die Freuden, die die Erinnerung für mich bereithält, aber dann offeriert sie mir nur den Schmerz, der aus Bedauern erwächst.
Ich sitze auf der vorderen Veranda von Dahlia House, trinke meine dritte Tasse Kaffee und sehe dem Platanenlaub nach, das der Wind über die Zufahrt treibt. Dahlia House hat einen neuen Anstrich nötig. Ich selbst aber hätte so viel mehr nötig.
Die Blätter des Kalenders scheinen um einiges schneller abzufallen als die der Platanen, und ich befinde mich in einer Art Niemandsland. Als ich gestern Abend zu Bett ging, dachte ich an Sheriff Coleman Peters und seine schwangere Frau, und heute Morgen hatte ich beim Aufwachen das Gefühl, neben mir läge Scott Hampton. Ich setzte mich auf und begriff, dass ich Scott hatte gehen lassen, ohne auch nur ein Wort zu sagen, das ihn vielleicht zum Bleiben ermutigt hätte. Ein einziges Wort. Bitte. Vielleicht hätte es genügt.
Dass ich ihn nicht hatte bitten können zu bleiben, während vor meinem inneren Auge all das Revue passierte, das ich in meinem Herzen verbarg, machte es mir nicht einfacher, allein aufzuwachen und mich der Berührung eines Mannes nur zu erinnern. Der Oktober weckt fürchterliche Bedürfnisse. Die delaneysche Gebärmutter sendet – wie es unsere Art ist, nicht sonderlich subtil – eine Reihe fordernder Signale aus.
»Wenn ich’s nich’ besser wüsste, würd ich sagen, du hast ’nen Moralischen, und nicht zu knapp!« Die vertraute Stimme kam von irgendwo hinter mir. »Du hast den Blues, aber wenn du ihn nich’ grad singst, ist er komplette Zeitverschwendung, Sarah Booth Delaney!«
Ich sog die Luft ein und roch den verlockenden Duft einer Zigarette. Drei Jahre lang hatte ich nicht mehr geraucht, doch nun packte mich blitzartig das Verlangen. Als ich einen Blick über die Schulter warf, sah ich zu meiner Überraschung Jitty, ihres Zeichens Gespenst aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die sich, ein Bein über die Armlehne gelegt, auf dem Schaukelstuhl flegelte. Von der Zigarettenspitze, die sie in der rechten Hand hielt, stieg träge sich kringelnder Rauch auf.
»Was machst du da?« Ich staunte sowohl über die Zigarette als auch über Jittys Äußeres. Sie steckte in einem kurzen, engen Schlauchkleid, glitzernd, malvenfarben, mit schwarzem Besatz. Um den Kopf trug sie ein Band aus dem gleichen Material, dem einige kunstvoll arrangierte Locken entschlüpften. An die Füße hatte sie sich über Strümpfe mit Naht klobige Schuhe mit hohen Absätzen geschnallt.
»Mach den Mund zu!«, riet sie mir und klemmte sich die Zigarettenspitze zwischen die Zähne. »Ich qualm nich’, ich tu nur so!«
»Was sollte es dir schaden?«, entgegnete ich. »Du bist ein Gespenst. Du kannst rauchen, ohne dass es Folgen für dich hat!«
»Tabak bringt einen längst nich’ so schnell um wie Reue«, stellte Jitty nüchtern fest.
»Was soll dieser Aufzug?«, fragte ich, indem ich auf ihr Kleid deutete. »Wir haben neun Uhr morgens.« Als Spukgeist, ansässig in Dahlia House, hatte Jitty mit den Stechuhren der Sterblichen nichts im Sinn. Sie war rund um die Uhr im Einsatz, sieben Tage in der Woche. »Nicht einmal Gespenster veranstalten am Morgen schon Kostümbälle, und für Halloween bist du eine Woche zu früh dran!«
»Du ertränkst dich doch gerade im Trübsinn«, warf sie mir vor. »Scott Hampton war nich’ der Richtige für dich, Sarah Booth! Er wär ein passabler Samenspender, aber er war nichts für immer. Hör auf, dir selbst Vorwürfe zu machen, und konzentrier dich auf das Positive!«
»Und das wäre?«, fragte ich, um es augenblicklich zu bereuen. Wer Jitty solch eine Frage stellte, dem war auch zuzutrauen, dass er einen Vampir zu sich ins Haus bat.
»Weißt du, wann Frauen das Wahlrecht gekriegt haben?«, fragte sie.
Ich seufzte. »Nein, keine Ahnung. Und es ist mir auch egal. Meine persönliche Vorgeschichte ist schwierig genug, da brauche ich mir nicht auch noch die ganze Welt auf die Schultern zu laden. Ich weiß alles, was es über mich zu wissen gibt, und trotzdem schaffe ich es nicht, mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Und wenn ich die gesamte Weltgeschichte kennen würde – niemand hätte was davon! Historische Kenntnisse bringen die Menschen offensichtlich nur dazu, in eigenartigen Kostümierungen herumzulaufen.«
»1920 war das. Erst die Frauen aus der Generation deiner Mutter konnten ’n Konto auf ihren eigenen Namen eröffnen. Wenn damals ’ne Frau keinen Mann hatte, wie sollte die dann überleben? Wenn du heutzutage ’ne alte Jungfer wirst, kannst du immerhin trotzdem behalten, was dir gehört!«
Ich blickte in meinen schwarzen Kaffee und wünschte mir, er enthielte einen tüchtigen Schluck Jameson. Um wenigstens diese Sehnsucht zu stillen, stand ich auf und ging ins Haus. Doch statt auf den Salon zuzusteuern, wo die Bar ist, wandte ich mich in letzter Sekunde nach links und strebte meinem neuen Büro zu. Ich war seit fünf Uhr morgens auf und hatte die beiden neuen Schreibtische, die beiden neuen Sessel, die Aktenschränke, die Telefonapparate, das Faxgerät und andere Büroeinrichtungsgegenstände immer wieder umgestellt; es war ein geschäftiger, produktiver Morgen gewesen, bis ich dann unbedingt anfangen musste, über Scott nachzudenken.
Jitty folgte mir, ohne das Dozieren zu unterbrechen; aber ich hatte nicht vor, sie durch Entgegnungen auch noch zu ermutigen. Die Vergangenheit verfolgte uns beide, und ich sah keinen Sinn darin, mich in sie zu versenken.
Der Raum, den ich zur offiziellen Geschäftsstelle der Detektivagentur Delaney erkoren hatte, war das ehemalige Schlafzimmer der großen Gästesuite im Ostflügel des Hauses. Die Suite eignete sich ideal, weil sie einen eigenen Eingang besaß und ein kleines Wohnzimmer dazugehörte, das wunderbar als Empfang geeignet war, sollte der Tag je kommen, an dem wir uns eine Empfangsdame würden leisten können. Ich hatte mein Tun vor Tinkie geheim gehalten, rechnete nun aber jede Minute mit ihrer Ankunft und freute mich schon darauf, ihr die große Überraschung zu präsentieren. Ihr Schreibtisch hatte ein eigenes Namensschildchen, und auf der Milchglasscheibe der Außentür stand Detektivagentur Delaney, darunter Delaney und Richmond, Private Ermittlungen.
»Wie findest du es, Jitty?« Ich konnte nicht widerstehen, sie zu fragen, obwohl sie meine Fähigkeiten als Innenarchitektin grundsätzlich zutiefst in Zweifel zog.
»Sähe viel besser aus, wenn hier ’n paar Klienten rumsitzen und warten würden.«
»Ich bekomme schon einen neuen Fall«, entgegnete ich trotz aller Zweifel, die mich plagten. Sechs Wochen ohne Auftrag bedeutet für eine Privatdetektivin eine lange Durststrecke. »Vielleicht sollten wir das neue Büro mit einer Bloody Mary einweihen?«
»Es gab mal ’ne Zeit, da konnte ’ne Frau nich’ so einfach in ’ne Bar kommen und sich was zu trinken bestellen.« Jittys schokoladenbraune Augen funkelten.
Weil sie eine Bar erwähnte, erregte sie meine Aufmerksamkeit. »Wann hat sich das geändert?«
»Zu Lebzeiten deiner Mutter. Zumindest ist es damals allgemein akzeptabel geworden, dass eine Frau in einer Bar was getrunken hat. ’türlich haben Frauen immer Alkohol getrunken, und ich red jetzt nich’ von einem niedlichen Gläschen Sherry. Aber wer als anständige Frau gelten wollte, durfte in der Öffentlichkeit auf keinen Fall was trinken.« Sie zog die makellos geformten Brauen hoch. »Ich nehm mal an, eine wie du wär im Knast gelandet oder hätt in irgendeiner Mission die Böden geschrubbt.«
Ich verstand gut, worauf Jitty hinauswollte. Ich profitierte von der generationenlangen Arbeit couragierter Frauen, die Änderungen in der Betrachtung und Behandlung ihres Geschlechts verlangt hatten. Ich nahm an meinem Schreibtisch Platz und legte die Füße hoch. »Okay, also ich hab’s schon sehr gut, Baby – da stimme ich dir zu. Wir wär’s, wenn du mir jetzt ’nen Charleston vortanzt?«
»Setz dich gerade hin und hör auf, dich wie ’ne Nutte zu benehmen!«, fuhr Jitty mich an. »Wir haben unsere Arbeit noch nich’ getan! Noch lange nich’! Noch ist’s nicht so weit, dass du die Beine hochlegen kannst!«
Meine feministische Anwandlung verblasste. Jitty hatte eine ganze Liste von Dingen, die noch zu erledigen wären, und ich würde dies durchleiden müssen. Diese Gleichung jedenfalls hatte sich noch nie als unzutreffend erwiesen. »Ich brauche einen neuen Fall, Jitty, kein soziales Gewissen!«
»Beides brauchst du! Aber selbst damit erfüllt sich deine Bestimmung als Frau nich’! Was du wirklich brauchst, das ist ’n Mann! Du gehörst zu der Generation, die alles haben kann, schon vergessen?«
Wenn meine Freundinnen gerade einmal nicht das Offensichtliche aussprachen, konnte man sich darauf verlassen, dass Jitty in die Bresche sprang.
»Danke. Ich schau in den Annoncenteil und guck, ob irgendwo Männer im Sonderangebot sind.« Sie hatte sich selbst in die Ecke manövriert, und ich genoss es zuzusehen, wie sie versuchte, sich wieder herauszuwinden. »Aber überleg doch mal, Jitty: Wenn ich die Speerspitze zur Durchsetzung von Frauenrechten in Sunflower County sein soll, dann sähe es doch erheblich besser aus, wenn ich unabhängig wäre! Du weißt schon, eine von den Selbst-ist-die-Frau-Frauen. Wenn ich verheiratet wäre, stünd ich doch da wie eine Heuchlerin, meinst du nicht auch?«
»Ticktack, Sarah Booth! Mit deinem ganzen klugen Gequatsche endest du nur in der Unfruchtbarkeit!«
»Verschwinde und lass mich allein!« Jitty wusste genau, wie sie mich treffen konnte.
»Ich komme wieder«, entgegnete sie, und obwohl sie die Worte weich und im gedehnten Ton der Südstaaten aussprach, klang sie, fand ich, haargenau wie der Terminator. Dann war sie fort.
Der grüne Cadillac, der über die Auffahrt herangebraust kam, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Während ich die Ankunft meiner Partnerin beobachtete, empfand ich den leisen Kitzel der Vorfreude.
Das neue Büro hatte Fenster nach vorn und zur Seite, damit ich jeden gut sehen konnte, der sich mit dem Auto näherte. Für eine Privatermittlerin, die immer die Illusion aufrechterhalten sollte, niemals überrascht werden zu können, war das ein großer Vorteil. Ich lächelte, als ich an Jitty und ihre neue fixe Idee dachte. Manche Leute würden sagen, ich diskutierte mit einem Trugbild über Illusionen.
Ich hörte, wie Tinkie an die Vordertür pochte. »Komm herein!«, rief ich. »Ich bin in der Pfauensuite.« Die Suite hatte ihren Namen von der riesigen Vase mit Pfauenfedern, die in einer Ecke des Zimmers stand. Ich hatte daran gedacht, sie zu entfernen, mir dann aber gesagt, dass Tinkie und ich alles Glück nötig hätten, das wir bekommen konnten.
»Was um alles in der Welt machst du denn da hinten? Ich dachte, du hast so früh angerufen, weil du einen Stapel French Toast machst! Mir war schon das Wasser im Mund zusammengelaufen, und jetzt …« Sie hatte den Durchgang erreicht und hielt inne.
Ihr Blick schweifte durch den Raum und nahm jede Einzelheit in sich auf. Schließlich blieben ihre Augen auf dem Schreibtisch mit ihrem Namensschildchen hängen. »Sarah Booth!«, quietschte sie in ihrem besten Verbindungsstudentinnenton, der nicht auszudrückende Glückseligkeit bedeutete. Sie riss das Namensschild an sich. »Das ist ja wundervoll!«
Ich grinste breit, während Tinkie Chablis auf den Boden setzte und mich umarmte, wobei sie mir ihren Kopf unter das Kinn drückte. Entzückt über ihre Freiheit schoss die kleine Yorkie in die Küche, wo Sweetie Pie, meine Hündin, schon wartete. Die beiden waren ein genauso ungleiches Paar wie Tinkie und ich und ebenso unzertrennlich.
»Ich dachte, wir brauchen ein richtiges Büro«, meinte ich.
»Da steht mein Name an der Tür.« Sie hatte Tränen in den Augen.
»Die Hälfte der Agentur bist du.«
»Du bist einfach großartig, Sarah Booth.«
»Und du bist hungrig. Machen wir uns was zum Frühstück!«
»French Toast?«
»Wenn du gern möchtest.«
Wir waren auf halbem Weg in die Küche, als die roten Telefone klingelten. Die Idee mit den roten Fernsprechern hatte ich Kinky Friedman geklaut, und ich wurde ganz aufregt, wenn sie läuteten.
Wir eilten ins Büro zurück. Ich wollte schon abheben, doch dann nickte ich Tinkie zu.
»Detektivagentur Delaney«, sagte sie mit leuchtenden Augen. »Tinkie Richmond am Apparat.«
Eine lange Pause folgte. »Ja, ich verstehe«, sagte sie abschließend. »Ich muss kurz mit meiner Partnerin Rücksprache halten, dann rufen wir sofort zurück.« Sie nahm einen Kugelschreiber und notierte sich eine Telefonnummer auf dem Schreibblock. Als sie auflegte, hatte sie die Augen aufgerissen. »Das war eine Nonne aus New Orleans. Sie möchte uns engagieren, damit wir einer Frau helfen, die hier in Sunflower County festgenommen worden ist.«
Wir brauchten einen Fall. Zumindest ich brauchte ihn. Tinkie hatte einen reichen Mann und einen noch reicheren Daddy. Die Worte ›knappe Kasse‹ kamen in ihrem Wortschatz nicht vor.
»Eine Nonne?« Sunflower County hatte eine katholische Kirche, St. Lucy’s. Dort gab es auch einen Priester, aber wer die Nonnen zählen wollte, kam nicht über null hinaus. »Hat sie gesagt, wer die Frau ist oder was sie getan haben soll?«
Tinkie nickte. »Die Frau heißt Doreen Mallory. Ihr wird vorgeworfen, in New Orleans ihre kleine Tochter ermordet zu haben.«
2
In den Gräben drängten sich nickend die Köpfe von Sonnenhüten. Tinkie saß am Steuer des großen Caddys und schwatzte aufgeregt über das bevorstehende Gespräch mit Doreen Mallory. Ich blickte aus dem Fenster und fragte mich, was ich zu Coleman sagen sollte. Ich hatte ihn seit dem Abend im August, an dem er Spider und Ray-Ban wegen des Mordes an Ivory Keys verhaftet hatte, nicht mehr gesehen. An diesem Abend hatte seine Frau uns bei einer Umarmung erwischt und dann verkündet, dass sie schwanger sei. Alles in allem war das einer der übelsten Momente meines Lebens gewesen.
»Ich habe gehört, dass Connie keine leichte Schwangerschaft durchmacht«, meinte Tinkie gerade.
»Tut mir Leid zu hören.« Es tat mir nicht Leid. Connie war absichtlich schwanger geworden, weil sie wusste, dass sie sonst ihren Mann verloren hätte. Ich wünschte ihr Übelkeit am Morgen, am Mittag, Nachmittag, Abend und während der Nacht.
»Ich habe gehört, dass Coleman sie zu einem Psychiater nach Jackson fährt.« Tinkie nahm die Augen nicht von der Fahrbahn.
»Wahrscheinlich tut es ihr gut.« Ich empfand einen Stich, wusste aber nicht, ob aus Schuldgefühl, Hoffnung oder Rachsucht. Ich wollte mich auch nicht näher damit befassen.
»Hast du mit Coleman gesprochen?«, fragte sie rundheraus.
Ich sah sie an. »Nein. Was soll ich ihm denn sagen? Ich schäme mich, und seinetwegen ist es mir peinlich. Er ist verheiratet, seine Frau bekommt ein Kind. Was gibt es da noch zu besprechen?«
Tinkie drosselte das Tempo. »Ich hätte dich nie für dumm gehalten, Sarah Booth, aber du benimmst dich, als hättest du blonde Haarwurzeln im Hirn! Coleman und du müsst über die Sache sprechen und sie ein für alle Mal bereinigen. Ihr könnt die Dinge doch nicht einfach in der Schwebe lassen.«
»Warum nicht?«
»In ein paar Minuten musst du ihm gegenübertreten. Was hast du vor? Willst du so tun, als wäre er dir gleichgültig?«
»Das war mein Plan.«
Sie rollte mit den Augen. »Für einen Feigling hätte ich dich auch nicht gehalten.«
Diese Bemerkung setzte mir zu, und zuerst überkam mich der Drang, einfach um mich zu schlagen, doch ich ließ es bleiben. Tinkie war niemals grausam, und hier hatte sie sogar Recht. Indem ich Coleman bisher aus dem Weg gegangen war, hatte ich es mir zu einfach gemacht. Nun würde ich mich ihm stellen müssen.
»Ich weiß ja, dass ich mit ihm reden muss. Ich weiß nur ganz ehrlich nicht, was ich sagen soll. Er sitzt in der Falle, und nichts, was ich sage, könnte daran etwas ändern. Er kann Connie jetzt nicht verlassen. Uns aus dem Weg zu gehen, ist das Beste, was wir tun können.«
Tinkie seufzte. »Hast du noch etwas von Bridge gehört?«
Bridge Ladnier war ein reicher Investor, mit dem Tinkie mich hatte zusammenbringen wollen. Während der Ermittlungen in meinem letzten Fall hatte ich ihn irrtümlich für einen Mörder gehalten. »Er hat mir den Ohrring meiner Mutter geschickt, den ich bei ihm verloren hatte. Ich dachte, Cece und er kämen glänzend miteinander aus.«
»Er ist ein netter Mann«, erwiderte Tinkie, während sie wieder beschleunigte. »Mit Cece hat er sich angefreundet. Ich weiß aber, dass er von dir bezaubert war, Sarah Booth.«
Wäre Bridge zu einem anderen Zeitpunkt in mein Leben getreten, hätte ich mich vielleicht in ihn verknallt. »Ich habe alles vermasselt.«
Tinkie bog in eine Parktasche vor dem Courthouse ein. »Nicht alles. Du hast den Fall gelöst, Scott Hamptons Unschuld bewiesen, Ivorys Traum gerettet und aus Ida Mae Keys eine glückliche Frau gemacht. Eigentlich also gar keine schlechte Bilanz.«
»Ohne deine Hilfe hätte ich das nie geschafft, Tinkie. Aber danke, du hast mal wieder die richtigen Worte gefunden!« Ich wollte ihre Hand berühren, doch Tinkie sprang bereits aus dem Wagen.
»Ich muss in den Waschraum«, verkündete sie und schoss die Treppen zum Courthouse hinauf. Erst als sie verschwunden war, begriff ich, weshalb sie es so eilig hatte: Aus dem Wagen neben mir stieg Coleman Peters. Sein Blick ließ mich nicht los.
»Wie geht’s Connie?«, fragte ich schließlich, doch es lag kein Zorn in der Frage, kein Bedürfnis zu verletzen.
»Nicht gut. Ich hätte nie gedacht, dass eine Schwangerschaft eine Frau umbringen könnte, doch es sieht so aus, als könnte Connie die erste Frau sein, der das passiert. Sie kann nicht schlafen, sie kann nicht essen. Sie nimmt ab, statt Gewicht zuzulegen. Aber über einen Abbruch will sie nicht einmal nachdenken.«
Coleman sah furchtbar aus. Seine blauen Augen waren noch immer scharf, aber sie lagen tief in den Höhlen. Dunkle Ringe zeigten, dass auch er nicht viel Schlaf bekam. »Was sagt der Arzt?«
Er lachte bitter auf. »Sie weigert sich, zum Arzt zu gehen. Sie benimmt sich, als würde sie eine Art Strafe erdulden. Für sich und für mich. Sie wird sie weiter aushalten, egal was passiert, und ich soll an ihrer Seite leiden.« Er atmete durch. »Ich habe Angst um sie.«
»Bring sie doch einfach zum Arzt!«
»Das ist leichter gesagt als getan.«
Coleman konnte seine Frau sicherlich zwingen, daran bestand kein Zweifel. Der Schaden, der dadurch entstand, konnte sich aber als schlimmer erweisen als abzuwarten, bis sie sich selbst dazu durchrang. Coleman saß in der Zwickmühle.
»Ich wünschte, die Dinge lägen anders.«
Er schwieg, und ich sah, wie all das, was hätte anders sein können, vor seinem inneren Auge vorbeiblitzte. »Ja, ich auch. Sarah Booth, ich hätte dich niemals anrühren dürfen! Dazu hatte ich kein Recht. Ich habe dir nichts zu bieten, und dir auch nur die Gefühle zu zeigen, die ich für dich habe – das war schon falsch.«
Er sagte mir damit, dass er Connie gegenüber seine Pflicht tun würde. Er gab nicht einmal mehr vor, dass er ›seine Ehe in Ordnung bringen‹ wollte. Trotzdem würde er bei seiner Frau bleiben, und da er mir keine legitime Beziehung bieten konnte, wollte er mich überhaupt nicht mehr behelligen.
Ich bewunderte Coleman und war gleichzeitig stinksauer auf ihn. Im gleichen Ton wie er begann ich: »Ich kannte den Stand der Dinge, als ich …« Ich gab es auf. »Du hast mir nie etwas vorgemacht.«
»Vielleicht habe ich uns beide getäuscht.«
Wir standen dort, und so vieles blieb ungesagt. Schließlich fragte er mich, weswegen ich ins Courthouse komme.
»Doreen Mallory«, antwortete ich.
Er zog die Brauen hoch. »Woher weißt du von der?«
»Ich weiß nichts von ihr. Wir haben einen Anruf von einer Nonne bekommen.« Mir war klar, wie seltsam das klang. »Warum sollte eine Nonne aus New Orleans ein Detektivbüro anrufen, damit es dieser Frau hilft?«
Coleman überlegte kurz, bevor er antwortete. »Ich habe mit Ms Mallory gesprochen. Sie wurde in New Orleans von Nonnen aufgezogen. Sie war eine Waise. Ich habe mit Schwester Mary Magdalen gesprochen, und ich kann dir jedenfalls sagen, dass die große Stücke auf Doreen Mallory hält. Sie behauptet, Ms Mallory vollbringe Wunder.«
Ich sah Coleman tief in die Augen, während er sprach. Sein Beruf hatte ihn zynisch werden lassen, doch diesmal lag nicht der geringste Hinweis auf Spott in seinem Ton.
»Eine Wundertäterin?« Ich schwieg, doch er sagte nichts weiter. »Erweckt sie die Toten, verwandelt sie Wasser in Wein?« Er sagte immer noch nichts. »Oder heilt sie Warzen und liest aus Teeblättern?«
»Sprich selbst mit ihr!«, entgegnete er und ging zum Courthouse.
Coleman überließ es mir regelmäßig, meine eigenen Schlüsse zu ziehen, aber dabei war es ihm nie gleichgültig, welchem Weg ich bei meinen Ermittlungen folgte. »Warum sagst du mir nichts?«
»Ich werd dir sagen, was ich über die Frau weiß«, erklärte er. »Wir haben sie auf dem Friedhof von Pine Level gefunden, wo sie mit dem Grabstein ihrer Mutter sprach. Festgenommen haben wir sie aufgrund eines Haftbefehls aus New Orleans, in dem sie beschuldigt wird, ihre Tochter getötet zu haben, einen zehn Wochen alten Säugling.«
Doreen Mallory schien mir nach dem, was mir Coleman da gerade eröffnete, mehr ein Mensch mit seelischen Problemen zu sein und keine Wundertäterin. »Wie ist das Baby gestorben?«
»Durch eine Schlaftablette, die vermutlich in seiner Babymilch aufgelöst und ihm dann mit dem Fläschchen verabreicht wurde. Ich kenne die Einzelheiten nicht.«
Wir betraten das Courthouse, und unsere Schritte hallten durch den Flur. »Wäre es möglich, dass sie einfach verrückt ist? Ich meine, welches Motiv könnte sie denn haben, ihr eigenes Baby umzubringen?«
»Der Säugling war krank. Damit meine ich wirklich ernsthafte Geburtsfehler.«
»Du willst mir also sagen, dass du der Ansicht bist, sie habe ihr Baby ermordet, weil sie sich nicht darum kümmern wollte?« Dergleichen war schon früher geschehen. Es gab sogar Frauen, die sich nicht einmal um ein gesundes Kind kümmern wollten.
»Einmal das, und darüber hinaus sieht es nicht gerade toll aus, wenn eine Frau, die behauptet, Wunder zu wirken, nicht einmal ihrer eigenen kleinen Tochter helfen kann.« Coleman öffnete die Tür zum Revier des Sheriffs.
Als wir hineingingen, blieb ich auf dem Fleck stehen. Coleman hätte mich warnen sollen. Am Schreibtisch der Dispatcherin saß Connies beste Freundin, Rinda Stonecypher. Aus ihren braunen Augen funkelte außerordentliche Missgunst, während sie mich anstarrte. Einen Augenblick lang verspürte ich tiefes Mitgefühl für Coleman. Er war seiner Freiheit weit stärker beraubt als irgendjemand, der in seinen Gefängniszellen einsaß. Für den Fehltritt, den er mit mir begangen hatte, hatte Connie ihm eine furchtbar strenge Strafe auferlegt.
»Rinda, du erinnerst dich an Sarah Booth«, begann Coleman und legte damit den Ton fest.
»Ja, ich erinnere mich an sie«, entgegnete Rinda. »Mrs Richmond erwartet dich in deinem Büro.«
Coleman nahm mich beim Arm und führte mich in sein privates Büro. Hinter uns schloss er die Tür, was früher nicht zu seinen Gewohnheiten gehört hatte. Tinkie saß vor seinem Schreibtisch. Ihr Blick maß uns mit der Intensität eines Laserstrahles, der nach den feinsten Haarrissen und Schäden scannt. Zufrieden mit dem Ergebnis lehnte sie sich dann zurück.
»Du vermutest also, Doreen Mallory hätte ihre Tochter getötet, weil sie ihrer ›Berufung‹ im Weg gestanden haben könnte?«, fragte ich Coleman, während ich mich in den anderen freien Stuhl vor seinem Schreibtisch setzte.
»Das ist nicht meine Theorie, sondern das New Orleans Police Department vermutet das. Das NOPD hat die Auflieferung zum Gerichtsverfahren beantragt.«
»Hast du mit ihr gesprochen, Coleman?«
Er zögerte. »Ja. Ich habe sie am Friedhof abgeholt.«
»Und?« Ich sah in seinen Augen etwas flackern.
»Sie war kooperativ, bestritt aber, ihrer Tochter etwas zuleide getan zu haben. Sie war sogar schockiert, dass man ihr den Tod der Kleinen vorwirft. Ursprünglich war befunden worden, das Kind sei eines natürlichen Todes gestorben. Es litt, wie gesagt, an schweren Geburtsfehlern, und man nahm an, dass es einfach aufgehört hat zu atmen. Plötzlicher Kindstod erschien die plausibelste Erklärung. Dann allerdings kamen die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung, und das Medikament wurde gefunden.«
»Ich weiß, dass du unvoreingenommen bist, Coleman, was also hältst du von ihr?«, fragte Tinkie. »Es ist nicht dein Fall. Du darfst dir eine eigene Meinung bilden.«
Ich bedachte meine Partnerin mit einem langen Seitenblick. Sie wurde immer besser. Colemans Ansichten über den Fall zu kennen wäre auf lange Sicht sehr wertvoll. Gewöhnlich zählten für ihn nur die Tatsachen, doch wie Tinkie so geschickt bemerkt hatte, hatte Coleman keinen Hund im Rennen. Er konnte sich eine persönliche Meinung leisten.
»Als ich das Amtshilfeersuchen aus New Orleans erhielt, sie festzunehmen, habe ich nicht großartig darüber nachgedacht. Als ich erfuhr, dass sie auf dem Friedhof war, wurde ich neugierig. Aber dann stand ich ihr gegenüber und war förmlich überwältigt. Ich hab mit ihr gesprochen …« Diesmal legte er eine längere Pause ein. »Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Aber ich bezweifle nicht, dass ihr beide euch eine eigene Meinung bilden werdet.«
»Jetzt sag mir noch einmal genau, was sie auf dem Friedhof von Pine Level gemacht hat. Sie hat mit einem Grabstein gesprochen?«, fragte ich. Pine Level gehört zu den wenigen Friedhöfen, die von Anfang an gemischtrassig gewesen waren. Viele Jahrzehnte lang lagen im vorderen Teil des Friedhofs die Weißen. Im hinteren Teil jedoch befanden sich einige der ältesten Gräber im ganzen Bezirk. Sklaven lagen dort begraben, viele Ruhestätten nur durch einen einfachen Holzpfosten markiert.
»Sie hat das Grab ihrer Mutter besucht«, erklärte Tinkie. Die Erregung in ihrer Stimme sicherte ihr meine volle Aufmerksamkeit. »Und ihre Mutter war Lillith Lucas. Rinda hat mir auf ihre unfreundliche Art ein paar Einzelheiten mitgeteilt.«
Ich konnte es kaum fassen. »Die irre Lillith?«, fragte ich. Mir trat eine lebhafte Erinnerung an die extravagante Straßenpredigerin vor Augen. »Lillith hatte keine Kinder. Sie war unverheiratet. Und sie hat uns Kindern furchtbare Angst vor dem Sex eingejagt!«
Colemans leises Lachen begleitete die Erinnerung an eine Frau mit langem, strähnigem Haar, die eine Bibel über ihren Kopf hob, während sie uns durch die Straßen von Zinnia hetzte und rief, dass unsere Organe abfallen würden, wenn wir uns der Lust des Teufels hingäben.
»Sie hat nicht praktiziert, was sie gepredigt hat«, meinte Tinkie und blinzelte Coleman zu.
»Bist du dir da sicher?« Ich konnte es noch immer nicht glauben.
»Doreen gibt an, dass Lillith ihre Mutter sei. Schon als Säugling oder Kleinkind wurde sie weggegeben. In der Nähe eines Klosters in New Orleans ausgesetzt, um genau zu sein. Warum sollte jemand Lillith zu seiner Mutter erklären, wenn es nicht stimmt?«, fragte Coleman.
»Das ist eine gute Frage«, stellte Tinkie fest.
»Eine Frage, die wir unserer Klientin stellen müssen«, meinte ich. »Können wir sie sehen?«
»Sicher«, sagte Coleman. »Aber sie wird bald nach New Orleans überstellt.«
»Wann?«
»Sobald man uns jemanden schickt, der sie abholt.« Wir standen auf und kehrten in den Wachraum zurück. »Rinda, könnte ich den Gefängnisschlüssel haben?«
»Dewayne hat vergessen, ihn hier zu lassen«, entgegnete sie, ohne jemanden von uns anzusehen.
Coleman klopfte sich auf die Hüften. »Ich habe meine Schlüssel in der Jackentasche«, meinte er. »Ich bin gleich wieder da.«
Kaum hatte er die Tür geschlossen, als Rinda von ihrem Stuhl aufsprang und auf mich zupreschte. Früher einmal war sie Cheerleaderin gewesen, aber sie hatte sechzig Pfund zugelegt und ihren Elan verloren.
»Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen?«, fauchte sie mich an. »Willst du ihre Ehe um jeden Preis ruinieren, oder was?«
»Weiß Coleman, dass du deine Tabletten nicht nimmst?«, fragte Tinkie zuckersüß.
»Ich an deiner Stelle wär verdammt vorsichtig, Mrs Richmond«, erwiderte Rinda. »Auf deinen Mann hat sie es als Nächsten abgesehen!«
»Um die Treue meines Gatten mache ich mir keine Gedanken«, entgegnete Tinkie, und ihre normalerweise fröhlichen Augen waren eisigblau geworden. »Und du solltest dir lieber Gedanken um deinen Job machen, nicht um die Angelegenheiten anderer Leute! Wenn Coleman von diesem Zwischenfall Wind bekommt, bist du gefeuert.«
»Das glaube ich kaum«, meinte Rinda lächelnd. »Connie hat mir die Stelle verschafft.«
»Coleman lässt sich nur soundsoviel gefallen«, warnte Tinkie sie. Rinda beachtete sie nicht und wies mit einem roten Fingernagel auf mich. Ihre Figur mochte zum Teufel gegangen sein, aber gegen ihre Maniküre war nichts einzuwenden. »Ich behalte dich im Auge! Ich weiß, was für eine Frau du bist, und eins kann ich dir versprechen: Wenn du Coleman weiterhin hinterherläufst, wird das gesamte Delta wissen, was für eine Schlampe du bist!«
»Hat dein elastischer Hosenbund dir die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abgeschnürt?«, fragte Tinkie.
»Du bist doch das beste Beispiel, dass man sich mit Geld keinen Verstand kaufen kann!«, fauchte Rinda Tinkie an.
Ich wollte etwas einwerfen, doch Tinkie hob die Hand, um mich davon abzuhalten. »Rinda, das Einzige, was dich je attraktiv gemacht hat, war deine Niedlichkeit. Ich an deiner Stelle würd mir keine Gedanken um andere machen und lieber der verlorenen Niedlichkeit hinterherjagen! Wenn mir auch nur der Fetzen eines Gerüchts über Sarah Booth zu Ohren kommt, dann bin ich, das versprech ich dir, wieder hier und rechne mit dir ab! Und das wird alles andere als reizend sein!«
Rinda war wieder an ihrem Schreibtisch, bevor die Tür sich öffnete und Coleman zurückkehrte. Er blickte sich im Raum um und roch vermutlich ganz schwach verbal versengtes Haar. »Alles okay?«
»Reden wir mit Doreen«, entgegnete Tinkie mit klaren, ungetrübt blauen Augen. »Ich kann es kaum erwarten, sie kennen zu lernen.«
3
Beim Anblick Doreen Mallorys kam mir das Plattencover eines Albums von Rita Coolidge in den Sinn: Sie hatte das gleiche lange Haar, den gleichen schlanken Körperbau und die gleiche Haltung. In meinem Kopf hörte ich Bird on a Wire. Doreen Mallory fehlte zwar das indianische Erbe der Sängerin; die Sommersprossen, die hell Doreens Nase sprenkelten, verrieten einen anderen Genpool. Doch ihr schwarzes Zigeunerinnenhaar reichte ihr bis zu den Hüften, und ihre haselnussfarbenen und grünen Augen wirkten unbeirrbar. Sie trug Stiefel, Jeans und ein weites weißes Hemd, das ihre gertenschlanke Eleganz betonte. In Doreens Gesicht fand ich nicht das geringste Anzeichen, eines ihrer Chromosomen könnte von Lillith Lucas stammen.
Tinkie stellte uns vor, und ich beobachtete, wie ein gequältes Lächeln Doreens Lippen berührte. »Ich habe Schwester Mary Magdalen gesagt, sie soll ihr Geld nicht auf Privatdetektive verschwenden«, sagte sie mit einer Stimme, die sowohl kühl war als auch beruhigend.
»Warum würde sie ihr Geld verschwenden?«, fragte ich, während ich überlegte, ob Doreen damit bereits zugegeben hatte, ihr Kind auf dem Gewissen zu haben. Ganz gewiss war sie nicht die klassische trauernde Mutter.
»Weil ich nichts verbrochen habe«, antwortete Doreen. »Ich bin mir sicher, die Polizei wird zu dem gleichen Schluss kommen. Ich bin unschuldig. Es ist alles ein Irrtum.« Sie presste die Lippen zusammen. »Niemand hätte Rebekah etwas zuleide getan. Sie war doch nur ein winziges Baby.«
»Sie hatte Schlafmittel im Blut«, entgegnete ich mit einer Schärfe, über die ich mich selbst wunderte. »Nach einem Versehen klingt mir das nicht. Jemand hat ihr das Zeug in die Milch getan.«
»Die Polizei muss die Blutproben verwechselt haben«, behauptete Doreen, völlig unbeeindruckt von meinem Ton. »Rebekah bekam keine Medikamente.«
Ich wollte gerade etwas erwidern, als mir Tinkie so fest auf den Fuß trat, dass ich dachte, ihr Pfennigabsatz hätte meine Muskeln, Knochen und Bänder durchbohrt. Ich stolperte rückwärts in die gegenüberliegende Zelle und packte die Gitterstäbe, um mich daran festzuhalten.
»Aber was, wenn es kein Irrtum war?«, fragte Tinkie sehr sanft. »Was, wenn jemand Ihrer Rebekah etwas angetan hat? Gibt es jemanden, der dem Baby vielleicht wehtun wollte? Oder Ihnen?«
Doreen blinzelte. »Nein. Niemand hätte einer von uns beiden wehtun wollen.«
»Was ist mit dem Vater?«, warf ich ein.
»Er hat nichts damit zu tun. Gar nichts.«
»Trotzdem müssen wir mit ihm reden«, entgegnete ich.
»Nein, das sehe ich anders«, widersprach Doreen mit einer Härte, die an polierten Stahl erinnerte. »Sie werden mein Wort darauf nehmen. Er hat nichts damit zu tun.«
»Erzählen Sie uns von Ihrem geistlichen Amt«, sagte Tinkie und wies mich mit einem Blick in die Schranken. »Wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie Predigerin.«
»Nein, keine Predigerin«, erklärte Doreen, »eher eine Lehrerin. Ich versuche den Menschen beizubringen, in Frieden und Freiheit zusammenzuleben. Mit sich selbst und anderen. Der erste Schritt zur Harmonie findet stets in uns selbst statt.«
»Ich habe gehört, Sie können Wunder wirken?«, fragte ich, auf der Hut vor Tinkies rechtem Absatz. Offenbar hatte sie Zuneigung zu Doreen Mallory gefasst und war bereit, sie mit allen Waffen zu verteidigen.
Doreen lächelte amüsiert. »Jeder kann Wunder wirken, Ms Delaney, und ich bilde da keine Ausnahme.«
»Aber Sie haben Menschen geheilt?«
Darüber dachte sie kurz nach. »Nein, ich kann nicht behaupten, Menschen geheilt zu haben. Bei verschiedenen Gelegenheiten konnte ich Menschen zeigen, wie man eine Krankheit hinter sich lässt.«
»So wie man den Mantel an der Garderobe abgibt?«, fragte ich und wich von Tinkie zurück, bevor sie wieder zutrat.
»Ja, in gewisser Weise schon«, erwiderte Doreen, ohne sich auch nur im Geringsten an meiner flapsigen Ausdrucksweise zu stoßen. »Wenn Sie glauben, dass es draußen warm ist, brauchen Sie Ihren Mantel nicht. Mit der Krankheit ist es ähnlich. Wenn Sie nicht glauben, sie zu brauchen, können Sie sie zurücklassen.«
»Erkenntnis des Geistes?«, fragte ich.
»So würde ich es nicht nennen wollen«, antwortete Doreen. »Es ist eigentlich sehr einfach. Es hat mit Gedanken und Energie zu tun.« Ich bekam das Gefühl, sie versuchte es mir auf eine Weise zu erklären, die ich begreifen konnte. »Darf ich Ihnen eine Frage stellen?«
»Mir?« Ich war erstaunt, aber ich nickte. »Natürlich.«
»Warum verwenden Sie so viel von Ihrer Energie auf die Vergangenheit, Ms Delaney?«
Ich fühlte mich Doreen Mallorys grünen Augen vollkommen nackt und hilflos ausgeliefert. Bloßgestellt. »Um mich geht es hier nicht«, wies ich die Frage ab. »Wie nennen Sie sich selbst?«
»Doreen Mallory«, entgegnete sie, ohne sich zu bemühen, ihre Erheiterung über mein Unbehagen zu verbergen. »Wie Sie sicher wissen, ist das nicht mein Geburtsname. Im Kloster hat sich meistens eine ältere Nonne um mich gekümmert. Bevor sie ihr Gelübde ablegte, hieß diese Nonne Mallory.«
»Ich meinte, welchen Titel Sie sich geben: Reverend, Doktor, oder was?«
»Ich führe keinen Titel und benötige auch keinen. Nennen Sie mich einfach Doreen! Was können Sie mir über meine Mutter sagen?«
»Was wollen Sie wissen?«, fragte ich ausweichend. Ich konnte nicht glauben, dass Doreen wirklich Wunder wirkte, aber ich sah keine Notwendigkeit, ihr zu eröffnen, dass man ihre Mutter für die Stadtverrückte gehalten hatte.
Doreens ruhiger Blick blieb unbeirrt. »Ich habe erst vor wenigen Wochen herausgefunden, woher ich wirklich stamme. Ich dachte, dass meine leibliche Mutter mir vielleicht etwas zum Robert-Syndrom sagen könnte, das eine Erbkrankheit ist. Die Nonnen gaben schließlich nach und erzählten mir so viel darüber, wie ich nach Rosebriar kam, dass ich schließlich zwei und zwei zusammenzählen konnte und auf Lillith stieß. Es war aber zu spät; sie war schon tot.«
Zum ersten Mal bekam ihre perfekte Haltung Risse. Die zahlreichen medizinischen Probleme ihrer Tochter hatten sie dazu gebracht, in einer Vergangenheit nach Antworten zu suchen, die, wenn Lillith Lucas wirklich ihre leibliche Mutter war, nur unangenehme Überraschungen bereithalten konnte. Wenigstens hatte sie einen Versuch unternommen. Darum konnte ich sie schon ein wenig besser leiden.
»Wir kannten Lillith nicht sehr gut«, erklärte Tinkie, wie immer diplomatisch. Sie verschwieg, dass wir uns alle vor Lillith gefürchtet hatten, weil in ihren Augen das Feuer des Wahnsinns gelodert und ihr verfilztes graues Haar wie Spanisches Moos ausgesehen hatte. »Wir wissen von ihr nur sicher, dass sie eine fromme Frau war. Einige meinen, sie sei von der Religion besessen gewesen.«
»Alle haben gedacht, sie wäre verrückt, nicht wahr?«, fragte Doreen.
Tinkie trat näher an die Gitterstäbe und musterte Doreens Gesicht. »Ja. Ich sage es nicht gern, aber die meisten Leute hier hielten sie für ein wenig durchgedreht. Als Kinder haben wir uns vor ihr gefürchtet. Sie lauerte uns an Straßenecken auf und schrie uns Bibelzitate zu. Wir gingen ihr aus dem Weg, wann immer das möglich war. Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht entsinnen, ihr je ins Gesicht gesehen zu haben.«
Doreen hob die Hände an die Gitterstäbe und umfasste sie mit ihren schlanken Fingern. »Sheriff Peters hat mir ein wenig von ihr erzählt. Und diese Frau in seinem Revier sagt, dass Lillith wahnsinnig gewesen ist. Sie hat mir gesagt, dass meine Mutter verbrannt ist. Sie sagt, dass Lillith nur eine Hure gewesen ist, die mit Religion die Leute einschüchtern wollte, damit sie ihr Geld spendeten.«
»Ich gebe keinen falschen Nickel auf irgendetwas, das Rinda Stonecypher behauptet.« Mich machte Rindas unnötige Grausamkeit wütend.
»Niemand hier wusste, dass meine Mutter ein Kind hatte?«, fragte Doreen.
Ich schüttelte den Kopf. »Von uns niemand«, gestand Tinkie. »Natürlich haben die Erwachsenen vor uns Kindern nicht über so etwas gesprochen, aber wir hätten trotzdem davon gehört. Ich würde sagen, dass Lillith es irgendwie geschafft hat, Ihre Geburt geheim zu halten.«
»Sie muss sich sehr allein und isoliert gefühlt haben«, meinte Doreen.
»Lillith war besessen vom Thema Sexualität. Dagegen predigte sie vor allem. Wir hätten nie gedacht, dass sie selbst jemals Sex würde haben wollen, geschweige denn ein Baby.«
Doreen lächelte. »Wie oft fluchen wir wider die Dämonen in anderen, die uns selbst beim Nacken gepackt halten.«
»Glauben Sie an Dämonen? An Besessenheit?«, fragte ich; ich überlegte, ob sie ihr Kind vielleicht bei einem Versuch getötet haben konnte, ihm die bösen Dämonen der Krankheit auszutreiben.
»Nein, nicht an die Sorte, an die Sie jetzt denken. Rebekah war nicht vom Teufel besessen. Für mich war sie wunderschön; ich habe ihre Seele immer gespürt. Auch trotz all ihrer Krankheiten war sie ein wahres Geschenk Gottes. Sie ist gekommen, um mir etwas Wunderbares zu zeigen, und dann ist sie ins Paradies zurückgekehrt.«
Für einen Sekundenbruchteil begriff ich, wie machtvoll der Friede war, den Doreen Mallory ihren Mitmenschen anbot. Fest und unerschütterlich daran zu glauben, der Tod des eigenen Kindes sei Teil eines Plans, Teil von etwas, das mehr war als furchtbares Pech und das übliche Leid, das Menschen zu ertragen hatten – das hätte man auch als Wunder bezeichnen können.
Aber wirklich daran glauben konnte nur eine Verrückte. Während ich Doreen in die ruhigen grünen Augen starrte, fragte ich mich, wer genau dort in ihrem Kopf wohnte.
»Coleman sagt, er habe Sie auf dem Friedhof von Pine Level aufgegriffen«, mischte sich nun wieder Tinkie ein.
Doreen nickte. »Ich habe dort meine Mutter besucht. Ich musste mit ihr reden.«
»Doreen, Sie wissen aber doch, dass sie tot ist.« Tinkie war sehr sanft.
»Was genau ist der Tod?«, entgegnete Doreen. »Ihren sterblichen Leib hat sie hinterlassen, aber das heißt nicht, dass auch ihre Seele fort ist, ihre Energie.«
»Ach so, sie hängt also die ganze Zeit auf Pine Level rum?«, fragte ich.
»Ich wusste nicht, wohin ich sonst gehen sollte. Ich weiß nicht, wo in Sunflower County sie gewohnt hat, aber ich wollte mich ihr nahe fühlen. Manchmal besteht die einfachste Möglichkeit darin, an eine Stelle zu gehen, die der Seele und dem Verstand vertraut ist.«
»Haben Sie mit ihr gesprochen?«, fragte Tinkie.
»Ich wollte gerade anfangen, als eine ältere Dame vorbeikam, um Blumen auf ein Grab zu legen. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Sie hat mir viel über meine Mutter erzählt. Ich glaube, dass Lillith sie mir vielleicht geschickt hat.«
Doreen verstand sich gut darauf, Geschehnisse zu ihrem Vorteil auszulegen. Sie hatte mit ihrer toten Mutter sprechen wollen, und eine lebendige Person war aufgetaucht. Sehr bequem.
Die Verbindungstür zwischen dem Zellentrakt und dem Revier des Sheriffs öffnete sich, und Coleman führte eine kleine Frau in fließendem, wasserblauem Habit herein. Coleman nahm die Szene in sich auf, bevor er die Tür wieder schloss, damit wir unter uns waren.
Die Nonne eilte auf uns zu. Sorge trieb eine Furche zwischen ihre Augenbrauen. »Michael kümmert sich um alles, aber deine Anhänger machen sich Sorgen! Die Schwestern beten ohne Unterbrechung. Der Sheriff sagt, er kann keine Kaution festlegen, diese Entscheidung läge beim Richter in New Orleans – als ob es dort jemanden gäbe, der diesen Titel verdient!« Die kleine Frau brummte fast vor Furcht und Energie.
»Schwester Mary Magdalen«, sprach Doreen die Frau an. »Sie hätten sich nicht auf einen solch weiten Weg machen sollen! Mir geht es gut.«
Obwohl wir nur ein paar Fuß entfernt standen, beachtete die Nonne Tinkie und mich überhaupt nicht; sie hatte nur Augen für Doreen. »Wenn ich dich hinter diesen Gitterstäben sehe, empfinde ich furchtbare Angst.« Ihre Augen waren groß, ihr Gesicht blass.
»Du brauchst dich nicht zu ängstigen«, entgegnete Doreen. »Wie du siehst, fehlt mir nichts. Der Sheriff ist vom Scheitel bis zur Sohle ein Gentleman.«
»Wir haben eine Detektivin engagiert. Wir müssen dich aus dem Gefängnis bekommen.« Die Schwester blickte sich bestürzt um. »Ich weiß überhaupt nicht, wie uns geschieht! Ich habe dir gesagt, du sollst nicht hierher fahren. Die Vergangenheit beantwortet deine Fragen nicht. Hier erwarten dich nur Schwierigkeiten. Ich hatte Schwester Mary Grace unmissverständlich klar gemacht, dir gegenüber über dieses Thema zu schweigen. Ich …«
Doreen unterbrach die Wortflut der Nonne, indem sie Tinkie und mich vorstellte.
»Entschuldigen Sie«, meinte Schwester Mary Magdalen atemlos. Sie rang um Fassung. »Ich kann es kaum ertragen, Doreen hinter Gittern zu sehen. Sie könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Wirklich nicht! Dass man behauptet, sie hätte ihre eigene Tochter getötet, ist einfach lächerlich. Sie ist eine Heilerin, keine Mörderin!« Mit einer Geste der Frustration wischte sie sich eine Träne von der Wange. »Als ob der Verlust dieses lieben Kindes nicht schlimm genug wäre, nun auch noch das!«
Doreen griff zwischen den Gitterstäben hindurch und fasste die Nonne leicht an der Schulter. »Mir geht es gut, Schwester. Es ist alles ein Missverständnis. Ms Richmond und Ms Delaney werden es für uns in Ordnung bringen. Sie dürfen sich nicht so aufregen. Das bekommt Ihnen nicht.«
Schwester Mary Magdalen atmete tief durch, ohne den Blick von Doreens Augen zu nehmen. Und plötzlich wirkte sie nicht mehr alt und grau. »Aber sicher«, entgegnete sie. »Alles wird gut. Ich habe mich ein wenig zu sehr von Sorge auffressen lassen.« Sie atmete noch einmal durch und lächelte uns an. »Okay, was also unternehmen wir nun, um Doreen zu helfen?«
4
Tinkie und ich brüteten über einer Strategie, während wir das Courthouse verließen und zum Gesundheitsamt fuhren, um in Erfahrung zu bringen, ob dort eine Geburtsurkunde von Lilliths Tochter existierte. Sonderlich wichtig war es für unsere Ermittlungen nicht, aber ich wollte schwarz auf weiß lesen, dass Lillith Lucas in der Tat eine Tochter gehabt hatte.
Der Tag war wunderschön, mit klarem, goldenem Licht, und nur ein Hauch kühl. Tinkie kuschelte sich enger in ihren Sweater, weil ich mich weigerte, das Fenster ihres Autos hochzufahren. Während der vier Sommermonate war mein Haar ein wirres Etwas gewesen, das sich schwer um meinen Kopf gelegt hatte. Jetzt aber genoss ich das Gefühl, wie der Fahrtwind mit den Strähnen im Nacken spielte. Die Fee der niedrigen Luftfeuchtigkeit hatte schlackeschwere Locken in luftige Seide verwandelt.
»Sie hat es nicht getan«, erklärte Tinkie, als wir im Schatten eines Pekanbaumes parkten. Die Nüsse hatten herunterzufallen begonnen, und wir zerknackten mehrere davon mit den Reifen. Mit Mord in den Augen beobachteten uns drei Eichhörnchen.
»Wie kannst du dir so sicher sein?« Ich war erstaunt, dass Tinkie eine Frau in Schutz nahm, die sie kaum kannte. Tinkie war kein naives Provinzgänschen. Die meisten Menschen mussten sich ihr Vertrauen erst verdienen.
»Ich weiß es einfach«, meinte sie. »Weibliche Intuition.«
»Weil du keinem Baby etwas zuleide tun könntest«, entgegnete ich spitz. »Uns fällt es immer schwer zu glauben, jemand könnte etwas tun, das wir nicht übers Herz brächten. Trotzdem hat jemand die Kleine ermordet.«
»Vielleicht war es wirklich eine Verwechslung«, sinnierte Tinkie, während sie ausstieg. Sie blickte mich über das Dach hinweg an, und nie hatte ich sie mit ernsterem Gesicht gesehen. »Jeder macht mal einen Fehler. Ich meine, es ist drei Wochen her, seit das Baby gestorben ist. Man könnte doch im Labor etwas verwechselt haben. Vielleicht hat das Blut, das getestet wurde, gar nicht von Doreens Baby gestammt.«
Ich erhob keine Einwände. Stattdessen stieg ich die fünf Betonstufen in das verklinkerte Gebäude des Gesundheitsamts hinauf. An der Tür überfielen mich urplötzlich Erinnerungen. Als Kind war ich hier gewesen, bevor ich in die erste Klasse kam. Impfungen waren zwingend vorgeschrieben, auch wenn meine Mutter einen erstklassigen Protest gegen die Injektionen erhoben hatte. Sie war sich nicht sicher gewesen, ob die Impfungen wirklich ungefährlich oder überhaupt nötig waren, und wenn sie eins wusste, dann dass alles zwingend Vorgeschriebene nichts Gutes sein konnte. Sie protestierte, und ich lief davon. Trotzdem erwischten sie mich. Drei Angestellte umringten mich schließlich auf dem abgetretenen gelben Linoleumboden und hielten mich fest, während die Krankenschwester mich mit Antikörpern voll pumpte. Es war eine albtraumhafte Erinnerung.
Als ich in den Geruch nach Desinfektionsmittel und Alkohol eintauchte, war ich froh, Tinkie neben mir zu wissen. Ich merkte ihr an, dass auch sie von unangenehmen Erinnerungen überfallen wurde. Die Empfangstheke war unbesetzt, deshalb folgten wir dem stillen Korridor. In meinem Gedächtnis wimmelte es in der Klinik ständig von schreienden, verängstigten Kindern. Heute war nichts zu hören und niemand zu sehen. Außer der weiß gekleideten Gestalt, die uns plötzlich den Weg vertrat.
Penny McAdams hatte sich in den paar und zwanzig Jahren, seitdem ich kreischend und um mich tretend in ihr Büro gezerrt worden war, kein bisschen verändert. Sie trug die gleiche weiße Krankenschwesterntracht mit dem Fledermausflügelhut. Ihre Schuhe waren weiß und geräuschlos an weiß verhüllten Füßen und Beinen. Sie beäugte mich mit kühlem Erkennen.
»Sarah Booth Delaney«, sagte sie und nickte für sich. »Ich erinnere mich. Sie haben mir einmal gegen’s Schienbein getreten. Ihre Mutter hätte Sie dafür durchwalken sollen, aber das hat sie nicht getan. Sie hat sich selber aufgeführt wie ein verzogenes Balg.«
»Das ist lange her«, entgegnete ich und überlegte dabei, ob ich mich nun entschuldigen sollte, konnte aber nicht sagen, ob ich es aufrichtig gemeint hätte.
»Wir führen lückenlose Krankenblätter.« In ihren Worten schwang eine leise Drohung mit.
Ich lächelte. »Genau das wollte ich hören. Wir sind in offiziellem Auftrag hier und benötigen eine Kopie der Geburtsurkunde eines Kindes, das von Lillith Lucas zur Welt gebracht wurde.«
»Warum warten Sie nicht in meinem Büro?«, meinte sie. »Ich bin gleich wieder da.«
Wir setzten uns, und Penny ging ins Vorzimmer und blieb dort über eine Viertelstunde. Sie kam mit mehreren Aktenmappen wieder. Eine davon warf sie vor mich auf den Schreibtisch.
»Sie sind nicht zu Ihrer Auffrischungsimpfung gegen Diphterie gekommen«, schalt sie mich und durchbohrte mich mit ihrem Blick. »Krempeln Sie sich den Ärmel auf! Meine Schulimpfungen sind samt und sonders komplett erledigt, mit Ihnen als einziger Ausnahme.«
»Vergessen Sie’s!«, wagte ich zu antworten.
»Für etwas Kooperation wäre ich sehr dankbar«, entgegnete Penny mit einem Lächeln. Sie kämpfte mit harten Bandagen. Wenn ich bekommen wollte, was ich von ihr brauchte, müsste ich ihr geben, worauf sie es abgesehen hatte – ein Stück von meiner Haut.
»Sarah Booth hat ihre übrigen Impfungen im Bibellager von Jackson bekommen«, warf Tinkie mit unerschütterlicher Autorität ein. »Wir können die dort bitten, Ihnen den Eintrag zu faxen.«
Ich hätte Tinkie küssen können.
Penny schob meine Akte beiseite und nahm eine andere zur Hand. »Tinkie Richmond«, meinte sie sinnend. »Sie haben eine gute Partie gemacht bei Ihrer Heirat.« Mir warf sie noch einen missgünstigen Blick zu. Mein Versagen, was das Abschließen einer Ehe anging, stand gewiss unauslöschlich in meinem Krankenblatt vermerkt. Ich fragte mich nur, welche Diagnose unter dem Vermerk wohl zu lesen stünde. Weiblichkeitsstörung. Charmemangel. Hohes Anspruchssyndrom. Gedankenversunken hörte ich nicht, was die Schwester sagte, aber ich bemerkte Tinkies Reaktion: Sie wich in ihren Sessel zurück. »Wie bitte?«, fragte sie. »Was sagen Sie da?«
»Sind Sie je auf Würmer untersucht worden?« Penny lächelte.
»In meinem ganzen Leben habe ich keine Würmer gehabt! Wie kommen Sie nur dazu, mich so etwas zu fragen?«
»Weil bei Ihnen keine entsprechende Untersuchung eingetragen ist.« Penny sah sie besorgt an. »Würmer können eine recht ernste Sache sein. Der Test ist sehr simpel. Wir könnten es arrangieren, dass …«
»Ich habe keine Würmer, und ich lasse mich auf gar nichts untersuchen!« Tinkie war völlig entsetzt. Normalerweise genoss sie medizinische Aufmerksamkeit – vorausgesetzt, sie stammte von einem entsprechenden Mediziner, männlichen Geschlechts selbstverständlich, gut aussehend, fürsorglich und bereit, einer Südstaatenlady Trost zu spenden.
Penny ließ sich nicht abwimmeln. »Ich habe Fälle gesehen, die Sie nicht für möglich halten würden! Unbehandelt können Würmer den gesamten Verdauungstrakt durchdringen und den inneren Zusammenhalt so sehr schwächen, bis die Darmwand platzt. Das kann Ihnen bei einem Galadiner im The Club passieren oder beim Einkaufen, sogar beim Abendessen mit Freunden!«
»Tinkie hat keine Würmer«, mischte ich mich ein und sah, dass meine alte Furcht vor der Klinik restlos gerechtfertigt war. Schwester McAdams war eine Sadistin. »Haben Sie nun Geburtsurkunden von Lillith Lucas’ Kindern oder nicht?«, fragte ich in sachlich-kühlem Ton. »Doc Sawyer schickt uns.«
Doc hatte seine Praxis aufgegeben, arbeitete aber noch immer in der Notaufnahme und behandelte weiterhin ein paar alte Patienten. Gerade eben hatte ich mir erlaubt, ein altes Gerücht ins Spiel zu bringen, das mir im Hinterkopf herumgeschwirrt war: dass Penny McAdams einmal in Doc verknallt gewesen sei. Mit dieser Trumpfkarte erzielte ich ein beachtenswertes Ergebnis.
Sie kniff leicht die Augen zusammen. »Ich könnte Doc anrufen und mir das von ihm bestätigen lassen.«
»Bitte sehr. Er hat uns gebeten, Sie brav zu bitten, uns zu helfen.«
Sie räusperte sich und griff nach dem Stapel Krankenblätter. »Nun, auf Lillith Lucas sind drei Kinder registriert, auch wenn wir ihr jemanden ins Haus schicken und sie zwingen mussten, uns die nötigen Daten zu geben. Alle drei Babys sind von der Mutter ohne ärztliche Hilfe zu Hause auf die Welt gebracht worden, sogar ohne Hebamme. Bemerkenswert, dass unter diesen Umständen nur eins von ihnen gestorben ist.«
»Drei?«, fragten Tinkie und ich unisono.
Schwester McAdams sah uns lauernd an. »Masern können manchmal zu Taubheit führen. Ich muss mir unbedingt die Impfpässe Ihrer Mütter ansehen.«
»Hören können wir schon«, versicherte ich ihr, »wir hätten nur nicht mit drei Geburten gerechnet. Wir wussten nur von einer.«
»Auch wenn Sie es sich in den Kopf gesetzt haben, in jedermanns Angelegenheiten herumzuschnüffeln, Ms Delaney, wissen Sie dennoch nicht alles.« Sie brummte etwas vor sich hin, das klang wie ›hätte auch gegen Neugierde geimpft werden sollen‹.
»Könnten wir die Geburtsdaten der Kinder erfahren?«, fragte ich, denn ich hatte beschlossen, mir lieber eine Spritze in den Hintern rammen zu lassen, als in eine weitere Runde Konversation mit dieser Frau gehen zu müssen.
Mit einigem Widerstreben reichte sie uns die Geburtsurkunden. »Wenn Doc Sie nicht geschickt hätte, würde ich sie Ihnen nicht zeigen. Juristisch gesehen muss ich Ihnen überhaupt nichts vorlegen, das wissen Sie beide!«
Ich überflog die Dokumente. Lilliths erstes Kind war ein Junge, der zwei Jahre vor mir auf die Welt gekommen war. Auf der Urkunde standen weder Name noch Geburtsgewicht, keine Größe, kein behandelnder Arzt, keine Geburtszeit. Kein Vater war angegeben. Der Junge war lediglich als Baby Lucas aufgeführt, nur mit Geschlecht und Geburtsdatum.
Die zweite Geburtsurkunde gehörte zu einem Mädchen. Das Alter entsprach annähernd dem Doreens. Wieder waren weder Vater noch andere Einzelheiten angegeben: noch ein Baby Lucas.
Das dritte Kind war ein Junge, geboren im darauf folgenden Jahr. Aus der Urkunde ging sein Geburtstag hervor und dass er wenige Stunden nach der Entbindung gestorben sei. Er hatte nicht lange genug gelebt, um auch nur Baby Lucas genannt zu werden.
»Gibt es irgendeine Möglichkeit festzustellen, woran dieser Junge gestorben ist?«, fragte ich die Schwester.
»Klar, beauftragen Sie ein Medium!«
Tinkie, die von einer kurzzeitigen imaginären Reise in die teuflische Möglichkeit eines Wurmbefalls zurückgekehrt war, erhob sich zu ihrer vollen Größe von fünf Fuß und zwei Zoll. »Für solche Grobheiten besteht überhaupt keine Veranlassung«, sagte sie. »Wir wollen niemandem etwas und haben Sie um nichts gebeten, wofür Sie nicht bezahlt werden. Sie können uns mit keiner Nadel stechen, also geben Sie Ihr Möglichstes, um uns auf andere Weise leiden zu lassen. Nun, das funktioniert nicht. Ich werde das Gesundheitsamt von der Liste der förderungswürdigen Einrichtungen meiner Wohltätigkeitsvereine streichen.« Ihre Augen blitzten. »Und ich gehöre jedem einzelnen an. Sie bekommen keinen Penny mehr für Renovierungen.«
Ich presste die Lippen zusammen. Tinkie gehörte nun Pennys gesamte Aufmerksamkeit.
»Ich erinnere mich noch sehr deutlich an den Tod des Babys«, erklärte Penny. Sie war nicht freundlicher geworden, aber entgegenkommender. »Vom Aussehen her war es völlig gesund, aber es hat einfach zu atmen aufgehört. So jedenfalls hat Lillith es behauptet.«
»Gab es keine Autopsie?«, fragte ich.
»Kaum. Damals wäre niemand auch nur auf die Idee gekommen, eine Mutter könnte ihr eigenes Kind töten! Der Plötzliche Kindstod war selbstverständlich bekannt, auch wenn wir ihn noch nicht so nannten. Einige Säuglinge hörten einfach auf zu atmen. Von diesem Risiko wusste jeder.«
»Das kleine Mädchen wurde in der Nähe eines katholischen Klosters ausgesetzt«, fuhr ich fort. »Was ist aus dem ersten Jungen geworden?«
Penny zuckte mit den Schultern. »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das Gesundheitsamt ist dafür nicht zuständig. Damals hat sich nicht einmal die Wohlfahrt um solche Fälle gekümmert. Ich erinnere mich noch, dass einmal jemand Lillith nach den Kindern gefragt hat, und sie sagte, die Babys wären an gute Familien gegeben worden.«
»Sagte sie?« Tinkie verbarg ihre Ungläubigkeit nicht. »So ähnlich wie: Meine Hündin hat geworfen, und ich habe die Welpen in gute Hände gegeben?«
Penny lächelte tatsächlich. »Ganz genau. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an Lillith erinnern, aber sie war wirklich verrückt. Heute würde man sie wegschließen. Sie ist wie ein Flüchtling aus dem Irrenhaus durch die Stadt gelaufen, das Haar zu Rattenschwänzchen geflochten, hat jeden angeschrien und mit der Bibel bedroht. Egal, wohin sie ihre Kinder gegeben hat, es ist eine Verbesserung gewesen. Leute wie sie sollten von Staats wegen sterilisiert werden!«
Ich stand auf. Wir hatten alles erfahren, was sie uns verraten würde. »Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, Schwester McAdams.«
»Sagen Sie Doc, dass er mich das nächste Mal, wenn er meine Hilfe braucht, bitte selber anrufen soll«, meinte sie säuerlich.
»Ich werd’s ihm bestimmt bestellen«, versprach ich. Mit raschen Schritten gingen Tinkie und ich in die Oktobersonne hinaus.
»Das ist einfach unglaublich!«, ereiferte Tinkie sich, ihre Entrüstung stieg mit jeder ausgesprochenen Silbe. »Diese Kinder hätten in die Sklaverei verkauft werden können! Jeder Kinderhändler hätte leichtes Spiel gehabt!«
»Die Vergangenheit ist vorüber. Wir können nichts unternehmen. Wenn der Junge noch lebt, ist er älter als wir.«
Sie bückte sich und las eine Hand voll Pekannüsse auf. Sie knackte sie in der Hand, fischte den saftigen Inhalt heraus und bot mir die Hälfte an. »Hast du dich jemals gefragt, weshalb wir die Eltern bekommen haben, die wir hatten?«, fragte sie.
Nein, das hatte ich nicht. Nicht bis zu diesem Augenblick. Dennoch ließ sich die Frage nicht einfach auf die Seite schieben. Warum hatte ich liebevolle Eltern bekommen, während Doreen ausgerechnet von Lillith Lucas in die Welt gesetzt worden war?
Auf dem Rückweg nach Dahlia House versank ich in Schwermut. Nachdem Tinkie abgefahren war, wobei Chablis’ winzige Pfoten auf dem Lenkrad ruhten, als steuerte sie den Wagen, machte ich auf dem weiten Rasen vor dem Haus einen Spaziergang.
Als ich mich fünfzig Meter entfernt hatte, wandte ich mich um und blickte das alte Plantagenhaus mit neuen Augen an. Es war eine Schönheit, die von der Zeit mit Freundlichkeit behandelt worden war. Diesem Haus fehlte nichts, was man mit einem bisschen Farbe nicht wieder hätte ins Lot bringen können. Meine Vorfahren hatten ein Haus für die Ewigkeit errichtet. Welche Rolle spielte da ich in der langen Reihe von Delaneys? Diese Frage hätte eher zu Jitty gepasst, aber kaum zu mir.
Ich konnte nicht anders: Ich verglich Doreen mit meiner Erinnerung an ihre Mutter. An Doreen war ein Friede und eine Ruhe, denen selbst ich Anerkennung zollen musste. Lillith dagegen war Furcht einflößend gewesen. Selbstverständlich musste im Zentrum meiner Ermittlungen, die Doreens Entlastung galten, der Vater der kleinen Rebekah stehen, doch mich ließ die Frage nicht los, wer Doreens Vater gewesen und wie dieser mit Lillith zusammengekommen war, einer Frau, deren religiöse Ereiferung sich auf die Sünde der Fleischeslust zu konzentrieren schien. Welche Kombination von Genen hatte aus dem Rohmaterial Lilliths eine Frau geschaffen, deren Äußeres so viel Liebreiz zu verströmen vermochte wie das Doreens?
Doreen Mallory hatte die Tür zu einer Unzahl von Fragen aufgestoßen, deren Antwort ich wohl niemals erfahren würde. Es waren jedoch Fragen, die auch mich betrafen. Wie konnte es geschehen, dass ich in die Familie Delaney hineingeboren worden war? Stand dahinter nur eine zufällige Kombination von Chromosomen und chemischen Vorgängen, oder war dort noch mehr am Werk?