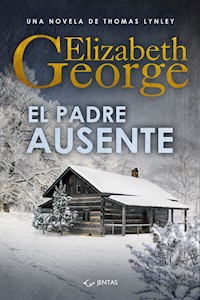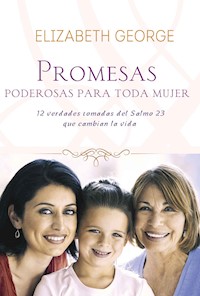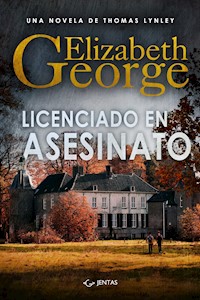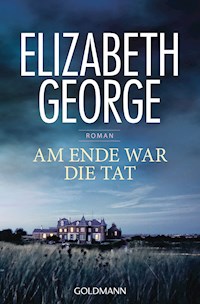
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
Chief Inspector Lynleys Frau Helen und sein ungeborenes Kind sind einem willkürlichen Akt sinnloser Gewalt zum Opfer gefallen. Doch was hat einen erst Zwölfjährigen zu dieser schrecklichen Bluttat getrieben?
Die Anatomie eines Mordes: Meisterhaft erzählt Elizabeth George die Geschichte des Jungen Joel, der sich im verzweifelten Versuch, sein Leben am Rande der Gesellschaft zu meistern, auf einen Pakt mit dem Teufel einlässt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1030
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Der sinnlose, brutale Mord an Lady Helen, Chief Inspector Lynleys Frau, hat alle Kollegen in Scotland Yard erschüttert. Am schlimmsten jedoch war die Erkenntnis, dass ein Zwölfjähriger die Tat verübte – wer ist dieser Joel Campbell? Und warum hat er geschossen?Als Kendra Osborne von der Arbeit nach Hause kommt, wartet eine Überraschung auf sie: Vor der Tür ihres Hauses in einem der ärmsten Londoner Stadtteile stehen die fünfzehnjährige Vanessa, der elfjährige Joel und der siebenjährige Toby, die Kinder ihrer Schwester. Seit der Vater der drei ums Leben kam und die Mutter in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde, lebten sie bei ihrer Großmutter. Doch die kehrt nun nach Jamaika zurück und denkt nicht daran, die Enkel mitzunehmen.Kendra richtet ein improvisiertes Nachtlager ein und organisiert den Schulbesuch der Kinder. Doch auf die Dauer ist sie überfordert – und die drei geraten in ein Milieu, das seine eigenen Gesetzte hat. Verzweifelt sieht Joel mit an, wie seine ältere Schwester im Drogensumpf zu versinken droht und sein kleiner Bruder ins Visier einer brutalen Straßenbande gerät. Ausgerechnet an einen berüchtigten Dealer wendet er sich um Hilfe. Und schließt damit einen Pakt mit dem Teufel …
Die Inspector-Lynley-Romane in chronologischer Reihenfolge:Mein ist die RacheGott schütze dieses HausKeiner werfe den ersten SteinAuf Ehre und GewissenDenn bitter ist der TodDenn keiner ist ohne SchuldAsche zu AscheIm Angesicht des FeindesDenn sie betrügt man nichtUndank ist der Väter LohnNie sollst du vergessenWer die Wahrheit suchtWo kein Zeuge istAm Ende war die TatDoch die Sünde ist scharlachrotWer dem Tode geweihtGlaube der LügeNur eine böse TatBedenke, was du tustWer Strafe verdient
Elizabeth George
Am Ende war die Tat
Roman
Deutschvon Ingrid Krane-Müschenund Michael J. Müschen
Die Originalausgabe erschien 2006unter dem Titel »What Came Before He Shot Her«bei HarperCollins Publishers, Inc., New York.
Für Grace TsukiyamaPolitisch LiberaleKreativer GeistMum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Neuausgabe August 2017Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCopyright © der Originalausgabe 2006by Susan Elizabeth GeorgeCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007by Blanvalet Verlag, Münchenin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: Lookphotos/Martin KreuzerFinePic®, MünchenTh · Herstellung: Str.ISBN 978-3-641-28193-9V002www.goldmann-verlag.de
Lieber ein authentischer Mammonals ein falscher Gott.
Louis MacNeice, Autumn Journal
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
1
Für Joel Campbell, elf Jahre alt, begann der Abstieg mit einer Busfahrt. Es war ein neuerer Bus, keiner dieser älteren Doppeldecker, er trug die Nummer 70 und bediente die Du Cane Road in East Acton – nur ein kurzes Stück auf dem nördlichen Abschnitt der Busroute, auf der es nicht sonderlich viel Bemerkenswertes zu sehen gab. Der südliche Abschnitt war ansehnlicher, führte am Victoria and Albert Museum und an den stattlichen weißen Gebäuden von Queen’s Gate in South Kensington vorbei. Im Norden jedoch lagen Stationen, die sich wie eine Liste zu meidender Örtlichkeiten in London lasen: die Swift Wash Laundry an der North Pole Road, H. J. Bent Bestattungsinstitut (Einäscherung und Bestattung) auf der Old Oak Common Lane, das unsägliche Gewirr von Läden an der turbulenten Kreuzung, wo die Western Avenue zum Western Way wird und Autos und Lastwagen dem Stadtzentrum zustreben. Drohend über alldem, fast wie Charles Dickens’ Feder entsprungen, ragt Wormwood Scrubs auf: nicht das von Bahnlinien begrenzte Stück Land namens Wormwood Scrubs, sondern das gleichnamige Gefängnis, das halb wie eine Festung, halb wie eine Klinik aussieht und ein Ort nicht enden wollender düsterer Realitäten ist.
Doch an diesem Januartag nahm Joel Campbell nichts von alledem zur Kenntnis, was draußen vor den Busfenstern vorüberglitt. Er war in Begleitung dreier weiterer Personen und spürte eine vage Hoffnung, dass sein Leben im Begriff war, sich zum Positiven zu wenden. Bis jetzt hatten East Acton und ein winziges Reihenhaus an der Henchman Street seine Lebensumstände umrissen: ein schäbiges Wohnzimmer und eine schmierige Küche im Erdgeschoss, drei Schlafzimmer oben und ein Fleckchen Grün vor dem Eingang, um welches die Gebäude sich hufeisenförmig drängten wie Kriegerwitwen um ein Grab. Vor fünfzig Jahren mochte die Siedlung einmal hübsch gewesen sein, doch eine jede Generation ihrer Bewohner hatte Spuren hinterlassen, und die Spuren der derzeitigen Bewohner bestanden vornehmlich aus Müll vor den Haustüren, zerbrochenem Spielzeug auf dem Gehweg, der die Gebäude miteinander verband, Plastikschneemännern und pummeligen Nikoläusen und Rentieren, die von November bis Mai auf den Dächern der Erkerfenster residierten, und einer Schlammpfütze inmitten des Rasens, die sich dort acht Monate des Jahres hielt und in der es wimmelte wie in dem Labor eines Insektenforschers. Joel war froh, diesen Ort hinter sich zu lassen, auch wenn sein Abschied eine lange Flugreise und ein neues Leben auf einer Insel mit sich brachte, die vollkommen anders war als die einzige Insel, die er bislang kannte.
»Ja-mai-ka.« Seine Großmutter sagte das Wort nicht, sie intonierte es vielmehr. Glory Campbell zog das »mai« in die Länge, bis es sich wie eine warme Brise anhörte, einladend und lau und verheißungsvoll. »Was sagt ihr dazu, ihr drei? Ja-mai-ka.«
»Ihr drei« waren die Campbell-Kinder – Opfer einer Tragödie, die sich eines Samstagvormittags auf der Old Oak Common Lane zugetragen hatte. Glorys ältester Sohn, der Vater der Kinder, war inzwischen ebenso tot wie ihr zweitältester, wenn auch unter völlig anderen Umständen. Die Kinder hießen Joel, Ness und Toby. Oder »arm’ klein’ Dinger«, wie Glory sie gern nannte, seit ihr Freund, George Gilbert, seinen Ausweisungsbescheid bekommen hatte und sie ahnte, worauf sein Leben fortan hinauslaufen würde.
»Arm’ klein’ Dinger« – diese Ausdrucksweise war neu und ungewohnt für Glory. Seit die Campbell-Kinder bei ihr lebten – was seit gut drei Jahren der Fall war und zum Dauerzustand zu werden schien –, hatte sie stets größten Wert auf eine korrekte Sprache gelegt. Auf der katholischen Mädchenschule von Kingston hatte sie selbst vor langer Zeit gelernt, Englisch zu sprechen wie die Queen. Das hatte ihr zwar nicht annähernd so viel genützt, wie sie gehofft hatte, als sie nach England emigrierte, aber sie konnte ihr Hochenglisch immer noch aus dem Hut zaubern, wenn etwa eine Verkäuferin zurechtgestutzt werden musste, und sie wollte, dass auch ihre Enkelkinder die Fähigkeit erwarben, Leute zurechtzustutzen, wenn es sich je als notwendig erweisen sollte.
Doch als Georges Ausweisungsbescheid eintraf – nachdem der dicke Umschlag geöffnet worden war und sein Inhalt gelesen, verdaut und verstanden und nachdem alle juristischen Schritte, das Unvermeidliche wenigstens aufzuschieben, wenn schon nicht zu verhindern, sich als ergebnislos erwiesen hatten –, legte Glory ihren englischen Patriotismus von einer Sekunde zur nächsten ab. Wenn ihr George sich auf den Weg nach Ja-mai-ka machte, dann würde sie das auch tun. Dort brauchte man kein königlich-makelloses Englisch. Vielmehr konnte es dort sogar ein Hindernis sein.
Also wandelten sich Tonfall, Satzmelodie und Syntax von Glorys charmant antiquiert wirkender Hochsprache zum honigweichen Karibischen. Sie wurde wieder zur »Eingeborenen«, wie ihre Nachbarn sagten.
George Gilbert hatte London bereits verlassen. Beamte der Einwanderungsbehörde hatten ihn nach Heathrow eskortiert, um das Versprechen des Premierministers einzulösen, etwas gegen jene Besucher zu unternehmen, die ihr Visum »überstrapazierten«. Sie waren in einem Zivilfahrzeug gekommen und hatten unablässig auf ihre Uhren geschaut, während George sich ausführlich von Glory verabschiedete – angenehm beflügelt von jamaikanischem Red-Stripe-Bier, auf das er angesichts der bevorstehenden Rückkehr zu seinen Wurzeln umgestiegen war. »Kommen Sie, Mr. Gilbert«, hatten sie gesagt und ihn an den Armen gepackt. Einer hatte die Hand in die Tasche gesteckt, als wolle er Handschellen hervorziehen für den Fall, dass George nicht kooperierte.
Aber George hatte keine Einwände dagegen, sie zu begleiten. Nichts war in Glorys Haushalt mehr so wie früher, seit die Enkel dort aufgeschlagen waren wie drei menschliche Meteoriten aus einer Galaxie, die er nie so recht begriffen hatte. »Die seh’n echt komisch aus, Glory«, hatte er manchmal gesagt, wenn er glaubte, die Kinder hörten es nicht. »Die Jungs jedenfalls, das Mädchen geht ja noch.«
»Bist du wohl still«, lautete Glorys Antwort dann immer. Schon das Blut ihrer eigenen Kinder war ein wildes Durcheinander, aber es war nichts im Vergleich zu dem Blut ihrer Enkel – und sie ließ nicht zu, dass irgendjemand sich über eine Tatsache mokierte, die ohnehin so unübersehbar war wie verbrannter Toast im Schnee. Außerdem war gemischtes Blut heutzutage keine Schande mehr wie in vergangenen Jahrhunderten. Es brandmarkte niemanden mehr.
Aber George schürzte die Lippen. Dann saugte er an den Zähnen, musterte die Campbell-Kinder aus dem Augenwinkel und bemerkte: »Die passen nicht nach Jamaika.«
Diese Einschätzung konnte Glory nicht abschrecken. Zumindest sah es so für ihre Enkel aus, als der Abschied von East Acton näher rückte. Glory verkaufte die Möbel. Sie verstaute die Küchenutensilien. Sie sortierte Kleider aus. Sie packte die Koffer, und als sich herausstellte, dass sie nicht ausreichend Platz hatten, um all das zu verstauen, was ihre Enkelin Ness mit nach Jamaika nehmen wollte, faltete sie diese Kleidungsstücke und stopfte sie in ihren Einkaufstrolley. Sie würden unterwegs einen zusätzlichen Koffer besorgen, verkündete sie.
Die kleine Prozession sorgte auf dem Weg zur Du Cane Road für Aufsehen: Glory führte sie an, in einem marineblauen Wintermantel, der ihr bis zu den Knöcheln reichte, und mit einem grün-orangefarbenen Turban auf dem Kopf. Ihr folgte der kleine Toby, trippelnd auf Zehenspitzen, wie es seine Gewohnheit war. Er trug einen aufgeblasenen Schwimmreifen um die Taille. Der Nächste, Joel, hatte seine liebe Mühe, Schritt zu halten, denn die beiden Koffer, die er schleppte, behinderten seine Schritte. Ness bildete die Nachhut. Sie hatte sich in eine Jeans gezwängt, die so eng war, dass man sich fragen musste, wie sie sich damit hinsetzen konnte, ohne dass die Nähte platzten. Das Mädchen stöckelte auf den zehn Zentimeter hohen Absätzen ihrer schwarzen Stiefel einher. Sie zog den Einkaufstrolley hinter sich her, und sie war alles andere als glücklich darüber. Genau genommen war sie über gar nichts glücklich. Ihre Miene war voller Hohn; ihr Schritt drückte Verachtung aus.
Es war ein kalter Tag, einer von der Sorte, wie es sie nur in London im Januar gibt. Feuchtigkeit lag schwer in der Luft, vermischt mit Autoabgasen und dem Ruß längst verbotener Kohleöfen. Der Nachtfrost war nicht getaut, und vereiste Gehwegplatten lauerten auf unachtsame Fußgänger. Alles war grau: vom Himmel über die Bäume und Straßen bis hin zu den Gebäuden. Und alles war beherrscht von einer Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit. Im schwindenden Tageslicht schienen Sonne und Frühling ein leeres Versprechen.
Selbst in London, wo man jeden nur denkbaren Anblick irgendwann schon einmal gesehen hatte, zogen die Campbell-Kinder im Bus neugierige Blicke auf sich; aus verschiedenen Gründen allerdings: Bei Toby waren es die mehr oder weniger kahlen Stellen an seinem Kopf, auf dem das Haar ungleichmäßig nachwuchs und für einen Siebenjährigen viel zu spärlich war – und natürlich der Schwimmreifen, der viel zu viel Platz beanspruchte, von dem er sich aber um keinen Preis trennen wollte. Auch Ness’ Vorschlag: »Nimm das verdammte Ding einfach in die Hand«, stieß nicht auf Gegenliebe. Bei Ness selbst war es der unnatürlich dunkle Ton ihrer Haut, offensichtlich durch Make-up verstärkt, als wolle sie ihre ethnische Herkunft schwärzer malen, als sie tatsächlich war. Hätte sie die Jacke ausgezogen, wäre außer ihrer Jeans auch ihrer übrigen Kleidung einige Aufmerksamkeit zuteilgeworden: Das paillettenbesetzte Top ließ ihren Bauchnabel frei und offenbarte ein üppiges Dekolleté. In Joels Fall waren es die münzgroßen Pigmentflecken im Gesicht, die man beim besten Willen nicht mehr als Sommersprossen abtun konnte und die eine physische Folge der ethnischen und genetischen Scharmützel waren, die sein Blut vom Moment seiner Zeugung an ausgetragen hatte. Und wie bei Toby war auch sein Haar auffällig: Unbändig und widerspenstig stand es vom Kopf ab wie rostige Stahlwolle. Nur Toby und Joel sahen aus, als könnten sie möglicherweise miteinander verwandt sein; und keines der Kinder hatte auch nur die geringste Ähnlichkeit mit Glory.
Also fielen sie auf. Nicht nur nahmen sie mit ihren Koffern, dem Einkaufstrolley und den fünf randvollen Sainsbury-Plastiktüten, die Glory zu ihren Füßen abgestellt hatte, fast den ganzen Platz im Gang ein. Sie boten eben auch einen denkwürdigen Anblick.
Von den vieren waren sich nur Joel und Ness der Blicke der übrigen Fahrgäste bewusst, und sie reagierten unterschiedlich darauf. Joel las aus jedem Blick: »Gelbärschiger Bastard«, und jedes Mal, wenn ein Augenpaar sich hastig abwandte, schien es ihm, als werde sein Recht, auf Erden zu wandeln, in Abrede gestellt. Dieselben Blicke deutete Ness als musternde Lüsternheit, und sie war versucht, ihre Jacke aufzureißen, ihre Brust vorzustrecken und zu schreien: »Willst du das, Mann? Isses das hier, was du willst?«, wie sie es häufig auf der Straße tat.
Glory und Toby hingegen hielten sich in ihren eigenen Welten auf. Bei Toby war dies der Normalzustand – eine Tatsache, über die niemand in der Familie besonders gern nachdachte. Bei Glory lag es eher an ihrer momentanen Situation und an der Lösung, die sie anstrebte.
Der Bus quälte sich die Strecke entlang und ließ die Pfützen, die der letzte Regen hinterlassen hatte, aufspritzen. Ohne Rücksicht auf die Sicherheit der Fahrgäste, die sich an die Haltestangen klammerten, steuerte er die Haltestellen am Straßenrand an, und es wurde immer voller und enger. So wie immer im winterlichen Londoner Personennahverkehr lief die Heizung auf Hochtouren, und da kein Fenster außer dem des Fahrers geöffnet werden konnte, war die Atemluft nicht nur warm und stickig, sondern ebenso angefüllt mit jenen Mikroorganismen, die unverwehrtes Niesen und Husten verbreiten.
All das gab Glory den Vorwand, den sie brauchte. Sie hatte die ganze Zeit über akribisch verfolgt, wo genau sie sich befanden, und wog alle nur erdenklichen Gründe ab, die sie für das, was sie zu tun gedachte, anführen konnte. Doch die Luft im Bus genügte völlig. Als sie auf Höhe der Chesterton Road über die Ladbroke Grove fuhren, drückte sie entschlossen den roten Halteknopf. »Raus hier«, teilte sie den Kindern mit, und mitsamt ihrer Habseligkeiten drängten sie sich zur Tür und in die wohltuend kalte Luft hinaus.
Dieser Ort war meilenweit entfernt von Jamaika und selbst von jedwedem Flughafen, wo sie einen Flieger in Richtung Westen hätten besteigen können. Doch ehe irgendjemand sie auf diese Tatsachen aufmerksam machen konnte, rückte Glory ihren Turban zurecht, der im Gedränge des Busses in Schieflage geraten war, und erklärte den Kindern: »Wir können ja wohl nich’ nach Ja-mai-ka, ohne dass ihr euch von eurem Tantchen verabschiedet, was?«
Bei diesem »Tantchen« handelte es sich um Glorys einzige Tochter, Kendra Osborne. Obwohl sie nur eine Busfahrt von East Acton entfernt lebte, hatten die Campbell-Kinder sie im Laufe der letzten drei Jahre nur wenige Male gesehen, zu den obligatorischen Familientreffen an Weihnachten und Ostern. Nicht dass sie und Glory entfremdet gewesen wären. Die Wahrheit war, dass die Frauen einander missbilligten – und diese Missbilligung betraf ihren Umgang mit Männern. Mehr als zweimal im Jahr zur Henchman Street zu kommen, hätte bedeutet, dass Kendra George Gilbert arbeitslos und unvermittelbar im Haus herumlungern gesehen hätte. Ein Besuch in North Kensington hätte Glory ihrerseits der Gefahr ausgesetzt, einem Exemplar aus der endlosen Reihe von Männern zu begegnen, die Kendra aufgabelte und alsbald wieder abservierte. Die beiden Frauen betrachteten ihre seltenen Begegnungen als eine Art Waffenstillstand. Das Telefon reichte ihnen für gewöhnlich, um Kontakt zu halten.
Als die Kinder hörten, dass sie einen Umweg zu ihrer Tante Kendra machen sollten, um sich zu verabschieden, reagierten sie daher mit Verwirrung, Überraschung und Argwohn. Toby glaubte, sie seien in Jamaika angekommen. Joel bemühte sich, die plötzliche Abweichung von ihrem Plan zu verarbeiten, und Ness murmelte: »Ja, klar«, als habe ein heimlich gehegter Verdacht sich gerade bestätigt.
Glory hörte darüber hinweg und übernahm wieder die Führung. Sie ging davon aus, dass ihre Enkel ihr folgen würden wie die Küken der Entenmutter. Was sonst blieb ihnen auch übrig in einer Londoner Gegend, in der sie sich nicht auskannten?
Glücklicherweise war es kein weiter Weg von der Ladbroke Grove zum Edenham Estate, doch schon auf der Golbourne Road erregten sie erneut Aufmerksamkeit. Dort war Markttag, auch wenn die Zahl der Stände nicht so beeindruckend war wie auf der Church Road oder in der Umgebung der Brick Lane. Am Obst- und Gemüsestand von E. Price & Söhne bedienten zwei ältere Herren – Vater und Sohn, die in Wahrheit jedoch eher wie Brüder aussahen – zwei Kundinnen und kommentierten die vorüberziehende Karawane von Fremdlingen. Ihre Kundinnen waren selbst einmal als Fremde in die Gegend gekommen, aber Vater und Sohn Price hatten gelernt, ihnen mit Respekt zu begegnen. Es blieb ihnen auch nicht viel anderes übrig, denn in den sechzig Jahren, in denen sie den Obst- und Gemüsestand betrieben, hatten sie erlebt, wie die englische Bevölkerung des Viertels, das Golbourne Ward genannt wurde, erst von Portugiesen verdrängt wurde und diese von Marokkanern, und sie wussten, es war weise, diese zahlende Kundschaft anzuerkennen.
Doch die kleine Gruppe, die da die Straße entlangmarschierte, hatte offensichtlich nicht die Absicht, etwas an den Marktständen zu kaufen. Vielmehr hielten sie den Blick auf die Portobello Bridge geheftet, und bald schon hatten sie sie überquert. Ein Stück die Elkstone Road hinab auf der anderen Seite lag in Hörweite des unablässigen Getöses der Westway-Überführung und gleich neben einem mäandrierenden Park namens Meanwhile Gardens die Edenham-Siedlung. Das zentrale Element dieser Siedlung war der Trellick Tower, der mit anmaßendem Stolz in die Höhe ragte: dreißig Stockwerke Sichtbeton, Hunderte von Balkonen an der Westfassade, auf denen Satellitenschüsseln, bunte Sichtschutzplanen und flatternde Wäscheleinen wie Unkraut wucherten. Der freistehende Aufzugschacht, der durch ein System von Brücken mit dem Hauptgebäude verbunden war, war das einzig Bemerkenswerte an diesem Turm. Davon abgesehen, glich er den meisten Massenunterkünften der Nachkriegszeit in der Stadt; riesige, graue Narben in der Landschaft, sichtbare Beweise fehlgeschlagener guter Absichten. Um den Turm gruppierte sich der Rest der Siedlung: Mehrfamilienhäuser, ein Seniorenheim und zwei Reihen mit Einfamilienhäuschen, die unmittelbar an Meanwhile Gardens grenzten.
In einem dieser Häuschen lebte Kendra Osborne. Dorthin führte Glory ihre Enkel, und mit einem Seufzer der Erleichterung ließ sie die Plastiktüten auf der oberen Treppenstufe vor Kendras Haustür fallen. Joel stellte die Koffer ab und rieb sich die schmerzenden Hände an den Seiten seiner Jeans. Toby blickte sich blinzelnd um, während seine Finger krampfhaft den Schwimmreifen kneteten. Ness rammte den Einkaufstrolley vor die Garagentür, verschränkte die Arme vor der Brust und warf ihrer Großmutter einen finsteren Blick zu, der zu sagen schien: Und was kommt als Nächstes, du Miststück?
Viel zu clever, dachte Glory beim Anblick ihrer Enkelin nervös. Ness war ihren Brüdern seit jeher immer ein gutes Stück voraus gewesen.
Glory wandte dem Mädchen den Rücken zu und drückte resolut die Klingel. Das Tageslicht schwand, und auch wenn Zeit angesichts ihres Plans nicht von essenzieller Wichtigkeit war, lag Glory doch daran, dass der nächste Abschnitt ihres Lebens möglichst bald beginne. Sie klingelte ein zweites Mal.
»Sieht nich’ so aus, als würden wir uns hier von irgendwem verabschieden, Gran«, bemerkte Ness säuerlich. »Dann geht’s wohl jetz’ gleich weiter zum Flughafen, was?«
Glory ignorierte sie. »Lass ma’ hintenrum gucken«, schlug sie vor und führte die Kinder zurück zur Straße und den schmalen Pfad zwischen den beiden Häuserreihen entlang zu den winzigen Gärtchen, die sich hinter einer Ziegelmauer versteckten. »Halt ma’ dein’ Bruder hoch«, bat Glory Joel. »Toby, guck ma, ob da drin Licht an is’.« Und an niemand Speziellen: »Kann sein, sie is’ wieder ma’ mit einem von ihren Typen zugange. Die Kendra, die denkt eh nur an das Eine.«
Joel kniete sich hin, sodass Toby auf seine Schultern klettern konnte. Obwohl der Schwimmreifen ihn dabei erheblich behinderte, tat Toby wie geheißen, klammerte sich an die Mauer und murmelte: »Die hat ’nen Grill, Joel«, und starrte wie gebannt darauf.
»Is’ Licht an?«, fragte Glory den Kleinen. »Toby, im Haus!«
Toby schüttelte den Kopf. Die dunklen Fenster im Obergeschoss konnte sie selbst sehen, und Glory nahm an, das hieß, dass auch im Erdgeschoss keine Lichter brannten. Aber wenn Glory sich auf eines verstand, war es Improvisation. »Tja …«, sagte sie, rieb sich die Hände und wollte fortfahren, als Ness sie unterbrach.
»Jetzt müssen wir doch tatsächlich einfach so nach Jamaika fahren, was, Gran?« Ness war am Anfang des Pfades stehen geblieben, die Hände in die Hüften gestemmt, das Gewicht auf ein Bein verlagert, den freien Fuß vorgestreckt. Ihre Jacke stand weit offen, sodass ihr nackter Bauch, der gepiercte Nabel und ihr beachtliches Dekolleté zu sehen waren.
Verführerisch, kam es Glory in den Sinn, doch sie verdrängte den Gedanken schnell, musste ihn verdrängen, wie sie es sich in den vergangenen Jahren, da sie ständig in der Gesellschaft ihrer Enkelin gewesen war, eingetrichtert hatte.
»Wir könn’ Tante Ken ja ’nen Zettel dalassen.«
»Kommt mit«, sagte Glory, führte sie zurück zur Vorderseite des Hauses, wo die Koffer, der Einkaufstrolley und die Plastiktüten in einem wilden Durcheinander herumstanden. Sie wies die Kinder an, sich auf die Eingangsstufe zu setzen, obwohl eigentlich auf einen Blick ersichtlich war, dass dort nicht genug Platz sein würde. Joel und Toby gehorchten, ließen sich zwischen den Tüten nieder, nur Ness blieb zurück, und ihr Ausdruck besagte, dass sie auf die unvermeidlichen Ausflüchte ihrer Großmutter geradezu lauerte.
»Ich bereite alles für euch vor«, sagte Glory. »Das dauert halt seine Zeit. Also fahr ich schon ma’ vor und lass euch nachkommen, wenn in Ja-mai-ka alles bereit für euch ist.«
Ness schnaubte höhnisch. Sie schaute sich um, als suche sie einen Zeugen für die Lügen ihrer Großmutter. »Wir soll’n bei Tante Kendra bleiben, ja?«, fragte sie. »Weiß die das überhaupt schon, Gran? Is’ sie überhaupt da? Oder in Urlaub? Oder umgezogen? Woher willst du überhaupt wissen, wo sie is’?«
Glory streifte sie mit einem Blick, wandte sich dann aber an die Jungen, die sich so viel bereitwilliger ihren Plänen beugen würden. Mit fünfzehn war Ness bereits viel zu gerissen. Aber mit elf und sieben hatten Joel und Toby noch viel zu lernen.
»Ich hab gestern mit eurer Tante gesprochen«, behauptete sie. »Die is’ nur ’n paar Sachen einkaufen. Will was Besonderes für euch zum Abendessen holen.«
Wieder ein ungläubiges Schnauben von Ness. Ein ernstes Nicken von Joel. Ein rastloses Hin- und Herrutschen von Toby. Er zupfte an Joels Jeans. Joel legte ihm den Arm um die Schultern. Der Anblick wärmte den kleinen Teil von Glorys Herz, der solcher Regungen noch fähig war. Sie würden schon zurechtkommen, versicherte sie sich.
»Ich muss los«, sagte sie. »Und ich will, dass ihr drei hier bleibt. Wartet auf euer Tantchen, ja? Die kommt gleich wieder. Holt nur euer Abendessen. Ihr wartet hier auf sie, ja? Treibt euch nich’ in der Gegend rum, ihr kennt euch nich’ aus, und ich will nich’, dass ihr hier rumirrt, kapiert? Ness, du passt auf Joel auf, und Joel, du auf Toby!«
»Ich werd doch nich’ …«, begann Ness. »Okay.« Das war alles, was Joel herausbrachte. Seine Kehle war zugeschnürt. Das Leben hatte ihn gelehrt, dass es Dinge gab, gegen die zu kämpfen keinen Sinn hatte, aber er hatte noch nicht gelernt, diese Dinge gar nicht erst an sich heranzulassen.
Glory gab ihm einen Kuss auf den Kopf. »Bis’n guter Junge«, sagte sie und tätschelte dann Toby abwesend. Schließlich ergriff sie ihren Koffer und zwei der Plastiktüten, trat zurück und atmete tief durch. Es war ihr nicht gerade recht, die Kinder hier allein zurückzulassen, aber sie wusste, Kendra würde bald nach Hause kommen. Sie hatte sie zwar nicht angerufen, aber Glory wusste: Abgesehen von ihrem Männerproblem war Kendra ein Muster an Verantwortungsbewusstsein. Sie hatte einen Job und ließ sich gerade zu einem weiteren umschulen, um nach ihrer gescheiterten letzten Ehe wieder auf die Füße zu kommen. Was sie wollte, war ein richtiger Beruf. Völlig ausgeschlossen, dass Kendra sich einfach so verdrückt hatte. Sie würde bald zurück sein. Es war schließlich bereits Zeit fürs Abendessen.
»Rührt euch nich’ hier weg, klar«, trug Glory ihren Enkeln auf. »Und gebt euerm Tantchen ’n dicken Kuss von mir.«
Mit diesen Worten wandte sie sich um. Ness versperrte ihr den Weg. Glory versuchte ein freundliches Lächeln. »Ich lass euch nachkommen, Liebes«, versicherte sie. »Du glaubs’ mir zwar nich’, das merk ich. Aber ich schwör bei Gott, Ness, ich lass euch nachkomm’. Ich und George suchen ein Haus, in dem wir alle wohnen könn’, und wenn das fertig is’ …«
Ness machte auf dem Absatz kehrt und ging – nicht in Richtung Elkstone Road, wohin Glorys Weg führte, sondern in die entgegengesetzte Richtung, vorbei an dem Pfad, der hinter der Häuserreihe verschwand, und weiter nach Meanwhile Gardens und allem, was dahinter liegen mochte.
Glory sah ihr nach. Ness’ Gang hatte etwas Gestelztes, und die Absätze ihrer Stiefel knallten wie Peitschenschläge in der kalten Luft. Und wie Peitschenschläge traf der Laut Glorys Gesicht. Sie hatte den Kindern nie Unrecht zufügen wollen. Auf manche Dinge hatte man einfach keinen Einfluss.
Sie rief Ness nach: »Soll ich George was von dir ausrichten? Er richtet ein Haus für dich ein, Nessa.«
Ness’ Schritte beschleunigten sich. Sie stolperte über eine Unebenheit im Gehweg, fiel aber nicht hin. Im nächsten Moment war sie um die Ecke verschwunden, und Glory lauschte vergeblich auf eine Antwort. Sie gierte nach etwas, was sie beruhigte und ihr bewies, dass sie nicht versagt hatte.
»Nessa? Vanessa Campbell?«, rief sie noch einmal.
Die einzige Antwort war ein gequälter Schluchzer, und Glory spürte, wie es ihr das Herz zerriss. Sie suchte bei den zwei Jungen, was deren Schwester ihr verweigert hatte.
»Ich hol euch nach«, sagte sie. »Ich und George, wenn wir das Haus fertig haben, bitten wir Tante Ken, alles in die Wege zu leiten. Ja-mai-ka.« Sie sang das Wort. Ja-mai-ka.
Toby rückte noch näher zu Joel. Joel nickte.
»Ihr glaubt mir doch?«, fragte ihre Großmutter.
Joel nickte wieder. Er wusste nicht, was er sonst hätte tun sollen.
Die Straßenlaternen gingen bereits an, als Ness das niedrige Ziegelgebäude am Rand von Meanwhile Gardens umrundete – eine Kindertagesstätte, um diese Zeit allerdings unbesucht, und als Ness einen Blick durchs Fenster warf, sah sie eine ältere Frau, die offenbar gerade dabei war, Feierabend zu machen. Hinter dem Gebäude breitete sich der Park aus wie ein Fächer. Ein Pfad schlängelte sich zwischen baumbestandenen Hügeln hindurch und führte zu einer Treppe. Diese Treppe schraubte sich in einer stählernen Spirale zu einer Brücke empor, die wiederum den Paddington-Arm des Grand Union Canal überspannte. Der Kanal bildete die nördliche Begrenzung von Meanwhile Gardens, trennte Edenham Estate von einem Sammelsurium von Bauwerken – moderne, schicke Mehrfamilienhäuser, Seite an Seite mit alten Mietskasernen, die daran erinnerten, dass ein Leben am Wasser nicht seit jeher als besonders erstrebenswert gegolten hatte.
Ness nahm einen Teil all dessen wahr, aber nicht alles. Sie steuerte auf die Treppe zu, die Brücke mit dem Eisengeländer und die Straße, die hinter dieser Brücke lag.
Innerlich brannte sie – so schlimm, dass ihr danach war, ihre Jacke zu Boden zu werfen und darauf herumzutrampeln. Aber trotz der Hitze in ihrem Innern war sie sich der Januarkälte bewusst, spürte sie dort, wo ihre Haut nackt war. Und sie fühlte sich unentrinnbar gefangen zwischen der innerlichen Hitze und der äußerlichen Kälte.
Sie erreichte die Treppe, ohne das Augenpaar zu bemerken, das sie aus dem Schatten einer jungen Eiche auf einem der Hügel in Meanwhile Gardens beobachtete. Ebenso wenig war sie sich des zweiten Augenpaares bewusst, das ihre Schritte über den Grand Union Canal von unterhalb der Brücke verfolgte. Sie wusste nicht, dass nach Einbruch der Dunkelheit – und manchmal auch schon eher – gewisse Transaktionen in Meanwhile Gardens durchgeführt wurden. Bargeld wanderte von einer Hand zur anderen, wurde verstohlen gezählt, und ebenso verstohlen wechselten illegale Substanzen den Besitzer. Und tatsächlich: Als Ness die Brücke erreichte, lösten die beiden Beobachter sich aus der Dunkelheit und traten aufeinander zu. Sie handelten ihre Geschäfte in so routinierter Weise ab, dass Ness es für ein vollkommen harmloses, freundschaftliches Treffen gehalten hätte, hätte sie es denn gesehen.
Aber sie war voll und ganz mit ihren eigenen Belangen beschäftigt: Sie musste der Hitze in ihrem Innern ein Ende setzen. Sie hatte weder Geld noch kannte sie sich in dieser Gegend aus, aber sie wusste, wonach sie Ausschau halten musste.
Von der Brücke aus sah sie sich um, um sich zu orientieren. Gegenüber lag ein Pub, dahinter je eine lange Häuserreihe auf beiden Straßenseiten. Ness schaute sich den Pub genauer an, entdeckte aber weder darin noch davor irgendetwas Vielversprechendes, also ging sie zu den Häusern hinüber. Irgendwo in der Nähe würden ein paar Geschäfte sein. Nach kaum fünfzig Metern fand sie, was sie suchte.
Vor einem Pizza-Take-away stand eine Gruppe von fünf Teenagern: drei Jungen und zwei Mädchen, allesamt Farbige, wenn auch unterschiedlicher Couleur. Die Jungen trugen Schlabberjeans, die Kapuzen ihrer Sweatshirts auf den Köpfen, schwere Anoraks darüber – eine Art Uniform in diesem Teil North Kensingtons. Ihre Montur zeigte dem Betrachter auf einen Blick, wo die Loyalität des Trägers lag. Ness wusste das. Und sie wusste auch, was von ihr erwartet wurde: Sie musste Härte mit Härte begegnen. Doch das war kein Problem für sie.
Die beiden Mädchen taten bereits genau das: Sie standen mit halb geschlossenen Lidern und herausgereckter Brust an die Scheibe von Tops Pizza gelehnt und schnipsten Asche von ihren Zigaretten auf den Gehweg. Wenn eine etwas sagte, warf sie dabei den Kopf zurück, während die Jungen sie umschlichen und sich aufplusterten wie Gockel: »Du bis’ echt scharf. Los, komm mit, wir mach’n Party.«
»Was hängste eigentlich noch hier rum? So toll ist die Gegend auch nicht. Ich könnt dir ma’ was richtig Tolles zeigen …«
Gelächter. Ness spürte, wie sich die Zehen in ihren Stiefeln krümmten. Es war immer das Gleiche: ein Ritual, das nur in den Folgen seines Ausganges variierte.
Die Mädchen spielten mit. Ihre Rolle schrieb vor, nicht zögerlich, sondern vielmehr verächtlich zu reagieren. Zögern machte Hoffnung; Verächtlichkeit hingegen hielt das Feuer in Gang. Was leicht zu haben war, war uninteressant.
Ness trat näher. Die Gruppe verstummte – in dieser einschüchternden Weise, die Heranwachsende an den Tag legen, wenn ein Fremder in ihre Mitte tritt. Ness wusste, wie wichtig es war, als Erste das Wort zu ergreifen. Das Wort, nicht die Erscheinung, prägte den ersten Eindruck, wenn man auf der Straße mehr als einem Menschen begegnete.
Sie nickte kurz in ihre Richtung und steckte die Hände in die Jackentaschen. »Wisst ihr, wo ich hier was kriegen kann?«, fragte sie. Sie presste ein Lachen hervor, warf dann einen Blick über die Schulter. »Scheiße. Ich könnt was brauchen.«
»Ich hätt da was, was du brauchen kannst, Süße.« Ness hatte keine andere Reaktion erwartet. Es war der größte der Jungen gewesen. Ness sah ihn scharf an und musterte ihn von Kopf bis Fuß, noch ehe er das Gleiche mit ihr tun konnte. Sie spürte, wie die beiden Mädchen sich ob der Invasion in ihr Territorium anspannten, und sie wusste, dass alles von ihrer Erwiderung abhing.
Sie verdrehte die Augen und wandte die Aufmerksamkeit den Mädchen zu. »Von den Typen hier is’ ja wohl nix zu erwarten, was?«
Die Üppigere der beiden lachte. Genau wie die Jungen nahm sie Ness in Augenschein, aber auf eine andere Art. Sie untersuchte Ness auf ihr Integrationspotenzial. Um ihr die Sache zu erleichtern, fragte Ness: »Lässte mich ma’ ziehen?«, und zeigte auf die Zigarette.
»Is’ aber kein Joint.«
»Is’ klar«, erwiderte Ness. »Aber wenigstens etwas. Und wie gesagt, ich kann echt was brauchen.«
»Süße, ich sag doch, ich hab genau, was du brauchs’. Wir geh’n um die Ecke, und ich zeig’s dir!« Wieder der Große. Die anderen grinsten. Sie traten von einem Fuß auf den anderen, schlugen die Fäuste gegeneinander und lachten.
Ness ignorierte sie. Das Mädchen reichte ihr die Zigarette, und sie nahm einen tiefen Zug. Sie musterte die beiden Mädchen, genau wie umgekehrt.
Niemand stellte sich vor. Das war Teil des Rituals. Einen Namen zu nennen, hieß, einen Schritt zu machen, und niemand wollte der Erste sein.
Ness gab die Zigarette zurück.
»Also, was willste?«
»Scheißegal«, antwortete Ness. »Koks, Gras, Olly, Ecstasy – irgendwas. Ich bin grad einfach nur so was von down, weißte.«
»Ich wüsst da was …« Wieder der Große.
»Halt’s Maul«, sagte das Mädchen. Und dann zu Ness: »Was haste denn dabei? Hier gibt’s nämlich nix umsonst.«
»Ich kann zahlen«, versicherte Ness. »Solang’s nich’ unbedingt Cash sein muss.«
»Hey, na dann, Baby …«
»Halt’s Maul«, fuhr das Mädchen den Großen wieder an. »Du nervst, Greve, kapiert?«
»Eh, Six, du reißt ganz schön die Klappe auf!«
»Heißt du so?«, fragte Ness sie. »Six?«
»Ja«, antwortete sie knapp. »Das da is’ Natasha. Und du?«
»Ness.«
»Cool.«
»Also, wo krieg ich hier was?«
Six deutete mit einer Kopfbewegung zu den Jungen hinüber. »Von denen garantiert nich’. Die reißen hier gar nix, das is’ ma’ klar.«
»Also, wo?«
Six’ Blick suchte einen der Jungen. Er stand ein Stück außerhalb des Kreises, schweigsam, beobachtend. »Liefert er heut Abend was?«
Der Junge zuckte nur leicht die Achseln, sagte jedoch nichts. Er sah Ness unfreundlich an. Schließlich sagte er: »Kommt drauf an. Und selbst wenn, heißt das noch lang nicht, dass er was lockermacht. Und überhaupt, er verschenkt nix, und er macht auch keine Deals mit Schlampen, die er nich’ kennt.«
»Ma’ halblang, Dashell«, entgegnete Six ungeduldig. »Die is cool, okay? Sei nich’ so’n Arsch.«
»Es geht nich’ nur um ’nen einmaligen Deal«, schaltete Ness sich ein. »Ich hab vor, regelmäßig zu kaufen.« Sie verlagerte das Gewicht von einem Fuß auf den anderen und wieder zurück – ein kleiner Tanz, der signalisierte, dass sie ihn anerkannte, seine Position in der Gruppe und seine Macht über sie.
Dashell sah von Ness zu den beiden anderen Mädchen. Seine Beziehung mit ihnen schien schließlich den Ausschlag zu geben. »Okay, ich frag ihn«, sagte er zu Six. »Klappt aber bestimmt nich’ vor halb zwölf.«
»Cool«, erwiderte Six. »Wo bringt er’s hin?«
»Wenn er überhaupt was rausrückt. Da mach dir ma’ kein’ Kopf. Er findet dich schon.« Ein kurzes Nicken zu den anderen beiden Jungen, und sie schlenderten in Richtung Harrow Road davon.
Ness sah ihnen nach. »Und der kann liefern?«, fragte sie Six.
»Klar. Er weiß, wen er anrufen muss. Der labert nicht nur, was, Tash?«
Natasha nickte und sah Dashell und seinen Freunden nach. »Der sorgt schon für uns«, sagte sie. »Aber nur der Tod ist umsonst hier in der Gegend.«
Es war eine Warnung, aber Ness war überzeugt, dass sie mit jedem fertig werden konnte. So wie sie die Lage einschätzte, war es gleichgültig, wie sie an das Zeug kam. Worauf es ankam, war Vergessen, und zwar für so lange wie möglich.
»Ich kann schon auf mich aufpassen«, versicherte sie Natasha. »Und was geht jetz’? Is’ noch ’ne Weile bis halb zwölf.«
Unterdessen warteten Joel und Toby weiter auf ihre Tante und saßen gehorsam auf der obersten der vier Stufen, die zur Haustür führten. Von hier aus boten sich ihnen zwei Aussichten: Trellick Tower mit seinen Balkonen und Fenstern, hinter denen seit mindestens einer Stunde die Lampen brannten; und die Häuserreihe direkt gegenüber. Nichts davon war interessant genug, um die Gedanken oder die Fantasie eines elfjährigen Jungen und seines siebenjährigen Bruders anzuregen.
Die Sinne der Jungen waren nichtsdestotrotz voll und ganz in Anspruch genommen: von der Kälte, dem unablässigen Verkehrslärm, der von der Überführung und von der U-Bahn von der »Hammersmith and City«-Linie herüberdrang, die in dieser Gegend keineswegs unterirdisch verlief, und – zumindest soweit es Joel betraf – von der zunehmenden Notwendigkeit, eine Toilette aufzusuchen.
Sie kannten diese Gegend nicht, darum nahm sie in der Dämmerung, die rasch zur Dunkelheit wurde, etwas Bedrohliches an. Schon die Männerstimmen, die sich näherten, konnten Gefahr bedeuten: Drogendealer, Straßenräuber, Einbrecher, Taschendiebe … Der Klang dröhnender Rapmusik aus einem vorüberfahrenden Auto auf der Elkstone Road westlich von ihnen mochte die Ankunft des Anführers einer Straßengang ankündigen, der sie anpöbelte und ein Pfand verlangte, das sie nicht würden zahlen können. Jeder, der in den Edenham Way einbog – die kleine Gasse, an der das Haus ihrer Tante lag –, würde sie sofort bemerken, argwöhnische Fragen stellen und vielleicht sogar die Polizei rufen, wenn sie keine befriedigenden Antworten gaben. Polizei würde kommen. Dann das Jugendamt. Und »Jugendamt« – dieses Wort, das zumindest in Joels Vorstellung nur aus Großbuchstaben bestand – war etwa genauso Furcht erregend wie der Schwarze Mann. Während die Eltern anderer Kinder vielleicht frustriert oder nur um Gehorsam zu erwirken ausrufen mochten: »Tu, was ich sage, oder ich schwöre, du kommst ins Heim«, war diese Drohung für die Campbell-Kinder durchaus real. Glory Campbells Abreise hatte sie nur noch einen Schritt näher dorthin gebracht. Ein Anruf bei der Polizei würde ihr Schicksal besiegeln.
So war Joel nicht sicher, was er tun sollte, als er und Toby schon über eine Stunde auf ihre Tante warteten. Er musste dringend zur Toilette, aber wenn er einen Passanten ansprach oder an einer Tür klingelte und fragte, ob er das Badezimmer benutzen dürfe, lief er Gefahr, Verdacht – oder zumindest Aufmerksamkeit – zu erregen. Also presste er die Beine zusammen und versuchte, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Zur Auswahl standen die bereits genannten Lärmquellen und sein kleiner Bruder.
Toby weilte in einer Welt, in der er schon seit langem den Großteil seiner Tage verbrachte. Er nannte sie Sosi, und sie war bevölkert von Leuten, die freundlich mit ihm sprachen, die für ihre Liebe zu Kindern und Tieren ebenso bekannt waren wie für ihre tröstlichen Umarmungen, die sie großzügig verteilten, wann immer ein kleiner Junge sich ängstigte. Mit angezogenen Knien und dem Schwimmreifen immer noch um den Bauch hatte Toby einen Platz, wo er sein Kinn ruhen lassen konnte, und das tat er, seit Joel und er sich auf der obersten Stufe niedergelassen hatten. Er hielt die Augen die ganze Zeit geschlossen.
Seine Sitzposition gewährte Joel freien Blick auf den Kopf seines Bruders – das Letzte, was Joel sehen wollte, abgesehen vielleicht von dem gelegentlichen beängstigenden Fußgänger, der durch die Siedlung kam. Denn Tobys Kopf mit den großen kahlen Stellen glich einer Anklage, einer bitteren Erinnerung an ein Pflichtversäumnis. Die Ursache für die kahlen Stellen war Klebstoff gewesen. Eine Horde junger Taugenichtse hatte die zähe Masse über seinem Kopf ausgeschüttet, und nur mittels einer Schere hatte sich das Ergebnis in einer schmerzhaften Prozedur entfernen lassen. Diese Horde angehender Gangster und die Grausamkeiten, die sie bei jeder Gelegenheit mit Toby getrieben hatten, waren zwei der Gründe, warum Joel nicht traurig war, East Acton zu verlassen. Wegen dieser Halbstarken hatte Toby niemals allein losgehen können, um sich bei Ankaran Food & Wine ein paar Süßigkeiten zu kaufen, und wenn Glory Campbell ihm gelegentlich Geld fürs Mittagessen statt eines Sandwichs mitgegeben hatte, besaß Toby die Münzen zur Mittagszeit nur dann noch, wenn seine Peiniger sich ausnahmsweise einmal ein anderes Opfer gesucht hatten.
Joel wollte den Kopf seines Bruders nicht anschauen, weil der Anblick ihn daran erinnerte, dass er nicht da gewesen war, als die Jugendlichen Toby wieder einmal zugesetzt hatten. Da Joel sich zum Beschützer seines kleinen Bruders ernannt hatte, hatte es in seiner Brust gebrannt, dass er kaum atmen konnte, als Toby die Henchman Street entlanggekommen war, die Kapuze seines Anoraks am Kopf festgeklebt. Und als Glory, deren Schuldgefühle sich gern in Wut ausdrückten, zu wissen verlangte, wie Joel zulassen konnte, dass seinem kleinen Bruder so etwas zustieß, hatte er nur beschämt den Kopf senken können.
Joel holte Toby ins Hier und Jetzt zurück, um ihn nicht länger ansehen zu müssen, aber auch, weil der Drang, die Blase zu leeren, allmählich unerträglich wurde. Er wusste, dass sein Bruder nicht schlief, aber ihn seiner Traumwelt zu entreißen, war, als versuche man, ein schlafendes Baby zu wecken. Als Toby endlich den Kopf hob, stand Joel auf und sagte verwegener, als er sich fühlte: »Komm, Mann, wir geh’n uns ma’n bisschen umseh’n hier.« Toby war in höchstem Maße erfreut, »Mann« genannt zu werden, und willigte sofort ein, ohne den berechtigten Einwand vorzubringen, dass es unklug wäre, ihre Habseligkeiten in einer Gegend zurückzulassen, wo sie möglicherweise gestohlen werden konnten.
Sie gingen in die Richtung, die auch Ness eingeschlagen hatte: an den Häusern entlang auf Meanwhile Gardens zu. Doch statt an der Kindertagesstätte vorbeizugehen, folgten sie dem Pfad, der die rückwärtigen Gartenmauern der Häuserreihe säumte. Dieser Pfad führte zum östlichen Teil des Parks, der sich hier zu einem Streifen Buschwerk verjüngte, begrenzt von einem asphaltierten Weg und dem Kanal dahinter.
Joel konnte dem Gebüsch nicht widerstehen. »Sekunde, Tobe«, sagte er, und während Toby treuherzig zu ihm aufblinzelte, tat Joel das, was die meisten Männer in London ohne jedes Schamgefühl tun, wenn der Drang sie überkommt: Er pinkelte in die Büsche. Die Erleichterung war sagenhaft. Sie gab ihm neuen Schwung. Die Ängste, die die Siedlung zuvor in ihm ausgelöst hatte, waren so gut wie verflogen, und er nickte in Richtung des Asphaltwegs jenseits des Gebüschs und setzte sich in Bewegung. Toby folgte.
Nach gut dreißig Schritten blickten sie auf einen Teich hinab. Das Wasser glitzerte schwarz und bedrohlich, doch ein Wasservogel, der im Uferschilf hockte und mit dem Schnabel klapperte, vertrieb die unheimliche Stimmung. Schwaches Licht fiel auf einen Holzsteg. Ein gewundener Pfad führte dorthin, und die Jungen eilten hinunter. Sie polterten über die Holzbohlen und knieten am Rand des Stegs nieder. Links und rechts von ihnen flohen Enten ins Wasser und paddelten davon.
»Cool, was, Joel?« Toby schaute sich lächelnd um. »Wir könnten uns hier ein Fort bau’n. Bitte! Wenn wir’s hinter den Büschen da bau’n, kann keiner …«
»Pssst!« Joel legte seinem Bruder eine Hand auf den Mund. Er hatte gehört, was Toby in seiner Erregung nicht wahrgenommen hatte: Mehrere Personen gingen oben den Fußweg am Grand Union Canal entlang – junge Männer, dem Klang der Schritte nach.
»Gib ma’ den Joint rüber, Mann. Sei nich’ so geizig.«
»Was zahlst ’n? Ich bin doch nich’ das Sozialamt, Mann.«
»Komm schon, du lieferst hier doch eh überall Gras und Dope aus.«
»Hey, geh mir nich’ auf’n Sack.«
Die Stimmen verhallten. Sobald die Jungen fort waren, stand Joel auf und kletterte die Böschung hinauf. Toby flüsterte ängstlich seinen Namen, aber Joel brachte ihn mit einer schnellen Geste zum Schweigen. Er wollte wissen, wer diese Jungen waren, um abschätzen zu können, was dieser Ort für sie bereithielt. Oben angekommen, konnte er auf dem Pfad jedoch nichts als Schemen erkennen, Silhouetten an der Wegbiegung. Es waren vier, alle identisch gekleidet: weite Jeans, Sweatshirts mit hochgezogenen Kapuzen und Anoraks. Behindert durch den tiefhängenden Schritt ihrer Hosen, hatten sie einen schlurfenden Gang. Auf den ersten Blick wirkten sie alles andere als bedrohlich. Aber ihre Unterhaltung hatte etwas anderes offenbart.
Auf Joels rechter Seite erhob sich ein Ruf, und er entdeckte in der Ferne jemanden auf der Brücke, die den Kanal überspannte. Zu seiner Linken wandten die Jungen sich um, um zu sehen, wer sie gerufen hatte. Ein Rasta, meinte Joel zu erkennen. Er hielt eine Sandwichtüte in der ausgestreckten Hand.
Joel hatte genug erfahren. Er duckte sich und glitt die Böschung hinab zu Toby. »Wir hau’n lieber ab, Mann«, sagte er und zog Toby auf die Füße.
»Wir könn’ ein Fort bauen …«, begann Toby.
»Nicht jetzt«, zischte Joel. Er führte ihn in die Richtung, aus der sie gekommen waren, bis sie zurück vor der Haustür ihrer Tante und vergleichsweise in Sicherheit waren.
2
Kendra Osborne kehrte an diesem Abend um kurz nach sieben nach Edenham zurück. Sie kam in einem alten Fiat Punto um die Ecke der Elkstone Road geknattert. Bekannte konnten Kendra in ihrem Kleinwagen immer mühelos an der Beifahrertür erkennen, auf die irgendjemand in blutrot triefender Farbe »Blas mir einen« gesprayt hatte. Kendra hatte die krude Aufforderung stehen lassen, nicht weil sie es sich nicht hätte leisten können, die Tür neu lackieren zu lassen, sondern weil ihr einfach die Zeit dazu fehlte. Sie arbeitete an der Kasse in einem Wohltätigkeitsladen der AIDS-Stiftung auf der Harrow Road und bastelte gleichzeitig an einer Karriere als Masseurin. Letztere befand sich allerdings noch in den Kinderschuhen. Kendra hatte achtzehn Monate lang Kurse am Kensington and Chelsea College besucht, und seit sechs Wochen versuchte sie, sich als freiberufliche Masseurin zu etablieren.
Dabei hatte sie vor, zweigleisig zu verfahren: Sie wollte das kleine Gästezimmer in ihrem Haus für die Kunden nutzen, die lieber zu ihr kommen wollten, und gedachte, mit einem zusammenklappbaren Massagetisch und den Ölen im Kofferraum diejenigen Kunden zu besuchen, die in den eigenen vier Wänden massiert werden wollten. Die Kosten für die Anfahrt würde sie natürlich berechnen. Nach und nach würde sie genügend Geld sparen, um ihren eigenen kleinen Massagesalon zu eröffnen.
Massage- und Sonnenstudio. Sonnenbänke und Massageliegen. Das war es, was ihr vorschwebte, und damit bewies sie ein gewisses Einfühlungsvermögen in die Psyche ihrer bleichgesichtigen Mitbürger. Da in diesen Breitengraden das Wetter häufig verhinderte, dass man sich schöner und vor allem natürlich gebräunter Haut erfreuen konnte, hatten mindestens drei Generationen weißer Engländer sich an den seltenen Tagen, da die Sonne schien, regelmäßig Verbrennungen ersten oder gar zweiten Grades eingehandelt. Kendra hatte die Absicht, die Neigung dieser Menschen, sich ultravioletten Strahlen auszusetzen, gewinnbringend zu nutzen. Mit der Sonnenbräune, die sie ersehnten, würde Kendra sie anlocken, um sie dann später mit den Segnungen einer therapeutischen Massage bekannt zu machen. Denjenigen Kunden wiederum, die sie schon bei sich oder bei ihnen zu Hause massiert hatte, würde sie die zweifelhaften Vorzüge von Sonnenbänken anpreisen – der perfekte Plan zum sicheren Erfolg.
Kendra wusste, all das würde viel Zeit und Mühe kosten, aber sie war noch nie vor harter Arbeit zurückgeschreckt. In diesem Punkt unterschied sie sich grundlegend von ihrer Mutter. Und das war nicht der einzige Aspekt, in dem Kendra Osborne und Glory Campbell sich unterschieden.
Der zweite war – Männer. Ohne Mann fühlte Glory sich verängstigt und unvollkommen, ganz gleich, was er darstellte oder wie er sie behandelte. Allein deshalb saß sie auch genau in diesem Moment am Abflug-Gate des Flughafens, auf dem Weg zu einem heruntergekommenen jamaikanischen Alkoholiker mit fragwürdiger Vergangenheit und absolut keiner Zukunft. Kendra hingegen stand auf eigenen Füßen. Sie war zweimal verheiratet gewesen. Einmal verwitwet und jetzt geschieden, sagte sie gern; sie habe »ihre Zeit abgebüßt« – mit einem Hauptgewinn und einer totalen Niete –, und derzeit verbüßte ihr zweiter Mann gerade seine Zeit. Sie hatte nichts gegen Männer, aber sie war zu der Einsicht gekommen, dass sie nur dazu taugten, gewisse körperliche Bedürfnisse zu befriedigen.
Wenn diese Bedürfnisse sie überkamen, hatte Kendra nie Probleme, einen Mann zu finden, der sich der Angelegenheit annahm. Einen Abend mit ihrer besten Freundin um die Häuser gezogen, und in der Regel war das Problem gelöst, denn mit vierzig war Kendra immer noch eine kaffeebraune, exotische Schönheit, und sie war durchaus bereit, ihr Äußeres einzusetzen, um zu bekommen, was sie wollte: ein bisschen Spaß ohne Verpflichtungen. In Anbetracht ihrer Karrierepläne hatte sie in ihrem Leben keinen Platz für einen liebeskranken Mann, der irgendetwas anderes von ihr wollte als bloßen – wenn auch geschützten – Sex.
Als Kendra in die schmale Garageneinfahrt vor ihrem Haus einbog, waren Joel und Toby bereits seit einer Stunde von ihrem Ausflug zum Ententeich in Meanwhile Gardens zurück und saßen mit tauben Hinterteilen in der eisigen Kälte wieder auf der Treppe. Kendra entdeckte ihre Neffen zuerst nicht, weil die Straßenlaterne schon seit letztem Oktober kaputt war, und es sah nicht so aus, als hätte irgendjemand die Absicht, sie in naher Zukunft zu reparieren. Was sie stattdessen sah, war ein Einkaufstrolley, den irgendwer mit Habseligkeiten vollgestopft und dann vor ihrer Garage abgestellt hatte.
Zunächst glaubte Kendra, die Sachen seien für den Secondhandladen bestimmt, und obwohl sie es nicht sonderlich schätzte, wenn die Nachbarn ihre aussortierten Kleidungsstücke vor ihrer Haustür abluden, statt sie zur Harrow Road zu bringen, wäre es Kendra dennoch nicht in den Sinn gekommen, Waren zu verschmähen, die sich vielleicht noch verkaufen ließen. Darum war sie immer noch bester Laune, als sie aus dem Wagen stieg, um den Trolley beiseitezuschieben. Sie hatte einen erfolgreichen Nachmittag in einem Fitnessstudio in der Portobello Green Arcade verbracht, wo sie ihre Sportmassagen vorgeführt hatte.
Dann sah sie die Jungen, ihre Koffer und Plastiktüten. Auf einen Schlag verspürte Kendra Furcht, und Erkenntnis folgte der Furcht auf dem Fuße.
Sie schloss die Garage auf und öffnete das Tor, ohne ein Wort an ihre Neffen zu richten. Sie wusste ganz genau, was jetzt kommen würde, und sie fluchte – leise genug, dass die Jungen sie nicht hören konnten, aber doch so laut, dass es ihr ein klein wenig Erleichterung verschaffte: »Scheiße.« Und: »Diese blöde alte Kuh.« Dann stieg sie wieder in den Fiat, setzte ihn in die Garage und sann fieberhaft auf einen Ausweg, um sich nicht mit dem Problem befassen zu müssen, das ihre Mutter dort vor ihrer Haustür abgeladen hatte. Ihr fiel nichts ein.
Sie stieg wieder aus und umrundete den Wagen, um ihren Massagetisch aus dem Kofferraum zu holen. Joel und Toby standen auf und traten näher, blieben jedoch unsicher an der Hausecke stehen, Joel vorn, Toby wie üblich sein getreuer Schatten.
Ohne Gruß oder Vorrede sagte Joel: »Gran sagt, sie muss erst ein Haus einrichten, eh’ wir zu ihr nach Jamaika zieh’n könn’. Sie holt uns, wenn alles fertig is’. Sie sagt, wir soll’n hier auf sie warten.«
Kendra antwortete nicht. Die Stimme ihres Neffen und sein hoffnungsvoller Tonfall trieben ihr Tränen in die Augen, was weit mehr mit der Grausamkeit ihrer Mutter als mit Kendras eigenen Empfindungen zu tun hatte.
Joel fuhr noch eifriger fort: »Wie geht’s dir denn so, Tante Ken? Soll ich mit anfass’n?«
Toby schwieg. Er blieb in der dunklen Einfahrt zurück und vollführte einen kleinen Tanz auf Zehenspitzen – eine bizarre Ballerina, die ein Solo tanzte. In einem Wasserballett.
»Warum zum Henker trägt er dieses Ding?«, fragte Kendra Joel und machte eine schnelle Kopfbewegung hin zu seinem Bruder.
»Den Schwimmreifen? Den mag er im Moment einfach am liebsten. Gran hat ihn ihm zu Weihnachten geschenkt, weißte noch? Sie hat gesagt, in Jamaika kann er …«
»Ich weiß, was sie gesagt hat«, unterbrach Kendra schroff. Der plötzliche Zorn, den sie verspürte, richtete sich nicht gegen ihren Neffen, sondern gegen sich selbst, weil ihr plötzlich aufging, dass sie es damals schon hätte ahnen müssen. Schon an Weihnachten hätte ihr klar werden müssen, was Glory Campbell im Schilde führte, gleich im ersten Moment, als sie feierlich verkündet hatte, sie wolle ihrem nichtsnutzigen Freund zurück in ihrer beider Heimatland folgen. Kendra hätte sich ohrfeigen können, weil sie Scheuklappen getragen hatte.
»Die Kinder werden Jamaika lieben«, hatte Glory gesagt. »Und George wird besser zurechtkommen. Mit den Kindern, mein’ ich. War nich’ leicht für ihn, weiß’ du, drei Kinder und wir in der winzigen Bude. Wir steh’n uns gegenseitig auf den Füßen.«
Und Kendra hatte erwidert: »Du kannst sie nicht nach Jamaika verschleppen. Was ist mit ihrer Mutter?«
Worauf Glory geantwortet hatte: »Carole wird wahrscheinlich nich’ ma’ merken, dass sie weg sind.«
Während Kendra noch den Massagetisch aus dem Kofferraum wuchtete, wurde ihr klar, dass Glory irgendwann genau dieses Argument als Ausrede vorbringen würde, in dem Brief, der lange nach ihrer Abreise kommen würde, wenn sie es nicht länger aufschieben konnte. Ich habe gründlich darüber nachgedacht, würde sie erklären. Kendra wusste, ihre Mutter würde ihr einstmals makelloses Englisch für diesen Anlass verwenden und nicht das jamaikanische, das sie sich in Vorbereitung auf ihr neues Leben wieder zugelegt hatte. Und ich habe mich daran erinnert, was du über die arme Carole gesagt hast. Du hattest recht, Ken. Ich kann ihr die Kinder nicht wegnehmen und so eine große Entfernung zwischen sie bringen. Und damit wäre die Angelegenheit erledigt. Ihre Mutter war kein boshafter Mensch, aber sie hatte immer fest daran geglaubt, dass man Prioritäten setzen musste. Und da Glorys oberste Priorität immer das eigene Wohl gewesen war, war es unwahrscheinlich, dass sie je etwas zu ihrem eigenen Nachteil tun würde. Drei Enkelkinder in Jamaika in ein und demselben Haushalt mit einem unnützen, arbeitslosen, Karten spielenden, Fernseh glotzenden Exemplar übergewichtiger und übel riechender Männlichkeit, an das Glory sich mit aller Gewalt klammerte, weil sie nie in der Lage gewesen war, auch nur eine Woche lang ohne Mann auszukommen, und in dem Alter war, da Männer nicht mehr so leicht zu haben waren … Ein solches Szenario musste selbst einem minderbemittelten Volltrottel als nachteilig erscheinen.
Kendra knallte den Kofferraumdeckel zu. Sie stöhnte, als sie den schweren Klapptisch am Griff packte.
Joel eilte hinzu, um ihr zu helfen. »Ich nehm das, Tante Ken«, sagte er, als glaube er wirklich, dass er mit der Größe und dem Gewicht fertig werden konnte.
Wider Willen schmolz Kendra ein wenig. »Geht schon. Aber du könntest das Garagentor schließen. Und bring den Trolley und eure anderen Sachen ins Haus.«
Während Joel ihrer Anweisung folgte, sah Kendra zu Toby. Der kurze Moment der Versöhnlichkeit verflog. Was sie sah, waren das Rätsel, das jeder sah, und die Verantwortung, die niemand wollte. Die einzige Antwort auf die Frage, was denn mit Toby eigentlich nicht stimmte, die man je zu geben gewagt hatte, war das nutzlose Etikett »defizitäres Sozialverhalten« gewesen, und in dem allgemeinen Chaos, das kurz vor seinem vierten Geburtstag zur Normalität geworden war, hatte niemand den Mut aufgebracht, den Dingen weiter auf den Grund zu gehen. Auch Kendra wusste nicht mehr über dieses Kind, als was sie vor sich sah – und dennoch fand sie sich plötzlich in der Zwangslage, mit ihm zurechtkommen zu müssen, bis sie eine Möglichkeit auftat, sich dieser Verantwortung wieder zu entledigen.
Als sie ihn so dastehen sah – mit dem lächerlichen Schwimmreifen, den kahlen Stellen am Kopf, die Jeans zu lang, die Turnschuhe mit Klebeband verschlossen, weil er nie gelernt hatte, sich die Schuhe zu binden –, wollte sie am liebsten einfach weglaufen.
»Na«, sagte sie kurz angebunden zu Toby. »Und du? Alles klar?«
Toby hielt in seinem Tanz inne und sah zu Joel, auf der Suche nach einem Hinweis darauf, was er tun sollte. Als Joel ihm keinen Hinweis gab, sagte er zu seiner Tante: »Ich muss ma’. Is’ das hier Jamaika?«
»Tobe. Du weiß’, dass es das nich’ is’«, warf Joel ein.
»Nicht ist«, verbesserte Kendra. »Sprich anständig in meiner Gegenwart. Ich weiß, dass du dazu in der Lage bist.«
»Tobe, das hier ist nicht Jamaika«, sagte Joel folgsam.
Kendra führte die Jungen ins Haus und schaltete die Lichter im Erdgeschoss ein, während Joel zwei Koffer, die Plastiktüten und den Trolley hereinbrachte. An der Tür blieb er stehen und sah sich verstohlen um. Er war nie zuvor im Haus seiner Tante gewesen. Was er sah, war eine noch kleinere Wohnstatt als das Haus an der Henchman Street.
Im Erdgeschoss gab es nur zwei Zimmer, dahinter versteckt ein winziges WC. Eine Art Essecke gleich am Eingang, dann die Küche mit einem Fenster, das jetzt nachtschwarz war und Kendras Spiegelbild zurückwarf, als sie das Deckenlicht einschaltete. Zwei Türen im rechten Winkel zueinander machten die hintere linke Küchenecke aus. Eine führte in den Garten mit dem Grill, den Toby gesehen hatte, die andere stand offen und gewährte einen Blick auf die Treppe. Zwei Stockwerke lagen darüber, wie Joel später entdecken sollte. Im ersten befand sich das Wohnzimmer, im zweiten das Bad und zwei Schlafzimmer.
Kendra schleppte den Massagetisch auf die Treppe zu. Joel eilte zu ihr, um ihr zu helfen. »Soll der nach oben, Tante Ken? Ich kann das machen. Ich bin stärker, als ich ausseh.«
»Kümmere dich um Toby«, erwiderte Kendra. »Sieh ihn dir doch an, er muss zum Klo.«
Joel sah sich suchend nach einer Toilette um, ein Blick, den Kendra vielleicht hätte sehen und interpretieren können, hätte sie irgendetwas wahrgenommen außer dem Gefühl, dass die Wände ihres Hauses auf sie einstürzten. Sie machte sich an den Aufstieg. Joel, der keine Fragen stellen wollte, die ihn vielleicht dumm erscheinen ließen, wartete, bis er seine Tante auf der Treppe hörte, wo das anhaltende Gepolter darauf hinwies, dass sie den Massagetisch in die oberste Etage brachte. Dann schloss er die Gartentür auf und führte seinen Bruder hastig ins Freie. Toby erhob keine Einwände, sondern pinkelte in das erstbeste Blumenbeet.
Als Kendra zurück nach unten kam, standen die Jungen wieder bei den Koffern und dem Einkaufstrolley. Kendra hatte eine Weile in ihrem Schlafzimmer verharrt und versucht, sich zu beruhigen, einen Schlachtplan zu entwerfen, doch ihr war keine Lösung eingefallen, die ihr Leben nicht vollkommen auf den Kopf stellen würde. Sie war an dem Punkt angelangt, da sie eine Frage stellen musste, deren Antwort sie lieber gar nicht hören wollte. Sie wandte sich an Joel. »Und wo ist Vanessa? Ist sie mit eurer Großmutter gegangen?«
Joel schüttelte den Kopf. »Sie läuft da draußen irgendwo rum«, antwortete er. »Sie wa’ zickig und …«
»Wütend«, verbesserte Kendra. »Nicht zickig. Wütend. Verärgert. Aufgebracht.«
»Verärgert«, stimmte Joel zu. »Sie war verärgert und ist weggelaufen. Aber sie kommt bestimmt bald zurück.« Diese Vermutung sprach er aus, als sei er überzeugt, seine Tante müsse glücklich ob dieser Aussicht sein. Dabei kam die Sorge für das ungebärdige, aufsässige Mädchen auf der Liste der Dinge, die Kendra am Hals haben wollte, nur knapp an vorletzter Stelle vor der Sorge um Toby.
Eine fürsorglich veranlagte Frau hätte an diesem Punkt begonnen, den beiden bedauernswerten Kindern, die an ihrer Türschwelle gestrandet waren, eine anständige Mahlzeit zu bereiten, wenn nicht gar ihr Leben neu zu organisieren. Sie wäre die Treppe ein zweites Mal hinaufgestiegen, um ihnen in einem der zwei Schlafzimmer eine Bettstatt zu bereiten. Das notwendige Mobiliar dafür war zwar nicht vorhanden, schon gar nicht in dem Zimmer, das Kendra für die Massagen eingerichtet hatte, aber sie besaß doch ausreichend Bettzeug, das man am Boden ausbreiten konnte, und Handtücher, die sich zu Kissen zusammenrollen ließen. Und dann hätte die Suche nach Ness begonnen. Aber all das lag Kendra vollkommen fern, also ging sie zu ihrer Tasche und holte eine Schachtel Benson & Hedges heraus. Sie zündete sich eine Zigarette am Gasherd an und überlegte, was nun zu tun war. Das Klingeln des Telefons erlöste sie.
Ihr erster Gedanke war, dass Glory überraschend Gewissensbisse bekommen hatte und anrief, um ihr zu sagen, sie habe sich die Sache mit George Gilbert, Jamaika und den Kindern, für die sie sorgen musste, noch einmal anders überlegt. Doch die Anruferin war Kendras beste Freundin Cordie, und sobald Kendra deren Stimme hörte, fiel ihr ein, dass sie heute Abend verabredet waren, um miteinander auszugehen. In einem Club namens »No Sorrow« wollten sie trinken, rauchen, reden, Musik hören und tanzen – allein, zusammen oder mit einem Partner. Sie wollten Männer aufreißen, um sich zu beweisen, dass sie noch anziehend waren, und falls Kendra beschloss, mit ihrer Eroberung ins Bett zu gehen, würde sie Cordie, die glücklich verheiratet war, am nächsten Tag per Handy in einer detaillierten Nacherzählung an ihren Freuden teilhaben lassen. So machten sie es immer, wenn sie zusammen ausgingen.
»Na, schon die Tanzschuhe an?«, fragte Cordie. Es sollte der Prolog zu Kendras neuem Leben werden.
Kendra verspürte nicht nur das körperliche Verlangen nach einem Mann, sondern sie hatte dieses Verlangen auch schon seit einer ganzen Woche in sich getragen und lediglich mit der Schufterei im Laden und ihrer Massageausbildung überspielt. Bei dem Wort »Tanzschuhe« flammte das Gefühl wieder auf und wurde so intensiv, dass sie erkannte: Sie konnte sich nicht einmal mehr erinnern, wann sie zum letzten Mal für einen Mann die Beine breit gemacht hatte.
Also überlegte sie fieberhaft. Wohin mit den Jungen, damit sie rechtzeitig ins No Sorrow kam, solange dort die Auswahl noch gut war? Im Geiste ging sie den Inhalt ihres Kühlschranks und ihre Vorräte durch. Es musste doch irgendetwas geben, was sie schnell zusammenbrutzeln und ihnen vorsetzen konnte. Angesichts der fortgeschrittenen Stunde hatten sie wahrscheinlich Hunger. Außerdem musste sie das Massagezimmer herrichten, damit sie heute Nacht dort schlafen konnten. Sie würde Handtücher und Laken ausgeben und ihnen das Bad zeigen, und dann ab ins Bett mit ihnen. All das musste doch rechtzeitig zu bewerkstelligen sein, um immer noch um halb zehn mit Cordie im No Sorrow sein zu können.