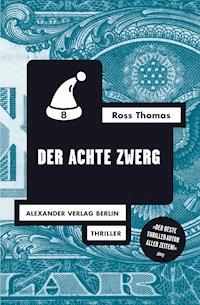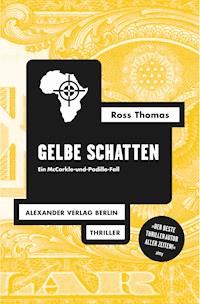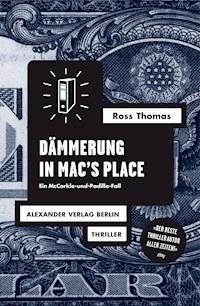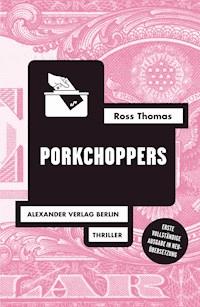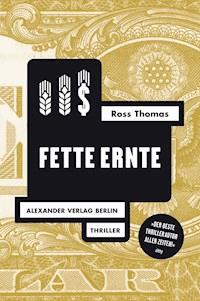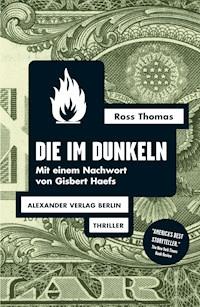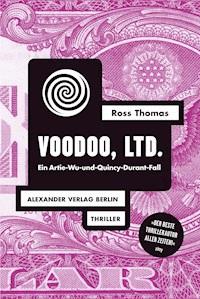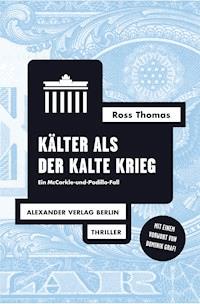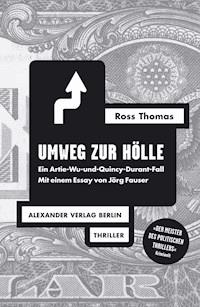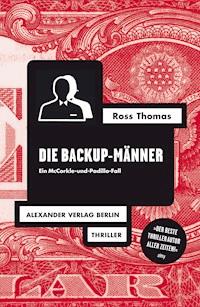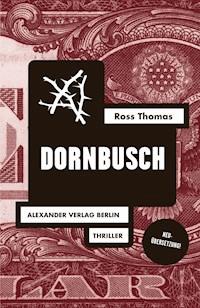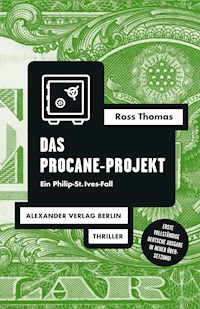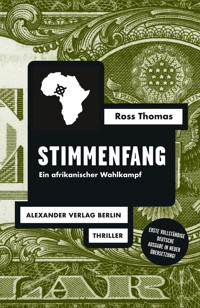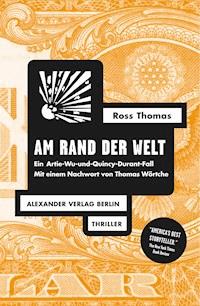
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ross-Thomas-Edition
- Sprache: Deutsch
Deutscher Krimipreis 1990 Dieser Politthriller spielt unmittelbar nach dem Ende des Marcos-Regimes auf den Philippinen 1986. Als der Terrorismusexperte Booth Stallings seinen Job verliert, erhält er von regierungsnahen amerikanischen 'Geschäftsleuten' den Auftrag, einen 5-Millionen-Dollar-Deal mit einem philippinischen Terroristen abzuwickeln, für ein hübsches Honorar versteht sich. Seine Auftraggeber wollen den Guerillaführer damit in den Ruhestand zwingen. Stallings, der den Guerillero Jahrzehnte zuvor im Zweiten Weltkrieg kennen gelernt hat, zweifelt an den lauteren Absichten seiner Auftraggeber. Er faßt den Entschluß, die Millionen mit der kompetenten Unterstützung von Hochstapler Maurice 'Otherguy' Overby und den Glücksrittern Artie Wu - Anwärter auf den Kaiserthron von China - und Quincy Durant zu stehlen, da sie eine bessere Verwendung dafür haben. 'Am Rand der Welt ist einfach genial. Ross Thomas führt uns, gemeinsam mit einem erstaunlichen Aufgebot an Figuren, an den Rand der Welt, in einer Geschichte, die sich windet und schlängelt und niemals innehält.' Elmore Leonard
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Ross Thomas, Am Rand der Welt
Das Buch: »Niemand zahlt einem Geldboten jemals eine halbe Million, damit er fünf Millionen überbringt, es sei denn, das Geschäft ist dreckig.« Dieser Politthriller spielt unmittelbar nach dem Ende des Marcos-Regimes auf den Philippinen 1986. Als der Terrorismusexperte Booth Stallings seinen Job verliert, erhält er von regierungsnahen amerikanischen »Geschäftsleuten« den Auftrag, einen 5-Millionen-Dollar-Deal mit einem philippinischen Terroristen abzuwickeln, für ein hübsches Honorar versteht sich. Seine Auftraggeber wollen den Guerillaführer damit in den Ruhestand zwingen. Stallings, der den Guerillero Jahrzehnte zuvor im Zweiten Weltkrieg kennengelernt hat, zweifelt an den lauteren Absichten seiner Auftraggeber. Er faßt den Entschluß, die Millionen mit der kompetenten Unterstützung von Hochstapler Maurice »Otherguy« Overby, der gerissenen Ex-Agentin Georgia Blue und den Glücksrittern Artie Wu – Anwärter auf den Kaiserthron von China – und Quincy Durant zu stehlen, da sie eine bessere Verwendung dafür haben.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimi-Preis 1990!
Der Autor: Ross Thomas (1926–1995) ist zunächst Journalist. Als Infanterist kämpft er im Zweiten Weltkrieg auf den Philippinen (und kehrt zu Recherchen für seinen Roman Am Rand der Welt Ende der 80er Jahre, unmittelbar nach dem Sturz des Marcos-Regimes, dorthin zurück). In den 50er Jahren richtet er das deutsche AFN-Büro in Bonn ein. Er arbeitet als politischer Berater und Wahlkampforganisator. Mit 40 schreibt er seinen ersten Roman, Kälter als der Kalte Krieg, für den er den renommierten Edgar-Allen-Poe-Preis erhält. Am Rand der Welt wurde mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet. Bis zu seinem Tod entstehen 25 Romane.
Ross Thomas
Am Rand der Welt
Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Aus dem Amerikanischen
von Jürgen Behrens,
bearbeitet von Gisbert Haefs
und Anja Franzen
Mit einem Nachwort von Thomas Wörtche
Alexander Verlag Berlin
Die Ross-Thomas-Edition im Alexander Verlag Berlin
Herausgegeben von Alexander Wewerka
Umweg zur Hölle. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Voodoo, Ltd. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Kälter als der Kalte Krieg. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Gottes vergessene Stadt
Teufels Küche
Die im Dunkeln
2. Auflage 2010
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1986 unter dem Titel Out on the Rim.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1987 im Ullstein Verlag,
Frankfurt/M. – Berlin.
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press LLC durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.
© für das Nachwort by Thomas Wörtche 2008
© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2008
Alexander Wewerka, Postfach 19 18 24, D-14008 Berlin
www.alexander-verlag.com
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Alle Rechte vorbehalten
Druck und Bindung: Interpress, Budapest
ISBN 978-3-89581-237-8
Printed in Hungary (March) 2010
Ebook: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH
Prolog
Die drei Überlebenden des Hinterhalts am schwarzen Sandstrand waren der neunzehnjährige Second Lieutenant der Infanterie, der eins sechzig große Guerillero und der riesige, etwas verrückte Sanitätssoldat, der sich in der Woche nach dem Hinterhalt sechzehn Pfund abgeschwitzt, abgehungert und abgerackert hatte.
Es war Hovey Profette, der Sanitäter aus Arkansas, der als erster die beiden kaiserlichen Marineinfanteristen unten im Tal bemerkte, etwa vierzig bis fünfzig Meter entfernt, als sie langsam aus einem Hain verwilderter Kokospalmen traten. »Erschieß die kleinen Scheißer«, drängte der Sanitäter mit heiserem Flüstern.
Booth Stallings, Second Lieutenant der Infanterie und vermeintlicher Anführer des überfallenen Aufklärungs- und Erkundungstrupps, preßte sich flach zwischen die beiden sonnendurchglühten schwarzen Felsen. Nachdem er einen Schwarm von, wie es schien, annähernd fünfzig Fliegen weggescheucht hatte, blinzelte er durch den Nachmittagsdunst hinab zu den beiden Gestalten in den senffarbenen Uniformen. Beide kaiserliche Marines waren stehengeblieben und musterten ihre Umgebung mit den besorgten Mienen von Vorposten, die ahnen, daß jemand gleich auf sie schießen wird.
»Ich sag dir, der zweite kleine Scheißer ist mindestens eins fünfundachtzig, wenn nicht eins neunzig«, sagte Stallings.
»Kaiserliche Marineinfanterie«, murmelte der Guerillero. »Die verlangen eine Mindestgröße.«
Zum vierten Mal an diesem Tag entlud sich die fürchterliche Wut des Sanitäters ohne Vorwarnung. Sie wogte in einer leuchtenden Welle seinen baumstarken Hals hinauf, färbte seine eigenartig kleinen Ohren lippenstiftrot und verzerrte sein Gesicht zu einem fetten rosa Wutknoten, der sich, so dachte Booth Stallings, vielleicht nie mehr lösen lassen würde.
»Du wirst nicht mal versuchen, sie zu erschießen, nicht wahr, Lieutenant Schisser?« sagte der Sanitäter und unterlegte seine sanfte Frage mit genug Rage, um sie in eine Todesdrohung zu verwandeln.
Booth Stallings schüttelte den Kopf, während er weiter auf die beiden kaiserlichen Marines hinabstarrte, die nun langsam die Lichtung überquerten, welche einst ein Maisfeld gewesen war. »Das sind Späher, Hovey«, sagte Stallings; er bemühte sich, seine Antwort möglichst vernünftig klingen zu lassen. »Die haben mindestens einen Trupp hinter sich. Vielleicht einen Zug. Vielleicht sogar eine Kompanie.«
»Wahrscheinlich eine Kompanie«, sagte der Guerillero mit dem flachen, fast tonlosen Kansas-Akzent, den er sich unter der Obhut einer Lehrerjungfer angeeignet hatte, die 1901 an seinem Gestade gelandet war und die nächsten vierzig Jahre damit zugebracht hatte, kleine braune Jungen amerikanisches Englisch auf genau die Art sprechen und schreiben zu lehren, wie es daheim in Emporia gesprochen und geschrieben wurde.
Hovey Profette, noch immer krebsrot im Gesicht und vor Wut kochend, ignorierte den Guerillero und streckte die rechte Hand nach Stallings’ Gewehr aus, der einzigen und gemeinschaftlichen Feuerwaffe. »Gib mir das Ding«, forderte er. »Ich erschieß die kleinen Scheißer.«
Stallings schüttelte wieder den Kopf und versuchte, die Geste mit einer Spur nicht empfundenen Bedauerns zu versehen.
»Es hat keine Kimme, Hovey«, sagte Stallings. »Der tote Guerilla, von dem ich’s habe, muß das Visier abgerissen und weggeschmissen haben. Die Guerillas glauben, daß ein Visier bloß alles versaut – stimmt’s, Al?«
Alejandro Espiritu, der eins sechzig große Guerillero, lächelte höflich. »Eine alte und hochgeachtete militärische Tradition in meinem Land.«
»Weißt du, was du bist, Lieutenant Stallings, Sir?« sagte der Sani mit fast zu lauter Stimme und viel zu rotem Gesicht. »Du bist bloß ein ... ein riesiger großer Haufen feiger Scheiße, nichts anderes.«
Hovey Profette stürzte sich auf das Garand, entriß es mühelos Booth Stallings’ Griff, rammte sich den Kolben an die rechte Schulter und war schon dabei, über den visierlosen Lauf zu zielen, als die Bolo-Klinge des Guerilleros seinen baumstarken Hals beinahe bis zur Mitte aufschlitzte.
Der Sani gab einen Laut von sich, der halb wie ein Seufzen, halb wie ein Schnauben klang, und brach über dem unbenutzten Gewehr zusammen. Ein gurgelndes Geräusch folgte, das Booth Stallings endlos vorkam, aber nur Sekunden dauerte. Als es vorbei war, lag Hovey Profette, Sanitäter der Infanterie und gescheiterter Kriegsdienstverweigerer, tot auf dem tropischen Vulkangrat, der auf der einen Seite kaiserliche Marineinfanterie zu bieten hatte und einen herrlichen Blick auf das Meer um Camotes auf der anderen.
Stallings zerrte das visierlose Garand unter dem toten Mann hervor. Ohne erst das Blut abzuwischen, löste er die Sicherung und richtete das Gewehr auf den hockenden Guerillero, der es ignorierte und weiter Profettes Blut mit einer Handvoll wildem Schuppengras von seinem Bolo wischte.
»Warum, zum Teufel, hast du ihn nicht bloß ein bißchen gepiekst?« knurrte Stallings.
Der Guerillero Espiritu prüfte sorgfältig das armlange Bolo, bevor er es wieder in die selbstgemachte Holzscheide schob. »Er hätte schreien können«, sagte er schließlich und deutete mit dem Kinn ins Tal hinab, wo nun eine lange Reihe kaiserlicher Marines eilig über die Lichtung zog. »Mindestens eine Kompanie«, sagte er. »Genau wie du und ich gedacht haben.«
Booth Stallings ließ den Blick zu den dahineilenden kaiserlich-japanischen Marines schweifen, dann zu dem toten amerikanischen Sanitäter und zurück zu dem Filipino-Guerillero. Ihm kam in den Sinn, daß dies der zweite Filipino war, dessen nähere Bekanntschaft er gemacht hatte; der erste war ein Edmundo Sowieso aus San Diego gewesen, der wie ein Rotkehlchen jeden Frühling vor Stallings’ Grund- und Sekundarschule aufgetaucht war, um im Auftrag von Duncans Jojo-Vermarktern deren Produkt vorzuführen. Edmundo konnte ein Jojo dazu bringen, so ziemlich alles zu tun, und drei Lenze seiner Kindheit lang hatte Booth Stallings eine begrenzte Anzahl Privatstunden zu exorbitanten fünfzig Cent die Stunde genommen, bis er mit dreizehn Masturbation, Lucky Strikes und Mädchen entdeckte – in etwa dieser Reihenfolge.
»Und was, verflucht noch mal, erzählen wir dem Major?« fragte Stallings.
Der zweiundzwanzig Jahre alte Guerillero schien die Frage mit Bedacht abzuwägen. »Wir – du und ich – werden Major Crouch erzählen, daß unser gefallener Kamerad heldenhaft bei der Verteidigung der Nachhut umgekommen ist.« Er hielt inne und musterte gedankenvoll den toten Profette. »Bis zum Morgen haben ihn die wilden Schweine gefressen.«
Ein Dutzend Sekunden lang starrte Booth Stallings den immer noch hockenden Guerillero mit einer gefrorenen Miene an, die Mißbilligung für alles ausdrückte. Denn während dieser zwölf Sekunden war Stallings über etwas gestolpert, das für ihn ein neues und tröstliches Credo war, eine Offenbarung gewissermaßen, die säuberlich den moralischen Imperativ herausschnitt und ihn nicht nur erquickt zurückließ, sondern auch weiser und älter. Viel älter. Mindestens sechsundzwanzig.
Immer noch mit derselben gefrorenen Miene und empfindungslos für den Schweiß, der darüberrann, sprach Stallings mit seiner neuen, kalten Erwachsenenstimme.
»Du hast ’ne ganze Menge Elaste da oben in deinem Kopf, nicht wahr, Al? Ich meine, du kannst es dehnen und um so ziemlich alles herumwickeln, was du willst.«
»Ich glaube schon«, sagte Alejandro Espiritu, lächelte beinahe, besann sich eines Besseren und setzte von neuem an. »Ich glaube, wir sollten den armen Profette hier für einen postumen Orden vorschlagen – einen Bronze- oder Silver-Star vielleicht?«
Booth Stallings starrte hinab auf den toten Sani und gestrauchelten Quäker. »Scheiße noch mal«, sagte er. »Warum nicht gleich das Verdienstkreuz Erster Klasse.«
1
Um drei Uhr nachmittags zitierten sie Booth Stallings, den Terrorismusexperten, in die Bibliothek des siebenstöckigen Stiftungsgebäudes östlich des Dupont Circle auf der Massachusetts Avenue und feuerten ihn bei einem Glas leidlich guten spanischen Sherry. Es war an den Iden des März, die 1986 auf einen Samstag fielen, und genau zwei Monate nach Booth Stallings’ sechzigstem Geburtstag.
Der Rausschmiß wurde, soweit Stallings erkennen konnte, ohne jeden Skrupel von Douglas House erledigt, dem fünfunddreißig Jahre alten Geschäftsführer der Stiftung. Selbstverständlich erledigte House es höflich, ohne eine Spur von Schärfe und mit etwa demselben Maß an Bedauern, das er ausdrücken würde, wenn er die Vertriebsabteilung der Washington Post anriefe, um sein Abonnement für die Urlaubszeit auszusetzen.
Es war der einundfünfzig Jahre alte Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Frank Tomguy, der ihm pro forma die Ego-Massage verpaßte, für die er eine entschuldigende, gar respektvolle Miene sowie einen seiner dreiteiligen 1100-Dollar-Anzüge trug. Tomguy ließ sich weitschweifig über gravierende Etatkürzungen aus und wandte sich dann der Qualität von Booth Stallings’ Arbeit zu, die, so schwor er, brillant gewesen sei. Keine Frage. Absolut, vollkommen brillant.
Nachdem Tomguys Massage vollendet war, sprach Douglas House von Geld. In Anbetracht der fristlosen Kündigung sollte er drei Monatsgehälter Abfindung erhalten, und die Stiftung wollte sechs Monate lang für Stallings’ Krankenversicherung aufkommen. Von einer Pension war nicht die Rede, da der Terrorismusexperte nur achtzehn Monate bei der Stiftung gewesen war, was immerhin drei Monate länger war, als er es je in einem anderen Job ausgehalten hatte.
Während die trockene Rede fortdauerte, verlor Stallings das Interesse und ließ, vermutlich zum letzten Mal, den Blick über die schwarze Nußbaumtäfelung der Bibliothek schweifen. Schließlich registrierte er die längliche Stille. Nun, da sie dich so nett abserviert und sich so artig entschuldigt haben, erwarten sie, daß du etwas Angemessenes sagst. Also sagte er das einzige, was ihm in den Sinn kam. »Ich habe hier mal gewohnt, wissen Sie.«
Es war nicht das, was Douglas House erwartet hatte, und er rutschte unruhig auf seinem ledernen Ohrensessel herum, als befürchte er, daß Stallings soeben zu einem sentimentalen, gar rührseligen Lebewohl angesetzt hatte. Aber Tomguy, der Vorsitzende, schien ihn besser zu kennen. Er lächelte und stellte die naheliegende Frage: »Was heißt hier, Booth?«
»Genau hier«, sagte Stallings mit einer knappen, aber umfassenden Geste. »Bevor die Stiftung diesen Bau hier – wann war das noch, zweiundsiebzig? – hochgezogen hat, stand hier eine große, alte vierstöckige Villa aus rotem Sandstein, die während des Krieges in Apartments unterteilt wurde.« Er blickte zu Douglas House. »Zweiter Weltkrieg.« House nickte.
»Im Februar einundsechzig habe ich die Wohnung im dritten Stock gemietet«, fuhr Stallings fort. »Teils, weil es von hier nur ein kurzer Fußweg zur Arbeit war, und teils wegen der Adresse – 1776 Massachusetts Avenue.« Seine Lippen verzogen sich leicht; es hätte die Andeutung eines Lächelns sein können, oder auch nicht. »Die Adresse eines Patrioten.«
Tomguy räusperte sich. »Dieser Fußweg führte damals zum Weißen Haus, nicht wahr, Booth? Und Sie waren aus Afrika zurück oder so ähnlich.«
»Ich war gerade aus Stanleyville zurück, und der Weg hat zum alten Executive Office Building geführt – das war damals nicht das Weiße Haus und ist es auch heute nicht.«
»Heiße Zeiten damals«, sagte Douglas House, offenbar nur, um irgend etwas zu sagen.
Stallings, der es dem Geschäftsführer nicht zum Vorwurf machte, daß er 1961 erst zehn Jahre alt gewesen war, musterte House flüchtig. »Antike Geschichte«, sagte er und wandte sich wieder an Tomguy. »Was passiert mit meinem Angola-Bericht?«
Tomguy hatte ein eckiges, zu aufrichtiges rosa Gesicht und nicht sehr viel graublondes Haar, dessen Spärlichkeit er klugerweise nicht zu verhehlen suchte. Hinter einer randlosen Bifokalbrille starrte ein Paar wäßriger, leicht vorquellender brauner Augen auf die Niedertracht dieser Welt, als löse diese bei ihm chronische Verwunderung aus. Dennoch war es ein vertrauenerweckendes Gesicht, das mit seinem markanten Kinn, dem energischen Mund und der aggressiven Römernase alles in allem eine beruhigende Wirkung hatte. Das perfekte Bankiersgesicht, dachte Stallings, wenn es nur fähig wäre zu heucheln, wozu es nicht imstande zu sein schien.
Die Frage nach dem Angola-Bericht veranlaßte Tomguy, sich Unterstützung heischend an den Geschäftsführer zu wenden. Mit einem leichten Lächeln, das alles mögliche bedeuten mochte, musterte Douglas House unverwandt Stallings, der sich auf die unvermeidlichen Ausflüchte gefaßt machte.
»Wir haben ihn ein paar Leuten in der Stadt vorgelegt«, sagte House noch immer lächelnd, die grauen Augen gleichmütig.
Stallings erwiderte das Lächeln. »So, haben Sie das? Welchen Leuten? Den Georgetown-Boys? Den Jungs im Building? Vielleicht ein paar Knaben aus Langley? Fanden ihn alle toll?«
»Sie waren alle der Auffassung, man sollte ihn ein bißchen umarbeiten.«
»Das heißt, sie haben nichts dagegen, daß ich Savimbi brillant nenne, aber es wäre ihnen lieber, wenn ich ihn nicht als
einen brillanten, hinterfotzigen, maoistischen Gauner bezeichnet hätte, was er, wie sie verdammt genau wissen, ist.«
Tomguy, der besonnene Mittler, gab beschwichtigende Laute von sich. »Er ist noch immer zur Veröffentlichung im Sommer vorgesehen, Booth. Als unser Hauptbeitrag.«
»Wenn auch umformuliert.«
»Bearbeitet«, sagte House.
Stallings zuckte mit den Schultern und erhob sich. »Dann lassen Sie meinen Namen weg.« Er widmete der hübschen Bibliothek einen weiteren Abschiedsblick. »Danke für den Drink.«
Tomguy erhob sich rasch mit ausgestreckter rechter Hand. Stallings schüttelte sie, ohne zu zögern. »Tut mir leid, daß es so gekommen ist, Booth.«
»Wirklich?« sagte Stallings. »Mir nicht.«
Er nickte dem immer noch sitzenden Douglas House zu, drehte sich um und schritt zur Tür – ein großer, schlaksiger Mann, dessen Gang einem geschmeidigen Gleiten ähnelte. Sein struppiger Schopf kurzen grauen Haars schmiegte sich wie eine alte Mütze um seinen Kopf. Darunter zeigte sich der Welt ein derart zerfurchtes und wettergegerbtes Gesicht, daß viele, unschlüssig, ob es häßlich oder gutaussehend war, zweimal hinschauten und sich dann für keins von beiden, sondern für ›eigenartig‹ entschieden.
Nachdem Booth Stallings gegangen war, sah Tomguy schweigend zu, wie House sich erhob, ans Telefon trat und auswendig eine Ortsnummer eintippte. Es klingelte nur einmal, dann wurde abgenommen. »Es ist erledigt«, sagte House ins Telefon. »Er ist gerade gegangen.« House hörte sich entweder eine Frage oder eine Bemerkung an, erwiderte: » In Ordnung«, legte auf und wandte sich Tomguy zu.
»Sie sind alle außerordentlich dankbar«, sagte House. »Ich zitiere hier.«
Tomguy nickte mit säuerlicher Miene. »Das sollten sie, verflucht noch mal, auch sein.«
Booth Stallings saß auf seiner Lieblingsbank an der Nordseite des Dupont Circle und trank in kleinen Schlucken vierzigprozentigen Smirnoff aus einer Viertelliterflasche, vorschriftsmäßig getarnt mit der braunen Papiertüte. Von der Nebenbank warf ihm eine hübsche junge Mutter einen weiteren besorgten Blick zu und verstaute schleunigst ihre achtzehn Monate alten Zwillingssöhne in dem aufwendigen, hochmodernen Sport-Kinderwagen, in dem sie, einander gegenübersitzend, nach Hause gekarrt werden würden.
Stallings versuchte es mit einem beruhigenden Lächeln, was offensichtlich ein Fehler war, da ihm die Mutter einen weiteren düsteren Blick zuwarf, dem Kinderwagen einen Schubs gab und davoneilte. Der in Fahrtrichtung sitzende Zwilling fing an zu plärren. Der in Gegenrichtung sitzende gluckste fröhlich und winkte Stallings, der ihm mit der Wodkaflasche zuprostete. Er genehmigte sich noch einen Schluck und steckte die Flasche in eine Tasche seiner acht Jahre alten Wildlederjacke, die er in Istanbul billig erstanden hatte.
Jetzt erst wurde sich Stallings des Wetters und der Tageszeit bewußt. Es war kühl geworden und dämmerte schon fast, was ihn vor das Problem stellte, wie er den Samstagabend verbringen sollte, der sich wie ein Stück Unendlichkeit vor ihm erstreckte.
Stallings’ Auswahl war begrenzt. Er konnte den Abend allein mit einem Buch oder einer Flasche in seiner Mietwohnung an der Connecticut Avenue, gegenüber dem Zoo, verbringen, oder er konnte uneingeladen, unerwartet und möglicherweise unerwünscht entweder bei seiner Tochter in Georgetown aufkreuzen oder bei der anderen, die in Cleveland Park wohnte.
In Georgetown versprach zwar das Essen einiges, aber die Dinnergäste (samstags mindestens sechs) würden den ganzen Abend damit zubringen, das Präsidentschaftsrennen für die Wahl 1988 zu analysieren, indem sie Zeichen und Omen aus dem gleichen gedruckten Kaffeesatz herauslasen, den jeder von ihnen während der vergangenen Woche in der Post, der Times, und was immer sie sonst eben lasen, studiert hatte.
Booth Stallings, ein Kind der Depression, hatte sich eigentlich nie darum geschert, wer nach Roosevelts Tod Präsident gewesen war. Er hatte nur einmal gewählt, und zwar 1948, als er, zweiundzwanzigjährig, unbekümmert sein Kreuz für Henry Agard Wallace gemacht hatte. Wann immer er heute daran dachte, was selten vorkam, beglückwünschte er sich zu seiner jugendlichen Torheit.
Stallings nippte ein letztes Mal an seiner Wodkaflasche, erhob sich von der Bank und machte sich auf die Suche nach einem Münztelefon, nachdem er sich entschieden hatte, seine Tochter in Cleveland Park anzurufen. In der Nähe des Peoples Drugstore am Südwestbogen des Dupont Circle stieß er auf eine Reihe Telefonzellen. Er benutzte die einzige, die nicht verwüstet worden war, und rief die dreiunddreißigjährige Lydia an, die Howard Mott geheiratet hatte, kurz bevor dieser 1980 das Justizministerium verließ, um sich auf die Verteidigung wohlhabender Wirtschaftskrimineller zu spezialisieren. Mott bezeichnete sein Gewerbe gern als Wachstumsindustrie. Nach zwei mageren Jahren wurde Mott allmählich selbst wohlhabend.
Als Stallings’ Tochter aus Cleveland Park sich meldete, sagte er: »Was gibt’s zum Abendessen?«
Lydia Mott ächzte. »Oh, mein Gott, jeder in der Stadt weiß es schon!«
»Was?«
»Man hat dich rausgeschmissen. Bist du schon blau?«
»Noch nicht, und ›jeder in der Stadt‹ heißt Joanna, stimmt’s?« Joanna war Stallings’ fünfunddreißigjährige Tochter in Georgetown. Sie hatte den Erben eines Autowachsherstellers geheiratet, dem Reichtum und politische Neigungen eine Berufung in die oberen Ränge des State Department eingebracht hatten. Stallings bezeichnete seinen Schwiegersohn manchmal insgeheim als Neal den Ahnungslosen.
»Sie hat dreimal angerufen«, sagte Lydia Mott.
»Weswegen?«
»Weil sie für dich dieses Sondierungsessen arrangiert hat. Es geht um einen Job, und er möchte, daß du mit ihm um halb acht im Montpelier-Saal des Madison zu Abend ißt ... Herrgott, das wird ihm an die Brieftasche gehen, oder?«
»Lydia«, sagte ein sehr geduldiger Stallings. »Wer ist er?« »Richtig. Das ist irgendwie relevant. Also, es ist ein gewisser Harry Crites.«
»Der Dichter.«
»Dichter?«
»Er wird gedruckt.«
»Schon, aber was macht er?«
Stallings zögerte. »Ich bin nicht ganz sicher. Nicht mehr.«
»Verstehe. Einer von denen. Na ja, möchtest du, daß ich jetzt Joanna anrufe und sie bitte, ihm, wenn er wieder anruft, auszurichten, daß du ihn dort um halb acht triffst?«
Wieder zögerte Stallings und erwog die Verheißungen eines Samstagabends in der Gesellschaft von Harry Crites. Das innere Abwägen dauerte an, bis seine Tochter ungeduldig wurde und sagte: »Nun?«
»Entschuldige«, sagte Stallings, »ich habe bloß versucht, diesen letzten Satz von dir zu sortieren. Aber okay. Ruf Joanna an und sag ihr, ja.«
Es entstand ein kurzes Schweigen, bis seine Tochter sagte: »Schau, Pappi. Wenn du nicht mit dem Dichter essen willst, warum kommst du nicht raus und ißt mit uns Lammstew und hörst dir einige von Howies schmutzigen Geschichten aus dem wirklichen Leben an?«
»Was für ein Trost und Segen du doch bist in diesen Prä-Alzheimer-Jahren.«
»Nein, danke also? Okay. Wieso haben sie dich gefeuert?«
Stallings wollte schon die Schultern zucken, unterließ es aber, als ihm klar wurde, daß sie es nicht sehen konnte. »Etatkürzungen, haben sie gesagt.«
»Etat? Bei all den Millionen?«
»Ich ruf dich wieder an«, sagte Stallings.
»Morgen.«
»Okay. Morgen.«
Booth Stallings hängte den Hörer ein, ging zu einem der erleuchteten Drugstore-Fenster und nutzte die Spiegelung, um seine Kleidung zu mustern: die alte Wildlederjacke aus Istanbul; die zu breite schwarz-braune Krawatte, die er seiner Erinnerung nach in Bologna gekauft hatte; ein hellbraunes Hemd von Marks and Spencer in London, an das er immer als sein Tausend-Meilen-Stück dachte, nachdem er einmal einen altgedienten Handelsreisenden ein ähnliches Hemd so hatte bezeichnen hören; und dann die graue Flanellhose, an deren Kauf er sich überhaupt nicht mehr erinnern konnte, deren scharfe Bügelfalten aber die Vermutung nahelegten, daß sie nicht in den Staaten gekauft worden waren. Was sein Schuhwerk betraf, wußte Stallings ohne hinzusehen, daß er trug, was er immer zu tragen pflegte: billige braune Halbschuhe, die er im Dutzend kaufte und paarweise wegwarf, sobald sie abgetragen waren.
Immerhin würde seine Aufmachung ihm den Zutritt ins Madison eröffnen. Und sie war sicherlich angemessen für ein Abendessen mit Harry Crites, der einen betagten blauen Anzug mit glänzenden Ellbogen und blankgewetztem Hosenboden getragen hatte, als Stallings ihm vor fünfundzwanzig Jahren erstmals begegnet war. Dreißig Minuten später hatte sich Crites fünfunddreißig Dollar gepumpt, um eine seit einem Monat überfällige Unterhaltszahlung zu tätigen.
Während er sich nach einem Taxi umsah, versuchte Stallings sich zu erinnern, ob Harry Crites ihm die fünfunddreißig Dollar je zurückgezahlt hatte, und kam zu dem Schluß, daß das nicht der Fall war.
2
Booth Stallings saß neben einigen gelangweilt wirkenden Saudis in der Lobby des Madison Hotels und wartete auf Harry Crites, der sich schon um neunzehn Minuten verspätet hatte. Aber Crites war schon immer zu spät gekommen, sogar damals, Anfang der Sechziger, als er gewöhnlich eine Viertelstunde nach Beginn in eine Sitzung platzte, ein fröhliches breites Lächeln im Gesicht, die unvermeidliche King-Edward-Zigarre im Mund und einen Stapel hoffnungslos durcheinandergeratener Dokumente in den Händen. Dann entwaffnete er immer selbst die Pünktlichkeitsfanatiker mit einem trockenen, selbstironischen Spruch, der alle zum Kichern brachte.
Nach Kennedys Tod, 1963, hatte Harry Crites das, was er später immer nicht ganz zutreffend »mein Kurzeinsatz im Weißen Haus« nannte, aufgekündigt und wechselte ins Verteidigungsministerium, wo er sich gar nicht wohl fühlte, und von dort ins Außenministerium, wo er einen Platz in dem fragwürdigen Programm für öffentliche Sicherheit bei der Abteilung für internationale Entwicklung an Land zog. Die Abteilung hatte Crites in sieben oder acht minderentwickelte Länder entsandt, aus denen bald Gemunkel über einige Deals drang, die er mit deren Ministerpräsidenten, Präsidenten auf Lebenszeit oder Premierministern gedreht hatte. Aber Stallings hatte nie besonders darauf geachtet.
Außerdem waren etwa um diese Zeit – 1965 – Stallings, seine Frau und ihre zwei kleinen Töchter, abgepolstert durch das 20 000-Dollar-Stipendium einer Stiftung, von Washington nach Rom gezogen, wo er seine Recherchen zum Terrorismus fortsetzte.
In den folgenden sieben oder acht Jahren war Booth Stallings nur dann nach Washington und manchmal New York zurückgekehrt, wenn er gezwungen war, zusätzliche Mittel bei zumeist unwilligen Stiftungen lockerzumachen. Und gelegentlich war er auf einer der unvermeidlichen Cocktailpartys oder Botschaftsempfänge Harry Crites über den Weg gelaufen.
Aber da hatten Harry Crites’ fadenscheiniger blauer Anzug, die King-Edward-Zigarre und der alte Ford Fairlane mit seinen durchgerosteten Trittbrettern der Vergangenheit angehört. Statt dessen waren seine Anzüge jetzt von J. Press, die Zigarren rochen nach Havanna, und das Auto war ein beigefarbener Mercedes, nicht das allerteuerste Modell, aber auch kein Diesel.
Bei diesen gelegentlichen Begegnungen hatten Harry Crites und Booth Stallings nie mehr als ein »Hallo« und »Wie geht’s denn so?« ausgetauscht, obwohl Crites nie eine Antwort darauf gegeben oder erwartet hatte, weil immer andere dagewesen waren, mit denen er sehr viel lieber reden wollte als mit Stallings, und gewöhnlich winkte und lächelte er ihnen bereits zu.
Aber einmal war niemand dagewesen – jedenfalls keiner, der sich lohnte –, und Harry Crites hatte ihm erzählt, er sei aus der Regierung ausgeschieden und betätige sich jetzt als Verbindungsmann; was im Klartext hieß, daß er das verhökerte, was damals noch »Einfluß« hieß, aber in späteren Jahren in »Zugang« abgemildert wurde. Stallings hatte sich manchmal überlegt, wer Crites bezahlen mochte, und seine Schlußfolgerungen hatten ihn gründlich deprimiert.
Harry Crites hatte zweiundzwanzig Minuten Verspätung, als der Gorilla das Madison betrat und die Lobby mit dem üblichen schnellen, nicht ganz gelangweilten Blick studierte, der über Booth Stallings hinweghuschte, sekundenlang auf den beiden Saudis verweilte, die Hilfskräfte hochrechnete und die Nebenausgänge registrierte. Danach zupfte sich der Gorilla unauffällig am linken Ohrläppchen, als wolle er sich des kleinen goldenen Ohrrings vergewissern.
Booth Stallings ernannte sie sofort zu einer der drei umwerfendsten Frauen, die er je gesehen hatte. Ihres ungeheuer selbstsicheren Auftretens wegen schätzte er ihr Alter auf zweiunddreißig oder dreiunddreißig. Aber er wußte, daß er um fünf Jahre in beide Richtungen danebenliegen konnte, denn ihre Art, sich zu bewegen, war die einer jungen Athletin, die noch acht ihrer besten Jahre vor sich hat.
Sie war mindestens eins fünfundsiebzig groß und nicht ganz so schlank, wie ihre Größe sie wirken ließ. Sie hatte keine Handtasche und trug lange, cremefarbene Gabardinehosen zu einer schwarzen Jacke aus einem genoppten Material, die kurz genug war, sie noch größer erscheinen zu lassen, doch weit genug, die Pistole zu verbergen, die sie trug, wie Stallings irgendwie wußte.
Ihr Haar war von einem kräftigen rötlichen Braun, bei dem das Rot das gewisse Etwas ausmachte. Trotz des lässigen Kurzhaarschnitts sah es perfekt aus. Es wirkte überdies so, als müsse sie nur mit den Fingern hindurchfahren, um es so aussehen zu lassen. Stallings argwöhnte, daß nichts Perfektes so einfach war. Das rotbraune Haar rahmte ein mehr oder weniger ovales Gesicht ein, dessen Züge genau so angeordnet waren, wie sie sein sollten – mit Ausnahme der Stirn, die ein wenig zu hoch war. Ihre Augen waren grün; allerdings konnte Stallings sich nicht entscheiden, ob sie meergrün oder smaragdgrün waren. Aber da sie teuer aussah, entschied er sich schließlich für dollargrün.
Wenige Sekunden, nachdem sie sich am linken Ohrläppchen gezupft hatte, folgte Harry Crites’ Auftritt; er trug eine Neun-Dollar-Zigarre und einen Tausend-Dollar-Kamelhaarmantel. Den Mantel hatte er wie ein Cape übergeworfen, ganz so wie ein reicher Dichter ihn getragen hätte, falls es so etwas gab, was Stallings bezweifelte.
Die Frau nickte Crites zu. Es war ein wertfreies Kopfnicken, das entweder »viel Spaß« oder »alles klar« bedeuten konnte. Crites blieb stehen. Ohne eine Spur von Unterwürfigkeit nahm die Frau ihm den Mantel von den Schultern. Stallings fragte sich, wieviel ihre Dienste kosteten und was sie alles umfaßten. Den Kamelhaarmantel über dem linken Arm, machte die Frau kehrt und verließ das Hotel durch den Eingang zur 15th Street.
Als Harry Crites seinen Dinnergast erblickte, kniff er die blauen Augen zusammen und zwinkerte über dem, was Stallings für Kontaktlinsen hielt. Der breite, joviale Mund, um einige Schattierungen blasser als ein Einweckgummi, verzog sich zu einem verzückten Lächeln, das bemerkenswert weiße Zähne entblößte, von denen Stallings wußte, daß sie überkront waren. Nachdem er sich erinnert hatte, daß Crites siebenundzwanzig gewesen war, als er sich 1961 jene noch immer unbeglichenen fünfunddreißig Dollar geborgt hatte, setzte Stallings sein gegenwärtiges Alter mit zweiundfünfzig an.
Booth Stallings erhob sich langsam und streckte ihm die rechte Hand entgegen. Crites ergriff sie mit seinen beiden und pumpte sie auf und nieder, während er um die gewaltige Zigarre herum und dahinter sprach: »Verdammt, Booth, es ist so verdammt viele Jahre her.«
»Vierzehn«, sagte Stallings, der über diese Art Gedächtnis verfügte. »Siebzehnter Juni 1972.«
Crites nahm die Zigarre aus dem Mund, blätterte in seinem geistigen Kalender zurück und ließ seine Augen in gespielter Panik nach links und rechts zucken. »Der Watergate-Einbruch. Jesses, ich habe dich dabei gar nicht gesehen.«
Stallings konnte das Grinsen nicht unterdrücken. »Am einundzwanzigsten Geburtstag meiner Tochter Joanna. Das ist die, mit der du heute gesprochen hast – die, die mit Staatssekretär Ahnungslos verheiratet ist.«
»Neal Hineline«, sagte Crites und nickte gewichtig. »Ein großartiger Kopf aus dem vierzehnten Jahrhundert. Tadellos.« Dann runzelte er die Stirn. »Aber ich kann mich nicht an Joannas Geburtstag erinnern.«
»Das liegt daran, daß du nicht dabei warst. Du bist in diesen bombastischen Laden gegangen, der dichtgemacht hat und fast zu einem McDonald’s gemacht worden wäre. Das – äh –«
»Sans Souci.«
»Richtig. Und ich war gerade mit Joanna unterwegs zu einem Geburtstagsessen im Mayflower, und du hast glatt durch mich durchgesehen.«
Crites tippte sich mit dem Finger ans rechte Auge. »Das war, bevor ich das Wundermittel für Eitelkeit gefunden hatte. Kontaktlinsen. Wenn du jetzt mit dem Verarschen fertig bist, laß uns essen.«
»Wird uns deine Freundin Gesellschaft leisten?«
Crites blickte über die Schulter in die Richtung, in der die große Frau verschwunden war, und sah dann Stallings mit einem leichten Lächeln an. »Sie ist nicht unbedingt eine Freundin.«
»Dann laß uns essen«, sagte Booth Stallings.
Man überließ Harry Crites die begehrte Sitzecke auf der Nordostseite des fast leeren Montpelier-Saals. Er und Stallings nahmen erst einen Drink, Perrier und Magenbitter für Crites, Wodka auf Eis für Stallings. Beide bestellten einen Salat, Kalbfleisch und eine doppelte Portion der ›ersten grünen Bohnen der Saison‹, die, wie der Kellner beteuerte, erst diesen Morgen in Loudoun County, Virginia, gepflückt worden seien, wenn Stallings auch annahm, daß dies am Vortag und nahe Oxnard, Kalifornien, geschehen war. Anschließend bestellte Harry Crites den Wein, was eine fünfminütige ernste Beratung mit dem Sommelier erforderte.
Sobald der Wein bestellt war, lehnte sich Harry Crites zurück, nippte an seinem Drink und musterte Stallings, als sei er noch immer etwas, das trotz zweifelhafter Herkunft ein günstiger Kauf sein könnte.
Stallings erwiderte das Starren, mäßig enttäuscht darüber, daß Crites sich so gut gehalten hatte. Er hatte nur um die Mitte ein bißchen Fett angesetzt, obwohl die gut geschnittene Weste dies geschickt zu verbergen half. Dem runden Gesicht war noch kein Doppelkinn gewachsen. Auch die Farbe war gut, wenig geplatzte Äderchen, und die kontrollierte Ausdruckspalette reichte noch immer von froh bis fröhlichst.
Natürlich waren ein paar neue Falten hinzugekommen, aber offensichtlich nicht aus Kummer. Sein Haar war hellbraun geblieben, nur ein oder zwei Schattierungen dunkler als ein echtes Blond, und was davon übrig war, reichte völlig aus. Nur die Jugendlichkeit fehlte. Sie war gewichen – gemeinsam mit ihren Spielgefährten Spontaneität und Sorglosigkeit. Geblieben war ein verhaltener, wenn nicht gar vorsichtiger Mann mittleren Alters, offensichtlich wohlhabend, der noch immer reich zu werden plante.
»Sie haben dich also rausgeschmissen«, sagte Harry Crites, und er ließ es nicht wie eine Frage klingen.
»Haben sie?«
Crites zuckte die Achseln. »Wir sind in Washington, Booth. Schon irgendeine Vorstellung, wo du anheuern willst?« »Keine Ahnung.«
»An einem Schnellschuß interessiert?«
»Warum ich?«
»Du bist der Alleinanbieter.«
»Das heißt, ich kann eine Menge verlangen.«
»Verdammt viel.«
»In Ordnung«, sagte Stallings. »Zuerst esse ich; dann höre ich zu.«
Nach dem Kalbfleisch, das sich als besonders gut erwies, bestellten Stallings und Crites eine große Kanne Kaffee, ließen das Dessert aus und lehnten den vom Kellner empfohlenen Cognac ab. Nach zwei Schluck Kaffee setzte Booth Stallings seine Tasse ab und lächelte Crites an. »Ist es nicht trotzdem komisch?«
»Was?«
»Daß ich um drei gefeuert werde und um Viertel nach acht im Madison sitze, Kalbfleisch zu sechsundzwanzig Dollar esse und mir anhöre, wie du mir einen Exklusiv-Schnellschuß anbietest. Wer hat die Sache angezettelt, Harry? Jemand bei der Stiftung?«
Crites fuhr fort, seine Verdauungszigarre anzuzünden, ließ sich Zeit, genoß offensichtlich das Ritual. Nach etlichen Zügen betrachtete er die Zigarre liebevoll. Als er sprach, richtete sich dies mehr an seine Zigarre als an Stallings. »Wenn ich sagen würde, ich selbst, würdest du denken, ich schneide auf. Wenn ich sagen würde, ich nicht, würdest du denken, ich lüge. Also laß ich dich denken, was immer du willst.«
»Dann her damit«, sagte Stallings. »Das Angebot.« »Die Philippinen.«
»Na so was.«
»Du warst schon mal da.«
»Nicht in letzter Zeit.«
»Länger her«, sagte Crites. »Im Krieg.«
»Stimmt. Lange her.«
»Wir – und mit wir meine ich gewisse Leute, mit denen ich in Verbindung stehe –«
Stallings unterbrach ihn. »Was für Leute?«
»Laß mich ausreden, Booth, ja? Wenn ich was zu verkaufen habe, mach ich das gern in einem Schwung.«
Stallings zuckte mit den Achseln.
»Also, diese Leute möchten, daß du zurückgehst.«
»Um was zu tun?«
»Den Mann treffen.«
»Wen?«
»Einen Kerl, der dieses Buch von dir gelesen hat – das Buch, das alle vom Hocker gerissen hat.«
»Ich habe nur dieses eine Buch geschrieben, Harry.«
»Ja. Anatomie des Terrors. Ich hab’s gelesen. Jedenfalls teilweise. Aber unser Knabe hat es ganz gelesen, und er ist sehr, sehr beeindruckt. Man könnte sagen, er ist ein Fan.«
»Und was hätte ich zu tun, wenn ich ihn treffen würde?« »Ihn überreden, daß er aus den Bergen kommt.«
»Wie?«
»Wir gehen bis auf fünf Millionen Dollar hoch, hinterlegt in Hongkong.«
»Wie ist sein Name – Aguinaldo?«
»Wer ist Aguinaldo?«
»Ein Mann, der vor langer Zeit aus den Bergen gekommen und nach Hongkong gegangen ist.«
»Nie von ihm gehört«, sagte Harry Crites. »Was ist passiert?« »Er wurde reingelegt.«
»Was dann?«
»Er ging zurück auf die Philippinen und wurde entweder ein verrückter Terrorist oder ein Revolutionsheld, je nachdem, welche Quelle man befragt.«
»Wann war das?«
Stallings blickte weg und runzelte die Stirn, als versuche er, sich genau zu erinnern. »Vor etwa neunzig Jahren. So ungefähr.«
»Such keine historischen Parallelen«, sagte Crites.
»Warum nicht? Sie sind nützlich.«
»Diesmal nicht. Unser Bursche ist bereit zu dem Deal, aber wir brauchen einen Garanten, eine Vertrauensperson. Dich.« »Mich.«
»Er kennt dich.«
»Durch mein Buch, meinst du?« sagte Stallings, der sich bemühte, Crites’ Antwort nicht vorzugreifen.
»Nicht bloß durch das Buch. Persönlich.«
»Hat er einen Namen?«
»Alejandro Espiritu. Du kennst ihn doch, oder?«
»Wir sind uns begegnet«, sagte Booth Stallings.
3
Während der nächsten halben Stunde tranken Stallings und Crites drei Tassen Kaffee und erörterten die kürzlich nicht ganz unblutig verlaufene Februarrevolution auf den Philippinen. Sie schnitten Ferdinand Marcos’ Exil auf Hawaii an; Imeldas Schuhe; den Schlamassel, in dem die philippinische Wirtschaft steckte; den katastrophalen Weltmarktpreis für Zucker; Mrs. Aquinos Aussichten als Präsidentin (zweifelhaft, fanden beide); und ob es vier oder acht Milliarden Dollar waren, die Marcos auf die Seite geschafft hatte. Nachdem sie entdeckt hatten, daß offenbar keiner viel mehr wußte, als er gelesen oder im Fernsehen gesehen hatte, kamen sie auf Alejandro Espiritu zurück.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!