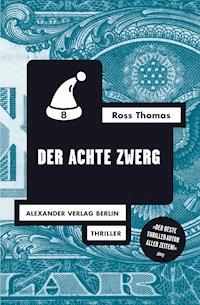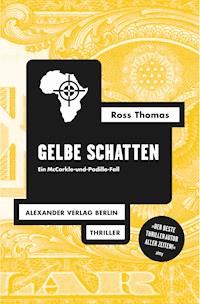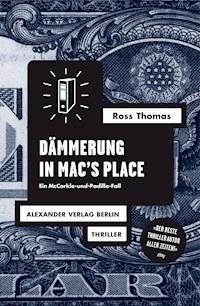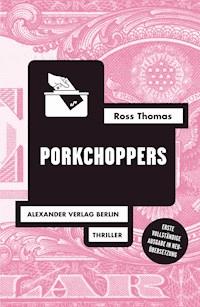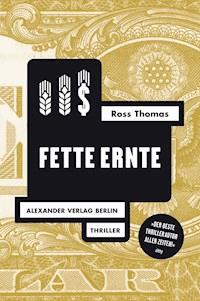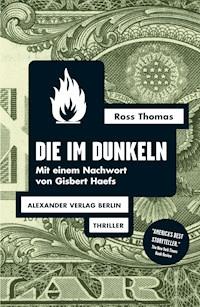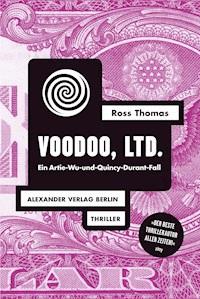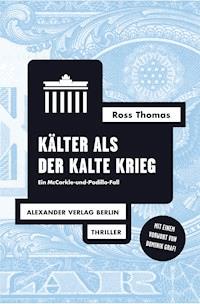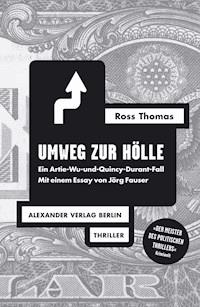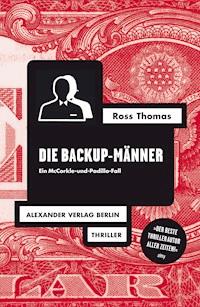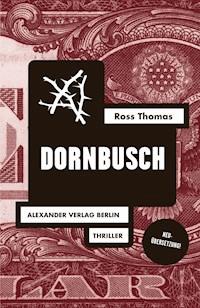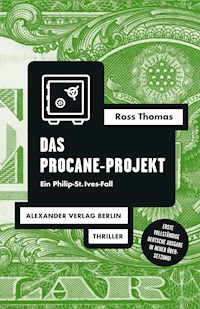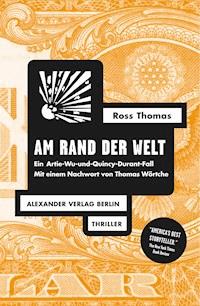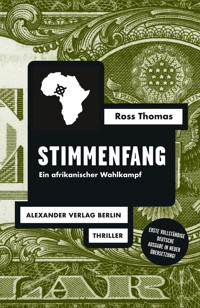14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ross-Thomas-Edition
- Sprache: Deutsch
Wer hat den Millionär und Senator Robert F. Ames mit 50.000 Dollar bestochen und dann seine Tochter ermordet? Warum hat er seine Frau verlassen, um mit einer wesentlich jüngeren Frau in einem Watergate-Appartement zu leben? Trieb ihn ein Erpresser in diesen Skandal? Das soll der Historiker und Korruptionsspezialist Decatur Lucas für Frank Size, Inhaber einer gefürchteten Presseagentur in Washington, herausfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Ross Thomas, geboren 1926 in Oklahoma, verarbeitete seine vielfältigen beruflichen Erfahrungen in seinen Politthrillern, in denen er vor allem die Hintergründe des (amerikanischen) Politikbetriebs entlarvt und bloßstellt. Ihm wurde zweimal der Edgar Allan Poe Award und mehrmals der Deutsche Krimi Preis verliehen. Bis zu seinem Tod 1995 entstanden 25 Romane.
Ross Thomas
Dann sei wenigstensvorsichtig
Aus dem amerikanischen Englischvon Jochen Stremmel,durchgesehen von Gisbert Haefs
Die Ross-Thomas-Edition im Alexander Verlag BerlinHerausgegeben von Alexander Wewerka
Der Messingdeal. Ein Philip-St. Ives-Fall
Protokoll für eine Entführung. Ein Philip-St. Ives-Fall
Umweg zur Hölle. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Am Rand der Welt. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Voodoo, Ltd. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Kälter als der Kalte Krieg. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Gelbe Schatten. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Die Backup-Männer. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Dämmerung in Mac’s Place. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Gottes vergessene Stadt · Teufels Küche · Die im Dunkeln · Fette Ernte · Der Yellow-Dog-Kontrakt · Der achte Zwerg · Dornbusch · Porkchoppers · Der Mordida-Mann
Alle auch als eBook!
Erste vollständige deutsche Ausgabe in neuer Übersetzung. Redaktion: Marilena Savino
Die gekürzte deutsche Erstausgabe erschien 1974 unter dem Titel Nur laß dich nicht erwischen im Ullstein Verlag, Frankfurt a. M./Berlin.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1973 unter dem Titel
If you can’t be good.
© 1973 by Ross Thomas
Licensed with The Estate of Ross E. Thomas
© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2018
Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlin
[email protected] · www.alexander-verlag.com
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-89581-481-5 (eBook)
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
1
Es begann so, wie das Ende der Welt beginnen wird: mit einem Telefonanruf um drei Uhr früh. Dieser kam von Larry Kallan, der an Schlaflosigkeit leidet und annimmt, daß es allen andern genauso geht. Vermutlich wird es Kallan sein, der mir dann erzählt, wie der Weltuntergang abgelaufen ist.
Anstatt Hallo zu sagen oder: Wie ist es Ihnen inzwischen ergangen oder auch nur: Tut Buße, denn das Ende ist nah, sagte er: »Wie würde es Ihnen gefallen, für den meistgefürchteten Mann Washingtons zu arbeiten?«
»Mr. Hoover ist tot und unter der Erde«, sagte ich.
»Ich meine Frank Size.«
»Oh«, sagte ich, »der.«
»Was soll das denn heißen: Oh, der?«
»Kennen Sie Frank Size?« sagte ich.
»Klar kenne ich ihn. Er ist einer meiner Kunden. Was stimmt denn nicht mit ihm?«
»Na ja«, sagte ich, »zum einen lügt er viel.«
»Ja, aber wenn er das tut, entschuldigt er sich immer. Er druckt einen netten Widerruf.«
»›With no harm done to anyone.‹« Um drei Uhr morgens summte ich es ihm nur vor, aber es klang trotzdem leicht schief.
»Was war das? Was haben Sie da gerade gesummt? Ich hab’s nicht mitbekommen.«
»Ein Fetzen aus einem Lied. Weiter nichts.«
»Was für ein Lied?«
»Bob Hopes Song ›Thanks for the Memory‹. Damit hat er Shirley Ross in The Big Broadcast of 1938 angesungen. Ich glaube, es war achtunddreißig. Inzwischen muß er es leid sein.«
»In dem Jahr sind Sie doch geboren. Neunzehn-achtunddreißig.«
»Das stimmt.«
»Sie werden nicht jünger.«
»Mein Gott, Larry, Sie können einen wirklich zum Nachdenken bringen.«
»Das sollten Sie auch besser tun – über Ihre Zukunft nachdenken. Wenn Sie jetzt nicht anfangen, darüber nachzudenken, na ja, dann werden Sie jede Menge Zeit haben, darüber nachzudenken, wenn Sie fünfzig sind und mit zwei Vierteldollar in der Tasche an einer Straßenecke rumstehen und nicht wissen, wo Sie schlafen sollen.«
Larry Kallan, inzwischen selbst fünfzig, war vermutlich Washingtons erfolgreichster Anlageberater. Er schien als erster allen Klatsch zu kennen und jeden, den er betraf, und anscheinend waren die meisten von ihnen seine Kunden. Außerdem war er ein echtes Kind der Großen Depression. Sie verfolgte ihn immer noch, und er malte gern anschauliche Wort-Bilder von Fünfzigjährigen aller Art, die an Straßenecken herumstanden und nichts in den Taschen hatten außer einem Quarter, drei Nickels und einem Dime. Manchmal fügte er noch ein bißchen feuchten Schnee und Wind hinzu.
»Was sucht Frank Size?« sagte ich.
»Einen investigativen Reporter, wie er selbst.«
»Ich bin kein investigativer Reporter; ich bin investigativer Historiker.«
»Sie sind ein Schnüffler«, sagte Kallan. »Ein Bundesschnüffler, und man will Sie im öffentlichen Dienst nicht mal fest anstellen. Sie sind ein Berater.«
»Ein Berater für hundertacht Dollar am Tag«, sagte ich. »Und was den Dienst angeht, bin ich der beständigste Berater in dieser Stadt. Ich bin seit den Tagen von Camelot im Dienst.«
»Und seit Billie Sol Estes.«
»Und seit der Marihuana-Affäre des Peace Corps in Nigeria«, sagte ich. »Die haben wir ziemlich sauber unter den Teppich gekehrt.«
»In zwölf Jahren hatten Sie einundzwanzig verschiedene Jobs«, sagte Kallan.
»Berufungen, Larry. Ich diene nur zum Vergnügen meines Präsidenten.«
»Kein sicherer Arbeitsplatz«, sagte er. »Keine Rente. Keine Krankenversicherung. Und außerdem sind Ihre politischen Ansichten ganz falsch. Wie Sie die letzten vier Jahre überlebt haben, ist mir immer noch schleierhaft.«
»Das ist einfach«, sagte ich. »Ich hab nur ein paar von den Leichen ausgegraben, bei deren Bestattung ich mal geholfen habe. Denselben Dienst kann ich vermutlich der nächsten Regierung leisten. Wenn es je eine gibt.«
»Ich finde, Sie sollten mit Frank Size reden.«
»Hat Frank Size irgendwas Interessantes wie beispielsweise Geld erwähnt?«
Es gab eine kurze Pause. »Ich habe genau genommen nicht mit Frank gesprochen.«
»Mit wem haben Sie genau genommen gesprochen?«
»Ich hab mit Mabel Singer gesprochen. Sie ist Franks Privatsekretärin. Kennen Sie Mabel?
»Ich hab von ihr gehört«, sagte ich. »Hat Mabel irgendwas Interessantes wie beispielsweise Geld erwähnt?«
»Na ja, nein, aber sie hat eine Sache erwähnt, an der Sie interessiert sein könnten.«
»Was?«
»Sie können zu Hause arbeiten.«
»Sie meinen, kein Bürojob?« sagte ich.
»Stimmt.«
»Sind Sie sicher?«
»Deshalb rufe ich Sie doch an«, sagte Kallan. »So sollten Sie Zeit genug haben, diesem Franzosen nachzuspüren, über den Sie immer Briefe schreiben. Wie heißt er noch, irgendwas mit Bon?«
»Bonneville«, sagte ich.
»Genau, Bonneville. Er ist schon eine Weile tot, oder?«
»An die hundert Jahre«, sagte ich.
2
Ende 1959 war ich Doktorand in Geschichte an der University of Colorado, als Bobby Kennedy dem Westen einen Kurzbesuch abstattete auf der Suche nach Leuten, die seinen Bruder vielleicht gern als Präsidentschaftskandidaten gesehen hätten. Zwar war ich damals erst einundzwanzig und nominell Sozialist, stellte aber eine Organisation auf die Beine, die sich Republikanische Studenten für Kennedy nannte. Sie machte eine Menge Lärm, aber nicht genug, um zu verhindern, daß John Kennedy bei der Wahl 1960 Colorado mit fast 62 000 Stimmen verlor. Ich bin kein Sozialist mehr. Nach zwölf Jahren bei der Regierung betrachte ich mich als Anarchisten.
Aber die Kennedys, die andächtig an die Ämterpatronage glaubten, waren mir für meine Bemühungen dankbar gewesen, und deshalb wurde ich nach Washington eingeladen. Als ich Anfang Februar 1961 eintraf, wußte niemand so recht, was man mit mir anfangen sollte, weshalb sie mich für 50 Dollar am Tag zu einem Berater machten und einer Abteilung zuwiesen, die Food for Peace hieß und aus einer kleinen Suite im alten Executive Office Building neben dem Weißen Haus von einem jungen Ex-Kongreßabgeordneten namens George McGovern betrieben wurde, der auch nicht so recht wußte, was er mit mir anfangen sollte.
Da ich angehender Historiker war, wurde irgendwann beschlossen, es wäre doch nett, wenn ich eine historische Aufzeichnung ab dem Zeitpunkt machen würde, an dem die erste Lieferung von Food for Peace Baltimore mit angemessenen Fanfaren verließ, bis zu dem Moment, in dem sie in den Bäuchen jener landete, deren Herz und Verstand sie bestimmt für die Sache der Demokratie gewinnen würde. Ich glaube, 1961 waren alle noch ein bißchen naiv.
Die erste Lieferung von Nahrungsmitteln waren 300 Tonnen Weizen, bestimmt für die Bäuche der Einwohner eines jener Länder an der Westküste Afrikas, die gerade zweihundert Jahre britischer Kolonialherrschaft abgeschüttelt hatten. Ein Drittel des Weizens verschwand noch am Tag, an dem er ausgeladen wurde, auf dem Schwarzmarkt. Der Rest löste sich einfach in Luft auf, um ein paar Wochen später wiederaufzutauchen, als ein holländischer Frachter unter liberianischer Billigflagge in Marseille vor Anker ging.
Rund sechs Wochen danach trugen ausgewählte Elitetruppen der Armee des neuen afrikanischen Staats die in Frankreich hergestellten Maschinenpistolen MAT 49, Kaliber 9 mm, und ich sorgte dafür, daß ein paar verdammt gute Fotos von ihnen gemacht wurden, die ich zusammen mit meinem 129-Seiten-Bericht einreichte, dem ich den Titel gab: »Wohin der Weizen ging, oder Wie viele 9-mm-Patronen pro Scheffel?«
Danach wurde ich eine Art inoffizieller Habgier- und Korruptionsspezialist, der immer für kurze Zeit der einen oder anderen Regierungsstelle aufgedrängt wurde, die es geschafft hatte, sich in die Nesseln zu setzen. Normalerweise stöberte und stocherte ich zwei oder drei Monate herum, durchwühlte Akten und stellte Fragen und sah grimmig und geheimnisvoll aus. Dann schrieb ich einen langen Bericht, der unweigerlich eine ziemlich schmutzige Geschichte von Habsucht und Bestechung auf seiten derer erzählte, die Dinge an die Regierung verkauften, sowie von Gier in den Herzen derer, die sie kauften.
Und fast immer saßen sie dann auf meinen Berichten, während jemand anders herumwuselte und Dinge notdürftig ausbesserte. Die Berichte von mir, die zum Vorschein kamen, betrafen große Skandale, die bereits so wild brodelten, daß man unmöglich den Deckel draufhalten konnte. Darunter die Affäre um den Erdnußöl-König und die, bei der ein paar Schwindler von der Madison Avenue das Office of Economic Opportunity abzockten. Dem Bericht gab ich den Titel: »Wie man mit der Armut Geld macht«.
Die Republikaner beschäftigten mich des schönen Scheins wegen weiter, vermute ich. Als sie 1969 wieder an die Macht kamen, wurde ich erneut in das alte Executive Office Building bestellt, und zwar in dieselbe Suite, in der vor acht merkwürdigen Jahren alles begonnen hatte. Dort wurde ich dann von einem anderen Ex-Kongreßabgeordneten, an dessen Namen ich mich nicht mal erinnern kann, davon in Kenntnis gesetzt, daß ich gern in meiner gegenwärtigen Funktion, was immer zum Teufel das sein mochte, dableiben dürfe, obwohl es wirklich keinen großen Bedarf für meine Dienste gäbe, denn die neue Regierung wäre »so sauber wie ein – äh – wie ein …«
»Hundezahn«, schlug ich vor.
»Genau«, sagte der Ex-Kongreßabgeordnete.
Also blieb ich da, wechselte von einer Agentur und Abteilung zu einer anderen und fand in hohen und niedrigen Positionen nicht mehr und nicht weniger Korruption und Täuschungsmanöver als zuvor.
Aber ich reiste weniger, viel weniger, und das versetzte mich in die Lage, die meisten Samstage in der Kongreßbibliothek in Gesellschaft von Hauptmann Benjamin Louis Eulalie de Bonneville zu verbringen, Protegé von Tom Paine, West-Point-Absolvent, der in der 7. Infanterie der United States Army gedient hatte, Trapper und Fellhändler, Freund von Washington Irving, bankrott und – wie ich vermutete – eine Zeitlang Geheimagent des Kriegsministers gewesen war.
Hauptmann (später General) Bonneville war das Thema der Dissertation gewesen, für die ich recherchiert hatte, als ich an Kennedys New Frontier bestellt wurde. Ich versuchte immer noch, sein Tagebuch ausfindig zu machen, das mal in Washington Irvings Besitz gewesen war, und inzwischen, zwölf Jahre später, glaubte ich, daß ich ihm vielleicht nähergekommen sei. Es spielte allerdings keine große Rolle. Zumindest nicht für Bonneville. Er hat schon einen Damm und irgendeine Salzwüste, die nach ihm benannt sind. Und einen Pontiac. Er lebt.
Aber ich klammerte mich immer noch an die Idee, ich könnte meine Dissertation zu Ende schreiben und mich mit einem Doktortitel bewaffnet an irgendein Provinzcollege zurückziehen, wo die Zeit stillstand und Ronald Colman Präsident war und die kurzhaarigen Studenten, frisch gestriegelt und glänzend, alle Kabrioletts fuhren und sich nur ernsthaft Sorgen darüber machten, ob der alte Professor Morrison den Boomer im Chemiekurs wohl durchkommen ließ, damit er beim Homecoming gegen die State mitspielen konnte.
Ich hatte diese auf dem Studiogelände von Paramount spielende Phantasie als harmloses Antidot gegen die giftigen Dämpfe des Großen Sumpfs der Betrügereien gehegt und gepflegt, durch den ich diese vergangenen zwölf Jahre gewatet war. Ich brauchte ein bißchen freie Zeit, um meine Doktorarbeit abzuschließen, und falls Frank Size so entgegenkommend war, mich zu Hause arbeiten zu lassen, würde ich ihn für seine Freundlichkeit dadurch entschädigen, daß ich ihm die Zeit stahl. Zwölf Jahre in der Regierung hatten meine eigene Moral ein bißchen geschmeidiger gemacht.
Ich war dabei, Frank Size die meisten dieser faszinierenden Details über mich – abgesehen von meinem Plan, ihm ein wenig Zeit zu stehlen – bei dem Mittagessen zu erzählen, zu dem er mich und seine Sekretärin Mabel Singer in Paul Youngs Restaurant an der Connecticut Avenue eingeladen hatte.
Size muß in jenem Frühling um die sechsundvierzig gewesen sein. Er hatte eine exklusive tägliche Kolumne, die gleichzeitig in mehr als 850 Tages- und Wochenzeitungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und, soweit ich wußte, in der ganzen Welt veröffentlicht wurde. Die Kolumne war in seinem höchstpersönlichen Gott-isses-nicht-furchtbar-Stil geschrieben, und er wollte, daß sie aus Washington gedonnert kam. Stattdessen klang sie wie das Kollern eines alten Truthahns, der gerade den Fuchs entdeckt hat. Trotzdem konnte die Kolumne in einem Absatz einen Ruf zerstören, und es gab viele, die sie für mindestens zwei Selbstmorde verantwortlich machten.
Der meistgefürchtete Mann in Washington sah nicht besonders beeindruckend aus. Von seinen Augen abgesehen hatte er eines jener Gesichter, die man immer am wichtigsten Tisch des formellen Mittagessens am Dienstag finden kann. Er hatte einen breiten Mund, wie geschaffen, um Witze zu erzählen, einen großen Unterkiefer, dem dicke rosafarbene Hängebacken gewachsen waren, eine erstaunlich schmale Nase und hübsche kleine Ohren, umringt von dem, was von seinem Haar noch übrig war.
Der Rest von ihm war den Bach heruntergegangen, und er machte einen weichen, schlaffen Eindruck und hatte eine Wampe, die ihm über den Gürtel hing und dort schwabbelte, als suchte sie nach einem Platz, wo sie sich hinlegen konnte. Aber wenn man ihm in die Augen schaute, wußte man, daß es ihm egal war, wie sein Bauch aussah. Oder daß er eine Glatze hatte. Oder Hängeschultern und ein Hohlkreuz. Wenn Verachtung eine Farbe hätte, wäre es derselbe Grauton, den seine Augen hatten, das blasse, kalte, glitzernde Grau von poliertem Granit im Winterregen. Es waren Augen, die den Wert der Welt ermessen zu haben schienen und zu dem Schluß gekommen waren, daß sie ein minderwertiger, schäbiger Ort sei, voll unersprießlicher Bewohner, die immer mit der Miete im Verzug waren.
»Sie haben dann ja offenbar tolle zwölf Jahre gehabt«, sagte Size und schob sich ein großes Stück Kartoffel mit der Gabel in den Mund. Ich wurde hungrig vom Zusehen. Ich hatte seit drei Jahren keine Kartoffel gegessen. Anders als Size war ich noch ein bißchen eitel.
»Es war nicht alles schlecht«, sagte ich. »Ich bin viel gereist.« Ich nahm den dritten Bissen von meinem Mittagessen zu mir, das aus einem Salat und einem einsamen Martini bestand. Ich fragte mich, was für Auswirkungen es auf das Vorstellungsgespräch haben würde, wenn ich seinen Zwilling kommen ließ. Frank Size schien nicht zu trinken, aber Mabel Singer erfreulicherweise schon.
»Ich werde mir noch einen Drink bestellen«, sagte sie. »Wollen Sie auch einen?«
»Na klar«, sagte Size. »Sie trinken ab und zu ein bißchen, oder, Mr. Lucas?«
»Ein bißchen.«
»Bestellen Sie die Drinks, Mabel, und geben Sie mir das Zeug, das Sie mitgebracht haben.«
Wenn man eine Kolumne schreibt, der sich die halbe Nation jeden Morgen nach der Sportseite zuwendet, braucht man sich über die Qualität der Bedienung, die man in einem Restaurant erfährt, keine Gedanken zu machen. Mabel Singer mußte nur den Kopf heben, damit ein Kellner mit den Augen eines Spaniels an ihrem Ellbogen auftauchte und ihr seine Dienste anbot. Sie bestellte einen Manhattan für sich, einen Martini für mich, bückte sich, hob eine schmale Ledermappe mit Reißverschluß auf, nahm eine hellbeige Akte heraus und reichte sie Size.
»Wie nennt man Sie, Mr. Lucas?« sagte er.
»Mr. Lucas.«
»Ich meine, man nennt Sie nicht Decatur, nicht wahr?«
»Meine Mutter nannte mich so. Fast alle anderen nennen mich Deke.«
»Wie in der Verbindung«, sagte Mabel Singer. »Ich war mal mit einem Deke an der Ohio State zusammen. Ich war eine Phi Gam. Ich wette, so was gibt’s gar nicht mehr. Jesses, ist das lange her.«
Ich schätzte, daß es rund sechzehn Jahre her war. Mabel Singer war eine große, dralle Frau, und sie mußte eine große, dralle Studentin gewesen sein, klug und dreist und voller Spaß, aber normalerweise ohne Begleiter, falls ihre Verbindungsschwestern nicht einen Spieler aus der Basketballmannschaft durch Geld oder gute Worte verleiteten, sie mitzubringen. Mit sieben- oder achtunddreißig war sie immer noch Miss Singer, und sie stand in dem Ruf, nicht nur die beste Privatsekretärin in Washington, sondern auch die am besten bezahlte zu sein. Ich wußte, daß die Regierung der Vereinigten Staaten es sich nicht leisten konnte, sie einzustellen, was sie es oft genug versucht hatte.
»Sie glauben also, Sie könnten sich vorstellen, für uns zu arbeiten, ja?« sagte Size, während er durch die Akte blätterte, die Mabel Singer ihm gegeben hatte.
»Ich bin mir nicht sicher«, sagte ich. »Wir haben noch nicht über Geld geredet.«
»Dazu kommen wir noch«, sagte er. »Hier steht, daß Sie fünfunddreißig und geschieden sind und daß Ihre Frau wieder geheiratet hat und daß Sie keine Kinder hatten und daß Ihre Kreditwürdigkeit nicht schlecht ist und daß einige Ihrer Nachbarn denken, Sie tränken zuviel, und daß Ihre Moralvorstellungen ein bißchen locker sind und daß Sie außerdem einigen ziemlich merkwürdigen Organisationen angehören wie etwa der Sacco and Vanzetti Fife and Bugle Marching Society.«
»Wo steht das alles?« sagte ich.
»Hier drin«, sagte Size und klopfte auf die hellbeige Akte.
»Was zum Teufel ist das?«
»Ihre FBI-Akte.«
»Mist«, sagte ich.
»Überrascht, daß ich sie habe?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Sie müssen dort einen ziemlich guten Informanten haben.«
»Sie mögen das aber nicht besonders, oder?«
»Ich mag das überhaupt nicht«, sagte ich. »Das FBI sammelt Abfall. Es sortiert ihn nicht, es sammelt ihn nur, und dann liegt er dort rum, bis er zum Himmel stinkt.«
»Sehe ich auch so«, sagte Size. »Hab ich auch in der Kolumne geschrieben. Oft genug. Aber wenn ich einen engagiere, nutze ich die FBI-Akten. Damit spare ich eine Menge Geld und Zeit. Referenzen sind einen Scheiß wert. Sie würden niemanden als Referenz aufführen, wenn Sie nicht wüßten, daß er etwas Gutes über Sie sagt, nicht wahr?«
»Vermutlich nicht.«
»Deshalb benutze ich das FBI.«
»Können Sie die Akte von jedem haben?«
»So ziemlich.«
»Das muß praktisch sein.«
»Ich nehme sie nicht als Bettlektüre mit nach Hause wie Lyndon Johnson. Ich benutze sie nur, wenn die Story es nach meinem Urteil erforderlich macht.«
»Nach Ihrem Urteil, ja?«
»Sie halten es nicht für unfehlbar, oder? Mein Urteil, meine ich.«
»Ich halte das Urteil von niemandem für unfehlbar.«
»Was ist mit Ihrem?«
»Das ist auch nicht unfehlbar.«
»Aber Sie verlassen sich darauf.«
»Klar. Ich verlasse mich darauf.«
»Na ja«, sagte er, »so verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Indem ich mich auf meins verlasse.«
Der Kellner brachte die Drinks, und ich nahm einen Schluck von meinem, bevor wir anfingen, die Moral der Angelegenheit zu untersuchen. Ich war mir nicht sicher, ob Frank Size wußte, wovon ich redete. Was das betraf, war ich mir auch nicht sicher, ob ich es wußte.
»Warum erzählen Sie ihm nicht von dem Job?« sagte Mabel Singer. »Deshalb haben Sie ihn doch zum Essen eingeladen.«
Frank Size grinste, und es war das fröhliche Grinsen eines verschmitzten Neunjährigen, geklebt auf das schlaffe Gesicht eines Mannes in mittlerem Alter. Es hätte charmant sein können, wenn die Augen nicht gewesen wären. Die Augen verdarben den ganzen Spaß.
»Okay«, sagte er. »Reden wir zuerst von Geld. Sie haben nichts dagegen, von Geld zu reden, oder, Deke?«
»Eins meiner Lieblingsthemen«, sagte ich, wobei ich mich fragte, was mich diese kumpelhafte Vornamensnummer im Jahr kosten würde.
»Der Job bringt Ihnen zweiundzwanzigtausend im Jahr, was ungefähr dem entspricht, was ein echter Spitzenreporter in dieser Stadt bekommt.«
»Ich bin ein echter Spitzenhistoriker, und ich verdiene im Moment achtundzwanzigtausend.«
»Ich weiß, wieviel Sie verdienen«, sagte er. »Ich kann keine achtundzwanzig bezahlen. Aber ich kann einiges dazugeben, was Sie im Moment nicht bekommen. Ich kann einen nicht beitragspflichtigen Pensionsplan dazugeben. Sie werden irgendwann eine Pension brauchen.«
»Das sagt Larry Kallan auch.«
»Unser gemeinsamer Freund«, sagte Size. »Tja, er hat mir geholfen, ihn einzurichten. Er sagt, daß er für einen Ihrer Gehaltsstufe zweitausend im Jahr wert sein würde.«
»Was kommt sonst noch in den Pott?« sagte ich.
»Gewinnbeteiligung.« Er wandte sich an Mabel Singer. »Wieviel hat das Ihnen letztes Jahr gebracht?«
»Rund zweitausend. Vielleicht ein bißchen mehr.«
»Okay«, sagte Size. »Das sind fast vier. Krankenhauszusatzversicherung. Ich habe den besten Vertrag laufen, weil ich ohnehin dafür zahlen muß. Er sollte dreißig bis vierzig im Monat für Sie wert sein. Das sind weitere vierzig Mäuse im Pott.«
»Allmählich wird es interessant«, sagte ich.
»Prämien«, sagte er. »Ich zahle nicht jedes Jahr eine Prämie für verdammt gute Arbeit. Die erwarte ich. Aber ich werde eine Prämie zahlen, wenn Sie verdammt ausgezeichnete Arbeit leisten, hervorragende Arbeit. Und es wird eine saftige Prämie sein.«
»Wie saftig?«
»So saftig, daß Sie eine ganze Woche lächeln werden.«
»Wir sind eine einzige glückliche Familie«, sagte Mabel Singer.
»Glücklich und froh«, sagte Size. »Ich hab eine kleine Belegschaft. Sechs Reporter oder Laufburschen und Mabel und mich. Buchhalter und Anwälte zähle ich nicht, weil die auf Honorarbasis für mich arbeiten. Ich hab nur zwei Regeln, aber die können Sie sich genausogut anhören. Die erste ist, daß ich keine Ausreden akzeptiere. Gründe ja. Aber Ausreden gehen mir auf den Sack. Die zweite Regel ist, daß ich Sie von einer Minute auf die andere rausschmeißen kann – keine Kündigungsfrist von einem Monat, einer Woche oder einem Tag: eine Minute. Sie können genauso kündigen. Da fangen manche Leute vielleicht an zu schreien von wegen Jobsicherheit, aber ich sehe das nicht so. Wenn Sie verdammt gute Arbeit leisten, wäre ich ein Trottel, Sie zu feuern. Aber wenn Sie saumäßige Arbeit leisten, wäre ich ein noch größerer Trottel, Sie weiter zu beschäftigen. Ich mache mir keine Sorgen über Leute, die mittelprächtige Arbeit leisten. Die arbeiten nicht für mich.«
»Was hätte ich zu tun, wenn ich für Sie arbeiten würde?«
»Also, darüber denke ich schon ziemlich lange nach«, sagte Size. »Mir kommt immer wieder mal eine Story zu Ohren. Vielleicht widme ich ihr eine Kolumne oder zwei. Vielleicht sogar drei oder vier, und das war’s dann auch. Aber was ich in der Kolumne verwende, ist nur die Spitze des Eisbergs. Da steckt mehr dahinter, verdammt viel mehr, aber dann taucht eine neue Story auf, und ich muß der nachgehen. Ich bin in einem Geschäft mit gottverdammt vielen Konkurrenten, und es läuft sieben Tage die Woche, dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr. Ich möchte den Storys nachgehen, die ich manchmal nur antippe. Und dafür muß man buddeln, tief und dauerhaft buddeln. Sie wissen, was für eine Art Buddeln ich meine.«
»Ich hab ein bißchen davon hinter mir«, sagte ich.
»Ja, ich hab ein paar von den Berichten gesehen, die Sie eingereicht haben.«
»Ich erinnere mich an einen, bei dem Sie es geschafft haben. Er trug auf allen Seiten den Stempel Top Secret, und das Justizministerium war verdammt neugierig, wo Sie Ihre Informationen herhatten.«
Size grinste. »Vielleicht hätte ich Sie dankend erwähnen sollen.«
»Hätten Sie vielleicht.«
»Das hab ich jedenfalls vor – komplizierten Geschichten nachzugehen, die eine Menge Zeit und Mühe beanspruchen – mehr Zeit und Mühe, als wir ihnen widmen können, so wie wir personell besetzt sind, und trotzdem sieben Tage pro Woche eine Kolumne füllen.« Aus seinem Mund klang die Kolumne wie ein Faß ohne Boden. Ich vermute, das war sie. »Sind Sie interessiert?« sagte er.
Ich nahm den letzten Schluck von meinem Martini. In Wirklichkeit willst du wissen, dachte ich, ob ich daran interessiert bin, dir dabei zu helfen, einen Pulitzer zu bekommen. Dreimal war Frank Size für einen Pulitzer-Preis nominiert worden, und dreimal hatte man ihn ihm vorenthalten. Manchmal schienen die Juroren den Eindruck zu haben, daß die Size-Storys zu sehr nach Tücke schmeckten und nicht genug nach sauberem Handwerk. Oder daß sie nach mitternächtlichen Treffen und geklauten Akten rochen anstatt nach akademischer, gesetzter Berichterstattung. Oder, am vernichtendsten von allem, daß die Methoden, die Size benutzt hatte, um an seine Storys zu kommen, solche waren, bei denen, zumindest nach Ansicht der Juroren, fragwürdige Praktiken angewandt worden waren. Mit anderen Worten: Wenn Frank Size nicht mit irgendwelchen anderen Mitteln an die Nachrichten herankam, klaute er sie fröhlich. Oder ließ sie klauen.
»Ich bin interessiert«, sagte ich.
»Wie schnell können Sie an die Arbeit gehen?«
Darüber dachte ich einen Moment nach. »Nächste Woche. Die werden froh sein, wenn sie mich los sind.«
»Wir könnten es sogar in der Kolumne ein bißchen pushen«, sagte Size.
»Sie könnten es mir auch schriftlich geben«, sagte ich.
»Sehen Sie, was ich meine, Mabel?« sagte Size. »Er ist einer von unserer Sorte.«
Mabel Singer nickte. »Ich sorge dafür, daß an ihn heute nachmittag ein Brief von Ihnen abgeht.«
»Kommen Sie doch mit uns ins Büro«, sagte Size, »dann können Sie ihr die Sachen geben, die sie braucht, Ihre Sozialversicherungsnummer zum Beispiel, und ich gebe Ihnen Hintergrundinformationen zu der Story, an der Sie arbeiten werden.«
»Hintergrundinformationen zu wem?« sagte ich.
»Ex-Senator Ames.«
»Mein Gott.«
»Was ist los?«
»Nichts«, sagte ich. »Ich hatte nur nicht geglaubt, daß man einen zweimal kreuzigen kann.«
Size grinste. »Sie werden sich wundern«, sagte er.
3
Die Kreuzigung des früheren Senators Robert F. Ames, Demokrat aus Indiana, hatte vor etwa sieben Monaten begonnen, als er an einem regnerischen Novembernachmittag an das Rednerpult trat und die vier anderen anwesenden Senatoren mit einem langen, stumpfsinnigen Vortrag von dreißig Minuten zu Tode langweilte, was es doch für eine prächtige Sache sei, daß ein kleinerer Mischkonzern namens Anacostia Corporation ein weiteres Opfer namens Can-Am Mining schlucken würde.
Am nächsten Tag hatte ein Interessenverband aus Washington allen betroffenen Aktionären per Luftpost Kopien der Rede des Senators aus dem Congressional Record zugeschickt. Fünfzehn Tage später schluckte die Anacostia Corporation Can-Am Mining, ohne auch nur aufzustoßen.
Am ersten Weihnachtsfeiertag präsentierte Frank Size in seiner Kolumne, was seiner Behauptung zufolge der unumstößliche Beweis dafür war, daß der Senator aus Indiana von dem Washingtoner Interessenverband 50 000 Dollar dafür bekommen hatte, die Rede zu halten. Size brandmarkte es als Bestechung und behauptete, die Seriennummern von einigen der dabei benutzten Hundert-Dollar-Scheine zu haben. Er schrieb, daß zwanzig Scheine von der Riggs Bank, wo der Interessenverband ein Konto hatte, bis zu dem Privatkonto des Senators bei der First National Bank verfolgt worden seien. Der Verbleib des Rests der 50 000 Dollar sei immer noch ungeklärt.
Andere Zeitungen und die Nachrichtenagenturen nahmen die Story auf und setzten ihre Reporter darauf an, die sich kläffend an die Verfolgung machten. Sie untersuchten die Übernahme von Can-Am Mining und fanden heraus, daß es einer jener Deals war, bei denen ein Unternehmen mit einer Menge liquider Mittel für seinen eigenen Untergang bezahlt – zum Schaden so gut wie aller Beteiligten, von ein paar wichtigen Aktionären abgesehen.
Die Story gewann Dynamik und weitere Verzweigungen, und als der Kongreß im Januar seine Sitzungen wiederaufnahm, entschied der Senat widerstrebend, daß er sich ein weiteres Mal mit der Moral eines seiner Mitglieder würde befassen müssen. Eine Anhörung wurde anberaumt, aber bevor sie beginnen konnte, trat Senator Robert F. Ames zurück – nachdem er genau fünf Jahre und vier Tage in einem Club gedient hatte, den manche immer noch als den exklusivsten der Welt bezeichnen. Das Justizministerium beschloß nach zwei Wochen lautstarken Räusperns, es habe nicht genug Beweise für eine Strafverfolgung. Zwei Tage später verließ Senator Ames seine Frau und ihre Millionen, um mit einer siebenundzwanzigjährigen Blondine zusammenzuziehen, einer Angestellten des Interessenverbands, der ihn angeblich bestochen hatte. Senator Ames war gerade zweiundfünfzig geworden.
»Er ist tot«, sagte ich und schloß die Akte. »Jemand hat nur vergessen, ihn zu begraben.«
Size schüttelte den Kopf. »Da steckt noch mehr dahinter.«
»Was?«
»Zum einen, warum sollte er sich mit fünfzigtausend Dollar bestechen lassen? Er hat selbst Geld. Seine Frau hat ihm zu seinem vierzigsten Geburtstag eine Million Dollar überschrieben.«
»Vielleicht hat er alles ausgegeben.«
»Es ist noch eine Menge übrig. Wenn er also das Geld nicht braucht, warum soll er sich bestechen lassen?«
»Vielleicht hat er es nicht genommen?«
»Quatsch«, sagte Size. »Er hat’s genommen.«
Ich schaute mich im Büro von Size um. Es sah nicht nach viel aus, nicht für einen im ganzen Land berühmten Mann, der 3000 Dollar für eine Rede bekam, wenn er sie in seinen straffen Zeitplan einbauen konnte. Er hatte eine Suite in der Pennsylvania Avenue, nur einen Block vom Weißen Haus entfernt, im fünften Stock eines ziemlich neuen Hauses, das mal ein Übungsgrün auf dem Dach gehabt hatte, bis es bei den Mietern darunter zu tropfen begann. Mabel Singer besetzte den Eingang zu der Size-Suite. Links von ihr war das Großraumbüro, wo die sechs Laufburschen arbeiteten. Hinter ihr war das Büro von Size, das einen grünen Nylonteppichboden hatte, einen braunen Schreibtisch, vermutlich Nußbaumfurnier, sechs Stühle mit geraden Rückenlehnen und grünen Plastikpolstern – auf einem von ihnen saß ich eben –, grüne durchscheinende Vorhänge und eine mechanische Schreibmaschine auf einem Metallständer. Das war alles. An den Wänden keine Bilder von ihm und Präsidenten, die er gekannt hatte. Keine Andenken auf dem Schreibtisch.
Ich stand auf. »Okay«, sagte ich. »Sie wollen die ganze Story.«
»Genau. Die ganze Story.«
»Wieviel Zeit habe ich?«
Size zuckte mit den Achseln. »Soviel Sie brauchen.«
»Und wenn es keine Story gibt?«
»Es gibt eine. Sie vergessen mein unfehlbares Urteil.«
»Sie haben recht«, sagte ich. »Hab ich vergessen. Ich arbeite zu Hause, ja?«
»Wenn Sie keinen Schreibtisch da drinnen haben wollen«, sagte er mit einem Nicken in Richtung Großraumbüro.
»Nein, danke.«
»Sonst noch was?«
»Nur noch eine Sache. Wann werden wir bezahlt?«
»Alle zwei Wochen.«
»Schön«, sagte ich. »Wir sehen uns am Zahltag.«
Drei Wochen später klingelte das Telefon in dem Moment, als Martin Rutherford Hill die Augen zusammenkniff, ein kleines grausames Lächeln um seine feuchten rosa Lippen spielen ließ, sorgfältig zielte und seine Schale Grießbrei über Foolish den Kater kippte. Foolish, ein fünf Jahre alter Rabauke von sieben Kilo, leckte einmal an dem Brei, befand, daß er ihn nicht mochte, sprang hoch auf den Kinderstuhl und schlug dem zweijährigen Martin Rutherford Hill mit eingezogenen Krallen auf die Nase. Das Kind schrie; Foolish grinste, sprang vom Hochstuhl und flitzte ins Wohnzimmer, wobei seine Krallen auf dem PVC-Boden wilde Klickgeräusche machten. Es war ein weiteres Scharmützel in einem langen Krieg, den keiner von beiden gewann.
Ich legte meine Washington Post hin, schaute hoch zur Decke und schrie einer unsichtbaren Präsenz zu: »Komm und nimm das gottverdammte Kind!« Zu Martin Rutherford Hill sagte ich: »Sei still, dir tut nichts weh.« Das Kind heulte und warf seinen Plastiklöffel nach mir, während ich das Wandtelefon beim vierten Klingeln abnahm.
Nach meinem Hallo sagte eine Frauenstimme: »Mr. Lucas?«
»Ja.«
»Ihre Telefonnummer habe ich vom Büro von Frank Size bekommen.« Sie hatte eine junge Stimme, dachte ich, nicht älter als fünfundzwanzig und wahrscheinlich näher an zwanzig.
»Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Ich heiße Carolyn Ames. Ich bin Robert Ames’ Tochter.«
»Ja, Miss Ames.«
»Sie haben in der ganzen Stadt Fragen nach meinem Vater gestellt.« So wie sie es sagte, war es keine Beschuldigung, sondern eher die melancholische Feststellung einer Tatsache. Vermutlich würde sie den gleichen Tonfall verwenden, um bekanntzugeben, daß gestern abend ihr junger Hund gestorben sei.
»Ja, ich habe einige Fragen gestellt«, sagte ich. »Tatsächlich würde ich Ihnen gern einige stellen.«
Ein kurzes Schweigen entstand, und dann sagte sie: »Sind Sie ein ehrlicher Mann, Mr. Lucas?«
»Durchschnitt«, sagte ich nach einer Pause. Ich hatte eine Pause machen müssen, um über die Frage nachzudenken, weil sie so noch niemand zuvor gestellt hatte.
»Wenn Sie die wahre Geschichte meines Vaters bekämen, würden Sie sie schreiben?«
»Ja«, sagte ich, diesmal ohne Zögern, »ich würde sie schreiben.«
»Würde Frank Size sie drucken?«
»Ja, da bin ich mir fast sicher.«
»Selbst wenn das bewiese, daß er gelogen hat?«
»Sie meinen Size?«
»Ja.«
»Er gibt normalerweise zu, wenn er sich geirrt hat. Er tut es sogar ziemlich fröhlich.«
»Dies ist keine fröhliche Angelegenheit.«
»Nein«, sagte ich. »Das ist es wohl nicht.«
Es entstand noch eine Pause, und als sie wieder sprach, klang es so, als ob sie es abläse oder es auswendig gelernt hätte und keine gute Schauspielerin wäre. »Ich habe bestimmte Informationen, die beweisen werden, daß mein Vater ein Opfer der Umstände war. Der Beweis ist sorgfältig durch Tonbänder und Schriftstücke belegt, darunter eine Zusammenfassung von fünfzig Seiten, die ich selbst geschrieben habe. Um den Namen meines Vaters reinzuwaschen und die wahren Schuldigen zu benennen, bin ich bereit, Ihnen dieses Material heute nachmittag um drei Uhr zu übergeben.«
Sie nimmt das Gespräch auf, dachte ich und beschloß, genauso vorsichtig und genauso formell zu sein. »Ich bin bereit, die von Ihnen beschriebenen Informationen entgegenzunehmen. Wo sollen wir uns treffen?«
Sie nannte den Namen eines Straßencafés an der Connecticut Avenue nicht zu weit vom Shoreham.
»Draußen?« sagte ich.
»Ja, draußen. Ich ziehe einen möglichst öffentlichen Ort vor.«
»Wie erkenne ich Sie?«
Sie gab mir eine kurze Beschreibung von sich und fügte hinzu: »Ich werde einen grünen Aktenkoffer tragen.« Dann legte sie auf.
Mittlerweile war die unsichtbare Präsenz und Mutter des Kindes eingetroffen und damit beschäftigt, den Grießbrei aufzuwischen, den Martin Rutherford Hill auf den Boden geschüttet hatte. Das Kind schaute Sarah Hill dabei zu, lächelte, als sie fertig war, und sagte: »Glock.«
»Wir glocken später«, sagte sie, als sie aufstand. »Wer hat gewonnen?« fragte sie mich, »das gottverdammte Kind oder die gottverdammte Katze?«
»Es war ein Unentschieden.«
»Na ja, das meiste hat er gegessen.«
»Er würde sich nicht davon trennen, wenn er noch Hunger hätte.«
»Willst du noch etwas Kaffee?« sagte sie.
»Bitte.«
Sarah Hill goß erst mir und dann sich eine Tasse ein. Sie setzte sich an den runden Frühstückstisch aus Ahorn, stützte die Ellbogen darauf ab, hielt die Kaffeetasse in beiden Händen und starrte über die Tasse in den Garten, der jenseits der offenen Glastür lag. Der Garten war ihr Reich, er war ziemlich schmal und tief, und die Hartriegel- und Azaleenblüten waren aufgegangen und schrien nach Aufmerksamkeit. Die Rosen würden später, im Juni, hinzukommen, nur zwei spät blühende Beete mit Narzissen folgten immer noch der Sonne auf ihrer Bahn. Es gab kein Gras im Garten, nur Pflanzen und Büsche und einen mit Ziegeln gepflasterten Pfad, der sich von einer Seite zur andern schlängelte und es nicht besonders eilig hatte, irgendwo anzukommen. Ein Trio hoher alter Ulmen sorgte für Schatten und ein bißchen Würde. Alles sah ein wenig wild und ein bißchen planlos und sogar willkürlich aus, und Sarah Hill hatte hart dafür gearbeitet, daß es so aussah.
»Stockrosen«, sagte sie.
Ich drehte mich um und schaute hinaus. »Wo?«
»In der Ecke neben dem kleinen rosa Hartriegel.«
»Du hast recht. Da sähen sie schön aus.«
»Man kann Bienen darin fangen.«
»In Stockrosen?«
Sie nickte. »Man kann sie in den Blüten einfalten und summen hören.«
»Was macht man dann mit ihnen?«
»Läßt sie fliegen, nehm ich an. Mein Bruder hat sie immer zertreten.«
»Ich hab ihn schon immer für einen gemeinen Scheißkerl gehalten.«
Sarah Hill und ich lebten seit etwas mehr als einem halben Jahr zusammen. Wir hatten uns an einem Samstagnachmittag in der Kongreßbibliothek kennengelernt, und ich hatte sie auf einen Drink zu mir nach Hause eingeladen, und sie war einfach irgendwie dageblieben und hatte ihre Bücher und ihr Baby und ihre Kameras in der folgenden Woche nachkommen lassen. Ohne es je wirklich zu besprechen, teilten wir die Hausarbeiten auf, wobei sie den Garten und das Putzen übernahm, während ich das Abendessen machte, nachdem sie angedeutet hatte, daß sie keine große Lust dazu hätte. Ich erledigte auch die Lebensmitteleinkäufe, bis sie entdeckte, daß ich der größte Spontankäufer der Welt war.
Sie war freiberufliche Fotografin und hatte sich auf Porträts bei natürlichem Licht spezialisiert. Ihre Talente waren bei mehreren Organisationen stark gefragt, die ihre Zentrale in Washington hatten und in Sachen Publicity-Fotos ihrer Manager und Vorstandsmitglieder etwas Neues haben wollten. Sarah brachte, indem sie oft nicht mehr benutzte als eine alte Leica mit hochempfindlichem Film, eindrucksvolle, zwanglose Porträts zustande, die ihre zumeist älteren Modelle warmherzig, weise, witzig und schmeichelhaft menschlich aussehen ließen. Sie bestand außerdem darauf, mir 200 Dollar monatlich für ihren Anteil an Miete und Haushaltskosten zu zahlen. Ich legte das Geld auf einem Sparkonto unter dem Namen Martin Rutherford Hill an.
Alles in allem kamen wir ganz gut miteinander aus, und wir konnten uns wirklich gut leiden. Vielleicht waren wir sogar ineinander verliebt; zumindest versuchten wir es, aber nach zwei misslungenen Ehen auf beiden Seiten hatten wir begriffen, daß es etwas war, woran man arbeiten mußte.
»Wer hat angerufen?« sagte sie.
»Die Tochter des Senators.«
»Können wir Samstag welche holen?«
»Was für welche?«
»Stockrosen.«
»Ja, ich glaube schon.«
»Ich glaube immer noch nicht, daß er es getan hat.«
»Wer?«
»Senator Ames.«
»Du meinst, Schmiergeld genommen?«
»Ja.«
»Warum?«
Sarah befeuchtete ihre Papierserviette mit der Zunge und benutzte sie, um etwas getrockneten Haferbrei vom Mund ihres Sohnes abzuwischen. Das Kind lächelte glücklich und sagte: »Hrap.« Sie schnitt ihm eine Grimasse. Er kicherte und sagte: »Hroo.« Sie schnitt noch eine Grimasse und sagte: »Er sieht nicht so aus, als ob er Schmiergeld nähme. Er sieht zu verträumt aus mit all dem gewellten grauen Haar und den traurigen braunen Augen und seinem Nur-du-und-ich-wissen-Bescheid-Ausdruck. Ich glaub einfach nicht, daß er’s genommen hat.«
»Weil er traurige braune Augen hat?« sagte ich.
»Weil seine Frau Geld hat, Klugscheißer. Sie ist achtzig Millionen Dollar wert.«
»Eher achtzehn Millionen«, sagte ich und schaute auf meine Uhr. »Also, ich muß los.«
»Zur Bibliothek?«
»Ja.«
»Nimmst du das Auto?«
»Ich komme später wieder und hole es.«
Sarah und ich wohnten in einem schmalen, zweistöckigen roten Backsteinhaus mit einer platten Vorderseite, das vor rund achtzig Jahren an der Southeast Fourth Street gebaut worden war und in fußläufiger Entfernung von der Kongreßbibliothek und fast um die Ecke von dort lag, wo J. Edgar Hoover geboren worden war.
Vor fünf Jahren war es von einem reichen jungen frischgebackenen Kongreßabgeordneten aus San Francisco gekauft, entkernt und kostspielig neugestaltet worden, der dachte, es würde seinen Wählern gefallen, wenn sie wüßten, daß er sich dafür entschieden hatte, in einem der gemischten Wohnviertel Washingtons zu leben.
Den zumeist schwarzen Wählern des Kongreßabgeordneten war es offenbar ziemlich egal gewesen, wo er lebte, weil sie ihn nicht zu einer zweiten Amtszeit zurückgeschickt hatten. Deshalb vermietete der Ex-Kongreßmann mir das Haus inzwischen billig unter der Bedingung, daß ich innerhalb eines Monats auszöge, wenn er es geschafft hätte, wiedergewählt zu werden. Ich wohnte jetzt seit drei Jahren in dem Haus, und danach zu urteilen, wie die letzte Wahlkampagne des Ex-Kongreßmanns verlaufen war, konnte ich vermutlich ewig darin wohnen.
»Bist du zum Mittagessen zu Hause?« fragte Sarah, als sie aufstand und die Kaffeetassen einsammelte.
Ich stand auch auf. »Nein, ich werde wohl irgendwo in der Stadt essen. Was machst du heute?«
Sie drehte sich um, schaute mich an und lächelte. Es war ihr gefährliches Ich-bin’s-langsam-leid-Lächeln. »Oh, mein Tag ist voll verplant mit einer Reihe aufregender Ereignisse, die dazu bestimmt sind, sowohl den Geist wie die Seele zu bereichern. Mein Sohn und ich gehen beispielsweise in das freundliche Filialgeschäft im Nachbarschaftsghetto, wo uns für die Esswaren, die du heute abend zubereitest, ungefähr fünf Prozent zuviel berechnet wird.«
»Was gibt es?« sagte ich.
»Rinderrippe.«
»Gut.«
»Als Gesprächspartner«, fuhr sie fort, »habe ich dann noch einen Zweijährigen, der in einer fremden Sprache redet – plus Mrs. Hatcher von nebenan, die normalerweise wissen will, ob ich ihr eine Tasse Gin leihen kann. Der Höhepunkt des heutigen Tages wird allerdings darin bestehen, daß ich das Katzenklo saubermache, damit Foolish gemütlich scheißen kann, und wenn sich die Dinge hier nicht bald zum Besseren wenden, such ich mir ’nen Lover, der ein bißchen Aufregung in mein Leben bringt und mich sonntagsnachmittags zu einem Ausflug nach Baltimore ausführt.«
Ich nickte. »Ich frage mich, was sie für mich hat.«
»Wer?«
»Senator Ames’ Tochter.«
»Oh.«
Ich bin knapp über eins achtzig groß, aber ich mußte mich nicht sehr bücken, um Sarah zu küssen, die eins fünfundsiebzig und schlank war und ein apartes Gesicht hatte, dessen interessante Flächen und Grübchen sie davor bewahrten, schön genannt zu werden. Sie hatte weit auseinanderstehende Augen und lange Haare, die ihr fast bis zur Taille gingen und blauschwarz glänzten. Sie nannte sie Rothaut-Haare und erzählte jedem, sie sei zu einem Viertel Choctaw, was sie in Wirklichkeit nur zu einem Zweiunddreißigstel war.
»Hmm«, sagte ich und umarmte sie, »hübsches Zungenspiel.«
»Du hast kein verdammtes Wort von dem gehört, was ich gesagt habe, oder?«
»Na klar hab ich das«, sagte ich. »Du wirst dir einen Lover suchen, der das Katzenklo saubermacht.«
4
Die Tochter des Senators war zu spät, inzwischen vierundzwanzig Minuten, und das veranlaßte den Lehrer in mir, falls es da einen gab, an Unpünktlichkeit zu denken, eine Eigenschaft, die ich noch nie ausstehen konnte, weshalb ich mich auf dem harten grünen Metallstuhl des Straßencafés wand und meine Sammlung vernichtender Bemerkungen durchforstete, die ich, wie ich wußte, nie benutzen würde. Zumindest nicht bei ihr.