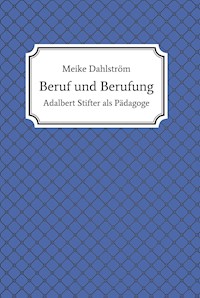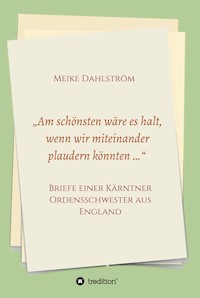
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Impressionen aus einem Ordensleben im frühen 20. Jahrhundert: Dieses Buch folgt Schwester Cuthberta (1884-1946) aus ihrer Kärntner Heimat über den Eintritt in den Schweizer Orden der Schwestern vom Heiligen Kreuz bis an ihr Lebensende in einem Konvent im englischen Woking. Anhand überlieferter Briefe und Fotografien zeichnet Meike Dahlström den Lebensweg ihrer Urgroßtante nach, einer selbstbestimmten Frau im Dienste der Kirche - durch vier Jahrzehnte voller historischer und politischer Turbulenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Meike Dahlström
„Am schönsten wäre es halt, wenn wir miteinander plaudern könnten…“
Briefe einer Kärntner Ordensschwester aus England
© 2019 Meike Dahlström
Lektorat: Tom Dahlström
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-7631-9
e-Book:
978-3-7482-7633-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für meine Mama, Mariannes Großnichte
„Ein Mensch mit gütigem, hoffendem Herzen fliegt, läuft und freut sich; er ist frei. Weil er geben kann, empfängt er; weil er hofft, liebt er.“
(Franz von Assisi, 1182-1226)
„Am schönsten wäre es halt, wenn wir miteinander plaudern könnten, aber ich glaube, das wird wohl erst im Himmel droben sein.“
(Sr. Cuthberta, 1884-1946)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Historische Einordnung
2 Ein Leben
2.1 Kleiner Exkurs: Das Heimatland Kärnten
2.2 Die Schwestern vom Heiligen Kreuz
3 Die Briefe
3.1 Erster Brief (1907)
3.2 Zweiter Brief (1909)
3.3 Dritter Brief (1909)
3.4 Vierter Brief (1922)
3.5 Fünfter Brief (1923)
3.6 Sechster Brief (1927)
3.7 Siebter Brief (1938)
3.8 Achter Brief (1939)
3.9 Neunter Brief (1946)
3.10 Zehnter Brief (1946)
3.11 Elfter Brief (1946)
4 Das Ende
4.1 Nekrolog von Sr. Christina Klischowsky
4.2 Statt eines Nachworts
5 Anhang
5.1 Zeitleiste
5.3 Literatur
5.4 Weblinks
5.5 Danksagung
Vorwort
Was ist Sinn und Zweck dieses Buches? Wer ist die im Titel erwähnte Ordensschwester? Was ist das Besondere an ihr? Eines sei vorangestellt: Hier geht es weder um die Biografie einer großen Persönlichkeit noch um die Briefe einer politisch oder kirchlichreligiös maßgeblichen Person. Ich habe die Gelegenheit ergriffen, über eine beeindruckende Österreicherin und Kärntnerin zu schreiben, auch wenn sie den Großteil ihres Lebens in England verbrachte. Dennoch steht hier eine „einfache Frau“ im Mittelpunkt: meine Urgroßtante Marianne, spätere Ordensschwester Cuthberta (1884-1946). Dieses Buch dient der Herausgabe ihres Nachlasses; dabei handelt es sich vor allem um Briefe an ihre Familie in Kärnten. Bereits als junge Frau entschließt sie sich dazu, ihre Heimat zu verlassen, um in die Schweizer Kongregation der Schwestern vom Heiligen Kreuz einzutreten – besser bekannt unter dem Namen „Menzinger Schwestern“. Nach ihrem Noviziat und einem Jahr Mitarbeit in einem Waisenhaus in Sarnen im Kanton Oberwalden lässt sie auch die Schweiz endgültig hinter sich, um am Aufbau der neuen Ordensprovinz in Südengland mitzuwirken.
Der Großteil meiner Nachforschungen zu ihrer Person beruht auf einer Kiste voll Erinnerungen. Ein Schatz an Briefen, Fotografien, Broschüren, Zeitungsausschnitten, getrockneten Edelweiß, Gebeten und Heiligenbildchen. Ein Erbe, gesammelt von meiner Urgroßmutter und weitergegeben an Großmutter und Mutter. Was damit anfangen? Fast vier Jahre ist es her, seit ich im April 2016 mit den ersten Recherchen begonnen habe. Beim Lesen und Nachforschen nimmt das Bild einer Frau, einer Persönlichkeit, Formen an. Einfach und dennoch willensstark ist sie, selbstbestimmt. Eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie aus dem Jahr 1907 zeigt sie als 22-jährige junge Frau, die mit einem verhaltenen Lächeln selbstbewusst in die Zukunft blickt und sich ihrer Lebenswahl gewiss zu sein scheint: Stolz erhobenen Hauptes lässt sie Heimat und Familie hinter sich, um in der Schweiz ihrer Berufung nachzugehen. Flüchtig sind ihre Spuren, oft nur schemenhaft, da viele Briefe und Dokumente aus ihrem Nachlass auf immer verloren sind. Nicht auf alle Fragen gibt es eine Antwort; oft gibt es statt dem erhofften Hinweis nur vage Vermutungen und Annahmen. Das Zusammensetzen fragmentarischer Aussagen und die Spurensuche in der Vergangenheit kommt einer Detektivarbeit gleich. Desto größer ist die Freude, wenn Zusammenhänge erkennbar werden und sich Vermutungen bestätigen. Im Laufe der Zeit lässt sich Stück für Stück eine Persönlichkeit ins Leben rufen und es entsteht das Bild einer ungewöhnlichen und mutigen Frau, die mehr als einmal unter Beweis stellt, dass sie als Ordensschwester das Sinnbild der modernen Frau widerspiegelt – sie ist eigenständig, unabhängig, weder Mann und Familie unterstellt noch durch häusliche Pflichten gebunden. Ihre tägliche Arbeit als Ordensschwester, Köchin und Lehrerin ist mehr als „nur“ eine Arbeit, es ist ein Beruf und eine Berufung aus eigenem Willen und Antrieb.
Besuche bei den so überaus liebenswürdigen, interessierten und hilfsbereiten Menzinger Schwestern in der Schweiz und in England helfen, die Briefe lebendig werden zu lassen; dank eigener Recherche fördern sie weitere Unterlagen zutage und tragen damit dazu bei, das Bild meiner Urgroßtante zu vervollständigen. Beeindruckend und emotional ist es, die Orte, an denen Marianne gelebt hat, mit eigenen Augen zu sehen. In England ergibt sich die Gelegenheit, mit zwei Schwestern zu plaudern, die Marianne selbst noch gekannt haben: Vor allem Mariannes positive Ausstrahlung, ihre innere Zufriedenheit und Ruhe und nicht zuletzt ihre überaus leckeren Torten sind den lieben Schwestern in Erinnerung geblieben. Ich bin gerührt: Marianne starb bereits im Jahr 1946, vor 72 Jahren, und dennoch ist es mir als Urahnin vergönnt, im Jahr 2018 mit Zeitgenossen über sie zu sprechen. Zuletzt stehe ich weinend vor ihrem Grab in Chalfont St. Peter – ich bin die erste in meiner Familie, die ihre Ruhestätte besucht.
In diesem Buch möchte ich den Lebensweg einer Frau aufzeigen, die trotz aller Umstände und ihrer Zeit weit voraus eigene Entscheidungen trifft, ihr Leben lang unabhängig bleibt und sich als zukunftsweisende Frau beweist – trotz oder gerade wegen ihrer Zugehörigkeit zu einem Orden. Ihre fromme Religiosität ist ihr beständiger Begleiter, ein Helfer und Tröster. Diesem Glauben ordnet sie sich unter; nicht aber dem gängigen Frauenbild ihrer Zeit. Die Modernität und Selbstbestimmtheit ihres Handelns ist auffallend und kann auch heute noch aufzeigen, dass jede Frau, ob jung, alt, mit und ohne Bildungshintergrund, ihren Weg finden und gehen kann – ungeachtet der Herkunft und vermeintlicher Einschränkungen. Doch wie schafft sie es, sich ihr Leben lang einer Glaubensgemeinschaft unterzuordnen und dennoch frei und selbstbewusst eigene Entscheidungen zu treffen und darüber hinaus ihren Glauben täglich unter Beweis zu stellen?
Diese Fragen stelle ich an meine Urgroßtante – in der Hoffnung, Antworten und Aufschlüsse in Form ihrer Briefe und Gedanken zu erhalten. Dabei geht es nicht um ein historisches Gesamtbild, sondern um einen persönlichen Einblick in das einfache Leben einer Ordensschwester zu geben. Dazu gehören Sorgen, Mühen und Nöte genauso wie Freuden und die sich wie ein roter Faden durch alle Briefe ziehende ungebrochene Glaubensstärke und Willenskraft. Das Zitat aus einem der Briefe an ihre Schwester „Am schönsten wäre es halt, wenn wir miteinander plaudern könnten, aber ich glaube, das wird wohl erst im Himmel droben sein“ gibt auf einfache und berührende Art ihren unverbrüchlichen Glauben wider – der Glaube daran, dass Gott es nur gut mit den Menschen meint und sie trotz aller Mühen und Entbehrungen auf ein Wiedersehen mit ihren Liebsten hoffen darf – auch wenn dies erst nach dem Tod geschehen mag.
1 Historische Einordnung
2 Ein Leben
Marianne wird in eine Zeit des Umbruchs hineingeboren. Noch existiert das österreichisch-ungarische Kaiserreich und damit das Herzogtum Kärnten als eines seiner fünfzehn Kronländer.1 „Ganz hübsch“2 muss es gewesen sein, das österreichische Leben im ausgehenden 19. Jahrhundert unter Kaiser Franz Joseph I., so der Historiker Golo Mann: „steigende Wohlhabenheit, politische Freiheit, Rechtssicherheit; eine tüchtige, wenn auch etwas umständliche Verwaltung; eine reife, noch immer schöpferische Kultur.“3 Die österreichische Wirtschaft und Kultur erleben eine Blütezeit sondergleichen und erreichen ihren Höhepunkt mit der Wiener Moderne, einer einmaligen geistigen und künstlerischen Schaffensperiode. Wien wird zum Zentrum einer einzigartigen künstlerischen und intellektuellen Blütezeit: der „Wiener Moderne“. Expressionistische Maler wie Egon Schiele, Oskar Kokoschka oder Gustav Klimt, aber auch die Schriftsteller Arthur Schnitzler und Karl Kraus entwickeln im Spannungsfeld des untergehenden Habsburgerreiches bislang ungekannte Ausdrucksmöglichkeiten. Nicht zuletzt beschreitet der Wiener Neurologe Sigmund Freud mit der Entwicklung seiner Psycholanalyse4 und seinem Hauptwerk über die Traumdeutung völlig neues Terrain.
Mariannes Geburtstag ist der 23. November 1884. Von ihrer Familie wird das kleine Mädchen „Marianne“ oder liebevoll „Mariandl“ gerufen. Ihr Geburtsort ist Paternion in Kärnten. Laut einem Pass von 1928 hat sie graue Augen, braune Haare und ein rundes Gesicht. Ihre Schwester Rosalia ist knapp dreieinhalb Jahre jünger, sie wird am 5. April 1888 geboren. In einem handgeschriebenen Lebenslauf erwähnt sie außerdem einen älteren Bruder, der aller Wahrscheinlichkeit nach früh gestorben ist, da er später nie wieder genannt wird und auch in der Familie nicht bekannt ist.
Am 24. April 1890 stirbt die Mutter der beiden kleinen Mädchen, Anna. Sie ist die Tochter eines Gastwirts aus Ferndorf nahe des Millstätter Sees und gerade einmal 29 Jahre alt. Über ihren Tod ist nicht viel bekannt, außer, dass die junge Frau schwermütig, vielleicht sogar depressiv gewesen ist. Die Frau sei „seelisch zugrunde gegangen“, so die verschwommene Überlieferung; sie habe an einer „Nervenkrankheit“ gelitten. Eine Fotografie aus dem Jahr 1888 zeigt eine ernste und schöne junge Frau; die kleine Rosalia strampelt auf ihrem Schoß. Über einen Freitod wird nicht gesprochen, es bleiben die Spekulationen, wie sich auch in einem ihrer Briefe noch zeigen wird. Auch vom Vater, einem Kaufmann, weiß man nicht viel; er gibt nach dem Tod der Ehefrau die beiden kleinen Töchter an seine Schwägerinnen ab und tritt fortan nicht mehr in Erscheinung. Zur Zeit der Geburt Mariannes hält er sich in Hohenthurm5 im südlichen Kärnten auf; vermutlich aus beruflichen Gründen. Nach dem Tod der Mutter wird Marianne von ihrer Tante aufgenommen, die selbst verwitwet und kinderlos ist.
Nur ein Jahr später, 1889, zeigt sich der schwache Grund, auf dem das altertümliche und marodem Kaiserreich steht: Kronprinz Rudolf6, der einzige Sohn von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth, erschießt im Jagdschloss Mayerling bei Wien seine Geliebte Mary Vetsera und danach sich selbst. Die Umstände des doppelten Suizids sind bis heute nicht aufgeklärt. Kaiser und Monarchie erleben eine erste Sinnkrise. Kronprinz Rudolf hinterlässt eine kleine Tochter, Elisabeth Marie, die gerade ein Jahr älter als Marianne ist und später aufgrund ihrer sozialdemokratischen Überzeugungen auch "Rote Erzherzogin" genannt wird.
Wie sich Marianne nach dem Tod der Mutter bei ihrer Tante eingelebt hat, ist nicht bekannt. Traumatisch ist der Verlust eines Elternteils in diesem Alter allemal; die kleine Marianne ist gerade einmal fünf Jahre alt und muss sich neben dem herzzerreißenden Verlust der Mutter an eine neue Umgebung und einen neuen Vormund gewöhnen. In einem Brief aus dem Jahr 1939 wird deutlich, wie sehr die Mädchen gelitten haben; selbst als 54-Jährige merkt man ihr den ungebrochen großen Schmerz an: „Morgen ist unserer Mutter Sterbetag, Gott gib Ihr die ewige Ruhe. Sie hat nicht viel versäumt, nur wir haben viel durch ihr frühes Sterben verloren.“7 In ihrem Nachlass findet sich außerdem eine Handschrift des anrührenden Gedichtes „Wenn Du noch eine Mutter hast“ von Friedrich Wilhelm Kaulisch (1827-1881).8
Im Herbst 1891 wird Marianne eingeschult. Dabei hat sie Glück: Sie kommt in den Genuss einer achtjährigen Schulbildung. Zwanzig Jahre zuvor galten noch andere Regeln. Erst das „Reichsvolksschulgesetz“ von 1869 legt Richtlinien der Schulpolitik in Österreich fest, die teilweise noch heute gültig sind. Die wichtigsten Reformen sind konsequente Trennung von Kirche und Staat sowie die Ausdehnung der Schulpflicht von sechs auf acht Jahre. Allerdings werden die Forderungen des Neuhumanismus9 nur für das höhere Schulwesen berücksichtigt; die Mehrheit der Bevölkerung, deren Schulbildung sich auf den Besuch der Volksschule beschränkt, ist davon ausgenommen: Einer umfassenden Bildung im humanistischen Sinn wird keine größere Bedeutung zugeschrieben. Stattdessen zählen Handarbeiten und Haushaltskunde zu den Pflichtfächern für Mädchen.
Am 12. April 1896, dem „Weißen Sonntag“10, empfängt Marianne die erste heilige Kommunion. Im Jahr darauf stirbt ihre Tante. Erneut muss sie in frühen Jahren den Tod einer Bezugsperson verwinden. Es mutet etwas seltsam an, dass sie nicht spätestens jetzt von einer weiteren Tante und deren Mann, die sich seit dem Tod der Mutter auch um Rosalia kümmern, aufgenommen wird. Die beiden Mädchen müssen ihre Kindheit getrennt voneinander verbringen; dennoch haben die trostlosen Umstände ihre enge Verbundenheit nur gestärkt. Marianne scheint der erneute Umzug sehr gut zu tun, sie lebt für ein Jahr als Internatsschülerin bei den Ursulinen11 in Klagenfurt, deren Hauptaugenmerk auf der Bildung von Mädchen liegt. Mariannes erster Kontakt zu einem Orden wird bestimmend für ihren weiteren Lebensweg, denn mit Sicherheit hat sie der Aufenthalt so beeindruckt, dass er später zum richtungweisenden Element wird.
Am 10. September 1898 wird Kaiserin Elisabeth in Genf von dem italienischen Anarchisten Luigi Lucheni erstochen. Zur gleichen Zeit beginnt für Marianne das letzte Volksschuljahr in Klagenfurt; mit dem Abschluss können die jungen Schulabgänger ins Berufsleben eintreten. Um 1900 üben bereits 43,2 %12 der österreichischen Frauen einen Beruf aus; der Großteil davon arbeitet auf Bauernhöfen; in den industrialisierten Gebieten um Wien überwiegen die Fabrikarbeiterinnen. Diese Zahlen müssen allerdings mit Vorsicht betrachtet werden: Den wenigsten Frauen wird eine Berufsausbildung zuteil; die meisten arbeiten als ungelernte Hilfskräfte oder in Berufen, die als Vorbereitung auf das Eheleben gelten: Haushälterin, Kindermädchen, Gesellschafterin. Schließlich ist es nach wie vor Pflicht der Frau, sich dem Ehemann unterzuordnen und zuhause das Familienleben zu organisieren.
Marianne kehrt mit dem erreichten Volksschulabschluss im Alter von 14 Jahren nach Paternion zurück, wo sie endlich wieder mit ihrer Schwester zusammenleben darf. Die Tante der beiden