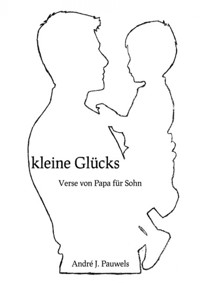Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Arbeit für eine Religionsgemeinschaft oder Kirche bedeutet immer wieder, mit Fragen konfrontiert zu werden. Die Fragen sind dabei manchmal kritisch, manchmal neugierig. Es gibt Menschen, die einfach etwas wissen wollen und solche, die sich eine glaubwürdige Stellungnahme fordern. Alle Fragen zeigen aber immer: Religion fasziniert die Menschen nach wie vor – ganz besonders in einer immer säkulareren Gesellschaft. Oft entstehen in der Praxis Fragen, die witzig klingen und es immer wieder auch wirklich sind – und die trotzdem eine Antwort verlangen. Genau diese Antworten will dieses Buch liefern: 40 Antworten auf 40 ausgesuchte Fragen zum Christentum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André J. Pauwels
An Weihnachten hat Jesus ne Tanne aufgestellt?!
André J. Pauwels
An Weihnachten hat
Jesus ne Tanne aufgestellt?!
40 Fragen an das Christentum
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnd.dnd.de abrufbar.
Texte: © 2025 Copyright by André J. Pauwels
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by André J. Pauwels
Verlag:
André J. Pauwels
An der Klanze 24
38554 Weyhausen
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Ein paar Worte vorneweg…
1: Was ist eigentlich ein Pontius Pilatus?
2: Wer soll das mit der Auferstehung denn bitte glauben?
3: Altes Testament – Neues Testament – Wer erbt hier eigentlich was?
4: Die sprechen in der Kirche ständig von Armen. Was soll das eigentlich?
5: Was soll mir ein 2000 Jahre altes Buch schon sagen?
6: Warum machen die Christenmenschen eigentlich immer so ein Gewese um das Abendmahl?
7: Was ist pilgern und wieso macht man das?
8: Muss ein Christenmensch nicht immer schön die andere Wange hinhalten?
9: Ging Jesus eigentlich an Christi Himmelfahrt mit seinem Bollerwagen zu seinem Vater?
10: Was soll das mit den Fischen auf den Heckklappen von Autos eigentlich?
11: Christenmenschen glauben an mehrere Götter. Sind sie dann überhaupt Monotheisten?
12: Wieso sollte man auf euch Christenmenschen hören, wenn ihr euch selbst nicht einig seid?
13: Wieso heißt Jesus mit Nachnamen Christus? Ich denke, der kam aus Nazareth?
14: Kann man nicht auch ohne Kirchen und ihre ganzen Rituale an Gott glauben?
15: Hat Jesus an Weihnachten eine Tanne aufgestellt, seinen Jüngern Geschenke gemacht und Last Christmas gesungen?
16: Wie mich diese Glocken am Sonntag- morgen nerven! Kann man das nicht endlich verbieten?
17: Die Christenmenschen mit ihrer Sündenvergebung! Ist doch praktisch, wenn man einen Blankoscheck für’s Scheißebauen hat, oder?
18: Ich finde ja gut, dass die Kirchen sich sozial engagieren, aber braucht es sie darüber hinaus überhaupt noch?
19: Was für ein Problem haben Christen- menschen eigentlich mit Homosexuellen?!
20: Wieso sollte man überhaupt noch etwas mit der Kirche zu tun haben wollen, nach allem, was die in der Inquisition und bei den Kreuzzügen angerichtet hat?!
21: Vertrösten Christenmenschen eh nicht bloß immer auf das Jenseits?
22: Wieso sollte irgendwer einer der großen Kirchen noch vertrauen, nach all den Missbrauchsfällen und der schlechten Aufklärung?
23: Ist Gott tot?
24: Glauben Christenmenschen wirklich an Dämonen?
25: Himmel, Hölle, Fegefeuer?! Was soll das? Nach dem Tod kommt nichts. Wir leben. Wir sterben. Das wars.
26: Hat der Nikolaus am 6. Dezember Stiefel vor die Türen von Kindern gestellt und kleine Schoko-Minis von sich selbst verschenkt?
27: Denken Christenmenschen wirklich, dass beten hilft? Handeln, ja, aber beten?!
28: Haben die Heiligen Drei Könige gekifft oder warum haben die Weihrauch und Myrrhe dabeigehabt?
29: Wieso ist eigentlich das Kreuz DAS Symbol des Christentums? Hätte man nicht etwas weniger Drastisches nehmen können?
30: Opfer, Sünde, Buße. Das ist mir alles zu martialisch und negativ. Geht das nicht auch positiver?
31: Wozu braucht es in Kirchen eigentlich Prunk und Protz, wenn Jesus ein einfaches Gewand und ein simpler Tisch gereicht hat?
32: Was für ein Problem haben Christen- menschen eigentlich mit dem Islam?
33: Haben Christenmenschen eigentlich einen Mutterkomplex oder warum überhöhen sie Maria so krass?
34: Interessiert sich Gott für meine individuellen Probleme?
35: Was hat es eigentlich mit dem Rosenkranz auf sich?
36: Wieso dürfen Priester eigentlich nicht heiraten?
37: Sind Heilige nicht am Ende so etwas wie Götter?
38: Was hat es mit der Fastenzeit auf sich und warum machen Christenmenschen das?
39: Glauben Christenmenschen allen Ernstes, dass Jesus nochmal wiederkommt?
40: Kannst du mal verständlich sagen, was Christenmenschen denn nun eigentlich glauben?
Ein paar Worte vorneweg…
„Was ist eigentlich ein Pontius Pilatus?“
„Haben die Heiligen Drei Könige gekifft oder warum haben die Weihrauch und Myrrhe dabeigehabt?“
„An Weihnachten hat Jesus ne Tanne aufgestellt und Last Christmas gesungen?!“
Sie denken, diese Fragen sind frei erfunden?
Sind sie nicht.
Sie kamen mir in unterschiedlichen Kontexten unter, mal in Firmkursen, mal im Unterricht, mal in hitzigen Diskussionen und mal auch in ganz normalen Gesprächen. Sie alle zeigen jedenfalls eines ganz deutlich, auf das ich später nochmal zurückkomme: Es gibt so Einiges, das Christenmenschen heute wieder erklären müssen. Es ist längst nicht mehr so, dass das Christentum selbsterklärend wäre – wenn es das denn je war.
Fragen zu stellen und gestellt zu bekommen bedeutet immer auch, dass man die Möglichkeit hat, Dinge zu erklären und Verständnis herzustellen. Fragen sind vielleicht das wichtigste gedankliche Instrument, das Menschen zur Verfügung haben. Und wenn schon gefragt wird, sollte es auch Antworten geben. Daher dieses Buch. Ich greife Fragen auf, die mir gestellt wurden oder mir in den Weg sprangen und versuche, diese zu beantworten. Ich habe dabei bewusst eine Mischung aus ernsten und unterhaltsameren Fragen gewählt, damit ein größeres Spektrum an Themen angesprochen werden kann. Je nach Art der Frage sind die Antworten manchmal unterhaltsamer und manchmal ernster oder auch kritischer gehalten. In jedem Fall hoffe ich aber, dass meine Antworten verständlich sind, denn darum soll es ja gehen: Dass ich als ein Christ verständlich auf die Fragen antworte, die mir begegnet sind.
Ich bin der Meinung, dass das notwendig ist, weil die Fragen selbst häufig schon zeigen, dass das Christentum in Deutschland und Europa immer mehr zu einem Randphänomen wird und weil zusätzlich die nackten Zahlen ein unwiderlegbarer Beweis dafür sind.
Im Grunde bildet das Christentum mittlerweile eher eine große Subkultur als eine gesellschaftlich prägende Kraft. Tendenz absteigend. Es steht neben anderen Subkulturen, deren Begriffe und Geschichten es genauso wenig versteht wie andere Subkulturen die christlichen. Das liegt von Seiten des Christentums auch daran, dass sich die Kirchen in den vergangenen Jahrzehnten viel zu wenig dafür interessiert haben, was an anderen kulturellen Bewegungen stattfand, weil sie es in ihren eigenen Bubbles doch recht gemütlich hatten. Daher kommt auch, dass Kirchen weder verstanden noch verstehen, was es mit dem Punk auf sich hatte oder dem HipHop, dem Techno, Flowerpower, Influencern oder den Fußball-Ultras – und das ist tragisch genug, denn Kirche sollte sich dafür interessieren, wenn sie anderen Menschen etwas von sich erzählen will.
Heute steht das Christentum als ein Sinnanbieter neben anderen und geht dabei leider viel zu oft immer noch davon aus, dass man es schon versteht, wenn es sich zu irgendeinem Thema laut äußert. Das ist aber nicht so. Da haben andere Sinnanbieter ihre Hausaufgaben besser gemacht, denn sie bedienen verschiedene Arten der Kommunikation und schauen genau hin, wie sie andere Menschen ansprechen können. Von der Herangehensweise sollte sich das Christentum in Europa dort etwas abschauen: Wie sehen andere Menschen die Welt und wie kann es Jesu Botschaft so erklären, dass sie verstanden werden kann?
Dazu soll dieses Buch einen Beitrag leisten. Ausgehend von den Fragen anderer zu erklären und neu darüber nachzudenken, wie ich mich als Christ eigentlich ausdrücke, wenn ich von Jesus erzähle.
Dazu noch eine Vorbemerkung:
Ich beantworte die Fragen aus meiner Perspektive und aus meinem Verständnis des Christentums heraus und erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Jeder und jede ist herzlich eingeladen, aus seiner und ihrer Perspektive auf die in diesem Buch enthaltenen Fragen zu antworten. Ich aber erkläre, beschreibe und antworte auf der Grundlage, die ich mir bisher in meiner Tätigkeit und meiner Erfahrung für und mit diesem Glauben angeeignet habe – und ich möchte sagen: Das ist nicht wenig. Daraus ergibt sich auch, dass dieses Buch keine wissenschaftliche Abhandlung ist.
1: Was ist eigentlich ein Pontius Pilatus?
Diese Frage ist kein Scherz und nicht ausgedacht, denn sie lief mir in einem Firmvorbereitungskurs über den Weg. Es ging darum, dass Jugendliche ihre Fragen und Kritik an das christliche Glaubensbekenntnis stellen sollten. Sie sollten diese Fragen oder ihre Kritik auf kleinen Karten notieren, damit sie anschließend gemeinsam besprochen werden konnten - immerhin sind Fragen Einzelner auch häufig die Fragen Anderer. Das Phänomen kennen Sie vielleicht noch aus der Schule, der Uni oder dem Betrieb. Irgendjemand stellt eine Frage, Sie hauen sich mit der flachen Hand vor die Stirn und denken: „Das habe ich mich auch immer schon gefragt!“
Jedenfalls bewahrheitete sich diese These gleich am selben Abend, denn die Frage, was denn eigentlich ein Pontius Pilatus sei, tauchte gleich auf zwei Karten aus unterschiedlichen Gruppen auf.
Stellen Sie sich diese Situation mal aus meiner Perspektive vor: Sie bereiten so einen Abend vor, drucken das christliche Glaubensbekenntnis auf großen Zetteln aus, legen Karten und Stifte bereit und rechnen mit kontroversen Fragen und intensiven Diskussionen rund um die immerwährenden Streitfragen nach der Jungfräulichkeit Mariens, der Dreieinigkeit, der Auferstehung der Toten, dem Ewigen Leben oder auch mit kritischen Fragen zur Kirche oder den Missbrauchsfällen – auch das kommt vor. Aber dann steht auf zwei Zetteln die Frage: Was ist eigentlich ein Pontius Pilatus?
Da sind Sie einen kurzen Augenblick baff.
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mache mich nicht über die Jugendlichen lustig, die diese Frage aufgeschrieben haben. Pontius Pilatus gehört für die meisten Jugendlichen schlicht nicht mehr zu ihrer Lebensrealität, ebenso wenig wie das Glaubensbekenntnis, Maria, die Kirche(n) oder Gottesdienste. Es ist nicht mehr Teil ihrer Welt. Und von dieser Welt sind meine ganzen theologischen Fragen nach Maria, Dreieinigkeit, etc. nun mal so weit weg, dass es viel näher liegt, nach einem Begriff zu fragen, den man als Fremdwort wahrnimmt - also nach Pontius Pilatus.
Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze dafür brechen, Fragen von Jugendlichen zur Religion sehr ernst zu nehmen. Immerhin stellen sie Fragen! Nichts ist schlimmer als Gleichgültigkeit, besonders, wenn es um den Glauben geht. Also bitte: Nicht herabschauen, nicht lustig machen - stattdessen ernst nehmen und ehrlich antworten.
Also: Was ist ein Pontius Pilatus?
Bei Pontius Pilatus handelt es sich um eine historische Person aus der Zeit Jesu, also von vor 2000 Jahren. Der Mann war Präfekt des römischen Kaisers in der Region Judäa, in der Jesus gelebt und gehandelt hat. Seine Aufgabe war es, in der vom römischen Reich eroberten Region Judäa im Namen seines Kaisers das römische Recht zu vertreten und durchzusetzen. Er war gleichzeitig Chef der Verwaltung der Provinz Judäa und Befehlshaber der dort stationierten römischen Truppen. Das machte ihn zum mächtigsten Mann in der Region mit absoluter Macht und Gewalt. Er war General, Richter, Finanzchef und Leiter der Verwaltung in einer Person. Rechenschaft schuldete er bloß dem Kaiser in Rom.
Genau in dieser Funktion traf er dann auch auf Jesus, der von einigen lokalen Verantwortungsträgern in Jerusalem angeklagt wurde. Da nur der Präfekt Roms ein Todesurteil fällen konnte, landete dieses Verfahren vor Pontius Pilatus, der Jesus schließlich zum Tod verurteilte. Genau deshalb taucht dieser Mann dann auch in der Bibel und damit auch im Glaubensbekenntnis des Christentums auf, denn er nimmt durch sein Todesurteil gegenüber Jesus eine zentrale Rolle in der Geschichte der Christenheit ein, denn sein Urteil führte zum Tod am Kreuz. Wozu das dann führte, ist Thema von einigen der noch kommenden Fragen.
2: Wer soll das mit der Auferstehung denn bitte glauben?
Diese Frage begegnete mir mal in einem Gespräch mit einem naturwissenschaftlich versierten Agnostiker, der sie natürlich auch bewusst provokant stellte. Sie setzt voraus, dass das Auferstehungsereignis, an das Christenmenschen glauben, prinzipiell unmöglich, unrealistisch und vor allem erfunden ist. Diese Gedanken sind nicht ganz unberechtigt, denn das Auferstehungsgeschehen widerspricht auf den ersten Blick unserer menschlichen Erfahrung.
Alle Menschen kennen den Tod. Sie kennen die Trauer, die damit einhergeht und kein heute lebender Mensch hat je erlebt, dass ein geliebter Mensch von den Toten zurückkehrt. Geschweige denn, dass dies alles von einem übernatürlichen Wesen ausgeht, welches man mit seinen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Aus Perspektive einer wissenschaftlich-faktenbasierten Weltanschauung ist ein Glaube an einen Gott und besonders an die Auferstehung unsinnig – ja geradezu irre.
Von außen betrachtet ist es also erstmal vollkommen normal, diesen wesentlichen Teil des christlichen Glaubens in Frage zu stellen – besonders dann, wenn man berücksichtigt, dass Glauben durch eine wirtschaftlich-optimierte und wissenschaftlich-faktenbasierte Weltanschauung prinzipiell in Frage gestellt und als persönliches Empfinden oder gar als Befindlichkeit abgewertet wird.
Häufig geht mit diesem grundsätzlichen Unverständnis leider auch eine gewisse Herablassung einher. Denn so wie sich früher Religionen hingestellt und behauptet haben, sie allein seien im Besitz der reinen Wahrheit und alle anderen seien Ungläubige und Unwissende, behaupten das auch manche heutige eher wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Weltanschauungen. All diese Sichtweisen täten gut daran, etwas mehr Demut zu üben. Diese Welt besteht niemals nur aus einer Perspektive. Wer diese für sich beansprucht, erhebt damit auch einen autoritativ-normativen Anspruch: Dass er oder sie bestimmen kann, was wahr und falsch ist. Das war in der Vergangenheit falsch, wenn sich religiöse Fanatiker – ob nun in der Kirche oder außerhalb – hingestellt und im Namen ihrer Religion andere Menschen unterdrückt oder getötet haben und es ist heute falsch, wenn sich vermeintlich „aufgeklärte“ und wissenschaftlich gebildete Menschen hinstellen und Glaubenden ihre Vernunft absprechen.
Die Frage selbst beantworte ich in zwei Schritten:
Zunächst einmal: Was verstehen Christenmenschen eigentlich unter Auferstehung?
Um Auferstehen zu können, muss man sterben. Das Prinzip kennen Sie aus jedem x-beliebigen Horrorfilm. In vielen Kulturen und Religionen gab und gibt es diese Vorstellung – schlagen Sie einfach mal Zombie bei Wikipedia nach – Sie werden staunen.
Das Prinzip ist also klar: Erst leben, dann sterben, dann wieder leben. Wie gesagt: Die ersten beiden Punkte sind uns als Menschen bekannt. Der letzte taugt in den meisten Kulturen und Religionen dann aber eher für Schauergeschichten – nach dem Motto: Was einmal tot war, das kann nicht gut sein, wenn es wieder lebt. Die beiden ersten Schritte geht der christliche Glaube denn auch mit: Jesus hat gelebt und ist gestorben. So weit, so normal.
Wieso man aber zweitausend Jahre später noch von diesem Kerl spricht, ist eben jenes Auferstehungsereignis und weil dieses Ereignis sich grundsätzlich von den negativen Vorstellungen anderer Kulturen unterscheidet. Jesus bringt hier nämlich ein anderes Motiv der Religionsgeschichte ins Spiel: Die Überwindung des Todes. Denn die meisten anderen Kulturen sehen Wiederkehrer – oder Zombies, wenn Sie so wollen – immer noch als den Gesetzen des Todes unterworfen an. Sie leben, aber halt als Tote, deutlich daran zu sehen, dass sie entweder noch halbe oder ganze Geister oder Skelette sind, verrottet und verwest. Jesus hingegen lebt wieder als Lebender und nicht den Gesetzen des Todes unterworfen – darin zu sehen, dass er als er selbst und eben nicht als groteske untote Version in das Leben zurückgekehrt ist.
Jetzt wird es eigentlich erst so richtig spannend, denn es drängt sich die Frage auf: Wie hat er das gemacht?
Die Antwort mag Sie verblüffen: Gar nicht.
Denn hier kommt Gott ins Spiel. Er hat Jesus halt einfach nicht losgelassen – so könnte man etwas salopp sagen.
Stellen Sie es sich etwa so vor: Sie haben ein Kind und das möchte schwimmen lernen. Jetzt haben Sie die Wahl: Sie schmeißen es ins Wasser und schauen mal, was passiert. Oder Sie halten es fest, während es den Pool durchquert und helfen ihm am Ende wieder raus. Gut, Sie können ihm auch das Schwimmen beibringen, aber auch dafür braucht es Anleitung, Hilfe und Übung. Und der Tod ist halt kein Pool, in dem man beliebig oft üben könnte. Also bleibt die Variante des Festhaltens und Raushelfens. Dieser Vergleich mag ein wenig helfen, sich vorzustellen, was Christenmenschen unter „Auferstehung“ verstehen. Letztlich bedeutet es: Gott lässt den Menschen selbst im Tod nicht allein und Jesus ist der Weg, dies zu verstehen. Man könnte also – um im Bild zu bleiben – sagen: Jesus ist der Schwimmlehrer, denn er weiß ja jetzt, wie es geht – und Gott die Garantie, dass es auch funktioniert.
Bei aller Anschaulichkeit im Schwimmbeispiel ist das trotzdem nicht einfach zu verstehen – immerhin haben sehr gebildete Männer und Frauen über die Jahrhunderte intensiv daran gearbeitet, dieses Geschehen bis ins abstrakteste Detail auszuarbeiten.
Ich versuche es deshalb nochmal ein wenig besser verständlich zu machen und komme damit zum zweiten Teil meiner Antwort, welcher die Frage aufgreift: Was meinen Christenmenschen eigentlich mit der Auferstehung?
Dazu muss ich kurz zum Tod zurückkehren. Sämtliche Kulturen und Religionen haben die ein oder andere Vorstellung davon, was es heißen kann, den Tod zu überwinden. Fragen Sie mal die Ägypter, die Kelten, die Inuit, die Inka oder die Aborigines. Dass die Vorstellung keineswegs antik oder veraltet ist, zeigen auch einige moderne Forschungsgebiete. Schauen Sie dazu einfach mal bei der Suchmaschine oder KI Ihres Vertrauens vorbei, und fragen sie, was Transhumanismus ist und zu welchem Zweck manchen Forschenden die Entwicklung der KI eigentlich dient. Kurz: Selbst die daten- und faktenbasierte Wissenschaft folgt in einigen ihrer Teilgebiete ganz offen dem Ziel, den Tod zu besiegen – ob nun durch Biotechnologie, Kybernetik, Robotik oder Genetik. Die Vorstellung also, den Tod endgültig und nachhaltig zu besiegen, ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst.
Wieso dieser Ausflug?
Weil ich zeigen möchte, dass es bei der Konfrontation mit dem Tod als endgültigem und unvermeidlichem Ende des Lebens völlig uninteressant und unerheblich ist, woran Sie glauben. Denn die Auseinandersetzung mit dem Tod und der Wunsch, nicht sterben zu müssen, ist grundlegend menschlich – ich nutze bei diesen Dingen gerne den Begriff des „menschlichen Grundaktes“. Er beschreibt etwas, das vor aller kulturellen, religiösen, weltanschaulichen, gesellschaftlichen oder politischen Prägung so sehr in unserer menschlichen Natur liegt, dass wir es alle teilen. Viele dieser Grundakte ziehen sich durch unser Leben und bei manchen von ihnen suchen Menschen nach Antworten, um ihnen einen Sinn zu geben. Diesen Sinn finden manche in der Religion, in der Gesellschaft, der Wissenschaft, der Politik, der Kunst, der Musik oder auch dem Fußball.
Soll heißen: Zuerst ist da die einfache Erfahrung: Ich lebe. Dann kommt die Erkenntnis – oft bedingt durch die Erfahrung des Todes bei Angehörigen, Freunden oder des Haustieres: Auch ich muss sterben. Bei Vielen geht diese Erkenntnis mit Widerwillen einher: Ich will aber lieber leben, nicht sterben!
Tot sein ist also doof. Das große Problem am Tod ist dabei, dass man nicht dahinter schauen kann. Man kann mit seinen Sinnen nicht erfassen, was danach kommt. Das ist ein Problem, denn die allermeisten Menschen leben gar nicht gerne mit dem Gedanken, dass der Tod einfach so das Ende sein könnte und sie mit dem Tod ihre Bedeutung verlieren.
Genau das bot und bietet Spielraum für Fantasie und Spekulation, denn die simple Tatsache, dass ich und mein Leben am Ende vollkommen bedeutungslos sein könnten, hat für eine riesige Vielzahl an Deutungsmöglichkeiten gesorgt. Das hat sich bis heute nicht grundlegend geändert, denn die grundsätzliche menschliche Erfahrung bleibt gleich: Der Tod ist für die allermeisten Menschen eine Zumutung. Genau darin unterscheiden sich auch die modernen Ansätze des Transhumanismus und ähnlich gelagerter Forschungsgebiete nicht von anderen Deutungsmöglichkeiten: Sie verschieben das Problem des Todes nur auf ein später oder auf den Zufall. Der Tod bliebe selbst dann ein Fakt, wenn Menschen unsterblich wären. Ich möchte behaupten: Dadurch würde der Tod noch schrecklicher als er es ohnehin schon ist. Hinzu kommt aber noch ein zweites Element: Die Unsterblichkeit betrifft immer nur einzelne Personen, niemals aber die gesamte Gesellschaft – sie taugt also nicht zu einer Heilsidee. Unsterblichkeit besiegt den Tod nicht, sie verlagert das Problem bloß.
Ich komme nach diesen Gedanken zurück zum Christentum: Der Tod nimmt dem Menschen das Leben und stellt damit den Inbegriff der Unfreiheit dar. Wenn Christenmenschen nun glauben, dass sie mit Jesus und durch Gott eine Möglichkeit haben, den Tod zu überwinden, dann glauben sie letztlich, dass sie vom Tod frei werden. Natürlich sterben sie noch. Sie können aber im christlichen Glauben die Kraft entwickeln, den Tod nicht als endgültige Bedeutungslosigkeit und Unfreiheit zu verstehen, sondern als Möglichkeit der Überwindung von Angst und Sinnlosigkeit. Das liegt daran, dass es im christlichen Glauben die Rede vom „Reich Gottes“ gibt, welches die Grenzen von Diesseits und Jenseits auflöst. Im Grunde sind Menschen durch die Auferstehung bereits mit in dieses Reich hineingenommen, sie leben bereits in Gottes Gegenwart, weshalb sich Diesseits und Jenseits als unnötig erweisen. Darauf gehe ich in anderen Fragen noch näher ein.