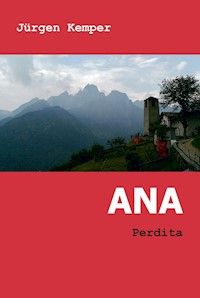
5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nach dem Verlust seiner Frau sucht der Erzähler Ablenkung und einen Weg zurück ins Leben. Er findet ihn nach einem Bergunfall in einer ebenso abenteuerlustigen wie atemberaubenden Frau. Immer wieder kehrt sie zu ihm in sein Haus in einem abgelegenen Bergdorf in den italienischen Alpen zurück, ohne viele Spuren zu hinterlassen. Er richtet sein Leben ganz auf sie aus und vernachlässigt darüber seine Familie in Deutschland. Wenn sie aufbricht, ist er beunruhigt, ob sie zurückkehrt. In böser Vorahnung schreibt der Erzähler die gemeinsamen Erlebnisse in einem Tagebuch mit vielen Rückblenden in sein eigenes Leben nieder, von Verlustphantasien beflügelt, ohne zu ahnen, was ihm wirklich bevorsteht. "Eine phantastische Reise in das Innere eines Mannes, der glaubt, sein Leben gelebt zu haben und der sich völlig unvorbereitet dem Existenziellen selbst, dem Verlust eines geliebten Menschen, stellen muss, was sein Leben aufs Neue aus der Bahn wirft."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jürgen Kemper
ANA
Perdita
© 2020 Jürgen Kemper
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-09281-5
Hardcover:
978-3-347-09282-2
e-Book:
978-3-347-09283-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Titelbild: Foppaccia und Manduino
Widmung
Für Caro, die ich nie kennen gelernt habe, weil sie viel zu früh abgestürzt ist.
Gewidmet meiner Frau und Lebensgefährtin Barbara, meinen drei Töchtern und drei Enkeltöchtern.
Teil 1
VERSCHÜTTET - SEPOLTO
2017-01-01 Ich war um vier Uhr wach geworden
Ich war um vier Uhr wach geworden, hatte mich gerade noch bis zum Klo retten können und das ganze schöne Essen mit Muscheln, Krabben und Fisch, den Enrico im Sommerurlaub auf der Insel Elba selbst gefangen, eingefroren und gut gekühlt mit der Teleferica, der Lastenseilbahn, in unser Bergdorf verfrachtet hatte, wieder erbrochen. Nun landete das alles in einer ekligen Kotzorgie im Schlund des Abwasserkanals. Es sah nicht nur ekelig aus, es roch auch genauso und ließ den gestrigen Abend in Enricos Haus in einem völlig anderen Licht erscheinen. Ich war froh, als es vorbei war, wusch mich und tappte leise durch mein Haus, das eiskalt war, an Schlaf war nicht zu denken. Es roch nach Kamin und kalter Asche und ich zog mir ein paar wärmende Sachen an, es würde dauern bis ich mein Haus etwas aufgewärmt hatte. Draußen war es stockfinster und es schneite. Im fahlen Licht schaute ich in mein Schlafzimmer, SIE schlief selig hingestreckt, die eine Hälfe ihrer Muschelschale lag neben ihr auf der Ablage, aber an einer Meerjungfrau war mir gerade nichts gelegen.
Bello, unser neuer vierbeiniger Mitbewohner rührte sich nicht, schlief lang hingestreckt auf dem Rücken seinen gerechten Welpenschlaf. Ich kochte mir einen doppelten Espresso und wärmte mich einen Moment an der Gasflamme, Appetit hatte ich überhaupt keinen. Dann schmiss ich meinen Kamin an und wärmte mich von vorn und hinten an dem lodernden Feuer. Eine diffuse Unruhe beschlich mich, zuerst empfand ich sie als rein körperlich und führte sie auf meinen entleerten Magen zurück, doch da war etwas anderes, was herauswollte. Zielstrebig holte ich mein Laptop, öffnete es, hatte aber keinen Empfang, keine Verbindung zum Internet, es schneite wohl zu stark. Unruhig wollte ich gerade den Deckel zuklappen, als mir ein Bild von ihr, das ich gegen meine Gewohnheit auf meinem Desktop gespeichert hatte, ins Auge fiel. Ich öffnete es, es war eines meiner Lieblingsbilder, auf dem SIE mich provokant anschaute, weil ich SIE schon wieder fotografierte, ihre wilde ungebändigte Mähne fiel ihr halb über das Gesicht, es war dieses Ungebändigte, was mich seit Beginn an ihr faszinierte, wie SIE nicht nur mich mit Blicken in ihre Aufmerksamkeit und ihren Bann ziehen konnte. Ihr provozierendes Wesen schreckte manche Menschen ab, eher die Frauen und manche Männer machten einen Bogen um SIE, andere rieben sich an ihr, das brauchte ich nicht, ich hatte mich von Anfang an aus dieser Konkurrenzrolle herausgehalten und mich eher auf´s Beobachten verlegt. Doch irgendetwas, das mit diesem Ort und ihr zu tun hatte, löste etwas in mir, ich konnte es nicht genau erfassen, es schwankte zwischen Glück und Angst. SIE lag ruhig und sicher im Nebenraum und trotzdem empfand ich sowas wie Verlassenheit oder Alleinsein oder war es nur die Angst davor.
Ich trank einen großen Schluck meines abgekühlten Espressos, rieb erwartungsvoll meine Hände, öffnete eine leere Word-Datei und begann zu schreiben, von ihr, von mir, meiner verstorbenen Frau, meinen Kindern, dem Unfall auf unserer ersten gemeinsamen Bergtour. Es floss so aus meinen Händen, ich schrieb, als hätte ich es die ganze Zeit schon in mir getragen, die Worte formten sich selbst, ohne Unterbrechung, vielleicht hatte mein kleines Gedicht, das SIE so kitschig fand, das Eis gebrochen, vielleicht das gestrige Gespräch über Heimat und Orte, darüber wo man sich wirklich zu Hause fühlt. Ich schaute auf und ja, Eis, das war’s, in meinen Fensterscheiben hatten sich Eisblumen gebildet, das kannte ich nur noch aus meiner Kindheit, als wir noch Ofenheizung hatten. Sie kämpften tapfer gegen die Wärme meines Kaminfeuers an, die sich langsam ausbreitete und die Eisblumen schmolzen so wie meine Erinnerungen mich überfluteten.
Und ich schrieb und schrieb, als hätte sich etwas aufgelöst. Warum hatte ich damit angefangen? Damals wusste ich noch nicht, warum ich alles festhalten wollte, aber ich schrieb unermüdlich weiter.
2017-07-14 Dies war jedenfalls nicht der Ort
Dies war jedenfalls nicht der Ort, an dem ich erwartet hatte zu sein, wenngleich er in meiner Vorstellung als Ort der Sehnsucht, glaube ich, immer existiert hat.
Ich war ihr vor vier Jahren begegnet, in jenem Sommer als mein Lieblingsonkel Fritz gestorben war. Nun lag SIE in meinem Bett, so wie nur SIE es konnte, scheinbar weit weg, völlig entrückt, so wie SIE mit mir schlief, als gäbe es nichts anderes auf der Welt. Ich war vorher keiner Frau begegnet, die sich so ohne jedes Ziel dem Liebesspiel hingab. Zu ihren Füßen lag Bello, eingerollt, obwohl er dort definitiv nicht liegen sollte, aber heute war es mir egal, beide sahen sehr zufrieden aus.
Ich hatte in dem Jahr meinen verstorbenen Onkel Fritz noch in der Totenhalle im tiefen Sauerland besucht, gemeinsam mit meinem alten Busen- und Kletterfreund Friedel. Wir hatten den Abstecher in meine alte Heimat gemacht, weil ich unsere gemeinsame Bergtour nicht absagen oder verlegen wollte. Es war mir eh lieber, als mir das tote Beerdigungsritual eines katholischen Priesters zu geben. So verabschiedete ich mich auf meine Weise, von demjenigen, der mich auf der Suche nach einem Ort wie dem, an dem ich mittlerweile überwiegend lebte, auf jeden Fall bestärkt hatte, vielleicht hatte ich auch seit meiner Kindheit so einen Ort gesucht. Und dort war ich mit ihm und meiner Tante Martha immer draußen gewesen, es gab immer etwas zu tun, sei es im Stall, aus dem ich die noch warmen Eier aus den Nestern einsammeln und vorsichtig in die Vorratskammer zu meiner Tante tragen durfte oder bei den Kühen aufpassen musste, dass ich beim Melken nicht den Schwanz ins Gesicht geschleudert bekam und den schweren Milcheimer aus Zink nicht umstieß, mit meinem Onkel watschelte ich in viel zu großen Gummistiefeln die Weide ab, um zu schauen, ob der elektrische Weidezaun auch funktionierte, was man natürlich am besten feststellen konnte, wenn man ihn anfasste, was definitiv zu den schwierigeren Mutproben in jungen Jahren gehörte. Aber am schönsten war neben dem vielen draußen sein der Umgang mit den Bienen, von denen ich mich strikt fernzuhalten hatte. Die etwas beängstigende Erscheinung meines Onkels im weißen Imkeranzug, eingehüllt in den Qualm seiner Pfeife, flößten mir großen Respekt ein und die erste wirkliche Arbeit, an die ich mich erinnere, ist es, die Handzentrifuge in Rotation zu versetzen und den goldenen Saft aus den eingelegten Honigwaben aus dem Röhrchen fließen zu sehen, welch ein süßes und schmackhaftes Erfolgserlebnis. Bis heute gibt es keine Reise, von der ich nicht ein Glas Honig mit nach Hause nehme. Erinnerungen kann ich schmecken. Ich war jedenfalls in der Zeit bis zu meiner Einschulung immer über mehrere Wochen dort gewesen, bis sie selbst Kinder bekommen hatten, ich wurde quasi ausgeliehen und hatte keinen Kindergarten von innen gesehen und ich hatte diese Zeiten von Aufmerksamkeit und besonderer Zuwendung, auch von den Großeltern, die beide mit im Haus lebten, stets genossen. Diese Zuwendung und Vertrautheit an diesem Ort im Sauerland bedeutet Heimat für mich, auch heute noch und so hatte ich meinen Onkel und meine Tante mein Leben lang schon öfter mit Freunden besucht, so als wollte ich das mit ihnen teilen, auch Friedel war zuvor schon einmal zusammen mit mir mit dem Motorrad dort gewesen.
Mit tränenerfüllten Augen verabschiedete ich mich von meinem Cousin und meiner Tante, die ihn um fünf Jahre überlebt hat. Die Fahrt nach Italien war schweigsam und Friedel drang nach meinen ersten Erzählungen über meinen Onkel und die Jahre meiner Kindheit nicht weiter in mich ein. Wir konnten auch lange schweigend nebeneinander sitzen bei so einer langen Fahrt, ohne dass wir uns unwohl fühlten. Wir kannten uns lange genug, hatten gemeinsam gegen Atomkraft in Brokdorf demonstriert und waren auf diversen Friedensdemos gewesen, doch neben unseren politischen Interessen verbanden uns zeitintensive Hobbys, das Motorradfahren, das Klettern und das Höhenbergwandern in den Alpen und im Himalaya. Ich glaube, die meisten Alpenpässe haben wir im „Pas des deux“- Stil auf dem Motorrad abgeschmirgelt und auch die meisten Klettersteige hatten wir abgehakt. Wir harmonierten gut zu zweit, auch wenn wir vom Temperament her sehr verschieden waren. Friedel war zurückhaltender als ich, was ihn allerdings nicht von extremen Schräglagen beim Motorradfahren abhielt und sein Diabetes bremste ihn an manchen Stellen etwas aus und seit er eine Tochter hatte, hatten sich sein Leben und seine Prioritäten und damit auch unsere gemeinsamen Aktionen etwas verändert.
So gelangten wir im Morgengrauen auf den mit Restschnee bewehrten Splügenpass, meinem Lieblingspass auf dem Weg in den Süden. In der aufgehenden Sonne beschlich mich das sichere Gefühl, nicht nur die Grenze nach Italien zu überschreiten, sondern es roch irgendwie nach Neuanfang, auch mein Freund war trotz des Schlafmangels aufgeräumter Dinge und im ersten Ort nach dem Pass betraten wir die Albergo della Posta und wurden eingefangen vom Duft frischen Kaffees in diesem ganz mit Holz verkleideten und alten Jagdtrophäen bestückten Gastraum, in dem sich schon eine ansehnliche Zahl von Frühaufstehern versammelt hatte, deren für mich unverständliches Gespräch im lombardischen Dialekt den Raum erfüllte. Ich kaufte eine schöne alte Postkarte mit Murmeltieren für meine beiden Enkeltöchter Iris und Ines, die ich immer auf dem Laufenden hielt, wir genossen unseren ersten Cappuccino und die Atmosphäre in der Albergo. Angekommen! Wir schwelgten noch kurz in alten Erinnerungen. Mit Friedel hatte ich die gleiche Strecke mal mit dem Motorrad abgefahren und diese eindrucksvolle Tour mit meiner auf meinem Tankrucksack installierten Kamera mit Weitwinkelobjektiv dokumentiert, an deren Ende wir in Chiavenna im Eiskaffee landeten, an solchen endlosen Kurvenfahrten hatten wir gleichermaßen unseren Spaß.
Wir fuhren weiter bis zum ersten Abzweig nach Isola, nahmen aber die alte, für schwere Fahrzeuge gesperrte Route, die viele Erinnerungen in mir wachrief. Dort hatte ich auch schon mit meiner Familie schlotternd gerastet, in Vorfreude auf südliche Temperaturen, Toskana, Sardinien und Korsika. Vor über dreißig Jahren hatten wir an dem Aussichtspunkt des Passes direkt vor dem ersten Tunnel gehalten, meine vor sechs Jahren verstorbene Frau Carina, ein befreundetes Paar aus Studentenzeiten und unsere beiden mittlerweile erwachsenen Kinder Mascha und Jakob. Wir hatten gemeinsam den sprudelnden Wasserfall, der kurz vor dem Tunnel in die Tiefe stürzt, angeschaut und die abenteuerliche Serpentinenpiste bewundert, deren äußere Kurven an den Fels angeklebt schienen. Am Geländer des Aussichtspunkts hatte ich krampfhaft meinen damals zweijährigen, sehr neugierigen Sohn vom Geländer ferngehalten, bevor wir unsere Fahrt nach Sardinien in dem altersschwachen aber bergtauglichen alten Hanomag fortsetzen.
Vielleicht war es der Tod meines Onkels, vielleicht die Flut der Erinnerungen, aber unsere Alpintour war unterlegt mit Dünnhäutigkeit und Verletzlichkeit.
Am späten Nachmittag trafen wir über das Aostatal und das Flusstal der Savara auf dem Campingplatz in Pont auf 1800 Höhenmetern ein, von wo wir zunächst ein paar Mountainbike-Touren starteten, um uns an die Höhe zu gewöhnen und die Kondition zu verbessern. Vier Tage später stiegen wir dann zum Rifugio Vittorio Emanuele II auf 2800 hm auf. In der großen Berghütte war bei herrlichem Sonnenschein und dazugehörigem Bergsee der reinste Bergtrubel, aber dafür mit hohem Unterhaltungswert und internationalem Publikum. Wir hatten einen der letzten Schlafplätze ergattert, direkt unter dem Dach, wo man nur geduckt unter den Deckenbalken des Tunneldaches umhergehen konnte und ständig Gefahr lief, sich den Kopf zu stoßen, besonders abends beim Rückzug in den Schlafsack. Wer Nähe- und Geruchsprobleme hatte, war hier definitiv fehl am Platze, doch das italienische Bergessen in Gesellschaft von zwei erfahrenen spanischen Bergsteigern entschädigte für manche Einschränkung. Trotzdem flohen wir am nächsten Tag auf einen im Osten liegenden Schneegipfel, der uns schon den ganzen Tag angelockt hatte. Hier übten wir noch mal unsere Anseiltechnik und das Fortbewegen in einer steilen Schneeflanke, erst war es eiskalt, dann wurden wir gegrillt und später zogen Dunst und Wolken auf, doch gut zufrieden kehrten wir in den Hüttentrubel zurück, wo wir uns noch lange mit den schon bekannten baskischen Bergsteigern unterhielten, die auch am nächsten Tag zum Gran Paradiso aufbrechen wollten. Also hieß es mal wieder früh ins Bett und nicht so viel Bier trinken, denn um fünf Uhr morgen wollten wir aufbrechen und da waren wir noch nicht einmal die ersten. Im Dunkeln und im schmalen Lichtkegel der Stirnlampen bewegten wir uns mit zehn anderen über Geröll langsam hinauf, begleitet durch das stetige Klappern der Karabiner an den Klettergurten. Hier machte sich die Höhe schon deutlich bemerkbar und der schnelle gleichmäßige Atemrhythmus machte ebensolche gleichmäßigen Atemwölkchen vor unseren Gesichtern. Im ersten Morgengrauen mussten wir unsere Steigeisen anschnallen, da es ab nun durch Eis und Schnee ging. An einer Stelle passierten wir eine Eis- und Schneebrücke, unter der an einem länglichen Loch sichtbar ein beeindruckender Sturzbach zum Vorschein kam, hier wollten wir auf keinen Fall hineinfallen, weswegen wir uns seiltechnisch mit einer anderen Seilschaft zusammentaten, was sich erheblich sicherer anfühlte. Über uns brauten sich einige dunkle Wolken zusammen, das schöne Wetter der letzten Tage hatte sich für heute offensichtlich erst einmal verabschiedet und es begann leicht zu regnen. Wir sprachen uns kurz ab, dass wir es weiter versuchen wollten, doch der Regen wurde stärker und auf ungefähr 3400 Höhenmetern kamen uns die ersten Bergsteiger entgegen, die meinten, dass auf dem Grat ein heftiger Wind wehen würde, so dass wir beschlossen umzukehren. Keine Viertelstunde später brach das Gewitter über uns herein, eine Unterstellmöglichkeit gab es nicht und die Blitze donnerten links und rechts in die Bergflanken und tauchten alles in ein fahles Licht, jetzt fing es auch noch an zu hageln und als wir die Stelle mit dem Bergbach passierten, wo das zuvor sichtbare Loch mittlerweile zur doppelten Größe herangewachsen war und der begehbare Steg nur noch sechzig Zentimeter breit war, waren wir froh, dass wir diese Stelle passiert hatten und uns um elf Uhr pitschnass im Rifugio mit allen anderen wiederfanden. An dem Tag war niemand auf dem Gipfel gewesen, ein schwacher Trost, denn am nächsten Tag schien wieder die Sonne aus einem azurblauen Himmel, als wäre nichts gewesen, ein anders Mal vielleicht.
Drei Wochen später, nach unserer gescheiterten und verregneten Besteigung des Gran Paradiso im Aostatal, war ich ihr begegnet, auf dem Campingplatz direkt am Lago di Como, wo schon Kohorten deutscher und holländischer Touristen in den 60er-Jahren campierten und so manches deutsche Mädchen dem Charme der den Campingplatz belagernden italienischen Gigolos erlagen. Der mir gefällige Geruch des Morbiden hing über allem und der Besitzer, ausgestattet mit dem für Italiener so typischen Machogehabe und entsprechenden in der Muckibude gestählten Muskeln, hatte sich mit dem Neubau seiner Bar gegen den drohenden Verfall aufgebäumt. Das Besondere war, wenn man sich dort zum Abendbier bei Emanuele und seiner wilden Stella traf, begegnete man sowohl den unvermeidlichen Stammcampern wie auch den Einheimischen auf dem Weg nach Hause. Und man brauchte nichts zu essen zu bestellen, denn alle halbe Stunde wurden köstliche Pizzastreifen aus dem Steinofen serviert, gratis, willkommen in bella Italia.
Zwischen all diesem bewegte SIE sich, schnell mit geschmeidigen Bewegungen, innehaltend, wie eine Eidechse, hier ein Küsschen links und rechts, dort ein Schwatz auf Italienisch, dann auf Englisch und für mein Ohr gewöhnungsbedürftig auf Schwiezerdeutsch. SIE war überall, aber nicht hier zu Hause. Als SIE an mir vorbeiging, fiel mir die auf ihrer Schulter tätowierte Eidechse auf, wie passend. Der kleine gewundene Körper ruhte auf ihrer Schulter, der Schwanz verschwand im Nacken unter ihren pechschwarzen Haaren, der Kopf, mit wachem Blick lauernd über ihrem Bizeps, der für eine Frau sehr ausgeprägt war, hielt nach Beute Ausschau, während eine kleine rote Zunge Witterung aufnahm, eine Jägerin, soviel war mir klar, ich war auf der Hut.
Mit einem Gast, ich glaube er hieß Ivo, habe ihn leider nie wieder getroffen, tauschte ich mich über meine Pläne für den nächsten Tag aus. Ich wollte den „Sentiero Roma“ gehen. Ein in den Alpen erfahrener Kollege hatte ihn mir empfohlen, eine Woche in alpinem Gelände, oberhalb der Baumgrenze, und Ivo wollte mir unbedingt im beginnenden Abendrot zeigen, welchen Weg ich nehmen sollte, aber ich sah nur steile bis auf dreitausend Meter aufsteigende, mit Kastanienwäldern bedeckte Berghänge, von zerklüfteten Felstürmen gekrönt. Er war mit mir nach draußen auf die Straße gegangen, immer wieder zeigte er auf die undurchdringlichen Waldhänge, ich sah nicht, was er sah und verstand nur die Hälfte von dem, was er mir in einem abenteuerlichen Mix aus Englisch und Italienisch beibringen wollte. Und plötzlich stand SIE hinter mir und sprach mich in geschliffenem Englisch an.
„Du kennst den Tracciolino nicht?“
Das waren die ersten Worte, mit denen SIE mich direkt angesprochen hatte, irgendwie hatte SIE den verzweifelten Versuch Ivos mitbekommen, mir den Weg zu erklären.
Von dem Moment an gab es kein Zurück mehr.
„Gibt´s heute eigentlich keinen Tee ans Bett? Ich bin völlig vertrocknet.“ war das erste, was ich heute von ihr hörte und so riss SIE mich aus meinen Gedanken und Erinnerungen, mit Bello im Schlepptau, der offensichtlich Aktivität witterte und unaufhörlich an ihr hochsprang, so dass ich ihn erstmal auf meinen Schoß nahm.
„Du meinst ausgetrocknet oder?“ SIE gab mir einen gehörigen Knuff in die Seite, den ich lautstark kommentierte und SIE wärmte sich kurz am Kaminfeuer und verschwand wortlos im Schlafzimmer. Sie trank immer sehr viel, nicht nur abends. Ich liebte diese Momente der Bedürftigkeit, wo SIE ansonsten doch niemanden zu brauchen schien. Ich ging in die Küche meines Hauses in den italienischen Bergen, mit Blick auf den Tracciolino, den ich mit ihr zuerst begangen hatte und kehrte mit dem dampfenden Tee mit Milch und einem Löffel braunem Zucker zum Bett zurück. Mein Blick fiel auf das zerwühlte Bett und ihr ebenso zerknittertes Gesicht mit drei deutlichen Schlaffalten auf ihrer linken Wange. Ihr strahlendes Gesicht war Belohnung genug für meine um fünf Uhr im Stockdusteren abgebrochene Nacht. Ich konnte nicht lange neben ihr schlafen oder gar untätig liegen. Ihre Nähe beunruhigte mich dermaßen, dass ich lieber aufstand und SIE hasste es, morgens früh geweckt zu werden, insbesondere nach Nächten wie dieser, wo wir eng umschlungen eingeschlafen waren, SIE ohne einen Mucks, ich, nachdem ich mich nach einer Stunde aus ihrer Umschlingung befreit hatte, wissend, dass ich diesen Moment nicht ewig festhalten konnte, genauso wenig wie SIE. Ich lag dann meist neben ihr, schaute SIE an. Irgendetwas von ihr lag immer außerhalb der Bettdecke und ich konnte mich nicht satt sehen an ihrem geschmeidigen Körper mit dieser schönen lauernden Eidechse. Bello legte sich währenddessen friedlich unter das Bett, wir waren ja schließlich beide da und es bestand offensichtlich für ihn keine Gefahr allein gelassen zu werden, was er tunlichst zu vermeiden suchte. Also gab ich ihr ihren Tee und trank auch meinen, der mittlerweile kalt geworden war, bis auf den letzten Schluck.
„Was hast du gemacht? Bist du schon lange wach?“
„Seit fünf, hab dir beim Schlafen zugeschaut.“
„Das ist nicht wahr.“
„Doch, ich schau dir gern zu.“
„Ich seh total verpennt aus.“
„Ja eben.“
„Nichts eben, was hast du gemacht seit fünf?“
So einfach war SIE nicht abzuwimmeln, das war mir bei meiner ersten Antwort schon klar. „Ich habe an meine Reise vor vier Jahren gedacht, als mein Onkel gestorben war.“
„Vermisst du ihn immer noch?“ SIE hatte einen guten Riecher für jedes überlagerte Gefühl.
„Nein, ich hab ja dich.“
„Das kannst du doch nicht vergleichen. Du warst ein Kind für ihn. Nichts hast du wirklich.“
Recht hatte SIE, aber das Gefühl des Verlustes hatte Bestand, mein Onkel war viele Jahre nach dem Tod meiner Eltern gestorben, das Gefühl hatte sich in dem Jahr breit gemacht und mich weidwund hinterlassen, hatte alte Wunden aufgerissen und mich offen für jede Zuwendung gemacht. Da kamen mir die neuen italienischen Freundschaften, in denen ich viel von der Gemütlichkeit und Geselligkeit meiner Kindheit wiederzufinden glaubte und SIE gerade recht. „Ja.“
„Wie ja?“ SIE insistierte.
„Ich meine ja nur das gleiche Gefühl.“
„Du bist ein unverbesserlicher Gestriger.“ Da war sie wieder, ihre Direktheit, in allem. Umwege ging SIE nicht. „Vergangenheit ist etwas für Romane. Die Zukunft ist etwas für das Leben.“
„War ich auch gestrig, als ich heute Nacht mit dir geschlafen habe?“
„Das ist Wortklauberei, du vermischt die Dinge und am Ende kriegst du sie nicht mehr auseinander.“
„Welches Ende?“
„Morgen!“
„Morgen ist es zu Ende?“
„Jetzt sei nicht albern. Morgen!“
SIE gab mir einen Kuss auf den Mund. Dieses „Morgen“ war unser Code, dass es weiter ging, SIE sagte nicht, dass SIE mich lieben würde, aber dieses kleine Zauberwort hatte etwas Magisches und ich hörte es gern und benutzte es ebenso gern.
„Nichts ist je zu Ende bis die Würmer an dir knabbern, danke für den Tee. Gehst du mit zu Pablo? Er hat mich eingeladen, seinen neuen Kalender mit Tierfotografien abzuholen. Er hat diesmal nicht nur seine Adler verewigt, sondern auch einen waschechten Bären im Adamello-Gebiet vor die Linse bekommen.“
Damit war das Gespräch offensichtlich beendet. Und mit einem Schwung ihres nackten Bauchs an meinem Gesicht vorbei, der einen unzweideutigen Geruch hinterließ, der mich schwindeln ließ, verschwand SIE in meinem Badezimmer.
Ich wusste, SIE würde auch allein gehen. Wenn SIE sich einmal entschlossen hatte, etwas zu tun, war SIE nur schwer davon abzubringen. Ich hatte keine Lust allein zu sein, also räumte ich auf, hing dem Klang von ihrem „Morgen“ nach und hängte das Bett zum Lüften über mein Balkongeländer, wo mir mein Nachbar Enrico fröhlich entgegenrief.
„Dormito bene?“
„Sempre.“ antwortete ich und ließ erstmal Bello vor die Tür, der natürlich die Bewegung im Raum erspürt hatte und wieder Sorgen hatte, etwas zu verpassen und begrüßte Enrico stürmisch, der sich nicht lumpen ließ und ihn zu nehmen wusste. Ich ließ meinen Blick noch eine Weile von meiner Terrasse über das Dorf schweifen. Das kleine Bergdörfchen Foppaccia war mir seit vier Jahren zu einer zweiten Heimat geworden, natürlich auch seit SIE als unstete Begleiterin in mein Leben geplatzt war. Es war schön hier zu sein, den Blick von hoch oben über den Lago di Como streifen zu lassen, der in wechselndem Licht in immer anderen Farben leuchtete, heute in blau-türkis. Ich liebte die alten dicken grauen, teils noch unverputzten Granithäuser mit ihren dicken Wänden und Fensterlöchern und ihren Holzterrassen und Windläden, das war für mich nachhaltige Baukunst, an der ich mich nicht satt sehen konnte. Auch im Sommer wehte wie heute oft ein rauchiger Qualm durch das Dorf, weil viele noch auf einem Holzofen kochten und an Holz gab es hier keinen Mangel. Der weiße Turm der Kirche leuchtete im Morgendunst wie eine Kerze und hinter dem Dorf erhob sich majestätisch der Manduino, ein einsamer Monolith aus Granit.
„Kommst du?“ rief SIE mir von innen entgegen und riss mich aus meinen Gedanken, es musste wohl sein, wenn ich den Tag nicht allein mit Bello verbringen wollte.
Eine gute Stunde später brachen wir zusammen zu Pablo auf. Bello flitzte vor und hinter uns her und war in seinem Element. Er machte noch einen Schlenker zur alten Viehtränke, dem heutigen mit Blumen geschmückten Dorfbrunnen, der Tag und Nacht vor sich hinplätscherte und konnte an keinem Dorfhund vorbeigehen, obwohl nur wenige Dorfbewohner Silvester hier oben gefeiert hatten. Wir gingen eine Stunde durch die Kastanienwälder des Val dei Ratti bis ins nächste Bergdorf nach Frasnedo und genossen gemeinsam die Ruhe und Kühle, Bello immer vorneweg, dann SIE und ich in der Nachhut, netterweise warteten die beiden nach einigen Kurven immer auf mich. Eine Straße zwischen den beiden Dörfern gab es nicht, es war auch keine geplant.
Als wir nach einer guten schweigsamen Stunde bei Pablo ankamen, saß er wie immer, falls er überhaupt zu Hause war, vor seinem Mac und bearbeitete Fotos oder Videos seiner unzähligen Aufnahmen. Er konnte sich stundenlang auf die Fotopirsch legen, um dieses eine Foto zu schießen, den Adler im Horst erst einmal finden oder die aufmerksame Gämse mit ihrem Jungen. Aber die Geduld hatte er sich schon in jungen Jahren angeeignet, als er in den frühen Siebzigern wie viele andere Verrückte allem Irdischen abschwor und sein Heil zuerst in der Vertikalen und dann in den eisigen Höhen des Himalaya suchte, den Cho Oyu bestieg, Bücher publizierte und immer wieder zurückkehrte. Mittlerweile war er über sechzig und hatte sich aufs Fotografieren verlegt, eine Leidenschaft, die ich zu gern mit ihm teilte. Wir konnten uns endlos bei einem Glas Wein Fotostrecken anschauen, ohne müde zu werden. Er hatte seine Träume, alles was damals ging, in die Tat umgesetzt, als ich schon Kinder hatte, die heute längst erwachsen sind und ihren eigenen Träumen nachhängen.
Er ließ sofort alles liegen und begrüßte kurz den aufdringlichen Bello, der ihn schon vor uns erreichte. Seine Frau Mariella, die ich sehr mochte und die exquisit kochen konnte, war mit den Kindern unten am See geblieben.
„La bella e la bestia!“ Den Spitznamen hatte mir Pablos Mutter Veronica verpasst, nachdem sie Ostern letzten Jahres von meiner Solotour über den verschneiten Pass vom Tracciolino über den 1600 Höhenmeter hohen Passo di Frasnedo gehört hatte. Ich war unvernünftigerweise allein aufgebrochen, recht spät, ohne jemandem Bescheid zu geben, es war eh niemand im Dorf unterwegs gewesen und hatte mich auf den Weg begeben. So gern ich auch Gesellschaft hatte, liebte ich es auch solche ungeplanten, spontanen Aktionen allein zu machen und mich durch irgendein Unterholz zu kämpfen. Ich war auf der Nordseite mit steigenden Höhenmetern in immer tieferen Schnee geraten. Der Weg war nicht mehr sichtbar, der Pass schon. Mehrmals sackte ich bis zur Hüfte ein, es dämmerte und mehrmals hatte ich Sorge, mich hier zu verfransen, niemand wusste Bescheid, wo ich war, an Umkehr hatte ich trotzdem nicht gedacht. Auf dem Pass war es schneefrei und ich konnte das Bergdorf, wo ich schlafen wollte, im Halbdunkel von oben sehen und nach all den Strapazen, die ich auf mich genommen hatte, erfüllte mich der Blick auf die andere Seite mit dem mir so bekannten Glücksgefühl, etwas geschafft zu haben, allen Widrigkeiten zum Trotz. Ich genoss den Abstieg und in zügigem Schritt kam ich eine Stunde später im Halbdunkel ins Nachbardorf Frasnedo, was völlig ausgestorben war und meine Schlafmöglichkeit vernichtete. Obwohl ich sehr erschöpft war, musste ich den kompletten Weg nach Foppaccia im Dunkeln mit Stirnlampe zurückgehen.
Wortreich begrüßte er SIE „la bella“ einen Kuss auf die Wange mehr als nötig gebend und auch ich wurde herzlich umarmt. „Habt ihr schon gegessen, ihr Glücklichen? Ich habe gerade meinen letzten Fang dokumentiert, einen Wolf, der morgens schwimmend die Mera durchquerte, ein reiner Zufall.“
„Nichts, einfach einen Roten und ein paar Oliven.“
Fünf Minuten später fanden wir uns auf seiner mit Wein berankten Terrasse im Halbschatten wieder, vor uns seinen roten Hauswein in grüner Flasche ohne Etikett, den er immer von seinem Lieferanten aus Sizilien bezog und selbst abfüllte. Wir prosteten uns mit Wassergläsern zu, edle Weingläser passten in dieses raue Bergszenario wirklich nicht hinein. Die dunkelrote, fast schwarze Flüssigkeit entfaltete sofort ihr Aroma und das frische Brot, die schwarzen Oliven und grober Käse aus dem Val di Bitto und Samolaco vervollständigten das verspätete Mittagsmenü perfekt, das würde ein guter Tag werden. Auch für Bello hatte er eine Leckerei aufgetan, auf der er genüsslich herumkaute.
Was wollte ich mehr? Ich hörte dem Geplätscher ihres Gesprächs in lombardischem Dialekt zu, von dem ich höchstens ein Drittel verstand, zuerst mussten alle Neuigkeiten aus dem Tal ausgetauscht werden. Ich verstand nur, dass es seiner Mutter wohl wesentlich schlechter ging, er öfter nach ihr sehen musste und sie auch nicht mehr allein hier in den Bergen lassen konnte. Deshalb könne er auch nicht mehr so lange weg.
„Ihr seid doch beide bergtauglich. Wollt ihr das nicht für mich machen? Ich beteilige euch auch am Umsatz.“
Ich hatte wohl nicht alles mitbekommen, worüber sie sich ausgetauscht hatten, konnte aber den erwartungsvollen Blick von ihr nicht ignorieren. Sie starrte mich an und ließ mit ihren großen Augen nicht locker, ihr schwarzer Pferdeschwanz, wackelte erwartungsfroh auf ihrer linken Schulter und ihrer Welle wollte ich mich nicht entziehen, geschweige denn konnte ich es.
„Hast du denn gar nicht zugehört?“ fragte SIE.
„Wir haben uns in Lombardisch unterhalten,“ sprang mir Pablo zur Seite. „Ich kann doch nicht weg und ich soll für das „Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna“ eine Werbestrecke für den „Sentiero Roma“ schießen, mit aktuellen Bildern und Videos, Touristen drauf, nicht diese alten Bilder mit Knickerbockern und Filzhut, die keinen Hering mehr hinter dem Ofen herlocken.“ Diese Redensart musste er wohl in freier Abwandlung von mir aufgeschnappt haben, ich hatte sie bisher noch von keinem Italiener gehört, wobei es ihnen an Redensarten ja nicht mangelte.
„Wir sollen für dich diese Fotostrecke machen? Das ist nicht dein Ernst.“
„Wir haben die Tour doch schon vor vier Jahren gemacht, als so viel Schnee lag, dass wir kaum über die Pässe kamen, weil es noch so früh im Jahr war,“ pflichtete SIE ihm bei.
Nur zu gut hatte ich diese erste Wanderung mit ihr in Erinnerung, jeden Tag, besonders den zweiten Tag, an dem mir nach zwanzig Jahren in den Bergen das erste Mal wirklich etwas Gefährliches passierte. Wir hatten die verschneiten Pässe gesehen und uns letztlich umentschieden und statt des Passo dell‘Oro zum Rifugio Omio den Passo del Barbacan mit 2596 Höhenmetern genommen und hatten deswegen das Geröllfeld gequert, was zwar unangenehm und Zeit raubend war, uns aber als die bessere Alternative erschien. Im Abstand von etwa zehn Metern querten wir das Geröllfeld, als ich nur leicht einen rechts neben mir in Hüfthöhe liegenden Felsen anfasste, der mich grollend umwarf und meinen rechten Fuß unter sich begrub. Ich schrie auf vor Schmerz, knallte beim Hinfallen mit dem Kopf noch gegen einen Stein und war davon etwas benommen. Es herrschte absolute Stille, mein rechter Fuß schmerzte höllisch, ich schaute rücklings liegend in den Himmel und die Zeit schien sich unendlich auszudehnen. Sekunden später stand SIE neben mir und brüllte.
„Was hast du gemacht, dein Fuß.“
„Der Scheißfelsen hat sich einfach bewegt, ich habe ihn nur leicht berührt, ich bin so blöd, das Geröllfeld zu queren in der Schneeschmelze, aua.“
„Was ist mit deinem Fuß?“
„Keine Ahnung, ich kann ihn nicht bewegen und es tut tierisch weh.“
„Was sollen wir machen?“ Wir kannten uns erst seit zwei Tagen und ich war der erfahrenere Alpinist und war meiner Meinung nach für die Sicherheit zuständig gewesen, hatte die Karte, das 1.-Hilfe-Paket, dachte ich zumindest. Den umgekehrten Fall, dass mir etwas zustößt und SIE mir helfen muss, hatte ich nicht auf meinem Schirm. Die Verzweiflung in ihren Augen und ihrer Stimme ließ mich ruhiger werden.
„Wir müssen irgendwie meinen Fuß unter dem Felsen wegkriegen. Gib mir meine Wanderstöcke.“
Der Schuh mit meinem Fuß drin ließ sich keinen Millimeter bewegen. Da ich meine Zehen bewegen konnte und ich außer dem starken Druck keine weiteren Schmerzen empfand, ging ich davon aus, dass mein Fuß nicht gebrochen war, aber er klemmte nun mal fest und schmerzte enorm. Die Wanderstöcke, die mich schon fünf Mal in den Himalaya begleitet und mir dort gute Dienste erwiesen hatten, wirkten hier etwas nutzlos. Ich hing etwas kopfüber nach unten und hatte auch Sorge, dass der Fels, wenn wir ihn bewegten, genau in meine Richtung rollen könnte. Die Stöcke bogen sich jedenfalls wie Flitzebögen und der Fels rührte sich nicht.
„Schieb sie zusammen,“ folgte ich einer Eingebung. „Ich versuche meinen Schuh aufzumachen, vielleicht kann ich ihn dann herausziehen.“
Mit Müh und Not kam ich an meinen Schnürsenkel und öffnete meinen Wanderschuh. Der Fuß bewegte sich nicht. Aber wir folgten meiner Idee und ich, kopfüber und sie, aufrecht mit all ihrer Kraft, konnten die zusammen geschobenen Wanderstöcke nebeneinander so verkanten, dass wir einen Hebel ansetzen konnten. Ich ruckelte Millimeter für Millimeter an meinem Fuß, nichts passierte, SIE setzte noch einmal neu an, um einen besseren Hebel zu haben, hob mit lautem Schrei beide Stöcke an und ich konnte endlich mit einem lauten „Ja!“ meinen Fuß aus dem Schuh herauszerren.
„Weg hier!“ rief SIE mir entgegen, bevor der Fels sich noch weiterbewegt.
Ich humpelte auf SIE gestützt ein kurzes Stück hinter ihr her bis zu einer Stelle, wo ich mich gefahrlos setzen konnte und SIE nahm mich mit finsterer Miene aber scheinbar auch erleichtert in den Arm.
„Was machst du denn für Sachen? So etwas ist mir beim Klettern noch nie passiert“, hörte ich.
Das Erste, was ich sah und fühlte, war, dass mein Fuß nicht gebrochen war und der Schmerz abrupt nachließ, als der Fuß befreit war und in der frischen Luft baumelte. Ich erblickte nur eine oberflächliche Schürfwunde, an der ich später noch Freude haben würde. Ich umarmte SIE, das war erst das zweite Mal, seit ich SIE kannte und bei allem Übermut der Befreiung meines Fußes vergossen wir unsere ersten gemeinsamen Tränen, beide wohl wissend, dass das auch anders hätte ausgehen können. Es sollten nicht unsere letzten Tränen sein.
Ich riss mich aus meinen Erinnerungen. „Ja haben wir, aber so ganz glorreich habe ich das nicht in Erinnerung.“
„Weil ich dich retten musste?“ fragte SIE mich herausfordernd.
„Nein, nicht nur deswegen. Wir wurden auf den Granitplatten gegrillt, wenn du dich erinnerst und die Schneepassagen an den Pässen waren nur mit Seilsicherung zu überqueren.“
„Jetzt liegt kein Schnee mehr im Juli. Ich habe schon mit dem Hüttenwirt vom Rifugio Gianetti telefoniert. Der sagt, dass es im Moment kein Problem gibt und das Wetter ist stabil.“ warf Pablo ein.
„Dann bin ich ja wohl der einzige Haken bei der Angelegenheit oder wie?“
„Ja,“ sagte SIE mit der provozierendsten Miene, die vorstellbar war.
„Aber ich kriege deine Kamera, Pablo?“
„Securo!“ sagte Pablo mit einem Grinsen und einem gewinnenden Blick auf SIE.
Nach der Begehung des Sentiero Roma vor vier Jahren war SIE vier Tage krank gewesen. SIE hatte sich in der Woche in bester Form gezeigt, die steilen verschneiten Rinnen waren kein Problem für SIE. Wir hatten meinen Fuß mit Pferdesalbe behandelt, dem Allheilmittel meines Mountainbike-Händlers in Deutschland, die ich immer bei Wanderungen dabeihatte. SIE hatte meinen Schuh mit Socke aus dem Spalt unter dem Felsen geprokelt und wir hatten den Pass überwunden, indem wir Stufen in den verharschten Schnee getreten hatten. Das ging relativ gut, doch beim Abstieg auf der anderen Seite des Passo del Barbacan hatte ich das Gefühl, dass jemand den Stecker gezogen hatte. Ich fühlte mich unsicher und erschöpft und auch SIE bemerkte meine Veränderung, offensichtlich hatte ich einen Schock gehabt und mein Adrenalin längst verbraucht. Ich schleppte mich mit mehreren Umwegen über verschneite, mir Angst einflößende, gurgelnde Schneebrücken, bis wir endlich im Rifugio Gianetti ankamen.
Doch an den folgenden Tagen wehte trotz Wärme dort oben ein kalter Wind und SIE musste sich dort oben wohl erkältet haben. Ihre Erkältung war hartnäckig und SIE lag zur Erholung ein paar Tage in Foppaccia in meinem Bett, wollte Tee und nichts essen. SIE esse nie etwas, wenn SIE krank sei, ihr Körper kriege nichts von ihr, wenn er SIE im Stich lasse, so sei das eben.
Wenn SIE gesund war, konnte SIE nicht genug Hautkontakt bekommen, SIE schlief jedenfalls immer nackt mit mir und mindestens ein Bein und ein Arm umschlangen mich. Doch wenn SIE krank wurde, dann wurde ihre Haut zu einer unüberwindlichen Grenze. SIE mummelte sich bis zum Halse ein, hatte zwei Schichten Hosen und Pullover an und einen dicken Schal um den Kopf, im Sommer. SIE schwitzte alles aus, ich schlief in meiner Wohnküche vor dem Kamin, schaute gelegentlich nach ihr und versorgte SIE mit Getränken. SIE hatte die ersten zwei Tage hohes Fieber und SIE sprach im Schlaf, berühren durfte ich SIE nicht. SIE fantasierte, ab und zu schrie SIE auf, schlief aber weiter. Es kam mir vor, als wäre sie in einer anderen Welt unterwegs, körperlos, entrückt, kein Bedürfnis mit profanen Menschen in Kontakt zu treten. Zweimal kam Pablo vorbei, der von ihrem Zustand erfahren hatte, einmal Enrico unser Nachbar, aber SIE wollte niemanden sehen. So vergingen vier Tage und am fünften Tag wachte SIE morgens um halb neun auf und stand vor meinem Bett in der Wohnküche. SIE war wieder da, in meiner Wirklichkeit, als wenn nichts gewesen wäre und fragte mich mit ihrem ihr eigenen herausfordernden Blick, was wir heute unternehmen wollten und von da an blieb SIE.
Mit dem gleichen Blick fragte SIE mich jetzt, eine Haarsträhne hing ihr über dem rechten Auge, ohne dass SIE sie wegstreifte: „Morgen?“
„Moment, Moment“, war das Einzige, was ich hervorbrachte gegenüber den beiden Verschwörern.
Ich liebte es, wenn sie dieses „Morgen?“ sagte, mit der hochgezogenen Stimme am Ende und dem speziellen Blick, so als gäbe es immer ein Morgen, als wäre alles Vergängliche vergangen, die Gegenwart vergänglich, ich wollte es hören, es war wie ein Versprechen auf Ewigkeit, als würde das alles niemals enden. Ich wollte auf keinen Fall, dass es jemals endete.
Also sagte ich: „Ja, aber wir müssen noch Proviant kaufen, unsere Ausrüstung zusammenstellen und du musst mir deine Kamera noch aufladen. Und was ist mit Bello?“
„Du Krämer, der bleibt bei Pablo und seiner Mutter,“ sagte SIE nur und: „Avanti amore.“
Was sollte ich dazu noch sagen. Ich schnappte mir noch ein paar Oliven und trank meinen Wein aus. Pablo seufzte, packte alles zusammen und empfahl mir noch, ein paar junge Touristen mit auf die Fotos zu bringen und natürlich SIE. Ich war nicht sicher, ob ich SIE in einem Werbefilm der Tourismusbehörde sehen wollte.
„Wie gesagt, Mariella reißt mir den Kopf ab, wenn ich das im September nicht fertig habe, wenn in Chiavenna die Tourismusbörse ihre Pforten öffnet und alle Grotten zum „Sagra dei Crotti“ geöffnet werden.“
Mariella war seine Ehefrau, erheblich ruhiger als Pablo, was keine Kunst war. Sie war weder Bergsteigerin, noch wollte sie dem Aktivitätswahn von Pablo folgen, der neben seinen Foto- und Filmprojekten noch jagen ging, die Wanderwege pflegte, das jährliche Dorffest vorbereitete und mit seinen Freunden im Sommer Pferde und Esel auf die Almen brachte. Sie war Vorsitzende des „Consorzio di Turismo di Valchiavenna“ und ihres Zeichens verantwortlich für alles, was sich touristisch hier und in den Nachbartälern ereignete. Einen Aufschub hätte es nicht gegeben, das wusste Pablo nur zu genau und ich auch. Also wurde ich nach etwas gefragt, was ich gerne tue, das hatte jemand mal Lebenskunst genannt.
„Ihr beiden kriegt das schon hin“, verabschiedete Pablo sich von uns, mit Bello auf dem Arm, ich hatte etwas Sorge, dass er uns folgen würde, wenn er ihn hinunterließ, also hatte ich ihn gebeten, ihn die ersten zwei Tage im Haus zu halten und nur mit Leine Gassi zu gehen. SIE hatte schon draußen gewartet und schaute versonnen bis weit über den Lago di Como, der von Wolkenfetzen zerrissen wirkte. SIE schien sich zu freuen, dass wir wieder gemeinsam etwas unternahmen und unsere erste gemeinsame Tour wiederholen sollten und auch mich überkam ein fast schon nostalgisches Gefühl für alles, was wir dort zum ersten Mal geteilt hatten und ich lächelte SIE an.
„Jaja, ihr müsst nur sehen, dass ihr morgens aus den Federn kommt, da ist das Licht am besten, aber das weißt du ja“, fügte Pablo noch hinzu.
Ich hatte schon öfter zunächst nur für mich und dann als Geschenke Fotobücher verschenkt, ich hatte immer meine Kamera, eine einfache Sony Digitalkamera, dabei und hatte auch keine





























