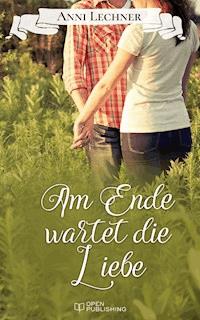3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Erich Fromm
- Sprache: Deutsch
Die kleine Melanie hat einen Entschluss gefasst: Die dauernden Streitereien ihrer Eltern müssen aufhören, denn sie wünscht sich nichts sehnlicher als eine glückliche, kleine Familie. Und so schmiedet Melanie einen Plan, um ihre Eltern zu versöhnen. Sie reißt von Zuhause aus und versteckt sich in einer abgelegenen Höhle. Doch Melanie weiß nicht, dass in der Gegend ein Kinderschänder sein Unwesen treibt und sie sich in große Gefahr begeben hat. Überwinden Melanies Eltern ihren Streit noch früh genug? Und können sie ihre Tochter noch retten? Dieser und die zwei weiteren spannenden Romane „Das doppelte Lottchen“ und „Flucht ins Glück“ sind in diesem Buch enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anni Lechner
Angst um Melanie
Das doppelte Lottchen
Flucht ins Glück
Anni Lechner: Band 28, Angst um Melanie ... und zwei weitere spannende Romane
Copyright © by Anni Lechner
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Überarbeitete Neuausgabe © 2017 by Open Publishing Verlag
Covergestaltung: Open Publishing GmbH – Mathias Beeh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
eBook-Produktion: Datagroup int. SRL, Timisoara
ISBN 978-3-95912-236-8
Angst um Melanie
Laute Stimmen weckten Melanie aus ihrem Schlaf. Sie schlug die Augen auf und lauschte in die Dunkelheit. Ihre Mama und ihr Papa stritten sich schon wieder. Melanie klammerte sich verzweifelt an ihren Teddybär, während sich ihre Eltern im Wohnzimmer nebenan heftige Wortgefechte lieferten.
»Renate, ich sag’s dir jetzt zum letzten Mal! Wir bleiben heut daheim. Ich lass mich ned wieder vor allen Leuten zum Narren machen, weil der Stowallner wie ein liebestoller Kater um dich herumscharwenzelt!«, brüllte ihr Vater eben voller Zorn. Melanies Mutter gab ihm jedoch sofort Kontra.
»So? Wenn der Toni ein- oder zweimal mit mir tanzt und mir ein paar hübsche Komplimente macht, so ist er für dich gleich ein liebestoller Kater! Aber mein Herr Gemahl darf natürlich auf seinen Firmenfeiern jederzeit mit der Habertanner Mira herumpoussieren und wer weiß was sonst noch mit ihr treiben. Arnold, du hast doch nimmer alle Sinne beisammen!«
»Renate, ich hab dir schon mindestens zehnmal gesagt, dass die Sach mit der Mira absolut harmlos gewesen ist. Wir hatten bei der Feier zum fünfzigsten Geburtstag vom Chef alle a wengerl zu viel getrunken. Dabei ist die Mira jedem von uns um den Hals gefallen und hat uns abgebusselt. Es war eben dumm, dass du ausgerechnet in dem Moment in den Saal gekommen bist, als sie das bei mir gemacht hat. Eine Minute früher hättest du sie noch mit dem Walter flirten sehen. Ich hab wirklich nix mit der Mira! Aber du und der Stowallner …!«
Arnold Gruber ließ den Rest ungesagt.
Melanie hielt sich die Ohren zu, um nichts mehr hören zu müssen. Doch es half nichts, denn die Stimmen im Wohnzimmer wurden immer lauter. Selbst als sie den Kopf unter das Kissen steckte, konnte sie das meiste noch verstehen. Die Vorwürfe, die ihr Vater ihrer Mutter machte, klangen wütend und seltsam hilflos, während die Mutter darauf mit einer bösen Stimme antwortete, die zu einem fremden Menschen zu gehören schien und in Melanies Ohren schrill und falsch klang.
Renate Gruber lachte höhnisch und sagte ein paar Worte, die Melanie nur zum Teil verstehen konnte. Erst die Antwort ihres Vaters drang wieder bis in ihr Kinderzimmer durch.
»Du brauchst gar ned so unschuldig zu tun, Renate. Wie du siehst, hab ich’s doch erfahren, dass du dich letzten Freitag in Kiefersfelden mit dem Stowallner getroffen hast.«
»Was du dir nur denkst? Ich hatte drüben in Bayern etwas für die Sylvia zu erledigen und bin dabei ganz zufällig auf den Toni getroffen. Wir haben uns in ein Café gesetzt und eine Tasse Kaffee miteinander getrunken. Warum sollt ich’s ned tun? Er war schließlich ein Schulkamerad von mir. Du nimmst in deiner eingebildeten Eifersucht natürlich das Schlimmste an. Aber selbst wenn es so wäre, wären wir ned das erste Ehepaar, wo Mann und Frau ihre eigenen Wege gehen!«, setzte sie bissig hinzu.
»Ganz zufällig hast du den Stowallner getroffen? Das glaubst du doch selber ned. Ich weiß doch, wie der Kerl hinter dir her ist. Außerdem hab ich erfahren, dass ihr vor zwölf Jahren schon einmal so gut wie verlobt gewesen seid!«
»Und weil du das gehört hast, unterstellst du mir gleich ein Verhältnis mit ihm? Arnold, du hast wirklich einen Schlag weg!«
Melanie begriff nicht alles, was sich ihre Eltern gegenseitig an den Kopf warfen. Es war diesmal jedoch schlimmer als sonst. Seit Anton Stowallner, ein alter Bekannter ihrer Mutter, vor einem Vierteljahr nach Terglan zurückgekommen war, herrschte Streit zwischen ihren Eltern. Melanie mochte den Mann nicht und sei es nur deswegen, weil er ihre Eltern entzweite. Sie hatte es ihm auch schon einmal mit der ganzen Autorität ihrer sieben Jahre ins Gesicht gesagt. Stowallner hatte kurz die Miene verzogen und sie ihrer Mutter gegenüber eine vorlaute Göre genannt. Beim nächsten Mal hatte er ihr eine große Tafel Schokolade mitgebracht und freundlich mit ihr geredet. Weil ihre Mutter es wünschte, hatte Melanie die Schokolade angenommen, sie aber dann heimlich in den Bach geworfen. Während das Mädchen in ihren Kummer versunken vor sich hinweinte, stritten ihre Eltern im Wohnzimmer noch immer darum, ob sie heute ausgehen sollten oder nicht.
»Was ist jetzt? Kommst du mit oder soll ich allein gehen?«, fragte ihre Mutter zuletzt ungehalten.
»Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du ned mit dem Stowallner tanzt!«, trumpfte der Vater auf.
»Dir geht es wirklich ned gut! Ich kann doch ned einem alten Bekannten einen Korb geben, nur weil mein Herr Gemahl ihn ned leiden kann. Außerdem ist der Toni einer der besten Tänzer, die ich kenn! Du könntest du dir ruhig eine Scheibe von ihm abschneiden!«
»Jetzt tanz ich dir wohl auf einmal nimmer gut genug, was?«, rief Melanies Vater beleidigt.
»Weißt du was, Arnold? Wegen mir kannst du daheimbleiben und dich mit dir selber streiten. Ich geh jetzt ins Edelweiß hinunter, um endlich wieder ein paar fröhliche Gesichter um mich zu sehen. Du kannst ja nachkommen, wenn du dich im Oberstüberl wieder eingerenkt hast!«
»Du bleibst daheim!«
»Du solltest ein Aspirin nehmen. Vielleicht kannst du danach wieder klar denken«, gab Renate spöttelnd zurück. Melanie hörte, wie ihre Mutter das Wohnzimmer verließ und auf ihr Zimmer zukam. Kurz darauf öffnete Renate vorsichtig die Tür und schaltete das Nachtlicht an.
»Du bist noch munter, Mela? Komm Spatzerl, du musst doch schlafen!«, raunte sie ihrer Tochter ins Ohr und küsste sie auf die Stirn.
»Müsst ihr denn immer so böse aufeinander sein, der Papa und du?«, fragte Melanie leise.
»Aber Spatzerl, du darfst dir ned zu viel dabei denken. Im Leben kracht es halt manchmal. Der Papa wird sich schon wieder beruhigen, hoffentlich!« Das letzte Wort setzte Renate ganz leise hinzu.
Melanie hörte es doch und es tat ihr weh. Um die Mutter nicht zu beunruhigen, tat sie so, als wäre sie müde und flüsterte ihr ein arg schlaftrunkenes »Gute Nacht, Mama!«, zu. Renate streifte Melanies Stirn noch einmal mit den Lippen und stand auf.
»Gute Nacht, Spatzerl, schlaf schön!« Sie winkte Melanie mit den Fingern zu und schaltete das Licht wieder aus.
Melanie sah ihrer Mutter nach, als diese das Zimmer verließ, und hörte kurz darauf das Geräusch der zuschlagenden Haustür. Die Stille, die auf einmal im Haus herrschte, erschreckte sie beinahe ebenso wie der laute Streit vorher. Melanie lauschte angstvoll in die Nacht hinein, doch sie hörte nur noch ihren eigenen Herzschlag und ihr leises Atmen. Sie fühlte sich sterbenselend und so hilflos wie ein neugeborenes Kätzchen.
»Liebes Jesulein im Himmel, kannst du ned den Stowallner und die Habertanner Mira verschwinden lassen, damit die Mama und der Papa wieder gut miteinander sind und wir wieder unsere Ruh haben?«, flüsterte sie mit tränenerstickter Stimme. Sie mochte die Arbeitskollegin ihres Vaters genauso wenig wie den ehemaligen Schulkameraden ihrer Mutter. Nur wegen diesen beiden gab es andauernd Streit. Bevor die beiden gekommen waren, war alles so schön gewesen!
Während sich Melanie schlaflos im Bett wälzte und wegen des Streits ihrer Eltern immer wieder weinen musste, hörte sie plötzlich die Tür des Wohnzimmers gehen. Der Vater war also daheimgeblieben, während die Mutter zum Tanzen gegangen war. Melanie wartete darauf, dass auch er zu ihr hereinkommen würde. Doch er ging an ihrer Zimmertür vorbei in die Küche. Wenig später kehrte er ins Wohnzimmer zurück. Melanie hörte, wie Flaschen mit einem klirrenden Geräusch gegeneinander schlugen, und begriff, dass sich ihr Vater etwas zu trinken geholt hatte.
»Bitte, Papa, du darfst ned so viel trinken wie nach eurem letzten Streit. Sonst schlägst du noch die Mama und sie geht wirklich fort, so wie sie’s letzte Woch gesagt hat«, flüsterte sie schluchzend.
Damals hatte ihr Vater schon mit der Hand ausgeholt, um ihrer Mutter eine Ohrfeige zu geben. In Melanies Ohren hallte noch immer der scharfe Ruf ihrer Mutter.
»Arnold, wenn du mich schlägst, bin ich morgen beim Scheidungsanwalt!«
Der Vater hatte erschrocken die Hand sinken lassen und war ohne ein weiteres Wort ins Bett gegangen. Wenn er diesmal doch zuschlug, würde ihre Mutter ihre schlimmen Worte sicher wahr machen. Dann würde sie ebenso für immer weggehen wie die Mutter ihrer Schulfreundin Maria. Melanie zitterte bei diesem Gedanken am ganzen Körper. Sich scheiden lassen war etwas ganz Böses, weil der Papa oder die Mama sie danach nicht mehr lieb haben würden. Bis spät in die Nacht lauschte sie auf die Geräusche im nächtlichen Haus und wartete voller Angst auf die Rückkehr ihrer Mutter. Erst als sie hörte, dass auch ihr Vater zu Bett ging, schlief sie vor Erschöpfung ein.
* * *
Der wöchentliche Tanzabend im Hotel Edelweiß war weit über Terglan hinaus beliebt, da hier weniger moderne Rhythmen, sondern mehr die Tanzmelodien für die reiferen Semester gespielt wurden. Doch auch die Dorfjugend war reichlich vorhanden, denn wer in Terglan etwas gelten wollte, der musste hier im Edelweiß schon seinen ersten Walzer links herum getanzt haben.
Obwohl es für den Tanzabend keine direkte Kleiderordnung gab, waren die meisten Gäste doch im Dirndlkleid oder passenden Trachtenanzug erschienen. Der Automechaniker Christian Margeller und seine Schwester Cornelia machten hier keine Ausnahme. Christian, ein lang aufgeschossener Bursche mit einem schmalen, von dunklen Augen beherrschten Gesicht begrüßte eben seinen Freund Walter Ralisch am Tisch, während die etwas pummlige, brünette Cornelia den Neuankömmling betont übersah.
»Grüß dich, Conny, du schaust aber heut wieder gut aus!«, sprach Walter das Mädchen an. Er erntete jedoch nur ein zorniges Schnauben von ihr.
»Seit deinem Flirt mit der Habertanner Mira beim Fünfzigsten von eurem Chef hast du bei der Conny das Kraut ausgeschüttet!«, teilte Christian seinem Freund mit.
»Ich habe ned mit der Mira geflirtet! Die hat sich mir einfach an den Hals geworfen. Außerdem war ich ned der Einzige, den sie bei der Feier beehrte. Den Gruber Arnold hat sogar seine Frau dabei erwischt, wie die Mira auf seinem Schoß gesessen ist!«, verteidigte sich Walter gegen den Vorwurf.
»Männer!, sag ich da bloß. Da braucht sich euch bloß so ein Flitscherl an den Hals zu werfen, und schon denkt ihr nur noch mit euren unteren Regionen!«, zischte ihm Cornelia mit betonter Abscheu zu.
»Jetzt mach einmal halblang, Conny. Ich hab mit der Mira bislang nix gehabt und will auch in Zukunft nix mit ihr haben. Wenn du mir das ned glauben willst, dann kann ich dir auch nimmer helfen!«, erklärte Walter und drehte Cornelia ernstlich beleidigt den Rücken zu. Das Mädchen sah ihren Bruder verwirrt und Hilfe suchend an. Dieser kümmerte sich jedoch nicht um sie, sondern starrte das Paar, das eben durch die Tür hereinkam, aus weit aufgerissenen Augen an.
»Sakra, das ist ja direkt eine Schönheit. Wie mag der Haasenreither zu so einer Begleitung kommen?«, flüsterte er mit andächtiger Stimme. Walter hörte es und drehte sich jetzt ebenfalls nach den Neuankömmlingen um.
»Ui, die könnt sogar mir gefallen. So was Feines hab ich selten gesehen. Da kann höchstens noch die Conny mithalten!« Er hatte aus den Augenwinkeln gesehen, wie Cornelia zu einem deftigen Rippenstoß ausholte und rasch den letzten Satz hinzugesetzt. Cornelia hielt in der Bewegung inne und funkelte ihn misstrauisch an.
»Meinst du das jetzt im Ernst, Walter? Oder willst du dir bloß wieder einen Spaß mit mir erlauben?«
»Bei dir spaß ich nie!«, antwortete Walter erleichtert darüber, dass Cornelia wieder mit ihm sprach, und tippte ihr mit dem rechten Zeigefinger auf die Nasenspitze. »So, aber jetzt sind wir zwei wieder gut miteinander.«
»So schnell geht das fei ned! Die Mira …«
»Die Mira tanzt grad mit dem Stowallner. Vielleicht bleibt sie an ihm hängen. Ich hätt endlich Ruh vor deinen Vorwürfen, und auch beim Gruber Arnold käm der Haussegen wieder ins Lot.« Ohne Cornelias Antwort abzuwarten, stand Walter auf und reichte ihr die Hand. Das Mädchen atmete auf und folgte ihm auf den Tanzboden. Christian blieb hingegen am Tisch sitzen und musterte noch immer das junge Mädchen, das mit Sepp Haasenreither in den Saal gekommen war. Die beiden irrten zwischen den Tischreihen herum und suchten einen Sitzplatz. Wo sie jedoch auch hinkamen, machten sich die Leute so breit, dass niemand mehr neben ihnen Platz fand, oder erklärten, die noch freien Stühle seien schon für Bekannte reserviert.
Sepp Haasenreither war ein hagerer Mann um die fünfzig, mit einem ausdrucksstarken Gesicht und bemerkenswert wohlgeformten Händen. Er hatte sich vor etlichen Jahren das alte Straßenwärterhaus gekauft und lebte dort als Kunstmaler. Von Anfang an war er ein Außenseiter in der Dorfgemeinde gewesen. Doch seit er vor einem Jahr des Mordes an der kleinen Terflinger Liesl bezichtigt worden war, wurde er von den meisten Terglanern gemieden oder sogar heftig angefeindet.
Die Gendarmerie hatte ihm damals zwar nicht das Geringste nachweisen können. Dennoch war die üble Beschuldigung an ihm haften geblieben. Auch Christian hatte sich seit dieser Zeit von ihm ferngehalten. Doch als er jetzt in das bleiche, von einer feinen Schweißschicht bedeckte Gesicht Haasenreithers blickte und dessen hilflosen, wie um Verzeihung bittenden Blick auf sich gerichtet sah, tat ihm der Mann mit einem Mal leid. Ohne sich um das Getuschel der Umsitzenden zu kümmern, stand er auf und winkte Haasenreither und dessen Begleiterin zu sich an den Tisch.
»He, Sepp, komm her! Bei uns sind noch zwei Plätz frei.«
Der andere zuckte zusammen und schien unschlüssig darüber, ob er der Einladung folgen sollte. Das Mädchen strahlte Christian hingegen dankbar an und kam auf ihn zu. Der junge Mann sprang auf und rückte ihr einen Stuhl zurecht. Mehr nebenbei beantwortete er Haasenreithers leisen Gruß und setzte sich dann so, dass er das Mädchen genau anschauen konnte.
Sie war ein wenig über das Mittel groß und so schlank, dass er glaubte, ihre Taille mit den Händen umfassen zu können. Weich gelocktes Goldhaar umschmeichelte ein herzförmiges Gesicht, in dem blauviolette Augen wie zwei große Amethyste funkelten. Sie trug kein Dirndl, sondern ein modernes Kleid, das ihr jedoch ausgezeichnet stand.
»Willst du mir den Herrn ned vorstellen, Onkel Sepp?«, wandte sie sich mit angenehm sanfter Stimme an Haasenreither. Doch Christian enthob den Mann dieser Mühe.
»Ich bin der Margeller Christian von der Autowerkstatt am Dorfanfang«, erklärte er lächelnd und entblößte dabei seine gesunden, weißen Zähne.
»Also, ich bin die Haslinger Gerti aus Rautenmoos«, erwiderte das Mädchen die Vorstellung. »Der Sepp ist mein Onkel. Ich bin zufällig auf Besuch da und hab gelesen, dass heut Tanzabend ist. Da hab ich mir gedacht, dass der Onkel doch wieder einmal unter die Leut müsst. Er ist ja doch ein arger Einsiedler geworden.«
»Da hast recht, Gerti!« Christian gab sich erst gar nicht mit dem steifen »Sie« ab, sondern schlug sofort einen familiären Ton an. Nur einmal wurde er böse, als nämlich die Bedienung Gita an seinem Tisch vorbeiging, ohne sich um die neuen Gäste zu kümmern. Christian schnappte sie am Schürzenband und hielt sie zurück.
»Ein Krügerl Bier und ein Viertel Wein, Gita, nein, zwei Krügerl Bier!«, erklärte er nach einem raschen Blick auf seinen eigenen Bierkrug. Da die Kapelle eben zu einem neuen Tanz aufspielte, wartete Christian die Antwort der Bedienung nicht ab, sondern streckte Gerti auffordernd die Hand entgegen.
»Wollen wir tanzen?« Es war weniger eine Frage als ein Befehl. Das Mädchen sah ihn einen kurzen Moment aus dunkel werdenden Augen an, dann warf sie den Kopf hoch, dass ihr Haar nur so stob, und stand auf.
»Bis gleich, Onkel!«, sagte sie und ergriff Christians Hand. Beide eilten zum Tanzboden und mischten sich unter die Paare. Sie hatten noch keine drei Takte getanzt, als Walter und Cornelia neben ihnen auftauchten.
»Bist du närrisch, Chris, weil du den Haasenreither an unseren Tisch gerufen hast?«, schalt ihn die Schwester. Christian sah das Mädchen in seinem Arm dunkel vor Zorn werden und fühlte den starken Wunsch, seiner Schwester eine saftige Ohrfeige zu geben. Walter spürte die Verstimmung seines Freundes und schlug mit Cornelia sofort eine andere Richtung ein.
»Du darfst dir nix dabei denken«, flüsterte Christian seiner Tänzerin zu. »Meine Schwester meint es ned so. Sie plappert nur den Unsinn nach, der …«
»Der im ganzen Ort und darüber hinaus erzählt wird«, unterbrach ihn Gerti traurig. »Warum kann man meinen Onkel denn ned endlich in Ruh lassen? Es ist doch bewiesen, dass er mit dem Tod der kleinen Liesl nix zu tun gehabt hat!«
»Daran ist unser Sherlock Holmes schuld«, erklärte Christian mit einem verkniffenen Lachen.
»Der wer?« Gertis Gesicht war ein einziges Fragezeichen.
»Unser Sherlock Holmes. Eigentlich heißt er ja Friedrich Holmer und ist der Chef der Bezirksgendarmerie. Weil er ein Kriminaler ist, haben die Leut aus Holmer ein Holmes gemacht, nach dem berühmten Detektiv. Dort hinten sitzt er übrigens!« Christian wies Gerti auf einen breit gebauten Mann in Uniform hin, der nicht weit entfernt bei den Honoratioren des Ortes saß. Die blassen Augen des Gendarmen ruhten gehässig auf Sepp Haasenreither, der jetzt noch als Einziger am Tisch saß und sich dort wie auf einem Präsentierteller vorkommen musste.
»Weißt du, Gerti, der Holmer hat’s ned verwinden können, dass er damals den Mörder ned gefunden hat. Er hatte sich in den Gedanken verrannt, dass nur dein Onkel der Täter sein könnt und dadurch wohl wichtige Spuren und Hinweise übersehen. Aber ich glaub, wir sollten uns wieder setzen. Am Tisch können wir viel besser miteinander reden als hier auf dem Tanzboden!«, schlug Christian vor. Gerti sah zu ihrem Onkel hin und erkannte, dass dieser jeden Augenblick aufspringen und davonlaufen konnte.
»Ich weiß zwar ned, was wir zwei zu besprechen hätten. Aber es ist wirklich das Beste, wenn wir zum Onkel gehen«, erklärte sie und brach den Tanz ab.
Sepp Haasenreither atmete sichtlich auf, als er die beiden zurückkommen sah. Christian begann eine Unterhaltung, in die er auch Gertis Onkel mit einbezog. Sepp Haasenreither antwortete wohl noch etwas zögernd, doch die Ansprache tat ihm sichtlich gut. In einer Tanzpause kehrten auch Walter und Cornelia an den Tisch zurück und brachten eine Menge guter Laune mit. Über ihre Späße musste schließlich sogar Haasenreither lachen. Walter machte dann auch noch einen Witz auf Kosten Friedrich Holmers, der wie ein düsterer Schatten an seinem Tisch saß und die Gruppe um Haasenreither mit seinen Blicken verschlang.
Plötzlich zupfte Cornelia Walter am Ärmel. »Schau einmal. Sind das in der Nische dort drüben ned der Stowallner Toni und die Gruber Renate?«, fragte sie ihn. Walter sah in die angegebene Richtung und nickte.
»Du hast recht. Ich hab gar ned gesehen, dass die Renate gekommen ist.«
»Ihren Mann hat sie auf alle Fälle ned dabei. Sonst dürft sie sich ned so mit dem Stowallner abgeben. Der Arnold platzt doch schon vor Eifersucht, wenn er den Kerl bloß sieht!«
»Jetzt küsst er ihr gar noch die Hand. Sauber, sag ich da bloß. Mit mir dürftest du so ein Spiel ned treiben!« Walter drückte Cornelia an sich und schüttelte besorgt den Kopf.
»Mir tut ja bloß das Dirndl leid«, schloss er und sah dann Cornelia fragend an. »Magst du tanzen? Die Kapelle spielt wieder auf!«
* * *
An diesem Morgen wachte Melanie erst nach mehrmaligem Weckruf ihrer Mutter auf. Ihr Vater schlief noch, obwohl er doch ins Büro musste. Sonst hatte ihre Mutter ihn immer rechtzeitig geweckt. Heute richtete Renate Gruber nur rasch das Frühstück für sich und Melanie her. Dem Mädchen blieb beinahe die Honigsemmel im Hals stecken, so unglücklich fühlte es sich. Auch als Melanie das Haus verließ und zur Schule eilte, wurde es nicht besser. Ihre Klassenlehrerin Lena Staßny schimpfte mit ihr, weil sie zu spät kam. Aber auch sonst war sie mit Melanies Leistungen unzufrieden. Als nach endlos langen Stunden der Schlussgong ertönte, hielt sie das Mädchen zurück.
»Melanie, ich muss über dich den Kopf schütteln! Du bist in deinem ersten Schuljahr wirklich eine der Besten in der Klasse gewesen. In letzter Zeit haben deine Leistungen jedoch stark nachgelassen. Wenn du nicht bald besser wirst, ist sogar deine Versetzung ernstlich gefährdet! Lernst du denn daheim nicht genug?«
»Doch, ich lern schon daheim …«, stotterte das Mädchen und fühlte sich dabei todunglücklich. Sie konnte der Lehrerin doch nicht sagen, was sie wirklich bedrückte.
»Ich will es dir glauben, Melanie«, antwortete die Lehrerin zweifelnd. »Auf alle Fälle wirst du die gestrige Hausaufgabe noch einmal machen. Diesmal aber bitte sorgfältiger als das erste Mal. Hast du mich verstanden?«
»Ja, Frau Staßny!«, erwiderte Melanie mit gesenktem Kopf.
»Das will ich hoffen, Melanie. Du kannst jetzt gehen!«
Melanie raffte rasch ihren Schulranzen an sich und huschte zur Tür hinaus. Voller Sorge eilte sie nach Hause. Ihre Mutter war nicht daheim, hatte ihr aber das Mittagessen in die Röhre gestellt. Es gab Hähnchen, Melanies Leibgericht. Doch heute kaute sie lustlos darauf herum und schob mehr als die Hälfte des Essens wieder in den Herd zurück. Schließlich zog sie sich in ihr Zimmer zurück und machte sich an die Schulaufgaben. Obwohl ihr Kopf wie ein alter Teekessel summte, gab sie sich alle Mühe. Sie wollte doch ihren Eltern keine Sorgen machen. Die Buchstaben und Ziffern waren heute jedoch so widerspenstig, dass sie bei jeder Aufgabe mehrere Anläufe nehmen musste, bis alles halbwegs so gelöst war, dass sie das Heft Frau Staßny am nächsten Tag vorlegen konnte.
Irgendwann hörte Melanie, wie die Haustür geöffnet wurde. Sekunden später kam ihr Vater ins Kinderzimmer. Das Mädchen erschrak über sein fahles Gesicht und seine flackernden Augen. Als er sich zu ihr niederbeugte, roch sie, dass er getrunken hatte.
»Hast du auch brav deine Aufgaben gemacht, Mela?«, fragte er mit schwerer Stimme. Auf einmal sank er mit einem Aufschluchzen in die Knie und presste das Mädchen an sich. »Wir zwei gehören zusammen, gelt Mela. Uns zwei kann nix trennen!« Bei den letzten Worten strömten ihm die Tränen über die Wangen und benetzten das Haar des Mädchens.
»Papa, was hast du denn?«, fragte die Kleine erschrocken.
»Es geht schon wieder, Katzerl«, antwortete er und stand auf. Er blieb noch einen Augenblick im Raum stehen und holte seine Geldbörse hervor. Er suchte umständlich darin, bis er einen passenden Schein fand, und drückte diesen Melanie in die Hand. »Dafür kaufst du dir etwas Schönes, Mela!«, sagte er und verließ mit müden Schritten das Zimmer.
Melanie sah ihm nach und kämpfte nun selber vergebens mit den Tränen. Das Geld in ihrer Hand steckte sie weg, ohne es überhaupt anzusehen.
Wenig später hörte sie erneut die Haustür aufgehen. Ihre Mutter trat mit einem munteren Gruß in den Flur und hing ihre Jacke an der Garderobe auf. Sofort klang die anklagende Stimme Arnold Grubers auf.
»Hast dich wohl wieder mit deinem Liebhaber getroffen? Du brauchst kein so unschuldiges Gesicht zu machen. Ich weiß doch alles! Und ned nur ich. In der ganzen Gemeinde pfeifen es die Spatzen vom Dach, wie du mit dem Stowallner herumzigeunerst!«
»Weißt du was, Arnold. Langsam bin ich deine Beschuldigungen und Verdächtigungen leid. Glaub, was du willst, mir ist es wurscht! Letztens hast du mir vorgeworfen, dass ich mit dem Toni tanzen war. Und heut beschuldigst du mich, mich mit ihm herumzutreiben! Für dich hab ich die Aushilfsstelle in Sylvias Laden in St. Johann gewiss auch nur deswegen angenommen, um mich dort mit meinen Liebhabern zu treffen!« Renates Stimme troff nur so vor Hohn, doch Melanie hörte noch etwas anderes heraus, Verzweiflung, Wut und Angst vor der Zukunft.
Streitet euch doch nicht schon wieder!, wollte das Mädchen rufen. Ihre Lippen blieben jedoch stumm und sie hörte mit wachsendem Entsetzen der Auseinandersetzung ihrer Eltern zu.
»Ich hab nix von Liebhabern, sondern nur vom Stowallner gesagt!«, entgegnete Arnold schnappig.
»Der hat mit meiner Arbeit bei der Sylvia aber nix zu tun. Die hab ich schließlich schon vor mehr als einem Jahr angefangen, als die Melanie in die Schul gekommen ist. Der Toni ist aber erst im Mai darauf nach Terglan gekommen!«
»Wegen mir hätt er bleiben können, wo der Pfeffer wächst. Dort tät er wenigstens ned unsere Ehe kaputt machen!«
»Hast du dabei ned ein bisserl die Mira vergessen? Ich hab mich mit dem Toni noch nie so aufgeführt wir du damals mit dieser Habergeiß!«
»Jetzt lass endlich die Mira aus dem Spiel. Da war nix und wird auch nix sein. Aber deine Vernarrtheit in den Stowallner ist Realität!«
»Weißt du was, Arnold, du kannst mir den Buckel runterrutschen. Wär die Melanie ned, hätt ich schon längst die Scheidung eingereicht. Wenn du jedoch so weitermachst, garantier ich für nix! So widerwärtig, wie du dich zurzeit aufführst, dagegen kann ein kultivierter Mann wie der Toni nur positiv abstechen!«
Die letzten Worte rief Renate mit ziemlicher Lautstärke und schlug danach die Tür der Küche heftig hinter sich zu. Melanie hörte, wie ihr Vater das Haus verließ, und saß dann mit zuckenden Lippen auf ihrem Stuhl. Wenig später öffnete sich die Tür ihres Zimmers und ihre Mutter kam herein.
»Aber Mela, du wirst doch ned weinen? Komm, wir zwei haben uns doch lieb.« Renate umarmte ihre Tochter und küsste sie auf die tränenfeuchten Wangen. »Wir beide halten zusammen, was immer auch geschieht, ned wahr?«
* * *
Auch in dieser Nacht schlief Melanie erst sehr spät ein und fiel sofort in einen schlimmen Traum. Sie sah ihre Eltern streiten, wie sie noch nie gestritten hatten und schließlich dröhnte das Wort Scheidung wie ein Hammerschlag durch das Haus.
»Die Mela gehört aber mir!«, rief ihr Vater und fasste nach ihr.
»Nein, mir!«, antwortete die Mutter und packte sie ebenfalls.
»Nein, ned, ihr tut mir weh! Ich gehör doch euch beiden!«, weinte Melanie im Traum. Doch weder Vater noch Mutter kümmerten sich darum, sondern zerrten sie in die jeweils andere Richtung. Jetzt kam auch noch Mira Habertanner dem Vater und Anton Stowallner der Mutter zu Hilfe und zogen so heftig an Melanie, bis diese in zwei Teile zerbrach.
In dem Moment wachte Melanie mit einem lauten Schrei auf und sah verständnislos um sich. Erst als ihre Mutter erschrocken die Tür aufriss, um nach ihr zu sehen, wurde sie sich ihrer Umgebung wieder bewusst.
»Was hast du denn, Spatzerl?«, fragte Renate und zog das Kind an sich.
Melanie dachte an den Traum und wich vor ihrer Mutter zurück.
Diese lächelte sie an und streichelte ihr Haar. »Komm, schlaf wieder ein, Mela«, flüsterte sie und strich die Decke zurück. Melanie schloss die Augen, ohne jedoch noch einmal einschlafen zu können. Als ihre Mutter kam, um sie zu wecken, stand sie müde und von dem Albtraum wie gelähmt auf. Sie brauchte weitaus mehr Zeit im Badezimmer als sonst und trank, weil die Zeit für das Frühstück nicht mehr reichte, nur rasch eine Tasse Kakao. Danach verließ sie mit einem geflüsterten Gruß das Haus und eilte in die Schule. Von den guten Vorsätzen des letzten Tages war nicht mehr viel übrig geblieben. Sie saß reglos auf ihrem Stuhl und starrte vor sich hin, ohne auch nur das Geringste von dem, was Frau Staßny an Lehrstoff erzählte, zu begreifen.
»Melanie, ist was mit dir?«, fragte die Lehrerin, als ihr das seltsame Verhalten des Mädchens nach einer Weile auffiel. Melanie hörte die Frage nicht. Erst als Frau Staßny sie rüttelte, erwachte sie aus ihrer Passivität.
»Es geht schon, Frau Staßny«, flüsterte sie leise. Die Lehrerin schien davon jedoch nicht überzeugt, denn sie legte ihr prüfend die Hand auf den Nacken.
»Ich glaube, du hast Fieber, Melanie. Es wird das Beste sein, wenn du jetzt heimgehst und deiner Mutter sagst, dass sie den Doktor holen soll. Sie kann mich ja morgen früh anrufen und mir sagen, wie es dir geht!«
Melanie schaute die Lehrerin erstaunt an, packte ihre Sachen und verließ das Klassenzimmer mit schlurfenden Schritten.
»Gute Besserung!«, rief ihr Frau Staßny noch hinterher.
Kurze Zeit später stand Melanie auf der Straße und wanderte langsam auf das elterliche Haus zu. Doch ihre Beine wurden umso schwerer, je näher sie ihrem Heim kam. Zu Hause würde sie doch nur in ihrem Zimmer sitzen und auf den nächsten Krach zwischen ihren Eltern warten, und darauf, dass sie irgendwann auseinandergingen. Dann würden sie sich um sie streiten wie die Jungen auf dem Schulhof um einen gefundenen Ball, so wie es auch die Eltern ihrer Schulfreundin Maria gemacht hatten.
»Sie sagen doch beide, dass sie mich lieb haben. Warum sind sie dann so böse aufeinander? Sie wissen doch, wie weh es mir tut!«, flüsterte sie unter Tränen.
Melanie dachte an die Mutter, die erst gestern wieder erwähnt hatte, dass sie sich bis jetzt nur wegen ihr nicht scheiden lassen wollte. Doch wenn es so weiterging wie jetzt, würde dieser Tag kommen. Ihre Mama und ihr Papa mussten doch auch einmal an etwas anderes denken als immer nur an ihren dummen Streit. Melanie erinnerte sich an die erste große Auseinandersetzung ihrer Eltern, die sie so geängstigt hatte, dass sie davongelaufen und bis tief in die Nacht weggeblieben war. Danach hatte für etliche Tage Ruhe zwischen den Eltern geherrscht und sie hatten sich beide bemüht, sie nicht wieder zu erschrecken. Was wäre, wenn sie erneut weglaufen und diesmal länger von daheim wegbleiben würde als nur ein paar Stunden? Vielleicht sorgten sich ihre Eltern so sehr um sie, dass sie ihren Streit darüber ganz vergaßen?
Melanie gefiel dieser Gedanke. Wenn ihre Eltern sie wirklich so lieb hatten, wie sie immer taten, dann musste sie ihnen doch mehr wert sein als diese Habergeiß Mira oder der Stowallner! Innerhalb weniger Sekunden kamen ihr alle möglichen Orte in den Sinn, wo sie sich verstecken konnte. Bei einer ihrer Freundinnen durfte sie auf keinen Fall bleiben. Deren Mütter würden allen ihren Bitten zum Trotz zu Hause anrufen. Blieb also nur der Wald. Doch dort würde man wohl als Erstes nach ihr suchen. Es war also kein guter Gedanke, dorthin zu gehen. Da dachte sie daran, dass ihr Schulfreund Rainer ihr erst vor wenigen Tagen unter dem Siegel der Verschwiegenheit von einer ganz geheimen Höhle am Rilserberg erzählt hatte. Die Grotte lag noch hinter Terglans Nachbarort Flaatz und war Rainers Worten zufolge nur ganz wenigen Leuten bekannt. Ihre Eltern und deren Freunde konnten ihrer Meinung nach unmöglich von ihr wissen.
Jetzt, wo die Idee erst einmal geboren war, war Melanie nicht mehr zu bremsen. Da heute Mittwoch war, der Tag, an dem ihre Mutter nicht im Laden einer Freundin in St. Johann aushalf, sondern daheim war, konnte sie nicht nach Hause. Die Mutter glaubte sie in der Schule und erwartete sie erst am Nachmittag zurück. Bis dahin konnte sie jedoch längst über alle Berge sein. Da Melanie ihren Schulranzen den weiten Weg nicht mitschleppen wollte, stellte sie ihn bei den Eltern ihrer Freundin Kati neben die Tür. Wenn Kati von der Schule kam, würde sie den Ranzen sehen und ihn zu ihr nach Hause bringen.
Als Melanie weiterging, hörte sie jemand im Garten des Nebenhauses arbeiten. Sie drückte sich rasch in den Schatten der Hausmauer und spähte vorsichtig um die Ecke. Frau Sulzeder zupfte gerade das Unkraut aus ihrem Salatbeet. Sie war in diese Tätigkeit so vertieft, dass sie das Mädchen nicht bemerkte. Melanie schlich leise und gebückt am Garten des Sulzederanwesens vorbei und erreichte kurze Zeit später die Straße nach Flaatz. Am nächsten Wegkreuz verließ sie diese wieder und schlug den Wanderpfad über den Kramsertobl ein. Dieser Weg führte zwar steil den Berg hoch, war aber mehr als die Hälfte kürzer als die Teerstraße. Melanie wusste, dass sie Flaatz auf diese Weise in weniger als anderthalb Stunden erreichen konnte.
Die Müdigkeit, die Melanie den ganzen Vormittag gefühlt hatte, war jetzt wie weggeblasen. Sie schlug von Anfang an ein recht strammes Tempo an und kam rasch voran. An der Stelle, wo der Weg den Grat überquerte und nach Flaatz hinunterführte, blieb sie kurz stehen und schaute zurück. Terglan lag bereits weit unter ihr. Seine Häuser sahen jetzt beinahe so klein aus wie die Häuschen von Rainers elektrischer Eisenbahn. Melanies Blick suchte unter den Gebäuden ihr Elternhaus, doch es war hinter der großen, gelb getünchten Kirche verborgen. Sie seufzte tief und ging langsam weiter. Jetzt merkte sie die Anstrengung und auch, dass sie am Morgen nicht gefrühstückt hatte. Mit zunehmendem Hunger fiel ihr auch ein, dass sie nichts zu essen mitgenommen hatte.
Melanie blieb an der Stelle, wo sie den nach Flaatz führenden Weg verlassen und erneut bergwärts abbiegen hätte müssen, stehen und schaute unschlüssig in den Ort hinab. Sie wusste, wenn sie Erfolg haben wollte, durfte sie nicht zu früh aufgeben. Rasch holte sie ihre Geldbörse hervor und schaute nach, was von ihrem Taschengeld noch übrig war. Gleich als Erstes fiel ihr der Schein in die Hand, den ihr der Vater vor Kurzem zugesteckt hatte. Es war ein Zehneuroschein und damit genug Geld, um ausreichend Lebensmittel einkaufen zu können. Da sie jedoch nicht noch einmal nach Terglan zurückwollte, beschloss Melanie, in Flaatz nach einem Lebensmittelgeschäft zu suchen.
Sie lief mit frischem Mut weiter und erreichte eine halbe Stunde später das Dorf. Schon von Weitem stach ihr die Leuchtschrift des Gemischtwarenladens Höllwein in die Augen. Erleichtert lief sie darauf zu und trat ein. Die Ladenglocke schellte überlaut, sodass sie vor Schreck zusammenzuckte. Doch sonst hatte sie Glück, denn außer ihr und dem Ladenbesitzer Wolfgang Höllwein befand sich niemand im Geschäft.
Höllwein, ein leicht korpulenter Mann um die vierzig mit beginnender Stirnglatze, sah von seiner Zeitung auf, in der er gelesen hatte, und schaute die Kleine neugierig an. »Ja grüß Gott, wer bist denn du? Dich kenn ich doch noch gar ned?« Obwohl er freundlich fragte, begnügte sich Melanie damit, seinen Gruß zu beantworten. Ohne auf seine Neugier einzugehen, suchte sie sich einige Sachen zusammen und stapelte sie auf dem Ladentisch.
»Bist du ned von Terglan drüben?«, fragte der Mann weiter.
Melanie verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin von St. Johann«, antwortete sie und deutete auf eine besonders lecker aussehende Wurst im Kühlregal.
»Ich hätt gern zweihundert Gramm von der Cervelat. Und dann noch drei Bananen und ein Liter Milch!« Melanie bestellte die Sachen so, wie sie ihr gerade einfielen. Höllwein schnitt die gewünschte Wurst auf und wog sie ebenso wie die Bananen ab. Dann packte er alles einschließlich der drei Tafeln Schokolade, die Melanie noch als Letztes kaufte, in einen festen Beutel und reichte es Melanie hinüber.
»So, von St. Johann bist du? Da bist du aber ein schönes Stück von daheim fort«, meinte er, während er die Summe zusammenrechnete.
»Ich mach mit dem Papa eine Wanderung. Er hat mich geschickt, damit ich ein bisserl Proviant hol’«, log Melanie und hoffte dadurch Höllweins Neugier zu stillen. Dies schien auch der Fall zu sein, denn der Mann nickte nur still vor sich hin und nahm ihren Zehneuroschein entgegen. Während er umständlich das Wechselgeld herausgab, benetzte er mit der Zunge die Lippen und sah Melanie mit schräg gehaltenem Kopf an. Der Blick seiner Augen gefiel dem Mädchen nicht, und so raffte es seinen Einkauf an sich und wollte das Geschäft verlassen.
Doch da griff Höllwein mit der Hand in eines der großen Bonbongläser, die auf der Anrichte standen, holte ein gutes Dutzend der süßen Leckereien heraus und kam hinter seiner Ladentheke hervor.
»Komm Dirndl, da hast du ein paar Guatln!« Ohne Melanies Antwort abzuwarten, stopfte er die Bonbons in ihre Einkaufstüte und strich ihr mit den durch die Süßigkeiten klebrig gewordenen Fingern über den Kopf. Die Berührung war Melanie so unangenehm, dass sie ihm am liebsten die geschenkten Bonbons wieder zurückgegeben hätte. So aber drehte sie auf dem Fuß um und verließ ohne Gruß den Laden.
Am Dorfende drehte sie sich aus einem seltsamen Gefühl heraus um und sah den Weg zurück. Höllwein stand vor seinem Geschäft und hielt seine Hand über die Augen, um nicht von der Sonne geblendet zu werden. Er starrte unverwandt hinter ihr her und kehrte erst in seinen Laden zurück, als eine andere Kundin erschien. Melanie war darüber mehr als erleichtert und lief flink wie ein Reh davon.
* * *
»Du, Arnold, hast du ned die Mela gesehen?«
Es waren die ersten Worte, die Renate Gruber an diesem Tag mit ihrem Ehemann sprach. Da jedoch die Uhr bereits auf sieben Uhr abends zeigte, wurde sie unruhig. So lange wie heute war ihre Tochter selten ausgeblieben.
Arnold starrte zum Fenster hinaus und ließ sich nicht anmerken, ob er die Frage seiner Frau gehört hatte oder nicht. Für einen Augenblick glaubte Renate, er würde den Beleidigten spielen und schweigen. Doch da drehte er sich zu ihr um und sah sie verwundert an.
»Die Mela? Nein, die hab ich heut den ganzen Tag noch ned gesehen! Ist sie denn ned daheim?«, fragte er verwundert.
»Tät ich dich sonst nach ihr fragen?«, gab Renate gereizt zurück. »Jetzt schau ned wie eine Schwalbe, wenn’s blitzt, sondern sag etwas. Weißt du, ob sie vielleicht bei einer Freundin eingeladen war?«
»Nein, ich weiß nix. Aber ich hab ja auch den ganzen Tag hart gearbeitet und bin erst vor einer halben Stunde heimgekommen!«
»Spät genug, wenn man bedenkt, dass du nur fünfhundert Meter Heimweg hast!«
»Ich hab mich nach Feierabend noch ein bisserl mit dem Walter unterhalten. Wir überlegen uns, ob wir ned zum nächsten Heimspiel des FC Tirol nach Innsbruck fahren sollen.«
»Um das auszumachen, habt ihr anderthalb Stunden gebraucht?« In Renates Stimme fehlte diesmal der Spott, mit dem sie in den letzten Wochen die Rechtfertigungen ihres Mannes gegeißelt hatte. Sie ging auch nicht weiter auf das Thema ein, sondern verließ das Zimmer und durchsuchte das ganze Haus. Doch schon nach kurzer Zeit kehrte sie ganz nervös zu ihrem Mann zurück.
»Ich glaub, die Mela ist nach der Schul gar ned heimgekommen. Zumindest hat sie den Apfelstrudel im Bratrohr ned angerührt!«
»Jetzt mach dich ned verrückt, Renate. Die Mela wird schon auftauchen. Wahrscheinlich ist sie zu einem Kindergeburtstag oder sonst einem Fest mitgegangen«, versuchte Arnold seine Frau zu beruhigen.
»Dann hätt sie gewiss angerufen. Ich war doch bis auf die zwei Stunden am Nachmittag, in denen ich eingekauft hab, den ganzen Tag daheim!« Renate hatte diese Worte kaum ausgesprochen, als die Türklingel schellte.
»Das wird sie sein!«, rief sie erleichtert und eilte zur Tür. Doch als sie öffnete, stand nicht Melanie, sondern deren Klassenkameradin Kati davor.
»Grüß Gott, Frau Gruber. Ich bring bloß den Schulranzen von der Melanie vorbei. Sie hat ihn bei uns neben die Tür gestellt. Er ist ihr auf dem Heimweg von der Schul wohl zu schwer geworden, weil sie doch krank ist! Wie geht’s ihr denn jetzt?«
»Krank?«, rief Renate mit sich überschlagender Stimme.
»Hat die Melanie denn nix gesagt? Frau Staßny hat sie doch heut Vormittag nach der ersten Stund heimgeschickt, weil es ihr ned gut gegangenen ist!«
»Arnold!« Der Ruf hätte einen Toten erweckt. Melanies Vater warf seine Zeitung beiseite und sprang wie elektrisiert auf.
»Ist mit der Mela etwas passiert?«, rief er in den Flur.
»Frau Staßny hat die Mela schon heut Vormittag von der Schul heimgeschickt, weil sie krank sein soll«, flüsterte Renate mit blutleeren Lippen.
»Dann hättest du sie doch sehen müssen! Du hast doch gesagt, dass du erst am Nachmittag zum Einkaufen gegangen bist, oder ned?«, fragte Arnold mit erwachendem Misstrauen. Renate bemerkte den forschenden Unterton in seiner Stimme jedoch nicht. Sie wandte sich wieder an Kati und fragte sie über das Geschehen in der Schule aus. Das Mädchen wiederholte das, was sie schon gesagt hatte und sah dann Renate fragend an.
»Ist die Melanie denn noch ned heimgekommen?«
Renate schüttelte den Kopf. »Nein, dabei bin ich bis um ein Uhr im Haus gewesen. Ich hätt die Mela sehen müssen, wenn sie gekommen wär’!«
»Vielleicht war sie bloß kurz da und ist gleich wieder fort?«, vermutete Arnold. Renate schüttelte heftig den Kopf.
»Gewiss ned. Ich hätt sie doch gehört, wenn sie die Haustür aufgemacht hätt. Außerdem ist es ned ihre Art, ohne ein Wort wieder zu verschwinden.«