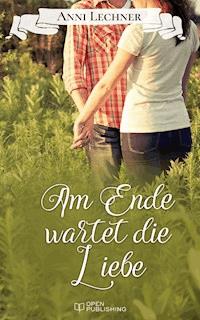3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Erich Fromm
- Sprache: Deutsch
Als sein Bruder stirbt, muss sich Thomas Buchenrieder plötzlich um dessen minderjährige Tochter Feli kümmern, damit sie nicht ins Kinderheim muss. Die Großmutter mütterlicherseits will nicht für das Kind sorgen und Angela, die Schwester der Mutter, hält sich im Ausland auf. Buchenrieders Entscheidung, das Kind aufzunehmen, stößt bei ihm auf dem Hof auf wenig Verständnis, besonders die Haushälterin macht Feli das Leben schwer. Unvermutet kehrt dann auch noch Angela in die Heimat zurück und will sich um das Mädchen kümmern. Doch Buchenrieder hat Feli ins Herz geschlossen und will sich nicht von seiner Nichte trennen. Gelingt es Buchenrieder und Angela sich zu einigen und Feli eine glückliche Zukunft zu schenken? Dieser und die zwei weiteren spannenden Romane „Die arme Lügnerin“ und „Du bist wunderschön“ sind in diesem Buch enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anni Lechner
Du gehörst zu mir
Die arme Lügnerin
Du bist wunderschön
Anni Lechner: Band 22, Du gehörst zu mir ... und zwei weitere spannende Romane
Copyright © by Anni Lechner
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Überarbeitete Neuausgabe © 2017 by Open Publishing Verlag
Covergestaltung: Open Publishing GmbH – Mathias Beeh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
eBook-Produktion: Datagroup int. SRL, Timisoara
ISBN 978-3-95912-231-3
Du gehörst zu mir
Während die übrigen Trauergäste sich in zwei streng voneinander abgegrenzten Gruppen um den jeweiligen Elternteil seiner Schwägerin scharten, stand Thomas Buchenrieder allein vor dem offenen Grab. In seinem dunklen Trachtenanzug und dem schwarzen Hut, den er in der Hand hielt, schienen die anderen ihn für einen Exoten zu halten. Er fühlte sich allerdings auch so, seit er gestern hier aus dem Auto gestiegen war. Die Landschaft sah anders aus als daheim, flach und mit einem schier endlos weiten Horizont. Auch der Ort, in dem er sich befand, unterschied sich mit seinen dunklen Klinkerbauten von Miesbach, Rosenheim und den übrigen Städten, die er kannte. Bei einem Bild hätte er auf Holland getippt. So abwegig war der Gedanke auch nicht, denn von hier bis ins Tulpenparadies war es näher als von seinem Hof nach Tirol.
Ausgerechnet in diese Gegend hatte es Alois verschlagen. Bei dem Gedanken an seinen älteren Bruder kamen Thomas die Tränen. Gleichzeitig dankte er Gott, dass die Eltern dies nicht mehr hatten erleben müssen. Für sie war Alois etwas Besonderes gewesen und sie hatten ihn sogar studieren lassen, wie der Dorfpfarrer es ihnen geraten hatte. Ein Priester, wie von ihnen erhofft, war Alois allerdings nicht geworden, sondern ein Chemiker.
Thomas dachte daran, wie oft seine Mutter gebangt hatte, es könne in dem großen Werk, in dem sein Bruder arbeitete, ein Unglück passieren und ihm etwas geschehen. Doch es war ein simpler Verkehrsunfall gewesen, der Alois und dessen junge Frau Beatrix hinweggerafft hatten.
Als der evangelische Pfarrer seine Trauerrede begann, stieg in Thomas Ärger auf, denn man hätte wirklich einen katholischen Priester mit hinzuziehen können. Sein Blick suchte die Eltern seiner Schwägerin. Schon vor Jahren geschieden, brachte nicht einmal die Trauer um ihre Tochter sie dazu, sich auch nur einmal anzusehen. Die Mutter, eine noch recht hübsche Frau in einem langen schwarzen Kleid tupfte sich einige Tränen von den Augen. Der Vater hingegen wirkte mürrisch und sah betont auf die Uhr. Siegfried Bouvier war ein erfolgreicher Geschäftsmann, dessen zweite Ehefrau vom Alter her seine Tochter hätte sein können. Sie trugen beide kein Schwarz, sondern wirkten in dem hellgrauen Nadelstreifenanzug und dem malvenfarbenen Kostüm wie Farbkleckse im düsteren Schwarz der übrigen Trauergäste. Die Gruppe, die sich um sie geschart hatte, war um einiges kleiner als die Verwandtschaft der Mutter, und sie wirkte auch nicht besonders betroffen.
Thomas gab es auf, über die Lebensgewohnheiten dieser Leute nachzusinnen. Er war hier, um seinen Bruder und seine Schwägerin zu betrauern. Fast im selben Augenblick wurde der Pfarrer fertig. Er reichte zunächst Beatrix‘ Mutter die Hand, dann Siegfried Bouvier und kam zuletzt zu Thomas.
»Mein Beileid, Herr Buchenrieder. Ich habe ihren Bruder und ihre Schwägerin sehr geschätzt. Nehmen Sie es als Gottes Wille, dass die beiden von uns gegangen sind.« Dasselbe hatte er wahrscheinlich schon hundert Mal gesagt, doch Thomas fühlte, dass es ihm ernst damit war.
»Danke, Hochwürden«, antwortete er.
»Pastor reicht.« Der Pfarrer drückte ihm noch einmal die Hand und kehrte dann in die Kirche zurück. Für einige Augenblicke herrschte angespanntes Schweigen. Thomas erwartete, dass die Eltern der toten Beatrix ihren Streit wenigstens für den Moment vergessen würden. Siegfried Bouvier blickte jedoch erneut auf seine Armbanduhr und nickte dann seiner jungen Frau und seinen Begleitern zu.
»Ich glaube, wir können jetzt gehen. Wir haben genug Zeit vergeudet.«
Für Thomas war es wie ein Schlag ins Gesicht und er hätte dem Mann am liebsten die Meinung gesagt. Da er aber am offenen Grab seines Bruders nicht laut werden wollte, ging er auf Laura Bouvier zu und streckte ihr die Hand hin.
»Ach, Sie sind Alois‘ Bruder.« Es klang nicht gerade begeistert. Thomas fragte sich schon, ob er nicht den Kirchhof verlassen und für sich allein trauern sollte. Da sah er das kleine Mädchen, das seltsam verloren zwischen den Erwachsenen stand. Niemand schien sich so recht dafür zu interessieren. Durch den Streit wegen seiner evangelischen Heirat, gegen die sich seine Eltern mit aller Macht gesträubt hatten, war Alois nur noch selten auf den Buchenrieder-Hof gekommen. Daher hatte Thomas seine Schwägerin und seine Nichte höchstens zwei- oder dreimal gesehen. Seit dem letzten Mal war Felicitas ein ganzes Stück gewachsen. Er versuchte sich zu erinnern, wie alt sie jetzt sein musste, etwa sieben oder acht Jahre?
Thomas versuchte ein Lächeln und sprach das Kind an. »Grüß dich, Feli. Ich wär der Thomas. Kennst du mich noch?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. Seine Großmutter blickte jetzt auch auf die Uhr.
»Ich habe im Café Horten einen Tisch bestellt. Sie sind auch eingeladen, Herr Buchenrieder.« Sie sagte es in einem Ton, als hielte sie ihn nicht für fähig, mit Messer und Gabel essen zu können. Um des lieben Friedens willen schluckte er seinen Unmut hinunter und folgte der Gruppe. Während Laura Bouvier mit einigen Bekannten voraneilte, fand Thomas sich an der Seite der kleinen Felicitas wieder.
Auch im Café blieben Thomas und Felicitas zusammen. Es sah fast so aus, als hätte Laura Bouvier ihre Enkelin vergessen. Sie taute im Kreis ihrer Vertrauten rasch auf und bezog alle bis auf Thomas und das Kind in ihre lebhafte Unterhaltung mit ein. Thomas überlegte sich, nach dem Essen aufzubrechen. Immerhin hatte er fast achthundert Kilometer vor sich. Da klopfte plötzlich eine ältere Frau nervös gegen ihr Glas.
»Und was wird jetzt mit Felicitas, Frau Bouvier?«
Die Großmutter des Mädchens hob verwundert den Kopf. »Was soll mit ihr sein?«
»Nach Beatrix‘ und Alois‘ Tod habe ich mich darum gekümmert. Aber für länger geht das nicht. Sie werden die Kleine jetzt selbst nehmen müssen.« Die Frau sprach den Namen wie Alohies aus. In einem anderen Fall hätte sich Thomas darüber amüsiert, doch jetzt war keine Zeit dazu. Laura Bouvier schüttelte nämlich energisch den Kopf.
»Das geht auf keinen Fall. Ich kann mich nicht um das Kind kümmern. Das soll mein Exmann tun. Der hat doch eine junge Frau, die nichts anderes zu tun hat.«
Die Frau, die sie angesprochen hatte, spürte, dass sie Felicitas auf Dauer am Hals haben würde, wenn sie jetzt nachgab. »Einer muss das Kind nehmen und zwar noch heute. Ich fliege nächste Woche nach Mallorca und kann Felicitas wohl kaum allein zurücklassen.«
»Das hätten Sie sich auch früher überlegen können, Frau Rinkel«, sagte die Großmutter.
»Als ich meinen Flug gebucht habe, war Ihre Tochter noch am Leben«, konterte Frau Rinkel, die langjährige Zugehfrau von Thomas‘ Schwägerin.
»Dann nehmen Sie das Kind doch mit. Ihm tut es sicher gut, mal etwas anderes zu sehen.« Laura Bouvier wischte den Einwand kurzerhand vom Tisch und wandte Frau Rinkel den Rücken zu.
»Nichts werde ich! Ich habe mich die letzten Tage um das Kind gekümmert, weil keiner seiner Verwandten dazu in der Lage war, doch damit ist jetzt Schluss. Auf Wiedersehen!« Die Zugehfrau packte ihre Handtasche und rauschte zur Tür hinaus.
»Ungutes Stück. Wenn ich daran denke, was die bei meiner Tochter alles eingesteckt hat!« Laura Bouvier sandte ihr einen zornigen Blick nach und wandte sich dann einer ältlichen Verwandten zu.
»Dann wirst du eben Felicitas zu dir nehmen, Louise.«
Die Angesprochene riss entsetzt die Arme hoch. »Nein, das halten meine Nerven nicht aus.« Da Laura Bouvier nicht nachgeben wollte, sprang auch diese Frau auf und verließ fluchtartig das Café.
Die Großmutter versuchte das Kind dem Nächsten anzudrehen und die bislang recht gemütliche Runde geriet zusehends in Streit.
»Kann denn nicht Angela das Kind nehmen. Immerhin ist sie Felicitas‘ Tante. Wo ist sie eigentlich. Ich habe sie heute vermisst«, warf schließlich eine Frau ein.
Thomas erinnerte sich erst jetzt wieder an die Schwägerin seines Bruders. Er hatte Angela Bouvier nie kennengelernt, doch nach Alois Worten musste sie ein schrilles Ding sein und gewiss niemand, der ein Kind aufziehen konnte.
»Angela befindet sich derzeit in Kanada bei irgendwelchen Indianerstämmen, um sich dort inspirieren zu lassen. Ich habe versucht, sie über ihr Handy zu erreichen, doch es kam keine Verbindung zustande. Außerdem kann sie sich als Künstlerin nicht auch noch um ein Kind kümmern.« Für den Augenblick war Felicitas vergessen und Laura Bouvier berichtete stolz von Angelas Erfolgen als Bildhauerin. Thomas interessierte sich nicht dafür, sondern widmete sich der Kleinen. Felicitas saß mit bleichem Gesicht neben ihm. Tränen liefen ihr lautlos über die Wangen und er fragte sich, wie Erwachsene so grausam sein konnten, über das Kind zu reden als wäre es ein Gegenstand, der einem im Wege war. Mit einem Ruck erhob er sich und funkelte die Großmutter des Mädchens zornig an.
»Diese Ausstellung in Hamburg, von der Sie erzählen, ist ja schön und gut. Aber jetzt geht’s um was Wichtigeres, nämlich um ihr Enkerl. Anscheinend will keiner von euch die Feli haben.« Ein verächtlicher Zug huschte über Thomas Gesicht, als die anderen die Köpfe schüttelten. Er schluckte einige harte Worte hinunter, die über seine Lippen wollten, und legte seine Hand auf die zuckende Schulter der Kleinen.
»Der Alois war mein Bruder und ich tät mich zu Tod schämen, wenn ich seine Tochter jetzt im Stich lassen tät. Ich nehm die Feli zu mir. Das mit den Behörden können wir später machen.«
Laura Bouvier starrte ihn zuerst indigniert an, dann aber glättete sich ihre Miene und sie streckte ihm die Hand hin. »Sie sind genau wie ihr Bruder, Herr Buchenrieder. Sie helfen auch immer, wenn Not am Mann ist.« Es hörte sich so an, als hätte sie ihren Schwiegersohn wegen seiner Hilfsbereitschaft öfter verspottet. Thomas nahm es mit einem Achselzucken zur Kenntnis. Ihn verband nichts mit dieser Bouvier-Verwandtschaft. Das Einzige, was für ihn zählte, war Feli.
»Wir sollten trotzdem eine Aktennotiz machen und als Zeugen unterschreiben, dass Alois‘ Bruder sich in Zukunft um die Kleine kümmert.« Einer von Lauras Verwandten öffnete seine Aktentasche und zog ein Blatt Papier mit einem amtlichen Briefkopf hervor. Während er eine in Thomas‘ Augen unsinnig komplizierte Klausel aufschrieb, wandten einige der Frauen jetzt ihre Aufmerksamkeit Feli zu und erklärten ihr, dass es das Beste für sie sei, bei Onkel Thomas im schönen Bayern zu leben.
Laura Bouvier schien sich jetzt doch ein wenig zu genieren, denn sie holte ihre Geldbörse heraus und reichte Thomas ein dickes Bündel Scheine. »Wir werden zwar noch Felicitas‘ Sachen aus der Wohnung meiner verstorbenen Tochter holen, doch sie werden sicher auch einiges besorgen müssen.«
Am liebsten hätte Thomas ihr das Geld vor die Füße geworfen. Er sagte sich aber, dass er es für Feli auf ein Sparbuch tun konnte, und steckte es ein. »Dank schön, Frau Bouvier. Wir werden’s brauchen können. Ned wahr, Feli?«
Die Kleine machte ein Gesicht, als wäre sie eben auf dem Sklavenmarkt verkauft worden.
*
Die Fahrt nach Hause verlief vom Verkehr her gesehen besser als gedacht. Es gelang Thomas allerdings jedoch nicht, Feli mehr als drei Worte zu entlocken. Sie saß angeschnallt auf dem Rücksitz und blickte die ganze Zeit starr vor sich hin. Zunächst hatte sie auch den Teddybären, den ihre Großmutter neben sie hingelegt hatte, nicht beachtet, doch nach einer Weile nahm sie ihn dann doch und klammerte sich so fest an ihn, als wäre er ihr einziger Halt im Leben.
Zuletzt wurde Thomas die Stille zu unheimlich. Da er sich sagte, dass die Kleine gewiss Hunger und Durst haben würde, fuhr er beim nächsten Rasthof von der Autobahn ab und hielt an. »Komm, jetzt wollen wir mal ein bisserl was für uns tun.«
Das Mädchen sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an und zuckte dann mit den Schultern. »Ich muss zur Toilette.«
»Dann komm.« Thomas führte sie in das Gebäude und wartete, während sie in der Damentoilette verschwand. Die Zeit verging und Feli kam nicht zurück. Da er nicht selbst eintreten wollte, überlegte er schon, ob er nicht eine der Frauen, die durch die Tür hasteten, bitten sollte, nach dem Kind zu schauen. Doch die Erste, die er ansprach, warf ihm nur einen indignierten Blick zu. Bevor er einen weiteren Versuch unternehmen konnte, schwang die Tür auf und Feli trat heraus.
»Puh, das hat aber ein wengerl gedauert.« Thomas atmete erleichtert auf und ging dann mit dem Kind nach oben. »Wir wollen ein bisserl was essen, meinst du ned?«
Er erhielt wieder ein Achselzucken zur Antwort. Auch am Tisch wurde Feli nicht gesprächiger. »Was magst du denn essen?«, fragte Thomas.
»Irgendwas«, klang es gleichgültig zurück.
»Aber du musst doch was lieber mögen als was anderes.
»Mir egal.«
Thomas seufzte. Anscheinend war die Sache nicht so einfach, wie er es sich gedacht hatte. Er verstand die Kleine jedoch. Immerhin hatte sie ihre Eltern verloren und fuhr nun mit einem ihr unbekannten Onkel in die Fremde. Unwillkürlich ärgerte er sich über die Großmutter, die ihre Verantwortung für das Kind auf eine so leichtfertige Art abgeschoben hatte. Da Feli von sich aus nichts wählte, bestellte er auf gut Glück etwas für sie. Feli rührte jedoch weder das Getränk noch das Schnitzel an, sondern stocherte nur auf ihren Teller herum.
»Hast du denn keinen Hunger?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nö!«
»Der wird schon wieder kommen. Jetzt schau zu, ob du noch ein bisserl was essen kannst, dann fahren wir weiter.« Thomas hatte es kaum gesagt, als die Kleine schon aufstand. Leicht genervt beendete er seine Mahlzeit, bezahlte und verließ mit dem Kind die Raststätte. Auf dem Weg zum Auto betrachtete er Feli mit einem besorgten Blick. Die Kleine sah blass aus. Er hoffte, dass sich dies in seiner Heimat bald geben würde. Sie war acht Jahre alt und besaß hellblondes Haar und blaue Augen, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Eigentlich war es ein hübsches Kind, das gewiss nur wegen des Unglücks, das es betroffen hatte, so bedrückt aussah.
»Es wird schon wieder werden!« Thomas nickte ihr lächelnd zu, öffnete ihr die Tür und achtete darauf, dass sie sich anschnallte. Als er weiterfuhr, dämmerte im Osten bereits die Nacht herauf. Im Auto blieb alles still, und als er sich einmal kurz nach Feli umblickte, sah er, dass sie eingeschlafen war. Ihr Mund zuckte jedoch und über ihre Wangen liefen Tränen.
*
Bei ihrer Ankunft auf dem Buchenrieder-Hof war es kurz vor Mitternacht. Der Knecht und die Stallmagd schliefen längst. Nur die Haushälterin Magda war noch auf und saß im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Sie war so in die laufende Sendung vertieft, dass sie Thomas‘ Ankunft gar nicht bemerkte. Erst als er mit Feli an der Hand ins Zimmer traf, schreckte sie hoch.
»Ach du bist es, Bauer. Ich hab denkt, du kommst erst morgen.« Dann entdeckte sie das Kind und riss die Augen auf.
»Das ist die Feli. Die bleibt ab jetzt bei uns«, erklärte ihr Thomas.
Magda schluckte sichtlich. »Ja was ned alles noch! Was wollen wir denn mit einem Kind?«
»Es ist die Tochter vom Alois und ich lass ned zu, dass sie in ein Heim kommt!« Es war zwar nicht direkt die Rede davon gewesen, Feli dort unterzubringen, doch Thomas traute es ihrer Großmutter zu.
»Richt ein Zimmer für die Feli her. Ich hol inzwischen ihre Sachen herein.« Thomas glaubte, alles damit gesagt zu haben. Seine Wirtschafterin zog ein schiefes Gesicht, weil sie die Sendung nicht weitersehen konnte und beäugte Feli, als wäre sie ein aufdringliches Huhn, das sich in ihre Küche verirrt hatte.
»Ich frag mich ja bloß, was die Marion dazu sagen wird.«
An seine Verlobte hatte Thomas während der ganzen Fahrt nicht gedacht. Jetzt wischte er den Einwand der Wirtschafterin mit einer knappen Handbewegung vom Tisch. »Die Marion wird das schon verstehen. Die Feli ist ja schließlich kein fremdes Kind, sondern gehört zur Familie.«
»Na ja, wenn du meinst. Komm mit!« Das Letzte klang so barsch, dass Thomas sich mahnend räusperte. Magda war seit mehr als zwanzig Jahren auf dem Hof, zunächst als Magd und seit dem Tod seiner Mutter als Haushälterin, und nahm sich daher das Recht heraus, ihn auch einmal zu kritisieren. Sollte sie es jedoch mit der Kleinen zu arg treiben, würde er sie in ihre Schranken verweisen. Er lächelte Feli zu und wies zur Tür.
»Geh ruhig mit der Magda. Sie wird dir alles zeigen, was du für die Nacht brauchst.«
Feli schob die Lippen nach vorn, folgte dann aber Magda in den Flur. Thomas schnaufte tief durch. So wie es aussah, würde es seine Zeit dauern, bis die Kleine sich hier eingewöhnt hatte. Am besten sprach er gleich morgen früh an der Milchsammelstelle mit Marion, damit sie sich um Feli kümmern konnte. Vielleicht sollten sie die für den Herbst geplante Hochzeit um ein oder zwei Monate noch vorn verlegen, damit seine Nichte bald eine Ersatzmutter bekam.
*
Angela Bouvier schritt noch einmal um den mehr als fünf Meter hohen Totempfahl herum, bei dessen Herstellung sie hatte mithelfen dürfen, und war mit sich und ihrer Arbeit zufrieden. Die Adler-, Bären- und Wolfsgestalten, die der alte Tlingit-Indianer John Greyeagle und sie geschaffen hatten, sahen einfach gut aus.
»Danke, John. Ich werde einiges von hier mit nach Hause nehmen. Wenn ich mein nächstes Werk beginne, werde ich es mit einem Gedanken an dich und die schöne Zeit hier tun.« Ihr Blick flog dabei noch einmal über die uralten Bäume, die sich an dieser Stelle bis fast an die Küste erstreckten, und auf das in der Abendstimmung rötlich schimmernde Meer.
Der alte Mann nickte ihr lächelnd zu. »Du besitzt die Gabe, den Geist des Holzes zu verstehen, weiße Frau. Doch du darfst darüber nicht das Wesen der Menschen vergessen.«
Der Ausspruch irritierte Angela. »Habe ich dich oder deine Freunde vielleicht gekränkt, weil du so etwas sagst?«
»Nein, das hast du nicht. Ich spüre jedoch, dass dir die Menschen weniger bedeuten als deine Kunst und das ist nicht gut.«
Obwohl Angela mit dem alten Tlingit ausgezeichnet zurechtgekommen war, schüttelte sie leicht den Kopf. Irgendwie erschien ihr Greyeagles Glaube an spirituelle Dinge übertrieben. Da sie ihren letzten Abend hier jedoch nicht mit unnützen Diskussionen verbringen wollte, ging sie nicht darauf ein. Stattdessen lobte sie noch einmal ihre Zusammenarbeit und versprach ihm, in ihrer Heimat ein Werk wie diesen Totempfahl zu schnitzen.
Der alte Indianer sah sie lächelnd an. »Du suchst in der Ferne, was du in der Heimat finden solltest, weiße Frau. Mein Herz sagt mir, dass deine Augen es bald sehen werden. Doch ob du es erkennen willst, musst du selbst entscheiden.«
Angela gab nichts darauf, sondern warf ihrem gemeinsamen Werk einen letzten Blick zu und reichte dem Tlingit die Hand.
»Noch einmal Dankeschön, John, dass du mich das miterleben hast lassen. Es war einfach grandios.«
»Es hat mich gefreut, zu sehen, wie deine Hände die Seele des Holzes erfasst haben, Angela, und ich wünsche dir Glück.«
»Das wünsche ich dir auch, John.« Erst als sie mit einem letzten Winken in ihren Wagen gestiegen und losgefahren war, kam es Angela in den Sinn, dass er sie eben zum ersten Mal mit ihrem Vornamen angeredet hatte. Sonst war sie für ihn immer die weiße Frau gewesen.
*
Bei ihrer Rückkehr ins Hotel wurde Angela von einer aufgeregten Angestellten abgefangen. »Gut, dass sie kommen, Miss Bouvier. Sie hatten ihr Handy im Zimmer gelassen. Das Zimmermädchen sagt, es hätte die beiden letzten Tage die ganze Zeit geklingelt. Zuletzt hat sie einen Anruf angenommen. Ihre Mutter war am Apparat. Es muss irgendetwas Entsetzliches geschehen sein.«
Angela zuckte zusammen. Wenn ihre Mutter sie anrief, musste wirklich die Welt zusammenbrechen. »Danke«, sagte sie und hastete in ihr Zimmer hoch. Während der Arbeit an dem Totempfahl war sie nicht ins Hotel zurückgefahren, sondern als Gast bei John Greyeagle geblieben. Jetzt fragte sie sich, ob dies nicht ein Fehler gewesen war.
Ihr Zimmer wirkte aufgeräumt, nur das Handy lag auf dem Bett. Angela ergriff es und wählte die Nummer ihrer Mutter an.
»Hier, Laura Bouvier!« Die Mutter hörte sich so normal an, sodass Angela sich fragte, ob es nicht doch ein Sturm im Wasserglas gewesen war.
»Ich bin’s, Angela! Ich hatte die letzten Tage mein Handy nicht bei mir und habe eben erfahren, dass du mich sprechen wolltest.
»Zu was besitzt man denn ein Handy, wenn man es nicht bei sich hat?«, sagte die Mutter. »Also Angela, manchmal frage ich mich wirklich, ob du etwas anderes als Holz im Kopf hast.«
»Danke«, wandte Angela sarkastisch ein.
»Es ist doch wahr. Da bist du drüben in Kanada, und wenn man dich mal anrufen will, hast du dein Handy nicht bei dir. Mir passiert so etwas nie.«
»Ich weiß, Mutter! Du bist einfach perfekt.« Angela begann sich zu ärgern. Da hatte sie fragen wollen, was los war, und wurde in einer Tour gescholten und belehrt. Mit einem kurzen Auflachen dachte sie, dass dies eigentlich die Quintessenz ihres Lebens war. Egal, was immer sie auch angefangen hatte, ihrer Mutter hatte es nicht gepasst. Das hatte diese aber nicht daran gehindert, sich später mit den Erfolgen ihrer Tochter großzutun.
»Jetzt sag schon, warum du angerufen hast. Du hast es ja sicher nicht getan, um nachzuprüfen, ob ich mein Handy bei mir habe.«
»Ach ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Beatrix und ihr Bayer sind vor vier Tagen verunglückt.«
Angela glaubte, ihr Herz würde stehen bleiben. »Mein Gott, ist es schlimm?«
»Wir haben die beiden heute Morgen beerdigt.«
»Nein!« Angela hatte ihre ältere Schwester heiß und innig geliebt und schrie ihren Schmerz mit diesem einen Wort hinaus. Jetzt verfluchte sie ihre Gedankenlosigkeit mit dem Handy. Während sie mit John Greyeagle den Totempfahl geschnitzt hatte, war Beatrix gestorben und beerdigt worden. Ihr kamen die Tränen und es dauerte eine ganze Weile, bis sie wieder einen Gedanken fassen konnte.
»Angela, bist du noch dran?« Die Mutter wurde ungeduldig.
»Ja! Mein Gott, ist das entsetzlich! Und ausgerechnet da bin ich nicht zu erreichen. Die arme Feli. Wie muss sie sich fühlen. Drücke sie in meinem Namen ganz herzlich und gib ihr einen Kuss von mir.«
Diesmal dauerte es einige Augenblicke, bis Laura Bouvier antwortete. »Um Feli musst du dir keine Sorgen machen. Die ist gut untergebracht. Beatrix‘ Schwager hat sich bereit erklärt, sie bei sich aufzunehmen.«
»Was?« Angelas Schrei war laut genug, um im ganzen Hotel gehört zu werden. »Mutter, du willst doch nicht etwa sagen, dass du dein eigenes Enkelkind abgeschoben hast wie einen nicht stubenreinen Hund?«
»Welch ein Vergleich. Dieser ... äh Thomas Buchenrieder ist zu Feli ebenso eng verwandt wie du und du hättest das Kind eh nicht an dich nehmen können.«
»Und ob ich das getan hätte! Und ich werde es auch tun. Feli ist das Vermächtnis meiner Schwester. Dir mag sie ja nichts bedeuten, aber für mich ...« Angela brach in einen Tränenstrom aus und konnte nicht mehr weitersprechen. Ihre Mutter erklärte ihr beleidigt, dass ihr die Enkelin gewiss etwas bedeuten würde. Nur könne sie die Verantwortung für ein kleines Kind nicht auf sich nehmen.
»Ich hatte ja erwartet, dass mein Ex sich um Feli kümmern würde. Er hat ja schließlich eine junge Frau, die Zeit für ein Kind hätte. Aber dieser Kerl hat ja nicht einmal das Ende der Trauerzeremonie abgewartet, da ist er schon wieder abgerauscht.« Laura Bouvier erging sich nun in etlichen Ergüssen über ihren geschiedenen Ehemann, dessen zweite Ehefrau und beider Verhalten. Angela hörte nur mit einem halben Ohr hin. Mit ihren Eltern hatten Beatrix und sie wirklich keinen Glücksgriff getan, dachte sie bedrückt. Sie schüttelte den Gedanken jedoch sofort wieder ab. Hier ging es nicht um die Vergangenheit, sondern um ihre Nichte, die ihre Mutter der Bequemlichkeit halber einem wildfremden Menschen übergeben hatte.
»Ich hole Feli zurück!« Es klang wie ein Schwur. Die Mutter lachte jedoch nur darüber.
»Was willst du denn mit einem Kind? Du bist eine bekannte Künstlerin und darfst dir deine Karriere nicht dadurch kaputt machen lassen. Du hast eine Verantwortung ...«
»Ja, und zwar Feli gegenüber«, unterbrach Angela ihre Mutter zornig. »Bei Gott, das hätte ich nicht einmal von dir erwartet.« Mit diesen Worten unterbrach sie die Verbindung und warf sich weinend aufs Bett.
*
Das Frühstück am nächsten Morgen brachte für Hias und Gitta, die das restliche Gesinde des Buchenrieder-Hofes bildeten, eine gelinde Überraschung. Am Küchentisch stand ein fünfter Stuhl und es war auch für eine fünfte Person gedeckt. Hias, ein hagerer Mitfünfziger mit bereits gelichtetem Haar, deutete darauf.
»Was ist denn da los, Magda?«
»Da musst du schon den Bauern fragen«, klang es schnippisch zurück.
»Ui, Jeggerl, da muss wirklich was im Busch sein.« Die im Gegensatz zu Hias pummelig wirkende Gitta sah ihren Kollegen kopfschüttelnd an. Sie und Magda vertrugen sich gerade so, dass Thomas nicht eingreifen musste, um zu schlichten. Hinter seinem Rücken fochten sie jedoch einen erbitterten Privatkrieg aus. Hias hielt sich zwar meistens zurück, doch insgeheim galten seine Sympathien der fidelen Gitta.
»Der Bauer wird uns schon sagen, was gespielt wird.« Hias setzte sich hin und nahm eine Scheibe Schwarzbrot in die Hand.
»Du wirst wohl warten können, bis der Bauer da ist«, giftete Magda ihn an.
»Ungute Urschel«, murmelte Gitta.
»Was hast du gesagt?«, fragte Magda scharf.
Gitta machte jedoch nur eine wegwerfende Handbewegung und setzte sich neben Hias. »Wohl bekomm’s!«, sagte sie und angelte sich ebenfalls ein Stück Brot.
»Beim Essen wird alleweil noch gewartet, bis der Bauer da ist!« Die Wirtschafterin sah aus, als würde sie den beiden das Brot am liebsten aus den Händen reißen.
»Es ist drei Minuten nach sieben. Um sieben ist Frühstück, ob der Bauer da ist oder ned.« Ohne sich weiter um Magda zu kümmern, schenkte Hias zuerst Gitta und dann sich Kaffee ein und begann zu essen.
Magda stemmte die Fäuste in die Hüften, um ein Donnerwetter loszulassen. Da wurde die Tür geöffnet und Feli kam herein. Sie hatte noch ihren Schlafanzug an und war barfuß. Da sie während der Fahrt im Auto geschlafen hatte, war sie halbwegs ausgeruht.
Hias blieb beim Anblick des Kindes der Mund offen stehen. »Ja, wer ist denn das?«
»Da müsst du schon den Bauern fragen«, erklärte Magda spitz. Dann wandte sie sich an Feli. »Was sind denn das für Sitten. Kannst du dich ned richtig anziehen?«
»Doofe Kuh!« Feli hatte bereits in der Nacht ihr Urteil über die Wirtschafterin gefällt und es war vernichtend ausgefallen. Magda holte bereits mit der Hand aus, um ihr eine Ohrfeige zu geben, doch da klang Hias Stimme warnend auf.
»Das tät ich an deiner Stell lieber ned, sonst kommst du noch wegen Kindesmisshandlung in den Bau.«
Gitta sah, wie Feli mit ihren bloßen Füßen auf den kalten Steinplatten der Küche hin und her hüpfte. »Hast du keine Hausschuh ned, Mauserl?«
Als Feli den Kopf schüttelte, stand die Stallmagd auf und verließ die Küche. Als sie zurückkehrte, hielt sie ein Paar Pantoffel in der Hand, die zwar viel zu groß waren, aber als Notbehelf reichten. Sie zog Feli die Hausschuhe an und setzte sie dann auf den freien Stuhl.
»Der ist gewiss für dich, ned wahr?«
»Wahrscheinlich.«
Gitta schüttelte bei dieser einsilbigen Antwort den Kopf. »Gesprächig bist du ja grad ned.«
»Das wärst du wahrscheinlich auch ned, wenn am Vortag deine Eltern eingegraben worden wären.« Unbemerkt von den anderen war Thomas in die Küche gekommen und nickte Feli kurz zu, bevor er sich auf seinen Platz setzte.
»Warum seid ihr noch ned beim Essen?«, fragte er nach einem Blick auf die Uhr.
»Weil die gnädige Frau gesagt hat, gegessen wird erst, wenn der Bauer da ist.« Diese Spitze gegen Magda konnte Gitta sich nicht verkneifen.
»So ein Unsinn.« Thomas schüttelte den Kopf und musterte dann den gedeckten Tisch. »Wo ist denn der Tee für die Feli. Der Kaffee ist doch viel zu stark für sie.«
»Mir hat keiner gesagt, dass ich einen Tee kochen soll«, antwortete Magda patzig.
Thomas zog die Stirn kraus, denn er konnte sich durchaus daran erinnern, es der Wirtschafterin aufgetragen zu haben. »Dann weißt du es jetzt.« Er wollte schon mit dem Essen anfangen, als er sah, wie Magda sich setzte.
»Was ist jetzt mit dem Tee für das Dirndl? Ein drittes Mal sag ich’s dir fei ned!«
Gitta kicherte, als ihre Intimfeindin so abgekanzelt wurde und auch Hias verbarg sein Schmunzeln hinter der hohlen Hand. Magda hingegen sah aus, als würde sie am liebsten platzen. Sie kannte Thomas jedoch zu gut, um es auf einen Krach ankommen zu lassen. Daher stand sie mürrisch auf und hantierte am Herd, dass die Töpfe nur so schepperten.
»Das ist also dein Nichterl, Bauer.« Hias sah Feli dabei neugierig an. Obwohl er nicht unsympathisch wirkte, schob das Mädchen die Unterlippe vor. In ihr war alles Schmerz und eine trotzige Ablehnung gegen das Schicksal, das sie so stiefmütterlich behandelt hatte. Feli dachte an ihre Eltern, die jetzt im Himmel waren, und kämpfte mit den Tränen. Warum hatten sie sie so alleinlassen müssen? Jetzt befand sie sich unter fremden Leuten und kam sich vor wie Heidi, die von ihrer Tante als lästiges Anhängsel zum Alm-Öhi gebracht worden war. Wie ein Alm-Öhi sah Thomas allerdings nicht aus. Wenn sie es genau nahm, ähnelte er sogar ein wenig ihrem Papa. Doch die fremde Kleidung, die andere Haartracht und vor allem die Sprache unterschieden ihn sehr von ihrem Vater. Ihre Mama und Tante Angela waren auch unterschiedlich gewesen, aber trotzdem hatte man gespürt, dass sie zusammengehörten. Hier jedoch fühlte Feli sich, als hätte man sie am Nordpol ausgesetzt. Sie verstand kaum ein Wort von dem, was am Tisch gesprochen wurde, und begriff nur, dass es um sie ging.
»Und? Hast du mit der Marion schon gesprochen?« Magda lächelte hämisch, denn sie konnte sich nicht vorstellen, dass Thomas‘ Braut von diesem unerwarteten Familienzuwachs nicht begeistert sein würde.
Der junge Bauer schüttelte den Kopf. »Nein, heut hat ihr Vater die Milch zur Sammelstelle gebracht. Ich hab aber ned viel mit ihm reden können, weil der Grandinger was von mir wissen hat wollen.«
»Will er sich den Heuwender ausleihen? Er hat gestern was in der Richtung gesagt?«, wandte Hias ein.
Magda schüttelte sofort den Kopf. »Also, das geht ned. Wir brauchen den Wender selber, wenn wir rechtzeitig mit dem Heuen fertig werden wollen.«
»Wenn, wird das der Bauer selber entscheiden. Die Wiesen liegen nebeneinander und man darf ned vergessen, dass uns der Grandinger im letzten Jahr bei der Maisernte geholfen hat.« Hias hielt die gegenseitige Hilfe zwischen den Höfen hoch, auch wenn sie jetzt nicht mehr ganz so ausgeprägt war wie noch in seiner Jugendzeit.
Thomas nickte. »Du hast recht, Hias. Wir Bauern müssen zusammenhalten. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, stellst du den Wender so hin, dass der Grandinger ihn bloß anzuhängen braucht.«
Der junge Bauer erteilte noch ein paar Anweisungen für den Tag und sah dann erst, wie Feli auf ihrem Teller herumstocherte.
»Heut müsstest du doch Hunger haben. Schmeckt’s dir ned?«
Feli war von zu Hause ein anderes Frühstück gewöhnt als Schwarzbrot mit Butter, Wurst und Käse, daher schüttelte sie den Kopf. »Ich will mein Müsli haben.«
Damit kam sie bei Magda allerdings schlecht an. »Wir sind kein Hotel. Bei uns wird gegessen, was auf den Tisch kommt.«
»Sei ned so harsch«, mahnte Thomas die Wirtschafterin. »Ich will, dass die Feli sich bei uns wie daheim fühlt. Also schau zu, dass du bei der Kramerin die Sachen kaufst, die sie braucht.«
»Ich hab auf dem Hof genug zu tun, als dass ich auch noch Kindermagd spielen kann!« Magda erntete damit jedoch nur einen spöttischen Blick Gittas und ein Achselzucken von Thomas. Er hatte es ihr befohlen und damit war die Sache für ihn erledigt.
»So viel Arbeit wird dir die Feli gewiss ned machen. Schließlich ist sie ja schon ein großes Madl. Da fällt mir was ein. Du musst doch in die Schul gehen.«
»Die Oma hat mich wegen, wegen ...«, Feli brach bei der Erinnerung an das Unglück ihrer Eltern in Tränen aus, fasste sich aber wieder und vervollständigte ihren Satz. »Die Oma hat mich bis zum Ferienbeginn freistellen lassen.«
»Bei uns dauert’s noch anderthalb Monat, bis die Ferien anfangen. Ich glaub, du solltest doch noch in die Schul gehen. Da lernst du auch gleich deine neuen Schulkameraden kennen.« Thomas meinte es gut, denn in seinen Augen war es das Beste für das Kind, wenn es so bald wie möglich ein normales Leben führte.
Feli hingegen fühlte wenig Lust, über die in ihrer Heimat übliche Zeit hinaus in die Schule zu gehen. Sie sah jedoch an Thomas‘ Gesicht, dass mit ihm nicht zu reden sein würde, und ließ es sein. Mühsam aß sie eine Scheibe Brot. Auf den Tee dazu musste sie warten, denn das Wasser kochte längst, ohne dass Magda sich darum kümmerte. Erst als Gitta sie spöttisch darauf aufmerksam machte, bequemte sich die Wirtschafterin, aufzustehen und den Tee aufzugießen. Sie nahm aus einer gewissen Boshaftigkeit heraus Kamillentee und sah denn zu, wie Feli schon beim ersten Schluck das Gesicht verzog.
Gitta nahm die Gelegenheit wahr, den nächsten Pfeil auf die Wirtschafterin abzuschießen. »Was hast du denn da für ein Zeugs aufgebrüht?« Sie schnupperte ein paarmal und streckte dann abwehrend die Arme aus. »Das riecht ja wie Kamillentee. So was trinkt man, wenn man krank ist, aber ned zum Frühstück.«
»Tee ist Tee!«, gab Magda patzig zurück.
Thomas versuchte zu beschwichtigen. »Jetzt regt euch erst einmal ab. Ich glaub, es ist das Beste, wenn du die Feli fragst, was sie am liebsten mag.«
»Da geb ich dir recht, Bauer. Also Dirndl, wenn du was willst, brauchst du es bloß zu sagen.« Hias nickte Feli aufmunternd zu und erinnerte sich dann an die Tafel Schokolade, die er noch in seinem Zimmer hatte. Er holte sie rasch und legte sie Feli auf den Tisch.
»Ich hoff, sie schmeckt dir. Es ist Vollmilch-Trauben-Nuss. Die mag ich nämlich ganz besonders gern.«
Feli blickte zuerst auf die Schokolade, dann auf den freundlich lächelnden Mann und griff zu. »Dankeschön.«
»Vergelt’s Gott, sagt man bei uns«, sagte Magda ärgerlich.
»Alte Giftnudel!« Mit diesem Ausspruch traf Gitta die Meinung aller Anwesenden bis auf die davon Betroffene.
*
Marion starrte ihren Verlobten an, als würde sie an seinem Verstand zweifeln. »Du kannst doch ned im Ernst meinen, dass du die Tochter von deinem Bruder auf dem Hof behalten willst.«
Thomas wischte sich eine Locke aus der Stirn und lachte humorlos auf. »Du bist gut. Die andere Verwandtschaft hat keine Verwendung für das Kind. Die hätten die Feli glatt ins Heim gegeben.«
»Aber es muss doch noch andere Leut geben, die das Kind nehmen können. Dein Bruder hat doch auch eine Schwägerin gehabt. Soll die sich doch um den Balg kümmern!« Marion war wütend. In wenigen Monaten sollte die Hochzeit sein und irgendwann würde sie auch eigene Kinder haben. Doch bis dorthin wollte sie das Leben in dem Rahmen, der ihr hier geboten wurde, genießen. Thomas war ein angesehener Bauer und mit vielen wichtigen Leuten in der Kreisstadt bekannt. Sie würden sich über Einladungen nicht beklagen müssen und selbst wohl auch die eine oder andere Feier geben. Zumindest in den nächsten Jahren hatte ein Kind in ihrer Lebensplanung nichts verloren, schon gar kein fremdes. Doch bevor sie drastischer werden konnte, lachte Thomas erneut auf.
»Dem Alois seine Schwägerin sagst du? Bei Gott, das soll eine überspannte Geiß sein, eine Künstlerin, wie man so schön sagt, und gewiss keine, der ich die Tochter meines Bruders anvertrauen tät. Da müsst ich mich ja schämen.«
»Herrschaftszeiten, du hättest mich wenigstens fragen können. Ich mag’s ned, wenn man mich vor vollendete Tatsachen stellt. Immerhin bin ich deine Verlobte und ned die zukünftige Hausmagd auf deinem Hof.« Der Ärger ließ Marion giftig werden. Es ging ihr nicht allein um das Kind, das für sie eine unerwünschte Last zu werden drohte, sondern über die Art, in der Thomas sie und ihre Wünsche übergangen hatte. Wenn sie jetzt klein beigab, sagte sie sich, würde sie wirklich nur eine bessere Magd auf seinem Hof sein.
»Da hätt ich ja besser den Schleibner genommen!« Obwohl Thomas‘ Miene sich verfinsterte, bedauerte Marion diesen Ausspruch nicht. Er sollte ruhig wissen, dass er nicht einfach mit dem Finger schnippen musste, damit sie zu ihm lief. Sie hatte lange geschwankt, wen der beiden Großbauern sie nehmen sollte, und sich zuletzt für Thomas entschieden, weil er jünger war und besser aussah als ihr anderer Verehrer. Xaver Schleibner hatte die dreißig schon vor etlichen Jahren überschritten und besaß eine Stirnglatze und einen bereits deutlich erkennbaren Bauchansatz. Außerdem war er bei Weitem nicht so wohlhabend wie Thomas.
Marion musterte ihren Verlobten mit dem Ausdruck eines Menschen, der dieses Prachtstück unbedingt in seiner Sammlung sehen wollte. Er war ein gutes Stück über eins achtzig, schlank mit breiten Schultern, besaß ein schmales und verwegen wirkendes Gesicht mit hellen Augen, die je nach Licht oder Laune grau oder grün leuchteten, sowie relativ kurze, dunkelblonde Haare. Er sah wirklich gut aus, fand sie, und würde sich an ihrer Seite gut machen. Dieser Gedanke brachte sie dazu, wenigstens halb einzulenken.