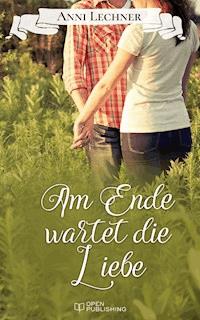3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Erich Fromm
- Sprache: Deutsch
Nachdem Ralf Stegmair seinen Job verloren hat, versucht er für sich und seine Frau Stella ein neues Leben in seiner alten Heimat Mitternreut aufzubauen. Doch kann ihm dies gelingen, an einem für ihn doch so fremden Ort, an dem so mancher Geschäftsmann gegen ihn arbeitet? Kann er seine erkaltete Ehe retten und die Liebe neu auflodern lassen? Neben „Die schöne Fremde“ enthält dieses E-Book auch noch die zwei weiteren spannenden Romane „Der Jubiläumsvirus“ und „Die Bissgurrn“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anni Lechner
Die schöne Fremde
Der Jubiläumsvirus
Die Bissgurrn
Anni Lechner: Band 1, Die schöne Fremde ... und zwei weitere spannende Romane
Copyright © by Anni Lechner
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Überarbeitete Neuausgabe © 2017 by Open Publishing Verlag
Covergestaltung: Open Publishing GmbH – Mathias Beeh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
eBook-Produktion: Datagroup int. SRL, Timisoara
ISBN 978-3-95912-208-5
Die schöne Fremde
Ralf Stegmair starrte seinen Vorgesetzten entsetzt an. Herrlich konnte das, was er sagte, doch nicht ernst meinen. Der Abteilungsdirektor zauberte ein scheinbar mitfühlendes Lächeln auf seine Lippen. »Ich verstehe, dass es Sie trifft, Stegmair, aber Sie dürfen es nicht persönlich nehmen. Die Firma muss sparen, und es kostet nun einmal weniger, in Indien programmieren zu lassen, als hier einen Stall teurer Spezialisten zu bezahlen.«
»Was soll ich nicht persönlich nehmen?« In Ralfs Augen war Herrlich gerade der Richtige, um das zu sagen. Er erinnerte sich noch gut an die Zeit vor etwa zehn Jahren, als sie gemeinsam in der Firma angefangen hatten. Wie oft hatte er Herrlich geholfen, dessen Fehler auszubügeln. Inzwischen war es Herrlich gelungen, sich den Geschäftsführern der Firma angenehm zu machen und die Treppe hinaufzufallen, während er selbst als Fachidiot verschlissen worden war. Als vor einem halben Jahr seine Kollegen Strunz und Weber die Firma verlassen hatten, hätte er ihnen folgen und in eine andere Firma wechseln können. Herrlich hatte ihn jedoch händeringend gebeten, es nicht zu tun. Jetzt ärgerte Ralf sich, weil er so dumm gewesen war, darauf hereinzufallen.
»Es ist ja nicht so, dass wir auf Ihre Fachkenntnis ganz verzichten wollen, Stegmair«, fuhr Herrlich fort. »Aus diesem Grund ist die Firma bereit, Ihnen einen neuen Vertrag anzubieten, und zwar auf der Basis eines Heimarbeitsplatzes für drei Tage in der Woche. Ich habe die entsprechenden Papiere bereits vorbereiten lassen.« Damit legte er eine Mappe auf den Schreibtisch und schlug sie auf.
Ralf las als Erstes die dick unterstrichene Zahl mit dem neuen Gehaltsangebot. Es war so erbärmlich wenig, dass er sich mit der flachen Hand gegen die Stirn schlug. »Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Herrlich? Das Geld reicht ja nicht einmal für die Miete, geschweige denn für zwei Personen, die davon leben sollen.«
»Mein Gott, Stegmair, jetzt tun Sie nicht so, als wenn Sie mit München verheiratet wären. Da Sie Ihre Arbeit ja per Fernleitung von daheim aus erledigen können, müssen Sie nicht in der Großstadt bleiben. Im Umland finden Sie gewiss eine billigere Wohnung.«
Am liebsten hätte Ralf dem anderen ins Gesicht geschlagen. Er wusste jedoch, dass er vorerst keine andere Chance hatte, als auf diesen Schandvertrag einzugehen. »Und was muss ich dann eigentlich tun?«, fragte er mit dem Rest an Beherrschung, der ihm verblieben war.
»Die Programme anpassen, die wir von der indischen Softwarefirma erhalten. Ich glaube nicht, dass da viel zu tun ist. Der Herr Salpeter meinte daher, die drei Wochentage wären eigentlich zu hoch angesetzt, aber ich habe diese Zahl dann doch durchgedrückt.« Herrlich bedachte Ralf mit einem Blick, als würde er dafür Dank erwarten.
Ralf wusste, dass Konrad Salpeter, der erste Geschäftsführer der Firma, in allen Fragen, die die EDV betrafen, sich hundertprozentig auf Herrlich verließ. Die ganze Sache war gewiss auf dessen Mist gewachsen, wahrscheinlich auch, weil Herrlich sich bei seinen neuen Geschäftspartnern in Indien als der große Boss aufspielen konnte.
Herrlich wurde die Pause, die entstanden war, zu lang. Er rückte unruhig auf seinem Schreitischsessel herum und klopfte mit den Fingern auf den Tisch. »Sie haben ja das ganze Wochenende Zeit, um darüber nachzudenken, Stegmair. Schauen Sie sich in der Zeit auch schon mal die Mietangebote in der Prärie, äh, ich mein im Umland an. Noch einen schönen Gruß an die Stella.« Damit beendete Herrlich den Blickkontakt und wandte sich betont auffällig seiner Computertastatur zu.
Ralf stand da und versuchte, die Leere zu vertreiben, die sich in seinem Innern breitmachen wollte. Ich hätte nicht heiraten sollen, dachte er. Für ein billiges Appartement und ein sparsames Leben als Junggeselle würde der Hungerlohn, den Herrlich ihm zugestand, noch reichen. Aber für zwei Leute war es zu wenig.
Ein ungeduldiger Blick Herrlichs erinnerte ihn daran, dass er hier nichts mehr verloren hatte. Mit einem bitteren Geschmack im Mund nahm er die Mappe mit dem Vertragsangebot und verließ das Büro. Draußen war es seltsam ruhig. Es war Freitagnachmittag, und die meisten Angestellten hatten die Firma bereits verlassen. Nur die Leute der Putzkolonne huschten an Ralf vorbei wie Schatten, die er zwar sah, aber nicht wirklich wahrnahm. Eine junge Afghanin machte gerade sein eigenes Büro sauber. Ralf blieb an der Tür stehen und betrachtete die aufgestapelten Ordner und die Reihen von Fachbüchern auf dem Regal. Es war nur ein Teil dessen, was er besaß, aber wahrscheinlich mehr, als Herrlich je gelesen hatte.
Mit einem leisen Knurren holte er wahllos einige Bücher aus dem Regal und stopfte sie in seine Tasche. Er erschreckte damit die Putzfee, die ihn ganz erschrocken ansah.
»Habe ich etwas falsch gemacht, Herr Stegmair?« Da sie bereits als Kind hierhergekommen war, sprach sie ein ausgezeichnetes Deutsch.
Ralf hob in einer beruhigenden Geste die Hände. »Nein, Sie haben gewiss nichts falsch gemacht, Fräulein. Im Gegenteil, niemand hat mein Büro je so sauber gehalten wie Sie.« Erst jetzt erkannte Ralf, dass er nicht einmal ihren Namen wusste, und schämte sich dafür. Für ihn war sie immer nur ein Mitglied der Putztruppe gewesen, die man zwar braucht, aber wegen der man sich keine Gedanken macht. Ich hätte freundlicher zu ihr sein sollen, dachte er. Schließlich ist auch meine Frau eine Fremde in diesem Land.
Er schob diesen Gedanken jedoch rasch wieder beiseite, denn erst einmal musste er sich um seine eigenen Probleme kümmern. Mit einem kurzen Nicken verließ er das Büro und schritt den langen und in seinen Augen plötzlich seltsam schäbig aussehenden Flur zum Aufzug entlang.
*
Als Ralf die Tür seiner Wohnung öffnete, drang ihm der Geruch frischer Pfannkuchen in die Nase. Er mochte Pfannkuchen sehr gern. Heute jedoch verzog er keine Miene, sondern ging in sein Arbeitszimmer, dessen Ausstattung die seines Büros bei Weitem übertraf. Jetzt trauerte er ein wenig dem dafür ausgegebenen Geld nach, denn es waren etliche Tausend Euros gewesen, wahrscheinlich sogar mehrere Zehntausend, für die er im Lauf der Jahre eingekauft hatte. Mit nur der Hälfte davon würden er und Stella mindestens ein weiteres halbes Jahr hier in der Wohnung bleiben können.
Der Gedanke an seine Frau erinnerte ihn daran, dass er sie noch nicht begrüßt hatte. Ralf stellte seine Tasche ab und ging in die kleine, gut eingerichtete Küche. Auch hier hätte er sparen können, dachte er, während er sich seiner Frau zuwandte, die ihm mit dem erwartungsvollen Blick eines jungen Hundes, der auf Lob hoffte, entgegensah.
Mit einem gewissen Schuldgefühl erinnerte Ralf sich daran, dass er Stella bisher auch nicht anders behandelt hatte als ein gut dressiertes Haustier. Sie kochte für ihn, und zwar gut, wusch seine Wäsche und war auch sonst für ihn da, während er ihr gerade mal die nötigste Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Als er sie jetzt betrachtete, fand er, dass sie mit ihrer braunen Haut und den prachtvollen dunklen Locken ein wenig exotisch, aber auch wunderschön aussah. Ihr Gesicht war ebenmäßig, die Lippen sanft geschwungen, und aus ihren großen Augen strahlte ein Licht, das ihm vorher noch nie aufgefallen war. Sie besaß eine schlanke, aber an den richtigen Stellen perfekt gerundete Figur, und war eigentlich alles, was ein Mann sich nur wünschen konnte.
»Ich haben Pfannkuchen gebackt«, sagte Stella, weil ihr Mann stumm blieb.
Sie spricht schlechter Deutsch als die Afghanin in der Firma, fuhr es Ralf durch den Kopf. Das ist auch etwas, um das ich mich hätte kümmern müssen. Da sie eine Antwort erwartete, nickte er ihr zu. »Danke, Stella.«
Die junge Frau sah ihn erstaunt an. Seine Stimme klang heute irgendwie anders als sonst, so als würde ihn etwas bedrücken. Das wunderte sie, denn bis heute war er ihr stets kühl und überlegen erschienen und nur auf seine Arbeit bedacht. Selbst in den Augenblicken gemeinsamer Intimität, die sie miteinander teilten, hatte sie oft das Gefühl, als wären seine Gedanken mehr mit seinen Computerproblemen beschäftigt als mit dem, was er gerade tat.
»Haben du Sorgen?«, fragte sie leise.
Ralf schüttelte im ersten Moment den Kopf, hob aber dann in einer hilflosen Geste die Hände. »Es ist wegen der Firma. Man will mir weniger Geld zahlen. Aber denen werde ich es schon zeigen. Triffst du dich eigentlich noch mit Webers Frau Adelana?«
Stella sah ihn kurz erstaunt an und verneinte. »Adelana und ihr Mann seien doch gezogen nach Frankfurt vor …«, sie überlegte kurz und setzte dann ihren Satz fort, »einem halben Jahr.«
Ralf schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Stimmt, wie konnte ich das nur vergessen!« Auf Webers Hilfe konnte er also nicht bauen. Gleichzeitig fiel ihm ein, dass mit dessen Frau Adelana die einzige Freundin fortgezogen war, die seine Frau hier in Deutschland besaß. Adelana war wie Stella Brasilianerin und hatte seinen Kollegen kennengelernt, als dieser in ihrer Heimat Urlaub gemacht hatte. Die beiden hatten sich ineinander verliebt und noch vor dem Ende des Urlaubs beschlossen, zu heiraten. Die Ehe war ein voller Erfolg geworden, was Ralf von seiner eigenen nicht so ganz behaupten konnte. Er hatte Stella durch Adelanas Vermittlung kennengelernt und war von dieser zur Heirat mit ihrer Freundin gedrängt worden. Liebe war dabei kaum im Spiel gewesen, bei beiden nicht, dachte er mit einem gewissen Bedauern. Stella hatte der Armut in ihrer Heimat entkommen und er eine passende Haushälterin haben wollen. Es war wie ein Geschäft gewesen, und er hatte den besseren Teil dabei gezogen.
»Deck du schon mal den Tisch. Ich muss noch schnell telefonieren.« Ralf verließ beinahe fluchtartig die Küche, während Stella ihm nachdenklich hinterhersah. Irgendetwas bohrte in ihm, das spürte sie fast am eigenen Leib. Ihr blieb nur zu hoffen, dass es nichts Ernsthaftes war, und dafür zu sorgen, dass ein gutes Abendessen seinen Unmut vertrieb. Stella gab sich daher diesmal besondere Mühe mit der Füllung der Pfannkuchen, legte Servietten in Ralfs Lieblingsfarbe auf den Tisch und entkorkte eine Flasche des guten Rotweins, von dem er gern ein Glas trank.
Das Telefongespräch schien sich jedoch zu ziehen, denn die Zeiger der Uhr rückten immer weiter, ohne dass Ralf erschien. Aus Angst, das Essen würde ungenießbar, klopfte sie zuletzt an die Tür seines Arbeitszimmers. Es dauerte einen Moment, bis er aufmachte.
»Was ist denn?«
»Das Abendessen stehen auf Tisch.«
Ralf wischte sich mit einer fahrigen Geste über die Stirn. »Ach so, das habe ich ganz vergessen! Fang du schon einmal damit an. Ich habe noch zu tun.«
»Die Pfannkuchen werden kaputt!« Stella maulte ein wenig, denn sie war auf ihre Kochkünste stolz und wollte nicht, dass etwas verdarb.
»Ja, ja, ich komme ja gleich«, brummte er und schloss die Tür vor ihrer Nase zu.
Stella kamen die Tränen. So hatte Ralf sie noch nie behandelt. Am liebsten hätte sie die Wohnung verlassen und jemanden gesucht, mit dem sie reden konnte. Mit ihren Nachbarinnen hatte sie jedoch kaum Kontakt, und Adelana, ihre Freundin, war in Frankfurt. Sie konnte sie nicht einmal anrufen, weil das einzige Telefon in Ralfs Arbeitszimmer stand und er es gerade selbst benutzte.
Seufzend kehrte sie in die Küche zurück und setzte sich auf ihren Stuhl in der Essecke. Als sie den ersten Bissen in den Mund steckte, schmeckte er wie Asche. Dabei hatte sie sich diesmal so viel Mühe gegeben.
*
Etwa zu derselben Zeit saßen imLöwenin Mitternreut die Stammgäste zusammen, tranken ihr Bier und unterhielten sich über Gott und die Welt. Der Wirt Florian Brettschneider ging von Tisch zu Tisch, setzte sich kurz dazu und begrüßte die Männer mit einem jovialen Lächeln. Im gehörte nicht nur die Gastwirtschaft, sondern auch das große neue Hotel gleich daneben. Die alte, holzverkleidete Gaststube bildete jedoch neben der Kirche das zweite Zentrum des Dorfes. Wer in Mitternreut etwas gelten wollte, traf sich hier, und so mancher Handschlag besiegelte an dieser Stelle ein Geschäft, das bei einem Glas Bier nicht weniger ernsthaft ausgehandelt wurde als in einem Büro. Auch Brettschneider war auf ein Geschäft aus, als er sich zu den großen Bauern des Dorfes setzte.
»Grüßt euch Männer, wie geht’s denn so?«, fragte er lärmend.
»Bestens Florian«, antwortete Hans Stegmair, dessen Hof unweit des Gasthofes auf einem kleinen Hügel thronte. Er prostete dem Wirt zu und trank mit durstigen Zügen.
Brettschneider merkte, dass Stegmair genau in dem Zustand war, in dem er ihn sehen wollte, und legte ihm den rechten Arm um die Schulter. »Ich hätt was zu bereden mir dir, Hans.«
»Dann schieß los, Florian!« Stegmair trank rasch sein Bier aus und streckte der drallen Bedienung das leere Glas entgegen. »Noch eine Halbe, Zenzi!«
»Die geht auf meine Rechnung. Und einen Schnaps bringst du auch gleich mit.« Brettschneider winkte seiner Angestellten, sich zu beeilen, und wandte sich dann wieder dem Bauern zu.
»Eigentlich ist’s bloß eine Kleinigkeit. Jetzt, wo deine Tante Hedwig gestorben ist, steht ihr Häusl leer. Du brauchst es ja eh net, weil du bloß eine Tochter hast, aber ich hätt einen Bedarf. Ich mach dir auch einen guten Preis.«
Ein paar Männer am Nebentisch zogen schiefe Gesichter, als sie das hörten, denn Brettschneiders »gute« Preise waren berüchtigt. Einer wagte sogar, etwas zu sagen:
»Tu’s lieber net, Hans, denn der Florian zieht dich dabei gewiss gewaltig über den Tisch.«
Ein ärgerlicher Blick des Wirts traf den Mann, dann machte Brettschneider eine wegwerfende Handbewegung. »Ein bisserl was verdienen muss ich dabei auch, aber es kann keiner sagen, dass ich ihn übervorteilt hab. Also Hans, verkaufst du mir das Häusl deiner Tant? Du bist doch schließlich ihr Erbe.«
Stegmair nahm gerade das volle Bierglas entgegen, das ihm die Bedienung reichte, und zog ein schiefes Gesicht. »Ich tät’s dir ja gern verkaufen, Florian, aber es geht net.«
»Hat die alte Hedwig in ihrem Testament eine Klausel eingebaut, dass du den Brettschneider net noch mehr füttern darfst. Er steht ja eh kurz vor dem Platzen.« Es war der Windlbauer, der dem Wirt im letzten Jahr ein Stück Wald hatte verkaufen müssen, um dringende Schulden bezahlen zu können. Brettschneider hatte seine Notlage ausgenutzt und den Preis so weit gedrückt, dass Windlbauer daran fast verzweifelt war.
Einige der Gäste sahen direkt schadenfroh drein und ein junger Mann, der am letzten Tisch bei den Holzarbeitern saß, bog verächtlich die Lippen. Es handelte sich um einen hochgewachsenen Burschen mit breiten Schultern und schmalen Hüften. Unter seinem schwarzen Haarschopf war ein schmales, rassiges Gesicht mit einer leichten Adlernase, einem kräftigen Kinn und durchdringend blickenden Grauaugen zu erkennen. Größer hätte der Unterschied zwischen dem fetten Wirt und Benedikt Riedler nicht sein können, und doch zeigten sie eine Ähnlichkeit, die noch größer war als die zwischen Brettschneider und seinem Sohn Andreas, der weiter vorne an einem der Tische saß. Ältere Leute in Mitternreut erinnerten sich daran, dass Benedikt der Sohn einer früheren Kellnerin Brettschneiders war und diesen achtzehn Jahre lang Alimente gekostet hatte. Jetzt war der junge Mann dreiundzwanzig und Holzknecht im staatlichen Forst.
Als würde Brettschneider den Blick seines unehelichen Sohnes im Nacken spüren, schüttelte er sich und fasste nach Stegmairs Hand. »Jetzt red endlich, warum du mir die alte Hütte net verkaufen willst?«
»Weil sie mir net gehört. Nach dem Testament, das meine Tante gemacht hat, erbt mein jüngerer Bruder das Haus.«
Es dauerte einige Augenblicke, bis Bettschneider sich an Ralf Stegmair erinnerte. Dieser war mehr als fünfzehn Jahre jünger als sein Bruder und hatte das Dorf vor einem guten Jahrzehnt verlassen, um eine gut bezahlte Stelle in München anzutreten.
»Sakra noch einmal, hat das sein müssen.« Brettschneider fluchte, denn die Leute in München besaßen andere Vorstellungen von Immobilienpreisen als die Einheimischen. Es würde schwer sein, Ralf so weit herunterzuhandeln, wie er es sich vorstellte. Um sich der Unterstützung Hans Stegmairs zu versichern, bestellte der Wirt zwei weitere Schnäpse und prostete dem anderen zu.
»Auf dein Wohl, Hans. Lass es dir schmecken. Wenn du den Ralf siehst oder mit ihm telefonierst, dann sag ihm, dass ich ein Interesse hätt, die alte Hütte zu kaufen. Sie ist zwar nimmer viel wert, aber er kann sie ja eh net brauchen.« In Brettschneiders Augen stand dabei eine Gier, die Benedikts Abscheu vor seinem Erzeuger noch steigerte. Es gab noch einen weiteren Grund, warum der junge Mann seinen Vater hasste, und der befand sich um diese Zeit auf dem Stegmairhof und erledigte die Arbeit, die Hans Stegmair liegen gelassen hatte. Das Mädchen hieß Margit und war achtzehn Jahre alt und so blitzsauber, dass Benedikt sich Hals über Kopf in sie verliebt hatte. Chancen brauchte er sich jedoch keine auszurechnen, denn als armer Holzknecht stand er weit unter einem Großbauern wie Stegmair. Zudem taten Brettschneider und dessen ehelicher Sohn Andreas alles, um ihn vor den Leuten schlechtzumachen.
Auch jetzt drehte Andreas sich mit höhnischem Gesicht zu ihm um. »Ist es heutzutag üblich, dass bei uns in Bayern die Förster die Wilddiebe, die ihnen die Hirschen wegschießen, als Holzknechte anstellen?«
»Da hat er’s wenigstens net so weit, um zum Schuss zu kommen«, setzte der Wirt mit einem bissigen Lachen hinzu.
Es war allgemein bekannt, dass im hiesigen Forst gewildert wurde, und Brettschneider und sein Sohn taten alles, um Benedikt in den Ruf zu bringen, der Wildschütz zu sein. Einer von Benedikts Kollegen, der ihn besser kannte, stimmte schallend ein Wildererlied an, in das der Windlbauer sofort einfiel. Benedikt hörte einen Augenblick mit eisigem Gesicht zu, dann mischte sich auch seine klare Baritonstimme mit in das Lieb. Brettschneider spürte, dass er eine Niederlage erlitten hatte, und warf seinem Sohn Andreas einen ärgerlichen Blick zu. Der war etwa im selben Alter wie Benedikt, zeigte aber bereits jetzt Anzeichen eines zu guten Lebens und würde dick sein, bevor er das dreißigste Lebensjahr erreicht hatte. Im Moment hielt er sich jedoch noch für den tollsten Hecht, der in Mitternreut und weit darüber hinaus herumlief.
»Du Stegmair, sag deiner Margit, dass ich sie am Sonntag abholen komm. Wir wollen zum Walchensee fahren und dort Boot fahren, und vielleicht auch noch mehr tun«, rief er dem Bauern zu.
Benedikt ballte die Fäuste, als er das hörte, denn mit solchen Worten zog der Wirtssohn den Ruf des Mädchens in den Schmutz. Margits Vater hingegen sah Andreas mit einem trunkenen Grinsen an.
»Du wirst mir schon so ein Hallodri sein, Andreas. Aber für so was ist meine Margit noch zu jung.«
»Jetzt mach einmal halblang, Stegmair. Schließlich ist die Margit im letzten Monat achtzehn geworden.« Andreas erwiderte das Grinsen des Bauern und prostete ihm zu. Da dessen Glas leer war, befahl er der Bedienung, ihm ein neues zu bringen. »Aber auf meine Rechnung«, rief er so laut, damit ja alle es verstehen konnten.
»Lump«, entfuhr es Benedikt. Nur ein paar Männer in seiner direkten Umgebung hörten es und nickten zustimmend.Nicht lange jedoch blieb die Aufmerksamkeit auf Andreas und dessen Sprüchen haften, denn die Gäste hatten ein interessanteres Thema gefunden. »Du, Stegmair, wir haben eigentlich schon lang nix mehr von deinem Bruder gehört. Er soll ja ganz schön Karriere gemacht haben da oben in München.«
»Von einer Karriere weiß ich nix. Er hat halt seinen guten Beruf, aber dafür muss er auch arbeiten wie ein Ross. Der kommt selbst Samstag und Sonntag kaum aus der Firma heraus«, antwortete Ralfs Bruder.
»Ist er deswegen auch net zu der Hedwig ihrer Beerdigung gekommen? Als ihr Erbe hätt er das eigentlich tun müssen«, bohrte Brettschneider nach.
»Er hat gewiss net geglaubt, dass die alte Frau ihm ihr Häusl vermacht. Ich weiß eh net, was sie sich dabei denkt hat. Der Ralf braucht es gewiss net.« Stegmair war ärgerlich, denn er hätte dem Wirt gerne den Gefallen getan und ihm das Haus abgetreten. Es hätte die Schulden, die er bei Brettschneider hatte und von denen nicht einmal seine Frau etwas wusste, wenigstens halbwegs ausgeglichen.
»Hat dein Bruder net vor zwei Jahren geheiratet? Mein Vetter, der Leermoser von Bruck, hat ihn und seine Frau vor einiger Zeit in München getroffen. Es soll eine richtige Negerin sein, hab ich mir sagen lassen.« Der Windlbauer beugte sich neugierig zu Stegmair hin, aber auch die anderen hielten jetzt inne und warteten gespannt auf die Antwort.
Stegmair hob hilflos die Arme. »Also, ich hab das Madl noch net gesehen, denn die letzten Male ist der Ralf allein gekommen. Aber zu Weihnachten wird er sie heuer wohl mitbringen, denk ich mir.«
»Weihnachten kommt er erst wieder! Mei, bis dort ist’s fei noch lang hin!« Einer der Holzknechte an Benedikts Tisch lachte auf.
Ein älterer Bauer schüttelte verwundert den Kopf. »Eine richtige Negerin? Wie kommt denn der Ralf an so eine? Als wenn’s bei uns in Bayern keine feschen Madln geben tät.«
»Hat er dir net wenigstens ein Foto von seiner Angetrauten gezeigt?«, wollte der Windlbauer wissen.
»Wahrscheinlich hat er sich net traut, wenn’s doch eine Negerin ist«, spottete einer der Gäste. »Aber weißt du, der Ralf war schon alleweil ein wengerl komisch.«
Es war der Beginn einer längeren Diskussion, zu der jeder etwas beitrug, der Ralf von früher gekannt hatte. Benedikt beteiligte sich nicht daran, obwohl er sich noch entfernt an den Onkel seiner Angebeteten erinnern konnte. Sein Halbbruder Andreas legte sich hier jedoch weniger Hemmungen an und brachte die Rede immer wieder auf die Negerin, die Ralf Stegmair sich wohl aus dem afrikanischen Urwald geholt hatte.
*
Ralf hatte den Brief des Notars aus Bad Tölz zunächst nicht beachtet und ungeöffnet beiseitegelegt. Ihn interessierte es mehr, eine neue Arbeitsstelle zu finden, um Herrlich den Bettel, mit dem dieser ihn abspeisen wollte, vor die Füße werfen zu können. Er bekam auch ein paar Jobangebote. Die waren allerdings so schlecht bezahlt, dass er auf seine schöne Vierzimmerwohnung in Schwabing verzichten und sich eine kleinere und einfachere Bleibe in Neuperlach oder gar auf dem Hasenbergl hätte suchen müssen. Es war, als hätte der Himmel selbst sich gegen ihn verschworen, dachte er, als er an diesem Tag nach einem weiteren vergeblichen Versuch nach Hause zurückkehrte.
Stella empfing ihn an der Tür und wirkte aufgeregt. »Es haben jemand angerufen, sagen, seien Bruder von dir!«
»Der Hans?« Ralf zwinkerte ungläubig mit den Augen. Der Kontakt mit seinem Bruder war in den letzten Jahren immer mehr eingeschlafen, und er fuhr eigentlich nur mehr aus Pflichtgefühl einmal im Jahr nach Mitternreut, meistens kurz vor Weihnachten, um ein paar hastig ausgesuchte Geschenke zu abzugeben. Er telefonierte auch nur mit seinem Bruder, wenn wirklich etwas Wichtiges geschah, so wie von ein paar Wochen der Tod seiner Tante Hedwig. Ralf hatte eigentlich zu ihrer Beerdigung fahren wollen, doch das hatte Herrlich ihm mit einem Sonderauftrag vermasselt.
»Was hat er denn wollen?«
»Ich nichts verstanden. Reden so komisch.« Stella duckte sich, als würde sie Schelte oder gar Schläge erwarten.
Ralf begriff zunächst nicht recht, was sie damit ausdrücken wollte, schlug sich dann aber mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Ach so, du hast ihn nicht verstanden, weil er kein Hochdeutsch kann. Hat er so daher geredet, wie ich’s jetzt tu?« Er wechselte in den Dialekt des Oberlandes, den er schon seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte, und wunderte sich selbst, wie leicht es ihm fiel.
Seine Frau sah ihn verdattert an und nickte. »Ja, das haben er.«
»Da darfst du dir nix dabei denken. Da wo ich herkomm, reden die Leut halt einmal so.« Jetzt, wo er einmal mit dem Dialekt angefangen hatte, konnte er kaum mehr damit aufhören.
»Haben du Stelle gefunden?«, fragte Stella, die sich mehr für den beruflichen Erfolg ihres Mannes interessierte als für dessen Bruder.
Ralf schüttelte den Kopf. »Leider net … nicht. Die Gehaltsvorstellungen gingen zu weit auseinander. Da kann ich genauso gut Herrlichs Angebot annehmen und für uns eine Wohnung im Umland suchen.« Er winkte ab, schielte dann zur Tür seines Arbeitszimmers und ging darauf zu. »Ich möchte doch zu gerne wissen, was der Hans von mir will.«
Während Stella wieder in die Küche zurückkehrte, um das Abendessen vorzubereiten, nahm Ralf das Telefon zur Hand und wählte die Nummer seines Bruders an.
»Hier Stegmair, Mitternreut«, meldete sich eine jugendliche Frauenstimme.
»Bist du es, Margit? Grüß dich, ich bin’s, der Ralf. Wie geht’s euch denn so?«
»Ich kann nicht klagen. Aber wie ist’s mit dir?«, antwortete die Nichte.
»Schlechten Leuten geht’s immer gut. Das weißt du doch.« Um nichts in der Welt hätte Ralf seine beruflichen Probleme zugegeben. Um weitere Nachfragen von vorneherein zu verhindern, lenkte er sofort auf ein anderes Thema um. »Ich hab von meiner Frau gehört, dass dein Vater angerufen hat. Es ist doch hoffentlich net schon wieder wer gestorben?«
»Net, dass ich wüsst. Aber ich kann dir auch net sagen, was er wollen hat. Wart ein wengerl, ich hol ihn ans Telefon.«
Ralf hörte das leichte Knacken, mit dem Margit den Hörer hinlegte, und dann ihren Ruf: »Vater, Telefon!« Es dauerte eine Weile, bis sich sein Bruder meldete.
»Hier Stegmair!«
»Servus Hans, ich bin’s, der Ralf. Die Stella hat mir erzählt, du hättest angerufen.«
»Hat sie dir also doch sagen können, dass ich es war. Weißt du, ich, hab sie net verstanden und sie mich net. Aber gut, dass du anrufst. Weißt du, es geht um das Häusl von der Tante Hedwig. Jetzt, wo sie gestorben ist, steht’s leer und der Brettschneider tät’s gern kaufen.«
»Dazu musst du doch mich net fragen. Verkauf’s ihm, wenn du meinst, es wär das Richtige.« Ralf wunderte sich über die Anfrage, denn er nahm an, dass die Tante Hans ihr Haus vermacht hatte.
Am anderen Ende der Leitung atmete Hans Stegmair erst einmal auf. Brettschneider hatte ihm eine Provision versprochen, wenn er seinem Bruder zum Verkauf bewegte, und die wollte er sich verdienen. »Dann ist ja alles in bester Ordnung. Ich werd dem Brettschneider Bescheid sagen, dass du ihm das Häusl verkaufst. Du brauchst net denken, dass er dich über den Tisch ziehen will. Aber bei uns sind halt die Immobilienpreise net so hoch wie bei euch in München.«
Jetzt verstand Ralf überhaupt nichts mehr. »Warum muss ich das Haus verkaufen?«
»Weil’s die Tant dir vermacht hat. Hast du denn den Brief vom Notar net gekriegt?«
Ralf erinnerte sich jetzt wieder an das Schreiben und fragte sich, was in seine Tante gefahren sein mochte. Die alte Hedwig hatte sich nicht mehr um ihn gekümmert, seit er nach München gezogen war. Erst als Hans sich am anderen Ende der Leitung räusperte, konzentrierte er sich wieder auf das Gespräch.
»Das muss ich mir erst einmal alles überlegen, Hans. Ich ruf dich später noch einmal an.«
»Aber ich kann dem Brettschneider schon sagen, dass du verkaufen willst«, klang es drängend zurück.
Ralf wollte schon Ja sagen, dachte dann aber nach. Mitternreut lag zwar weit vom Schuss, aber da er ja nicht in der Firma, sondern nur zu Hause am Bildschirm arbeiten sollte, war es vielleicht die Lösung seines dringendsten Problems. »Du Hans, ich will nix überstürzen. Sag daher lieber nix.«
»Was willst du da noch lang überlegen. Du brauchst die alte Hütte net, und der Brettschneider zahlt gut.« Es klang wie das Quengeln eines kleinen Buben, dem ein Bonbon verweigert wurde, dachte Ralf. So kannte er seinen Bruder eigentlich gar nicht.
»Über was nachzudenken hat noch keinem geschadet«, antwortete er schärfer als gewollt und legte nach einem kurzen Gruß auf. Dann schnaufte er tief durch und langte sich an den Kopf. Ihm sollte das hübsche Häuschen seiner Tante gehören? Das konnte er sich kaum vorstellen. Sein Blick glitt zum Arbeitstisch, auf dem sich die Post stapelte, die ihm nicht wichtig genug gewesen war, um sie sofort zu lesen. Er durchsuchte den Stapel und hielt schließlich das blaue Kuvert mit dem Brief des Notars in der Hand. Als er es aufriss, bemerkte er, dass es zwei Teile enthielt. In einem sehr offiziell aussehenden Schreiben wurde ihm mitgeteilt, dass seine Tante ihm ihr Wohnhaus samt Garten vermacht hatte. Das andere war ein Brief seiner Tante an ihn, mit zittriger Hand geschrieben und daher fast nicht zu lesen.
»Lieber Ralf«, stand darin. »Du wirst dich wahrscheinlich wundern, von mir zu hören, nachdem wir zwei in den zehn Jahren, die du nach München gezogen bist, keine zehn Wörter miteinander gewechselt haben. Ich habe dich aber immer gern gehabt, das sollst du jetzt wissen. Mir hat es nur wehgetan, mit welcher Leichtigkeit du deiner Heimat den Rücken gekehrt hast, so als wären wir nichts und die Großstadt alles. Dabei habe ich dir von Anfang an mein Häuserl vermachen wollen, damit du deinen festen Platz in Mitternreut hast. In den letzten Jahren hab ich dann doch eher an den Hans oder die Margit gedacht, aber davon bin ich wieder abgekommen. Für meinen Geschmack lässt sich dein Bruder zu sehr mit dem Brettschneider ein, diesem Bazi. Auf ehrliche Weis wär der nie zu dem Reichtum gekommen, den er jetzt hat. Außerdem hat er wissen lassen, dass er mein Grundstück haben will, um mein Häusel abzureißen und dort ein weiteres Hotelungetüm hinzustellen. Aus diesem Grund möcht ich nicht, dass mein Besitz einmal in seine Händ kommt. Das musst du mir versprechen. Mir tät’s gefallen, wenn du mein Häusel behalten könntest, und wenn du es bloß an Wochenenden und in deinen Ferien bewohnst. Das schreibt dir deine Tante Hedwig. Ach ja, du musst mir noch versprechen, dass jedes Jahr an meinem Todestag eine heilige Messe für mich gelesen wird und ein Rosenkranz.« Darunter standen noch die Unterschrift sowie das Datum.
Ralf starrte auf das Blatt, das so zu schreiben der alten Frau gewiss nicht leicht gefallen war, und wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Dieses Erbe erschien ihm wie ein Geschenk des Himmels. Jetzt mussten Stella und er nicht mehr in eine kleine, enge Wohnung oder gar ein winziges Appartement umziehen, sondern besaßen ein schönes, großes Haus in einer herrlichen Natur. Das musste er Stella sofort sagen. Er verließ sein Arbeitszimmer und eilte, noch mit dem Brief seiner Tante in der Hand, in die Küche.
»Stella, du wirst es nicht glauben, aber wir sind aus dem Schneider!«, rief er seiner Frau zu.
Stella vernahm den Jubel in seiner Stimme und blickte erstaunt auf. »Du haben neue Stellung mit gutem Geld?«
Ralf schüttelte lachend den Kopf. »Nein, das nicht. Aber ein Haus, in dem wir leben können. Meine Tante hat es mir vererbt. Jetzt kann ich den neuen Vertrag mit meiner Firma abschließen, denn mit dem Geld kommen wir leicht aus. Du wirst sehen, in Mitternreut ist das Leben billig. Außerdem haben wir dort einen Garten, in dem du frisches Gemüse und sogar Obst ziehen kannst.«
Stella wusste nicht so recht, was sie von dem Ganzen halten sollte. Ihr Blick wanderte durch die Küche, die in den letzten beiden Jahren ihr bevorzugter Aufenthaltsort gewesen war. Es tat ihr ein wenig leid, sie verlassen zu müssen. Dann aber sagte sie sich, dass ein Wohnort so gut wie der andere sein würde. Seit ihre Freundin Adelana fortgezogen war, hatte sie außer ihrem Mann keinen Menschen mehr, mit dem sie reden konnte, und der hatte selten für sie Zeit gehabt. Damit konnte eigentlich alles nur besser werden.
*
Mitternreut und die Gegend, in der es lag, erschienen Stella wie ein Bild aus einem Märchenland. Die große Stadt mit ihren hastenden Menschen, den Autokolonnen auf den Straßen und dem wenigen Grün, das man erst suchen musste, lagen so fern, als wären sie auf dem Mond. Hier strebten mächtige Berge grauen Riesen gleich in den Himmel und umgaben ein sanft geschwungenes Tal mit satten grünen Weiden, auf denen braun gescheckte Kühe grasten. Auf den Feldern, die die Straße säumten, reifte das Korn, und bei einem dunklen Tannenwald, der unweit ihres Weges lag, konnte Stella sogar ein Reh mit seinem Kitz erkennen. Der Ort selbst bestand aus einem guten halben Dutzend Bauernhöfen, die breit und behäbig etwas abseits der Straße lagen, einer Kirche mit schneeweißen Mauern, einem hohen, roten Dach und einem Turm mit einer kupfernen Zwiebel als Abschluss. Neben der Kirche befand sich die wuchtige GastwirtschaftZum Löwenund nicht weit davon ein in ihren Augen etwas protzig wirkendes Hotel.
Ralf lenkte den Wagen an Brettschneiders Besitz vorbei und widerstand nur mit Mühe dem Wunsch, gleich bei Tante Hedwigs Haus anzuhalten, oder besser gesagt, seinem Haus. Als sie daran vorbeikamen, zeigte er stolz darauf. »Und, was sagst du dazu, Stella, ist es nicht herrlich?«
Die junge Brasilianerin betrachtete das Haus mit staunenden Augen. So groß hatte sie es sich nicht vorgestellt. Dabei fügte es sich mit seinem blumengeschmückten Holzbalkon und den grünen Fensterläden so harmonisch in das Dorfbild ein, als hätte ein begnadeter Künstler es an dieser Stelle platziert.
»Das dort ist der Hof meines Bruders. Dort bin ich aufgewachsen.« Ein Rest bäuerlichen Stolzes sprach aus Ralf, als er zum Stegmairhof abbog. Der sah auch beeindruckend aus, doch als sie näher kamen, bemerkte er die Spuren eines schleichenden Verfalls. Die Wände hätten längst wieder gekalkt werden müssen und die Holzteile des Wohnhauses und der Scheune neu gestrichen. Auch der Traktor, der mitten auf dem Hof stand, sah irgendwie schmutziger aus, als er es von seinem letzten Besuch in Erinnerung hatte. Als Junge hatte er jeden Samstagabend die Maschinen mit dem Wasserschlauch abspritzen und sie alle Monate einmal mit einem speziellen Öl einreiben müssen. Damals hatte er über die Schinderei geschimpft. Heute jedoch zog er die Stirn kraus, weil es schon längere Zeit nicht mehr geschehen war. Das kommt wahrscheinlich daher, weil der Hans nur eine Tochter hat und keinen Sohn, sagte er sich. Ein Mädchen verstand nun einmal von solchen Dingen weniger als ein Bub.
Für Stella hingegen sah der Bauernhof einfach gigantisch aus. Sie bewunderte die mächtigen Gebäude und die kunstvoll geschnitzte Eingangstür, die, wie Ralf ihr erklärte, unter Denkmalschutz stand. »Die ist über dreihundert Jahr alt«, sagte er, während er den Wagen anhielt. Er konnte es kaum erwarten, seinen Bruder zu sehen und mit ihm zusammen zu Tante Hedwigs Haus hinüber zu gehen. Doch nicht Hans Stegmair, sondern ein junges Mädchen in einer unkleidsamen Latzhose, schmutzigen Gummistiefeln und einem rot karierten Hemd kam auf ihn zu, die blonden Haare unter ein helles Kopftuch gesteckt. Etwas verwundert betrachtete sie die Münchner Autonummer des Wagens und wandte sich dann fragend Ralf zu.
»Sie wünschen?« Dann erst erkannte sie ihn und schlug die Hände zusammen. »Onkel Ralf, ist das aber eine Überraschung. Hast du ein neues Auto?«
»Im letzten Januar gekauft«, gab Ralf zu und betrachtete seine Nichte seinerseits mit einem erstaunten Blick. Er hatte sie noch als halbwüchsiges Mädchen mit Zöpfen in Erinnerung, doch vor ihm stand eine trotz ihrer unvorteilhaften Kleidung recht hübsche, junge Frau mit einem fein gezeichneten Gesicht, einem Grübchen am Kinn und hellen, blauen Augen.
Unterdessen hatte Margit entdeckt, dass noch jemand im Auto saß. »Sag bloß, das ist deine Frau?« Noch bevor Ralf antworten konnte, eilte sie hin, öffnete die Beifahrertür und streckte Stella die Hand hin.
»Grüß dich! Ich bin die Hedwig, die Nichte von deinem Mann. Mei, freu ich mich, dich kennenzulernen.«
Stella ergriff die Hand und keuchte ein wenig unter den festen Griff der Bauerntochter. Gleichzeitig war sie froh, so herzlich empfangen zu werden. Sie stieg mit einem schüchternen Lächeln aus und zupfte unsicher an ihrer Jeans und ihrer Bluse herum.
Margit betrachtete sie und musste sich ein Lachen verkneifen. In den letzten Tagen hatte sich die Fantasie der Dorfleute zu recht seltsamen Vorstellungen über Ralfs Frau verstiegen. Doch vor ihr stand weder eine Wilde aus dem Urwald mit einem Nasenpflock, noch eine stämmige Matrone in einem langen, kreischend bunten Kleid, wie sie manchmal in Fernsehberichten über Afrika gezeigt wurden, sondern eine aparte junge Frau mit einer ausgezeichneten Figur und einem angenehmen, hübschen Gesicht. Auch war ihre Haut nicht schwarz, sondern leicht braun getönt und damit heller als die mancher der einheimischen Bäuerinnen nach einem heißen Sommer auf dem Feld.
»Also, wenn ich dich so anschau, versteh ich, dass der Ralf sich in dich verliebt hat«, sagte Margit bewundernd.
Ihr Onkel senkte beschämt den Kopf, denn Stellas gutes Aussehen war für seine Entscheidung, sie zu heiraten, nicht bestimmend gewesen. Er hätte sie auch genommen, wenn sie nicht gerade abgrundtief hässlich gewesen wäre.
»Ist dein Papa daheim?«, fragte er, um seine Unsicherheit zu verbergen.
Margit schüttelte den Kopf. »Nein, der ist drüben in der Wirtschaft!«
Ralf kniff die Augenlider zusammen, denn in den Worten seiner Nichte schwang Missbilligung mit. »Jetzt? Um die Zeit! Es ist doch erst Samstagmittag«, wunderte er sich.
»Er hat Geschäfte mit dem Brettschneider zu besprechen, hat er gesagt.« Margit zuckte mit den Schultern und zeigte auf das Wohnhaus. »Kommt doch herein. Ich ruf die Mama, damit sie sich um euch kümmert. Ich richt mich derweil ein wengerl her, denn so kann ich wirklich net ins Wohnzimmer.«
Ralf achtete nicht so recht auf das, was sie zuletzt gesagt hatte. Ihm war die Warnung seiner Tante vor Brettschneider in den Sinn gekommen. Daher gefiel es ihm wenig, dass sein Bruder zu einer Zeit, in der andere Bauern noch auf ihren Feldern arbeiteten, im Wirtshaus saß.
»Eigentlich sind wir gekommen, um uns das Haus von der Tante Hedwig anzuschauen«, sagte er zu seiner Nichte. Diese nickte.
»Das hab ich mir schon denkt. Aber lass dir eines sagen, Ralf. Verkauf’s ja net an den Brettschneider! Der zieht dich über den Tisch, dass du nachher die Engerl singen hörst. Du findest in der Stadt gewiss einen Käufer, der zu uns in die Berg will und auch einen fairen Preis zahlt. Der Brettschneider tut das gewiss net.« Margit zeigte deutlich, dass sie nicht viel von dem Wirt hielt. Ralf spürte, dass mehr dahinter stecken musste, und überlegte schon, ob er nachhaken sollte. Doch da öffnete sich die Tür des Wohnhauses, und seine Schwägerin kam heraus. Er hatte Franziska als eine recht ansehnliche Frau in Erinnerung, doch als er sie jetzt ansah, entdeckte er mehrere scharfe Kerben um ihren Mund und den Anflug erster Falten auf ihrer Stirn. Auch ihre Gestalt wirkte ein wenig gedrückt, so als würde sie sich Sorgen machen.
Franziska Stegmair erkannte den Bruder ihres Mannes auf Anhieb und reichte ihm die Hand. »Bin ich froh, dass du kommst. Dann hört wenigstens das ganze Gered um den Verkauf von dem Häusl an den Brettschneider auf. Der macht meinen Mann noch ganz verrückt damit, sag ich dir.«
Ralf machte eine unwirsche Geste. »Ich hab schon gehört, dass der Brettschneider das Grundstück will. Aber da wird ihm der Schnabel sauber bleiben.«
»Hast du vielleicht schon einen Käufer?«, fragte seine Nichte atemlos.
»Nein, die Stella und ich werden selber einziehen.«
Während Margit freudig aufquietschte, bemerkte ihre Mutter Stella erst jetzt und schien nicht ganz zu wissen, wie sie sich ihr gegenüber verhalten sollte. Etwas zögerlich streckte sie Hand aus. »Grüß Gott.«
»Guten Tag«, antwortete Stella durch den forschenden Blick der anderen verunsichert.
Franziska Stegmair wandte sich nun ihrem Schwager zu. »Das ist also deine Frau. Schön, dass du sie auch einmal mitbringst.«
Ralf zog bei diesen tadelnden Worten den Kopf ein. »Ich hätt’s ja längst getan, aber die Arbeit …« Es war nicht einmal eine Ausrede, denn bis zu seinem letzten Gespräch mit Herrlich hatte er in erster Linie für die Firma gelebt. Welche Bedürfnisse eine junge Frau wie Stella besaß, hatte er daher nie gelernt.