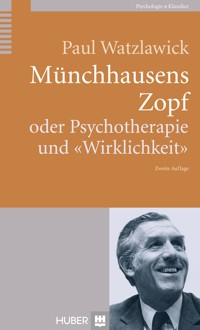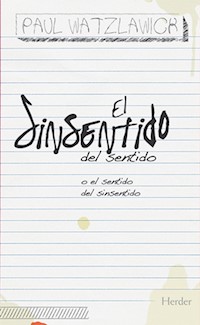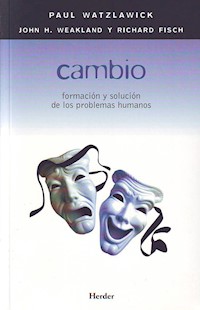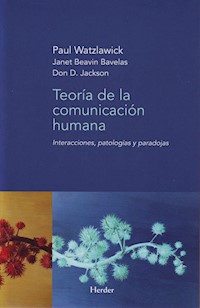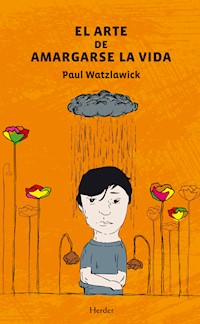9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Paul Watzlawick hat mit seiner »Anleitung zum Unglücklichsein« einen Millionenbestseller geschrieben – was nur den Schluss zulässt, dass Leiden ungeheuer schön sein muss. Anders als die gängigen »Glücksanleitungen« führen Watzlawicks Geschichten uns vor Augen, was wir täglich gegen unser mögliches Glück tun. Nach der Lektüre werden auch Sie begreifen, warum Sie den Nachbarn, den Sie um einen Hammer baten, am liebsten erschlagen würden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
© Paul Watzlawick 1983
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 1983
Umschlag: semper smile, München
Umschlagabbildung: Rafal Olbinski
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Vorbemerkung des Verlags
Man kann Paul Watzlawicks Buch mit einem lachenden und einem weinenden Auge lesen. Jeder Leser dürfte etwas von sich selbst in diesem Buch wiederfinden – nämlich seine eigene Art und Weise, den Alltag unerträglich und das Triviale enorm zu machen.
Darüber hinaus ist dieses Buch – obwohl der Autor dies nirgends zugibt – eine einzige große »Symptomverschreibung«, eine therapeutische Doppelbindung ganz im Stile der sogenannten Palo-Alto-Gruppe1. Und deshalb wird der Psychotherapeut oder Berater zwischen den Zeilen dieser maliziösen Seiten so manches herauslesen können, was unmittelbare Bedeutung für den therapeutischen Dialog hat: Metaphern, Vignetten, Witze, hintergründige Geschichten und gewisse andere »rechtshemisphärische« Sprachformen, die ungleich wirkungsvoller sind als tierisch ernste Deutungen menschlicher Fehlhaltungen.
Einleitung
»Was kann man nun von einem Menschen… erwarten? Überschütten Sie ihn mit allen Erdengütern, versenken Sie ihn in Glück bis über die Ohren, bis über den Kopf, so daß an die Oberfläche des Glücks wie zum Wasserspiegel nur noch Bläschen aufsteigen, geben Sie ihm ein pekuniäres Auskommen, daß ihm nichts anderes zu tun übrigbleibt, als zu schlafen, Lebkuchen zu vertilgen und für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen – so wird er doch, dieser selbe Mensch, Ihnen auf der Stelle aus purer Undankbarkeit, einzig aus Schmähsucht einen Streich spielen. Er wird sogar die Lebkuchen aufs Spiel setzen und sich vielleicht den verderblichsten Unsinn wünschen, den allerunökonomischsten Blödsinn, einzig um in diese ganze positive Vernünftigkeit sein eigenes unheilbringendes phantastisches Element beizumischen. Gerade seine phantastischen Einfälle, seine banale Dummheit wird er behalten wollen…«
Diese Worte stammen aus der Feder des Mannes, den Friedrich Nietzsche für den größten Psychologen aller Zeiten hielt: Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Und doch drücken sie, wenn auch in beredterer Sprache, nur das aus, was die Volksweisheit seit eh und je weiß: Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen.
Es ist höchste Zeit, mit dem jahrtausendealten Ammenmärchen aufzuräumen, wonach Glück, Glücklichkeit und Glücklichsein erstrebenswerte Lebensziele sind. Zu lange hat man uns eingeredet – und haben wir treuherzig geglaubt –, daß die Suche nach dem Glück uns schließlich das Glück bescheren wird.
Dabei ist der Begriff des Glücks nicht einmal definierbar. So wurden zum Beispiel die Hörer der 7. Folge des Abendstudios des Hessischen Rundfunks im September 1972 Zeugen der zweifellos befremdenden Diskussion zum Thema »Was ist Glück?« [11]2, in deren Verlauf es vier Vertretern verschiedener Weltanschauungen und Disziplinen nicht gelang, sich auf die Bedeutung dieses scheinbar so selbstverständlichen Begriffs zu einigen – und das trotz der Bemühungen des eminent vernünftigen (und geduldigen) Gesprächsleiters.
Das sollte uns eigentlich nicht überraschen. »Worin das Glück besteht, darüber waren die Meinungen immer geteilt«, lesen wir in einem Essay des Philosophen Robert Spaemann über das glückliche Leben [22]: »289 Ansichten zählte Terentius Varro und ihm folgend Augustinus. Alle Menschen wollen glücklich sein, sagt Aristoteles.« Und Spaemann erwähnt dann die Weisheit eines jüdischen Witzes vom Sohn, der dem Vater eröffnet, er wolle Fräulein Katz heiraten. »Der Vater widerspricht. Fräulein Katz bringe nichts mit. Der Sohn erwidert, er könne nur mit Fräulein Katz glücklich sein. Darauf der Vater: ›Glücklich sein, und was hast du schon davon?‹«
Die Weltliteratur allein schon hätte uns längst mißtrauisch machen sollen. Unglück, Tragödie, Katastrophe, Verbrechen, Sünde, Wahn, Gefahr – das ist der Stoff, aus dem die großen Schöpfungen bestehen. Dantes Inferno ist ungleich genialer als sein Paradiso; dasselbe gilt für Miltons Paradise Lost, demgegenüber Paradise Regained ausgesprochen fade ist; Jedermanns Sturz reißt mit, die ihn schließlich rettenden Engelchen wirken peinlich; Faust I rührt zu Tränen, Faust II zum Gähnen.
Machen wir uns nichts vor: Was oder wo wären wir ohne unsere Unglücklichkeit? Wir haben sie bitter nötig; im wahrsten Sinne dieses Wortes.
Unseren warmblütigen Vettern im Tierreich geht es nicht besser: Man besehe sich nur die monströsen Wirkungen des Zoolebens, das jene herrlichen Kreaturen vor Hunger, Gefahr und Krankheit (einschließlich Zahnfäule) schützt und damit zu den Entsprechungen menschlicher Neurotiker und Psychotiker macht.
Unserer Welt, die in einer Flutwelle von Anweisungen zum Glücklichsein zu ertrinken droht, darf ein Rettungsring nicht länger vorenthalten werden. Nicht länger darf das Verstehen dieser Mechanismen und Prozesse die eifersüchtig gehütete Domäne der Psychiatrie und der Psychologie bleiben.
Die Zahl derer, die sich ihr eigenes Unglück nach bestemWissen und Gewissen selbst zurechtzimmern, mag verhältnismäßig groß scheinen. Unendlich größer aber ist die Zahl derer, die auch auf diesem Gebiet auf Rat und Hilfe angewiesen sind. Ihnen sind die folgenden Seiten als Einführung und Leitfaden gewidmet.
Diesem altruistischen Vorhaben kommt aber auch staatspolitische Bedeutung zu. Wie die Zoodirektoren im kleinen, so haben es sich die Sozialstaaten im großen Maßstabe zur Aufgabe gemacht, das Leben des Staatsbürgers von der Wiege bis zur Bahre sicher und glücktriefend zu gestalten. Dies ist aber nur dadurch möglich, daß der Staatsbürger systematisch zur gesellschaftlichen Inkompetenz erzogen wird. In der gesamten westlichen Welt steigen daher die Staatsausgaben für das Gesundheits- und Sozialwesen von Jahr zu Jahr immer steiler an. Wie Thayer [23] zeigte, schnellten diese Ausgaben in den USA zwischen 1968 und 1970 um 27 Prozent von 11 auf 14 Milliarden Dollar. Bundesdeutschen Statistiken (aus der Entstehungszeit dieses Buches) ist zu entnehmen, daß die täglichen Ausgaben für das Gesundheitswesen allein 450 Millionen DM betragen und sich damit seit 1950 verdreißigfacht haben. Es gibt in der Bundesrepublik zehn Millionen Kranke, und der westdeutsche Normalverbraucher nimmt im Laufe seines Lebens 36000 Tabletten ein.
Man stelle sich nun vor, wie es um uns stünde, wenn dieser Aufwärtstrend zum Stokken käme oder gar rückläufig würde. Riesige Ministerien und andere Monsterorganisationen brächen zusammen, ganze Industriezweige gingen bankrott, und Millionen von Menschen wären arbeitslos.
Zur Vermeidung dieser Katastrophe will das vorliegende Buch einen kleinen, verantwortungsbewußten Beitrag leisten. Der Sozialstaat braucht die stetig zunehmende Hilflosigkeit und Unglücklichkeit seiner Bevölkerung so dringend, daß diese Aufgabe nicht den wohlgemeinten, aber dilettantischen Versuchen des einzelnen Staatsbürgers überlassen bleiben kann. Wie in allen anderen Sparten des modernen Lebens ist auch hier staatliche Lenkung vonnöten. Unglücklich sein kann jeder; sich unglücklich machen aber will gelernt sein, dazu reicht etwas Erfahrung mit ein paar persönlichen Malheurs nicht aus.
Doch selbst in der einschlägigen, das heißt hauptsächlich psychiatrischen und psychologischen Literatur sind dementsprechende Hinweise und brauchbare Informationen sehr dünn gesät und meist ganz unbeabsichtigt. Soweit mir bekannt ist, haben sich nur wenige meiner Kollegen an dieses heiße Eisen herangewagt. Rühmliche Ausnahmen sind die Frankokanadier Rodolphe und Luc Morisette mit ihrem Petit manuel de guérilla matrimoniale [12]; Guglielmo Gulottas Commedie e drammi nel matrimonio [7]; Ronald Laings Knoten [9]; und Mara Selvini Palazzolis Der entzauberte Magier [20], in dem die berühmte Psychiaterin nachweist, wie das Großsystem Schule das Scheitern des Schulpsychologen braucht, um sich nicht ändern zu müssen und weiterhin mehr desselben tun zu können. Ganz besondere Erwähnung verdienen ferner die Bücher meines Freundes Dan Greenburg, How to be a Jewish Mother [5]3 und How to MakeYourself Miserable [6], jenes bedeutende Werk, das von den Kritikern als die freimütige Untersuchung gefeiert wurde, »die es hunderttausend Menschen ermöglicht hat, ein wahrhaft leeres Leben zu leben«. Und last but not least sind hier die drei bedeutendsten Vertreter der britischen Schule zu erwähnen: Stephen Potter mit seinen »Upmanship«-Studien [17]; Lawrence Peter, der Entdecker des »Peter-Prinzips« [16]; und schließlich der weltberühmte Autor des nach ihm benannten Gesetzes: Cyril Northcote Parkinson [14, 15].
Was das vorliegende Buch zusätzlich zu diesen ausgezeichneten Studien bieten möchte, ist eine methodische, grundlegende und auf Jahrzehnten klinischer Erfahrung beruhende Einführung in die brauchbarsten und verläßlichsten Mechanismen der Unglücklichkeit. Trotzdem aber dürfen meine Ausführungen nicht als erschöpfende und vollständige Aufzählung betrachtet werden, sondern nur als Leitfaden oder Wegweiser, der es den begabteren unter meinen Lesern ermöglichen wird, ihren eigenen Stil zu entwickeln.
Vor allem eins:Dir selbst sei treu…
Dieses goldene Wort stammt von Polonius, dem Kämmerer in Hamlet. Für unser Anliegen ist es wertvoll, da Polonius, indem er sich selbst treu ist, es schließlich fertigbringt, von Hamlet »wie eine Ratte« in seinem Versteck hinter einem Wandschirm erstochen zu werden. Offensichtlich gab es das goldene Wort vom Lauscher an der Wand im Staate Dänemark noch nicht.
Man könnte vielleicht einwenden, daß damit des sich Unglücklichmachens zuviel getan war, doch müssen wir Shakespeare etwas poetische Freiheit zubilligen. Das Prinzip wird dadurch nicht geschmälert:
Daß man mit der Umwelt und besonders seinen Mitmenschen im Konflikt leben kann, dürfte wohl niemand bezweifeln. Daß man Unglücklichkeit aber ganz im stillen Kämmerchen des eigenen Kopfes erzeugen kann, ist zwar auch allgemein bekannt, aber viel schwerer zu begreifen und daher zu perfektionieren. Man mag seinem Partner Lieblosigkeit vorwerfen, dem Chef schlechte Absichten unterstellen und das Wetter für Schnupfen verantwortlich machen – wie aber bringen wir es alltäglich fertig, uns zu unseren eigenen Gegenspielern zu machen?
An den Zugängen zum Unglück stehen goldene Worte als Wegweiser. Und aufgestellt werden sie vom gesunden Menschenverstand, ganz zu schweigen vom gesunden Volksempfinden oder gleich gar vom Instinkt für das sich in der Tiefe vollziehende Geschehen. Doch letzten Endes ist es ganz nebensächlich, welchen Namen man dieser wunderbaren Fähigkeit gibt. Grundsätzlich handelt es sich um die Überzeugung, daß es nur eine richtige Auffassung gibt: die eigene. Und ist man einmal bei dieser Überzeugung angelangt, dann muß man sehr bald feststellen, daß die Welt im argen liegt. Hier nun scheiden sich die Könner von den Dilettanten. Letztere bringen es fertig, gelegentlich die Achseln zu zucken und sich zu arrangieren. Wer sich selbst und seinen goldenen Worten dagegen treu bleibt, ist zu keinem faulen Kompromiß bereit. Vor die Wahl zwischen Sein und Sollen gestellt, von deren Bedeutung bereits die Upanischaden sprechen, entscheidet er sich unbedingt dafür, wie die Welt sein soll, und verwirft, wie sie ist. Als Kapitän seines Lebensschiffs, das die Ratten bereits verlassen haben, steuert er unbeirrt in die stürmische Nacht hinein. Eigentlich schade, daß in seinem Repertoire ein goldenes Wort der alten Römer zu fehlen scheint: Ducunt fata volentem, nolentem trahunt – den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen zerrt es dahin.
Denn unwillig ist er, und zwar in einer ganz besonderen Weise. In ihm wird Unwilligkeit nämlich letzten Endes zum Selbstzweck. Im Bestreben, sich selbst treu zu sein, wird er zum Geist, der stets verneint; denn nicht zu verneinen wäre bereits Verrat an sich selbst. Der bloße Umstand, daß die Mitmenschen ihm etwas nahelegen, wird somit zum Anlaß, es zu verwerfen, und zwar selbst dann, wenn es – objektiv gesehen – im eigenen Interesse läge, es zu tun. (Reife, so lautet bekanntlich der ausgezeichnete Aphorismus, ist die Fähigkeit, das Rechte auch dann zu tun, wenn es die Eltern empfohlen haben.)
Doch das wahre Naturgenie geht noch einen Schritt weiter und verwirft in heroischer Konsequenz auch das, was ihm selbst als die beste Entscheidung erscheint – also seine eigenen Empfehlungen an sich selbst. Damit beißt sich die Schlange nicht nur in den eigenen Schwanz, sondern frißt sich selbst. Und damit ist ferner ein Zustand der Unglücklichkeit geschaffen, der seinesgleichen sucht.
Meinen minderbegabten Lesern kann ich diesen Zustand freilich nur als sublimes, aber für sie unerreichbares Ideal hinstellen.
Ende der Leseprobe