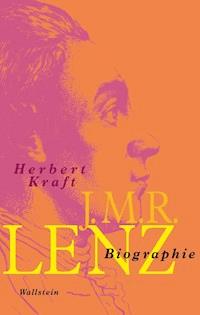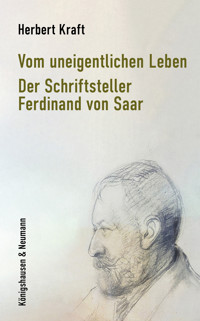9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) war die Schriftstellerin ohne Vorbilder, ihre Texte haben in der Literaturgeschichte Maßstäbe gesetzt: «Die Judenbuche» für Novelle und Erzählung, «Der Knabe im Moor» für die Ballade, die «Haidebilder» für die Landschaftsdichtung, das «Geistliche Jahr» für die religiöse Lyrik. Hinzugefügt werden kann jetzt: «Noth» für das sozialkritische Gedicht, «Grüße» für das biographische Gedicht. Und zu dem Gedicht «Im Grase» passt schon keine Einordnung mehr. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Herbert Kraft
Annette von Droste-Hülshoff
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848) war die Schriftstellerin ohne Vorbilder, ihre Texte haben in der Literaturgeschichte Maßstäbe gesetzt: «Die Judenbuche» für Novelle und Erzählung, «Der Knabe im Moor» für die Ballade, die «Haidebilder» für die Landschaftsdichtung, das «Geistliche Jahr» für die religiöse Lyrik. Hinzugefügt werden kann jetzt: «Noth» für das sozialkritische Gedicht, «Grüße» für das biographische Gedicht. Und zu dem Gedicht «Im Grase» passt schon keine Einordnung mehr.
Über Herbert Kraft
Herbert Kraft, geboren 1938 in Walsum (Niederrhein), Dr. phil. Tübingen 1962, Habilitation für Deutsche Philologie Tübingen 1970, o. Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte Münster 1972, Gastprofessor Armidale/Australien 1982 und 1985, Gastprofessor Kairo 1988, D. Litt, h. c. Sheffield 1997. Emeritiert 2003.
Veröffentlichungen: «Mondheimat. Kafka», 1983; «Editionsphilologie«, 2. Aufl. 2001; «Someone like K.: Kafka´s Novels». Translated from the German by R. J. Kavanagh, 1991; «Musil», 2003; «Literaturdidaktik. Mündigkeit als Lehr- und Lernziel», 2004; «Kleist. Leben und Werk», 2007; «J. M. R. Lenz. Biographie», 2015.
Lebensanschauung
Wie sie sich ihr Leben ausdachte, wie sie sein wollte, das steht, kaum verborgen durch den verschlüsselten Namen und die lustspielhafte Szenerie, in der Komödie Perdu! – als werde aus der Wirklichkeit zitiert. Das Stück spielt im Haus eines Verlegers. Unter den auftretenden Personen ist auch Anna Freyinn von Thielen, die aber meistens Frau von Thielen genannt wird und geradezu ein Wunschbild Annette von Droste-Hülshoffs ist: nicht Nette zu heißen, wie sie gerufen wurde und selber die Briefe an die Verwandten unterschrieb; confus zu sein, nicht wie sie selber es war, wirblich, als hätte sie einen Kreisel im Kopfe (9,104)[1], sondern wie Wilhelmine von Thielmann früher, ihre genaueste Freundinn (8,98), mit einem gesteigerten inneren Leben, dabei sehr liebenswürdig und beynahe glücklich (9,311); eine große schöne Frau zu sein; geliebt zu werden von dem, der roth würde wie ein Krebs, stachlicht wie ein Igel vor Eingeständnis; zu leben also wie in den «Gemälden der menschlichen Leidenschaften» (SD 75) von Jane Baillie, der ersten jetzt lebenden Schriftstellerin, dem weiblichen Shakspeare (MA II,9); zu leben so, dass die Personifikationen ein Teil der eigenen Existenz wären, aus keinem andern Grund entstand aus Joanna Baillie und ihrer literarischen Figur Jane De Monfort der Name Jane Baillie; ein weiblicher Bendemann zu sein, berühmt wie der Maler, dessen Bild «Die trauernden Juden im Exil» in Nachstichen und Lithographien verbreitet war; anerkannt zu sein als die Schriftstellerin, die besser schrieb als Freiligrath, sogar besser als Joanna Baillie, die doch nicht wahr genug schrieb, aber immerhin besser als die meisten Männer. (MA II,9)
In der letzten Szene des Stücks ist der poeta laureatus beim bacchantischen Fest auf dem Studentenboot Lætitia; von fern erkennt man auf dem Schiff drey Flaggen! blau, weiß, und roth, die Farben der Trikolore auf dem Dampfboot, das «die Bewegung der Zeit» in seinen Rädern hat.[2] An die weiße Fahne heftet jetzt der Dichter einen Kranz aus Rebenlaub, und wie er dabei seinen Mantel umgeschlagen hat, leuchtet dieser in Blau. Anna von Thielen ist da bereits weggegangen aus dem Haus mit dem Fenster zum Rhein, weggegangen voll Zorn über die Geringschätzung ihrer Gedichte, feuerroth im Gesicht um ihre Literatur. Aber einer hat sie begleitet, wüthend auch er, so schien es.
Sommer 1839 – Annette Droste hielt sich bei den Verwandten im Paderbornischen auf. Dort schätzte man ihre Schriftstellerei nicht sonderlich, aber man traute ihr zu, für das unruhige und doch nichtsthuerische Leben in Abbenburg und Bökendorf (8,310) Komödien zu verfassen; sie war ja auch, so hatte ihre Mutter schon früher nach Bökendorf geschrieben, der «Hoflustigmacher». (G 154) Die ärgerliche Einschätzung blieb auf Annette Droste nicht ohne Wirkung; halb verdrießlich wurde sie davon, halb unschlüssig (9,64), und im nächsten Frühjahr hatte sie sich zu dem, was ihr im Grunde widerstand, doch entschlossen. Freilich fehlte ihr die Intrigue des Stücks, der Stoff – bei allen Scenen, Situationen, lächerlichen Charakteren, die ihr in Ueberfluß zur Verfügung standen (9,98f.), wie in dem Lustspiel, das sie schließlich schrieb, als Charaktere Personen aus der Literaturszene wiedererkannt wurden: Der poeta laureatus trägt den Namen Friederich Sonderrath statt Ferdinand Freiligrath; der Dichter minimi moduli heißt Theofried Willibald, nicht Wilhelm Junkmann; Louise von Bornstedt erscheint als Claudine Briesen; in Seybold, Recensent, und nebenbei Dichter, ist Levin Schücking zu erkennen, noch daran, dass Seybold das kleine Pferdchen mit den langen Ohren heißt – so nannte Annette Droste Schücking, den Mann, für den sie, die fast achtzehn Jahre ältere Frau, das Mütterchen zu sein hatte.
Keiner lebt, wie er schreibt. Aber die Texte sagen, was einer will, verraten zugleich, was er entbehrt. Als Annette Droste 1841/42 ein halbes Jahr mit Levin Schücking in Meersburg war, hatte sie das Lustspiel zur Feilung mitgenommen. (9,264) Was sie auch verfasste, wollten sie anders, die Verwandten, die Bekannten und später die Interpreten, wollten es so, dass mit ein paar Worten, mit einer Zeile […] das Ganze klar gemacht wäre. Nur der Mann, der sie kannte, hielt sie als seine litterarische Freundinn. Es war überflüssig, dass Schücking in dem Buch, das er 1862 über Annette von Droste-Hülshoff veröffentlichte, die Leser «um Nachsicht» bat, weil in dieses «Lebensbild» er selbst mit eingezeichnet sei – es war ja kaum so. Und was er dort über die literarische Freundin sagte, nahm er mit dem letzten Satz des Zitats noch wieder zurück: «Das war eben das Eigenthümliche dieses Charakters […], daß seine größte Kraft sich concentrirte in der mit stahlscharfer Sonde eindringenden Menschenkenntniß, in dem genialen Urtheile über Welt und Verhältnisse, in dem ruhig klaren Blick, der durch alle Herzensfalten zu schauen schien. Diese Seite seines Wesens ist es ja, womit jeder geniale Geist den Horizont Derer, die ihm nahe treten, am meisten erweitert, und auf receptive verständnißvolle Naturen wenigstens, den dauerndsten Einfluß übt.» (SD 8f.)
Sie liebte ihn im Denken, in der Empfindung, mit ihrer Einbildungskraft. Aber das war bloß die gelebte Metapher, und die Wirklichkeit stand später in dem Buch über sie. Die Jahre, die sie ihn nicht gekannt hatte, drängten sie an ihn, auch weil es schon so spät war. Unterdem merkte sie nicht, dass er keine Anhänglichkeit hatte. Wenn es damals erlaubt gewesen wäre, hätte sie im Protevangelium des Jakobus, im 19. Kapitel, nachlesen können, wie jemand um denjenigen, den er als ihm zugehörig empfand, gebracht wurde und dies Schicksal annahm als Willen und Wirken Gottes: «Sie aber sprach zu mir: Wer ist die, die in der Höhle gebiert? Und ich sprach zu ihr: Meine Verlobte. Und sie sprach zu mir: So ist sie nicht dein Weib? Und ich sprach zu ihr: Es ist Maria, die auferzogen ward im Tempel des HERRN, und durchs Los ward sie mir gegeben zum Weib und ist doch nicht mein Weib, sondern sie empfing vom Heiligen Geist.»
Nachher, für Annette Droste und Levin Schücking, waren die Zugehörigkeiten vertauscht. Er war ihr Bild, sie sein Bild aber nicht; seine Jugend, sein Leben wollte es anders. Und wäre nicht er der Widerstrebende gewesen, hätte sie die Widerstrebende werden müssen, so würde es ihr Stand verlangt haben. Auch noch ihr Alter; die achtzehn Jahre ließen sich nicht streichen aus dem Lebensbuch. (1,160) Ihr Glück war es nicht, den einen Mann nicht zu verlieren trotz aller Wirrungen und Irrungen; ihr Unglück war, dass sie gar nichts verlor, was ihr angehört hätte. Aber keine Fügung wollte Annette Droste erkennen, und in ihr Schicksal ergab sie sich nicht. Sondern sie erfand sich als Individualität, erschrieb sich ein Leben.
Leben in Münster
Annette von Droste-Hülshoff wurde am 12. Januar 1797[3] in Haus Hülshoff bei Münster geboren, als zweites der vier Kinder von Clemens August Freiherrn Droste zu Hülshoff und Therese, geborener Freiin von Haxthausen. Zu früh geboren heißt ein 1841/42 geschriebenes Gedicht (MA I,36); die Fassung, in der es unter dem Titel Der zu früh geborene Dichter gedruckt wurde, enthält an der ersten Stelle keinen Reim: Acht Tage zählt’ er schon, eh ihn / Die Amme konnte stillen, / Ein Würmchen, saugend kümmerlich / An Zucker und Kamillen, / Statt Nägel nur ein Häutchen lind, / Däumlein wie Vogelsporen, / Und Jeder sagte: «armes Kind! / Es ist zu früh geboren!» Die Biographie stellt eine Reimordnung her: wenn er durch ich, dann ihn durch mich ersetzt wird; so hieß es auch in der ursprünglichen Version. Was in der ‹biographischen› wie in der ‹literarischen› Fassung steht, bestimmte Annette Drostes Leben als Vorstellung – Im zähen Körper zeigte sich – oder als Wirklichkeit – Zäh wilder Seele Streben.
Bis 1802 bestand noch das Fürstbistum («Hochstift») Münster. Hier konnte ein Landadliger durch die Wahl zum Bischof in den Reichsfürstenstand aufsteigen. Bei einer Sedisvakanz trat die «Domkapitularische Landes-Regierung» ein, ging alle Herrschaft, gingen zugleich die Einkünfte auf das Domkapitel über; die eigens geprägte Sedisvakanzmedaille zeigte die Wappen der Domkapitulare. De facto war das Domkapitel immer Mitregent, besonders seit das Hochstift, von 1723 an, wieder in Personalunion mit dem Kurfürstentum und Erzbistum Köln verbunden war. Der gewählte Bischof kam nach Münster, um die Huldigung der Landstände entgegenzunehmen, sonst zu eher seltenen Visitationen. Er hielt hof, der Kurfürst, in seiner Bonner Residenz, bald zudem im Poppelsdorfer Schloss sowie in Brühl auf Schloss Augustusburg; die Verwaltung des Bistums Münster überließ er dem Domkapitel und dem Domdechanten, zeitweilig gab es einen Minister für das Bistum.
Bei der Verbindung von Wahlstaat und Personalunion konnten sich, wenn vom Domkapitel ein neuer Bischof zu wählen war, Schwierigkeiten ergeben. «Wie hebbt nu enen gelehrten Kaplaon», wussten die Leute in Everswinkel, einem Kirchspiel im Münsterland, «denn äs lest de Domheeren den Landesfürsten wählen wullen, können se met de Sake nich up’t Reine kuemen; dao raipen se ussen Kaplaon daoto; de schmeet iär de Sake faots utenanner.»[4] Der Kaplan war Bernard Overberg, dem Annette Droste später begegnete. «Eine wunderbar naive Zeit» war es, stand 1841 in dem von Freiligrath und Schücking (mit Annette Drostes Hilfe) verfassten «Malerischen und romantischen Westphalen», als das «Stift auf seine gemüthliche Weise souverain über Land und Leute schaltete, oder nicht schaltete! Denn daß es nicht regierte, daß alles patriarchalisch aus Staats- und Regierungsrecht in den Bereich des Privatrechts gezogen wurde, war es allein, was die herrschenden Institute jener Zeit unangefochten ließ. Modernes Vielregieren hätte damals alles in die bunteste Verwirrung gestürzt.»[5] Über denselben Staat hatte der preußische Generalmajor von Blücher gesagt, hier verprassten «42 übermütige Domherren den Schweiß der Armut». (HT 29) Wie «auf dem Domhof […] des Abends die Laternen einen großem Schein von sich» warfen «als an andern Orten», so gaben «die auf selbigem wohnenden Domherren als der Clerus primarius einen größern Glanz von sich […] als andere» (L 30), schrieb Nikolaus Anton Lepping, Kaplan an der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti. Außer dem Domstift mit 41 Kapitularen und noch mehr Vikaren gab es in der Hauptstadt vier Kollegiatstifte (einschließlich des vor der Stadt gelegenen Stifts St. Mauritz), sieben Pfarren (zu denen auch die Stifte St. Ludgeri und St. Martini gehörten), vierzehn Klöster und Kongregationen. In Versen von Friedrich Raßmann war sogar die Landschaft als eine geistliche beschrieben: «Was ich mit Schmerzen vermisse? – Gesteilte Hügel und Berge, / Wo durch der Aussicht Magie höher sich stimmet der Geist. / ‹Aber dafür hast du wieder ja Cruzifixe, hochragend, / Kühn beflügelnd den Sinn. Rechn’ eins ins andre, mein Freund.›»[6]
Im Hochstift Münster gab es drei Landstände: 1. das Domkapitel, 41 Kapitulare aus den stiftsadligen Familien; 2. die Ritterschaft, über sechzig Mitglieder aus den stiftsadligen Familien; 3. die dreizehn landtagsfähigen Städte. Den Stiftsadel bildeten die Familien mit landtagsfähigen (innerhalb des Landes gelegenen) Gütern und sechzehn adligen Ahnen in der Generation der Ururgroßeltern; seit 1715 gehörte dazu wieder die Familie Droste-Hülshoff. Keine eigene ständische Vertretung hatten der nicht-stiftsfähige Adel, die niedere Geistlichkeit, die Beamten und Offiziere, die Bauern, die unterbürgerlichen und unterbäuerlichen Schichten. In Johann Ferdinand Neigebaurs «Katechismus der Münsterländer» konnte man später lesen, wodurch Münster sich auszeichnete als «das eigentliche wiedergefundene Paradies»: dadurch, «daß die wenigen adligen Familien Herren des Landes waren, die Bauern […] ihre Leibeignen, und der Mittelstand in ihren Privatdiensten, entweder als Juristen, Capläne, Aerzte oder auch Lieferanten. Besonders aber waren die Stifter die Hauptgrade der Glückseligkeit. […] Der älteste Sohn bekam das älterliche Vermögen, der andere wurde Domherr, der dritte Canonicus, und die Töchter alle Chanoinessen, so waren sie alle versorgt.»[7]
Für den Eintritt in das Domkapitel genügten die niederen Weihen, nur der Domdechant musste Priester sein; hinzu kam das «Biennium», ein Jahr und sechs Wochen Studium, eher Aufenthalt an einer Universität in Frankreich oder Italien, seit 1773 wurde genauso ein zweijähriges Studium an der neugegründeten Universität Münster anerkannt. Die meisten Domherren waren Subdiakone, hatten damit Sitz und Stimme im Kapitel, behielten trotzdem die Möglichkeit, wieder laisiert zu werden, falls sich ihnen eine andere Laufbahn eröffnete. Maximilian von Droste-Hülshoff, der Komponist, Annette Drostes Onkel, war Domherr von 1782 an, als er zugleich sein Studium in Münster begann, bis zu seiner Heirat 1788.
Ohnehin versahen die zum Domstift gehörenden Vikare für die Domherren den Gottesdienst in der Kathedralkirche, es sei denn, es war Sonntag und der Domkapitular war selbst Priester – und hielt sich nicht gerade, wenn er noch andere Präbenden besaß, in Osnabrück, Paderborn, Minden, Hildesheim auf. Mit seinem Vikar gemeinsam erfüllte der Domherr die Bedingung, an die der Apostel Paulus gemahnt: «Also hat der Herr befohlen, daß, die das Evangelium verkündigen, sollen sich vom Evangelium nähren.» (1 Kor 9,14) Auf das Evangelium leistete der Domherr auch den Eid. Wie die geistlichen waren die weltlichen Positionen im Staat meistens doppelt besetzt: für die vorderständischen Amtsinhaber, denen das Fachwissen und die Bereitschaft zu kontinuierlicher Arbeit fehlten, erledigten bürgerliche Beamte die Geschäfte. Nach demselben Muster entlastete in der Grundherrschaft der Rentmeister den Grundherrn.[8] Zwar galt der Domkapitular und Subdiakon Franz von Fürstenberg – Minister bis 1780, danach immer noch Generalvikar (mit den Aufgaben eines Unterrichtsministers und Kurators der Universität), zeitweise Kapitularvikar, ferner Domkapitular zu Paderborn, Propst von St. Martini und Archidiakon «aufm Dreen» bis 1793, Domkantor und Archidiakon zu Albersloh seit 1794 – zwar galt er, der nicht bloß Ämter hatte, sondern arbeitete und von seiner Arbeit etwas verstand, als öffentliches Vorbild, aber wer hätte ihm schon nacheifern wollen. Arbeitsfreiheit bewahrte vor den alltäglichen Misserfolgen. Das Sprichwort kannten jedoch alle: «Unterm Krummstab ist gut wohnen.»
Zum «Vielregieren» kam es, als das Hochstift aufgehoben wurde: die Hauptstadt und das östliche Münsterland fielen an Preußen zur Entschädigung für die linksrheinischen Gebiete, die im Frieden von Lunéville zu Frankreich kamen. Für den münsterischen Adel bedeutete die Säkularisation das Ende seiner ständischen Mitregentschaft, den Verlust der kirchlichen Ämter, Einkünfte und Versorgungsanstalten. Als ein Jahr nach der preußischen Besetzung «die Thore und Schilderhäuser […] schwarz und weiß gefärbet» wurden (L 18), sah man in Münster, wie im «Reichsdeputationshauptschluß» über das Land endgültig befunden worden war. Der neue Landesherr des preußischen «Erbfürstenthums Münster» hieß hier bloß der «lutherske Küenink»; seine Beamten nannten sie «dat prüüske Volk», die Offiziere «prüüske Windbüüls». (B 1,121f.) Verwundert waren die nach Münster versetzten Beamten nicht allein über die Sprache der Münsterländer und der Stadtmünsterer, genauso über das Erscheinungsbild der Hauptstadt mit ihren knapp 14000 «Bürgern», «Einwohnern» und Soldaten. «In dieser häßlichen, schmutzigen Stadt sollen wir künftig leben?» Das waren, erinnerte sich Karl Berghaus, die ersten Worte seiner Mutter, als die Wagen der Familie in Münster ankamen. Und unter Tränen rief sie: «O, unser liebes, hübsches, reinliches Cleve!» Trost wusste der Vater: «Siehe da den hohen, massigen Kirchthurm [von Liebfrauen-Überwasser]; eine Stadt, die so stattliche Kirchengebäude besitzt, kann im Innern auch nicht anders als schön sein.» (B 1,113)
Münster litt unter der Einquartierung. «Die Namen der Mannschaften […] waren auf den Hausthüren mit Kreide geschrieben»; Unteroffiziere liefen «die ganze Nacht auf Straßen und in Gassen» umher, riefen die Namen «mit lauter, oft brüllender Stimme» aus. (B 1,238) Der Alte Dom, die Gymnasialkirche St. Petri und die Jakobikirche auf dem Domhof wurden beschlagnahmt und fortan als Magazine genutzt; aus dem Minoritenkloster machten die «Ketzer» eine Kaserne; die Minoritenkirche wandelten sie gar in eine «lutherske Kiärke» um. Dort hingen nun keine Bilder mehr, die Wände waren geweißt, die Kirchenbänke «mit Oelfarbe weiß angestrichen», und merkwürdige Emporen waren eingebaut worden, welche «Einrichtung auf die Ständeverschiedenheit berechnet zu sein» schien, «da die Stühle dieser Emporkirchen von den Vornehmen, die Bänke im Unterraum aber von den Gemeinen besetzt wurden» (B 1,126f.) – wie im Theater. Ein besonderes Ärgernis stellte die Parade dar, von den Preußen jeden Sonntag auf dem Prinzipalmarkt abgehalten, zwischen 11 und 12 Uhr nach Beendigung des evangelischen Gottesdienstes, wenn in St. Lamberti noch das Hochamt andauerte. So konnte es nicht verwundern, dass die französischen Truppen, die nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 die Preußen in Münster ablösten, wie eine Befreiungsarmee empfangen wurden. «Dat sind doch no Lü, well met us in Eene Kiärke gaoht» (B 2,117), so sagte man im «westfälischen Rom» (HT 31), das manchmal nur das «westfälische Köln» war.[9] Die hohe Geistlichkeit und der Adel arrangierten sich schon deshalb lieber mit der französischen als mit der preußischen Fremdherrschaft, weil sie sich eine Wiederherstellung der altmünsterischen Verhältnisse ausrechneten. Das preußische Schwarz-Weiß durfte denn auch ersetzt werden, allerdings nicht durch das münsterische Gold-Rot-Silber, sondern durch das Rot der französischen Festungswerke.[10] Währenddem trugen die hohen Beamten der Regierung weiter ihre Dienstuniform; nur die preußischen Wappenknöpfe mussten mit «glatten» vertauscht werden. (HT 39)
Die Einquartierungen nahmen nicht ab. Und viel stärker betrieb die französische Regierung die erst eingeleitete Vermögenssäkularisation; an einem und demselben Tag im Dezember 1811 wurden «alle Capitel, das hochwürdige Domkapitel nicht ausgenommen, wie auch Hochadlichen und freyweltlichen Stifter und Klöster» aufgehoben. Nicht überall in Münster hörte man Klagen über die Maßnahme: Handwerker und Kaufleute verzeichneten Konjunktur, denn die Mönche, die sich in der Stadt niederließen, brauchten Möbel und Kleidung. Und «die Barmherzigen», die das Clemenshospital unterhielten, durften ja «nach abgelegtem Habit bleiben». (L 27f.) Aber dann sollte die Lambertikirche abgebrochen, der Kirchhof in einen Napoleonsplatz umgewandelt werden. Undenkbar für einen Stadtmünsterer: «sein liebes Münster» ohne den «Lambertthurm».[11]
Napoleon warf das Land «wie einen Ball bald sich, bald andern zu». [12] 1808 verfügte er den Anschluss des Oberstifts, des südlichen Bistumsteils, an das Großherzogtum Berg; zwei Jahre später gliederte er den größten Teil des Bistums mit der Hauptstadt in das Kaiserreich Frankreich ein, und aus «Münster in Westphalen» war plötzlich «Münster in Frankreich» geworden. Auf dem Domhof wurde die Guillotine errichtet; «das Militair exercirte an Sonn- und Feiertagen, auch aufm Domhofe, auch während des Gottesdienstes». Die Lebensart hatte sich gründlich verändert: «das Frauenzimmer» fing «häufig an auf das Eis mit Schlittschuhen zu jagen», und «die Mannspersonen sind mit Brillen auf der Nase über die Straßen gegangen», selbst «wenn sie nichts zu lesen hatten. […] Die Chaussé wurde gemacht und so, daß so viel möglich von einem Orte zum andern der geradeste Weg gewählt ward […]. Das Schönste unter französischer Regierung […] war die Sicherheit und ungestörte Ruhe auf Wege und Landstraßen, welche durch Gens d’armes befördert wurde». 1811 aber grassierte die Rote Ruhr; «das Todtengeläut» wurde «eingestellt […], um den Schwerlichkranken nicht zu erschrecken», und wo Sterbenden die heilige Kommunion gebracht wurde, durfte der Messdiener nicht schellen. (L 25f.,30,41f., 43)
Bis 1813 dauerte die «Franzosenzeit» Münsters, bis zur Schlacht von Leipzig, danach besetzten Truppen der Alliierten das Land. Die Einquartierungen wurden jetzt noch drückender. In Hülshoff waren es mal Preußen, mal Kosaken und Russen, Sachsen und Mecklenburger, Schweden und Dänen. Man lebte «wie im Lager», schrieb Annette Drostes Schwester Jenny in ihr Tagebuch. (T 1,91) In der Stadt brach der Typhus aus, «täglich wurden die Toten auf Karren nach Ueberwassers Kirchhof» vor dem Neuen Tor «gefahren und dort in große Gruben eingescharrt».[13] Wohl hatte sich beim Volk die Prophezeiung gehalten, dass der noch 1801 gewählte Fürstbischof, Anton Victor Erzherzog von Österreich, ein Bruder des Kaisers, endlich das Land regieren werde; aber in einer anderen Prophezeiung hieß es auch, das Eigentum werde abgeschafft[14], und daran glaubte doch niemand. So verbreitete sich allmählich die Einsicht, dass mit einer Wiederaufrichtung der stiftischen Länder nicht mehr zu rechnen sei, und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verband sich bald mit einem preußischen Münster. Die gesellschaftliche Grundlage der neuen Zeit – Kapital statt Stammbaum – existierte in Ansätzen schon: was die hohe Geistlichkeit, also der Adel, durch die Säkularisation an Pfründen in kirchlichem Besitz verloren hatte, konnten Bürger, Bauern und Pächter als Eigentum vom Staat erwerben. Darum hörte man in Münster mehr Zustimmung, weniger Kritik, als der Wiener Kongress 1815 Westfalen dem Königreich Preußen zuordnete. Die «Provinz Westphalen» wurde gebildet und Münster, ihre weitaus größte Stadt mit nunmehr 17000 Einwohnern (einschließlich des Militärs), zur Hauptstadt erklärt.
Nur einmal kam es zu offenem Widerstand gegen die Preußen, 1837, als der Erzbischof von Köln, früher Generalvikar, Kapitularvikar, zuletzt Weihbischof in Münster, Clemens August von Droste-Vischering, im Zusammenhang mit dem Kölner Kirchenstreit um den Hermesianismus und die Mischehenpraxis seines Amtes enthoben und verhaftet wurde. «Vivat Clemens August! nieder mit den Preußen!», riefen die Bürger, die aus der geringern und Mittelklasse, und warfen Steine gegen das Militär. (8,292f.) Der Adel entschloss sich, bis zur Beendigung der harten kirchlichen Lage, nicht die kleinste Lustbarkeit anzustellen oder mitzumachen, und blieb auf dem Lande. (9,13) Im Bericht eines preußischen Offiziers über die «Münstersche Revolution» hieß es, «der einzige Zweck der Unzufriedenheit» habe darin bestanden, «durch eine Unordnung der Staatsregierung beizubringen, dem hiesigen Volke gehe sein Adel und die Geistlichkeit über Alles».[15] Später las man im Roman «Die Ritterbürtigen» von Levin Schücking: Wie hatte nicht der «Einfluß» des Adels «sich gehoben», seitdem er «in dem kölnischen Zerwürfnisse […] die populaire Meinung» des Landes vertrat.[16] Das Gefühl, in einer Gemeinschaft zu leben und trotzdem in wohlgeordneter Hierarchie, hatten sie alle nur in der Kirche; wenige Tage, bevor im Dezember 1845 Annette Drostes Onkel Friedrich von Haxthausen in Münster starb, nahm an der Neuntägigen Andacht, die für ihn gehalten wurde. fast Alles teil, was vom Adel in Münster war, dazu viele vom Bürgerstande, – Herrschaften und Domestiquen. (10,338)
1808, als aus Münster 98 Männer zur großherzoglich-bergischen Armee eingezogen wurden, als es in den angrenzenden Staaten zu vermehrten Rekrutenaushebungen kam und in deren Folge zu Bauernunruhen, verfasste Annette Droste das Lied eines Soldaten in der Ferne. Noch wurde eine Vorlage umgeschrieben, die künstlerischen Mittel waren zusammengeborgt, die «Westphälischen Vorgeschichten», die ihr Vater gesammelt hatte, sagten die Erfahrungen voraus. Trautere Heymath des besten der Väter / Jetzt so entfernt von dem liebenden Sohne / Wo ich bey kindischen Spielen so froh war / Seh ich! ach seh ich dich nimmermehr wieder // Jahre auf Jahre sind ja schon verflossen / Seit ich die Heymath der Eltern verlassen / Doch zu vergessen unmöglich dem Herzen / Das nur die stillere Einigkeit liebt // Jetzt wo im wilderen Zeitengetümmel, / Kriege auf Kriege und Schlachten sich häufen / Gerne jetzt kehrt ich zur Heymath der Trauten / Gerne jetzt kehrt ich zum Vater zurück // Aber die Pflicht ist’s des kriegrischen Lebens / Immer zu bleiben im offenen Felde / Siegend zu leben in siegender Hoffnung / Siegend zu leben und siegend zu sterben // Drum nur ermuntert was hilft mir das Sorgen / Nimmer gelang ich zum liebenden Ziele / Immer im kriegrischen Stande zu bleiben / Ist meine Pflicht und ist mir Geboth. Das Gedicht schildert 1808 keinen Traum vom Frieden nach den Kriegshandlungen, sondern den Albtraum eines anhaltenden Kriegs. Darin ist es geradezu die Kontrafaktur des bei Salis-Seewis im «Lied eines Landmanns in der Fremde» Angelesenen, durch die Vertonung von Vincenzo Righini vertraut Gewordenen. Und der neue Text zeigt den Krieg als Gewalt gegen den Einzelnen. Ziemliche Mühe hatte die Verfasserin, die metrische und strophische Vorgabe auszufüllen mit Wiederholungen, Ellipsen, Parallelismen; an einer Stelle – im fünften Vers – blieb die metrische Betonung gar auffällig falsch; der absolute Komparativ – trautere, stillere, wilderen – war das Mittel zur Ausdruckssteigerung nach dem Vorbild Klopstocks. Von dem hatte Annette Droste jedoch auch die reimlosen Verse gelernt, und die Geminationen – Jahre auf Jahre, Kriege auf Kriege – verraten keine Unbeholfenheit der allzu jungen Dichterin mehr. Die Stilfiguren haben jetzt eine geschichtliche Bedeutung: das Elend wird dauern. Die Tugenden des christlichen und bürgerlichen Zeitalters sind dann, ablesbar an der Pflicht […] des kriegrischen Lebens, Reduktionen des Individuellen auf fremde Zwecke, und die Hoffnung, die wieder im Parallelismus abgebildet ist: Siegend zu leben in siegender Hoffnung / Siegend zu leben und siegend zu sterben, diese Hoffnung verliert, sichtbar in der Versstellung, ihre Position an das Sterben.
Welches die Ursache des Verkehrten in der Welt sei, das steht nicht im Gedicht, das wusste seine Verfasserin nicht. 1808 war für sie dies Verkehrte plötzlich da im Münsterland, und während die Historiker die Geschichte von oben schrieben, die Adligen den Offiziersberuf ausübten wie Annette Drostes Onkel Friedrich Wilhelm von Haxthausen in Diensten Jérômes, des in Kassel residierenden Königs von Westphalen, ist in den Text die Erfahrung eingegangen, die vom Krieg Betroffene machen. Dem Unterleutnant Haxthausen schrieb Annette Droste etwa zur selben Zeit, als das Lied eines Soldaten in der Ferne entstand, ein Gedicht (Freundlicher Morgen der jedes der Herzen) in den fernen und fremden Krieg hinterher; aber das war dann bloß ein Rollengedicht, in dem der Abwesende sprach wie in einem gekürzten Text von Salis-Seewis.
Aus Bildung und Erfahrung, in der Orientierung an literarischen Mustern ist mit dem Lied eines Soldaten in der Ferne