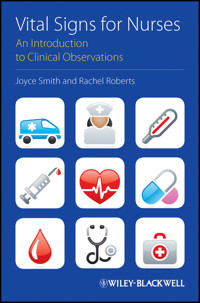Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Joyce Smiths Sohn bricht in einen zugefrorenen See. 20 Minuten ist er unter Wasser verschollen. Als er schließlich geborgen wird, ist er tot. Doch Joyce nimmt all ihren Glauben zusammen und wendet sich mit einem letzten verzweifelten Schrei an Gott – und das Herz ihres Sohnes beginnt wieder zu schlagen. Es folgen bange Tage, in denen Johns Leben am seidenen Faden hängt. Doch entgegen aller Expertenmeinungen kann er sechzehn Tage später das Krankenhaus verlassen – völlig geheilt. Die wunderbare Geschichte einer unglaublichen Rettung zeigt: Wenn wir Gott vertrauen und an seine Hilfe glauben, ist mit ihm nichts unmöglich. 2019 wurde die bewegende Geschichte von John Smith außerdem im Film "Breakthrough - Zurück ins Leben" verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
JOYCE SMITH
mit Ginger Kolbaba
AUFDÜNNEM
Eis
Ich wagte zu beten -und mein toter Sohn lebte
Aus dem amerikanischen Englischvon Heide Müller
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7412-1 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-5842-8 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
© der deutschen Ausgabe 2018
SCM Verlagsgruppe GmbH · Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Originally published in English under the title: The Impossible
The Impossible
Copyright © 2017 by Joyce Smith
This edition published by arrangement with Faith Words, New York,
New York, USA. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische
Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse folgender Ausgabe entnommen:
Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006
SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.
Weiter wurden verwendet:
Hoffnung für alle ® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.®.
Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Fontis –
Brunnen Basel
Übersetzung: Heide Müller
Umschlaggestaltung: Patrick Horlacher, Stuttgart
Titelbild: Michael Aleo, Tom Barrett, Nathan Anderson
www.unsplash.com
Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach
INHALT
1 | Eine böse Vorahnung
2 | Auf dünnem Eis
3 | Wettlauf zum Krankenhaus
4 | Das Gebet einer Mutter
5 | Der schönste Ton der Welt
6 | Nur ein Herzschlag
7 | Genug gehört!
8 | Die Macht der Worte
9 | Engel halten Wacht
10 | Meine längste Nacht
11 | Wider medizinisches Wissen
12 | Ein wundervoller Tag
13 | Frieden und Unruhe
14 | Ein schrecklicher Tag
15 | Zusammenbruch
16 | Angst und Vertrauen
17 | Loslassen
18 | Die Grenzen der modernen Medizin
19 | Eine liebevolle Hand
20 | Wunder über Wunder
21 | Auf wackeligen Beinen
22 | Lasst mich hier raus!
23 | Viele Fragen
24 | Das Unmögliche
EPILOG
NACHWORT von Jason Noble
ANMERKUNG DER AUTORIN
ANHANG
An der Schrift festhalten
Dr. Sutterers Brief an die Schüler der christlichen Mittelschule
DANK
ÜBER DIE AUTORINNEN
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1.
EINE BÖSE VORAHNUNG
Sonntag, 18. Januar 2015
Spannung lag in der Luft. Üblicherweise schrien bei Basketballspielen in der christlichen Mittelschule Living Word Schüler und Geschwister wild durcheinander, jubelten und feuerten ihre Mannschaft an, Eltern erteilten lautstark Ratschläge, Schiedsrichter pfiffen und Trainer riefen den Spielern Anweisungen zu. Aber bei diesem Spiel war es ungewöhnlich still. Keine Schreie oder Jubelrufe. Wir hörten nur die Stimmen der Spieler, die sich untereinander austauschten, den Aufprall des Balls auf dem Holzboden und das quietschende Geräusch der Schuhsohlen bei jeder Drehbewegung. Unser Achtklässler-Team A, die Eagles, hatten im Spiel gegen die Duchesne Pioneers einen toten Punkt erreicht. Wir gewannen einfach keinen ausreichenden Vorsprung. Diese Saison war für unser Team bisher nicht so gut gelaufen, deshalb brauchten wir unbedingt einen Sieg. Aber den schien uns das Duchesne-Team nicht zu gönnen. Bei jedem Punkt, den unser Team holte, gelang den Pioneers kurz darauf der Ausgleich. Elf, elf. Fünfzehn, fünfzehn. Zweiundzwanzig, zweiundzwanzig.
Wie gebannt verfolgte ich den gut aussehenden schwarzhaarigen Jungen mit der olivbraunen Haut, der das Trikot mit der Nummer 4 auf dem Rücken trug. Schwarz, Petrol und Weiß waren die Farben seiner Mannschaft. Als Point und Shooting Guard (Verteidiger und Werfer) gab mein Sohn John die Taktik vor, kontrollierte das Tempo und sprach mit dem Schiedsrichter, wenn einer der Spieler ein Problem hatte. Er holte auch die meisten Punkte für sein Team. Gar nicht so schlecht für einen Jungen von nur 1, 62 Metern. Zu behaupten, ich sei stolz auf ihn, wäre maßlos untertrieben. In meinen Augen war er einfach genial. Was heißt in meinen Augen – er war genial. Das bedeutet aber nicht, dass ich deshalb über seine Macken hinweggesehen hätte, zum Beispiel seinen Hang, mit dem Trainer über die richtige Taktik zu streiten und entrüstet die Augen zu verdrehen. Dafür hatte der Trainer ihn beim letzten Mal vom Feld genommen.
Ich war froh, dass John dieses Mal wieder mitspielen durfte, wusste jedoch, dass der Vorfall vom letzten Mal immer noch an ihm nagte. Aber er spielte konzentriert, sein Kampfgeist war voll erwacht. Er schob sich vor andere und löste sich durch geschickte Finten von seinen Gegnern. Basketball war sein Leben. Schon im Alter von drei Jahren hatte er einen Basketball in den Händen gehalten. Bei jedem Spiel ging es für ihn um alles oder nichts.
Nun war die Zeit fast abgelaufen – und noch immer stand es unentschieden. Mein Mann Brian und ich waren völlig fertig von dem spannenden Spiel. Wie musste es da erst John und seiner Mannschaft gehen? Die Anzeigetafel zeigte dreiunddreißig zu dreiunddreißig, als im letzten Viertel nur noch vierzig Sekunden zu spielen waren. Ganz plötzlich, wie aus dem Nichts, eroberte John den Ball, rannte über das Feld und dribbelte auf den Korb zu. Er löste sich blitzschnell von seinem Gegner und setzte zum Wurf an. Der Ball flog durch die Luft und rauschte durch das Netz. Ein perfekter Korbleger!
Fünfunddreißig zu dreiunddreißig.
Brian und mich hielt nichts mehr auf unseren Sitzen. Zusammen mit den anderen fünfzig bis siebzig Zuschauern auf der Tribüne brachen wir in lauten Jubel aus. Unsere Eagles hatten den Sieg nun fast in der Tasche.
Die Uhr lief ab, während die Pioneers vergeblich versuchten, noch auszugleichen. Der Schlusspfiff ertönte. Die christliche Mittelschule hatte gewonnen! Und mein Sohn hatte den entscheidenden Korb geworfen.
Die Spieler warfen sich übereinander, umarmten sich, schrien und lachten. Sie hatten sich so angestrengt für diesen Sieg und nun war es Zeit zum Feiern. Da sie am nächsten Tag wegen des Martin-Luther-King-Gedenktags schulfrei hatten, hatten sie dafür ausreichend Zeit.
Brian und ich verließen die Tribüne. Wir wussten, dass die Jungs einige Zeit brauchen würden, um sich so weit zu beruhigen, dass sie zum Umziehen in die Kabinen verschwinden würden und bereit wären, nach Hause zu fahren. Daher stellten wir uns darauf ein, geduldig zu warten. John kam jedoch mit seinen beiden Freunden und Teamkollegen Josh Rieger und Josh Sander schnurstracks auf uns zu.
Ich stöhnte innerlich, denn ich wusste, was sie wollten. Das ganze Wochenende hatte John mir in den Ohren gelegen, dass er nach dem Spiel zusammen mit Josh Sander bei Josh Rieger übernachten wollte. Und das ganze Wochenende über hatte ich ihn abgewimmelt, weil ich das nicht wollte. Warum, konnte ich selbst nicht erklären, ich hatte einfach ein ungutes Gefühl dabei.
Solche bösen Vorahnungen waren eher selten bei mir, aber wenn sie hochkamen, hatte ich gelernt, darauf zu hören, denn sie waren immer ein Zeichen dafür, dass irgendetwas passieren würde. In einer bestimmten Situation wurde das besonders deutlich. Einer meiner älteren Söhne, Tom, war gerade neu an der High School, als eines Tages sein Footballtrainer vor unserer Tür stand und fragte, ob Tom auf ein Trainingslager mitkommen dürfe. Irgendetwas an diesem Trainer gefiel mir nicht. Er war zwar nett, aber ich konnte mein Unbehagen einfach nicht abschütteln. Deshalb sagte ich Nein. Einige Monate später wurde dieser Trainer festgenommen, weil er Jungen sexuell belästigt hatte.
»Bitte, Mrs Smith! Kann John bitte mitkommen? Lassen Sie ihn bei mir übernachten. Biiitte!« Die beiden Joshs hatten sich gegen Brian und mich verschworen. Sie wussten, bei Brian würden sie leichtes Spiel haben, bei mir aber mussten sie hartnäckig sein.
»Darf ich, Mom? … Darf ich?«, rief auch John.
Alles in mir wehrte sich, ich wollte seinen verschwitzten Körper in meine Arme schließen und ihn nach Hause in Sicherheit bringen – aber wovor? Das wusste ich nicht. Stattdessen sah ich in die großen dunklen Augen, die vor Aufregung leuchteten. Wie konnte ich ihm diesen Wunsch abschlagen? Schließlich hatten sie gerade das Spiel gewonnen und alle drei waren gute Jungs. John hatte schon oft bei Josh Rieger übernachtet. Die Riegers waren eine nette Familie und Kurt und Cindy, Joshs Eltern, verantwortungsvoll und aufmerksam. Ich mochte sie und vertraute ihnen unseren Sohn gern an, und John fühlte sich wohl bei ihnen.
Sicher geht mein mütterlicher Beschützerinstinkt mit mir durch, dachte ich. Ich sah diese Vierzehnjährigen an, wie sie vor mir standen, so wild darauf, ihren Sieg noch weiter zu feiern und nach der Anstrengung etwas gemeinsam zu unternehmen. Joyce, sei doch kein Spielverderber. Das kannst du nicht machen!
»Mom?« John brauchte eine Antwort.
Ich seufzte und nickte, wider besseres Wissen, denn ich konnte meinem Kind etwas so Belangloses nicht einfach verwehren. Bestimmt war ich nur überbesorgt. »Okay. Du darfst.«
Die Jungs schrien erleichtert. »Oh, danke, Mrs Smith. Super! Wir werden –«
»Passt einfach auf, dass euch nichts passiert. Und macht keine Dummheiten!« Ha, dachte ich. Sie sind vierzehn. Sie sind Jungs. Natürlichwerden sie Dummheiten machen.Solange es nur keine gefährlichen sind …
»Danke, Mom! Danke, Dad!«
»Und melde dich mal«, rief ich John noch zu, als Brian und ich unsere Mäntel holten und aufbrachen.
»Mach ich. Bis bald.«
John drehte sich um und rannte zu seinen Teamkollegen, die immer noch mit ihrem Trainer feierten.
John hielt Wort und schickte mir am späten Abend noch eine Textnachricht. Es sei voll cool. Sie würden mit Josh Riegers Familie zusammen Pizzabrötchen essen und Call of Duty spielen. Nichts Besonderes.
Ich lächelte erleichtert. Die Jungs waren in Ordnung. Ich konnte mir meine Unruhe nicht mehr erklären. Was war schon dabei, dass John dort übernachtete? Kein Grund zur Sorge, sagte ich mir.
Was John mir nicht erzählt hatte, war, dass er mit seinen Freunden am frühen Abend aus Langeweile einen Abstecher zum Lake Ste. Louise gemacht hatte. Sie liebten diesen kleinen, nur zwei Häuserblocks von den Riegers entfernt gelegenen See. Als sie sahen, dass er zugefroren war, kamen sie auf die verrückte Idee, hinaus aufs Eis zu laufen, sich hinzuhocken, ein Selfie zu schießen und es auf Instagram zu posten. Sie waren nur leicht angezogen. John trug Shorts und ein ärmelloses T-Shirt. Es war zwar warm für einen Januartag in der Region St. Louis, aber trotzdem … Shorts und ein ärmelloses T-Shirt? Hätte ich von seinem unpassenden Aufzug gewusst – oder vielmehr von seinen Eskapaden auf dem Eis –, wäre ich schnurstracks hingefahren und hätte ihn nach Hause geholt. Aber ich wusste nichts davon. Eltern wissen so selten etwas von dem, was ihre Vierzehnjährigen tun – leider!
Nachdem wir unserem Sohn noch »Wir lieben dich« geschrieben hatten, gingen Brian und ich zu Bett, ohne etwas von diesem Ausflug aufs Eis zu ahnen.
Montag, 19. Januar 2015
Der nächste Morgen verlief ohne besondere Ereignisse. Brian ging zu seiner Arbeit als Spezialist für Unternehmensmedien-Events bei Boeing, denn der Martin-Luther-King-Gedenktag war in seinem Unternehmen kein offizieller Feiertag. Ich fütterte unseren Hund Cuddles und kuschelte mit ihm, telefonierte mit meiner Schwester Janice, nahm mir etwas zu essen und meine Bibel und setzte mich damit in die Küche, um mit Gott allein zu sein.
Dort sah ich auf die Uhr meines Handys. Es war fast zwanzig nach elf. Joshs Mutter Cindy und ich hatten vereinbart, den »Kindertausch« erst am Nachmittag vorzunehmen, also blieb mir noch etwas Zeit. Cindy wollte mir Bescheid geben, wenn sie losfuhren. Üblicherweise traf ich Cindy und die Jungs in einem Kaufhaus oder irgendwo auf halbem Weg, da wir in St. Charles, Missouri, wohnten, und sie fast zwanzig Minuten entfernt in Lake St. Louis, etwa fünfundsechzig Kilometer entfernt von der Großstadt St. Louis. Wenn wir uns auf halbem Weg trafen, musste keiner von uns die ganze Strecke zurücklegen.
Nach dem Abholen würde John wohl noch ins Freizeitzentrum Rec Plex bei uns in der Stadt gehen wollen, um ein paar Körbe zu werfen und zu trainieren, das tat er gewöhnlich an schulfreien Tagen. Ich fragte mich, ob er am liebsten direkt dorthin fahren oder vorher noch einen kurzen Stopp zu Hause einlegen würde. Daher beschloss ich, das mit ihm zu klären. Auf meinem Telefon war es nun 11:23 Uhr und ich überlegte, was sie wohl gerade taten.
»Hey, fahren wir gleich zum Rec Plex oder willst du erst noch mal heim und wann?«, schrieb ich ihm.
John antwortete sofort: »Schreib Cindy, KA.« KA, das wusste ich, war die Abkürzung für »Keine Ahnung«.
Was hat Cindy damit zu tun, ob John ins Freizeitzentrum fahren oder vorher noch einmal heimwill?, fragte ich mich. »Nein«, schrieb ich zurück. »Ich frage dich, wie es aussieht mit dem Rec Plex. Ja oder nein?«
»IME.« Ist mir egal. »Kommt Dad auch?«
Ich lächelte. John und sein Vater unternahmen gern etwas miteinander. Sie machten zusammen Sport, gingen ins Freizeitzentrum und frühstückten, seit John acht Jahre alt war, jeden Samstag »unter Männern« im Waffle House in der Stadt.
»Nein, er ist auf der Arbeit. Er kommt erst später nach Hause. Vielleicht dann. Ich weiß es nicht.«
»Okay«, schrieb er zurück. Das war alles. Frustriert seufzte ich. Ich wusste nicht, wozu er sein Okay gab, und hatte auch keine Antwort bekommen, ob wir gleich zum Rec Plex fahren würden oder ob er noch einmal heimwollte. »Das Kind bringt mich noch ins Grab«, grummelte ich. »Ich rufe ihn einfach an.«
Um 11:26 Uhr wählte ich die Nummer meines Sohnes, entschlossen, eine Antwort auf meine Frage zu bekommen.
Er nahm sofort ab. »Hallo!«
»Du hast meine Frage nicht beantwortet«, sagte ich. »Willst du jetzt ins Rec Plex oder nicht? Wenn ja, kann ich Cindy bitten, dich dort abzusetzen, und dich später abholen.«
»Hm, ja, klingt gut«, sagte er. Er wirkte fröhlich, als sei sein Tag bisher gut gelaufen.
»Okay, also dann bis später. Ich hab dich lieb.«
Nachdem diese Sache nun geklärt war, widmete ich mich wieder meinem Smartphone, diesmal jedoch aus einem anderen Grund. Ich öffnete die Facebook-App und besuchte die Seite von Mark Callaway, dem ehemaligen Jugendpastor meiner älteren Söhne. Mark arbeitete in einer Gemeinde, in die wir als Familie vor vielen Jahren gegangen waren, als wir noch in Indianapolis gelebt hatten. Er und seine Frau Leslie waren gute Freunde von uns. Mark postete täglich Andachten auf Facebook und ich versuchte, sie jeden Morgen zu lesen. Was er schrieb, schien mir immer genau das bewusst zu machen, was ich für den Tag brauchte.
Was tun, wenn du in einer Krise steckst, sei sie nun selbst verschuldet oder durch andere verursacht? Wir können dasitzen und uns aufregen, wie gemein uns jemand behandelt hat, oder uns einreden, was für Versager wir doch sind … aber das nützt rein gar nichts (außer dass wir es aufschieben, die Dinge in Angriff zu nehmen). David schrieb »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht?«, und kaum einen Atemzug später sagte er, dass Gott heilig ist und Israel ihn mit seinen Liedern lobt (Psalm 22). An anderer Stelle sagt die Bibel, wir sollen Gott in allen Dingen danken (1. Thessalonicher 5, 18). Sorge und Entmutigung sind ganz natürliche Reaktionen. Es kommt darauf an, was wir damit tun. Bleiben wir dabei stehen oder gehen wir weiter? Wenn wir uns von einem großen Problem weg- und unserem großen Gott zuwenden, eröffnet uns das eine neue Perspektive und hilft uns über unsere emotionale Kurzsichtigkeit hinweg. Gehen wir noch einen Schritt weiter und danken wir Gott für die Herausforderung, dann beginnt der Prozess der Überwindung. Wenn wir Gott als größer ansehen und anfangen, ihm für die Herausforderung zu danken, nehmen wir die Herausforderung als etwas an, was wir mit Gott besiegen können … Dann wissen wir nach der Krise mehr von Gott als vorher.
In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Es war 11:51 Uhr und Cindy war am Apparat.
Johns Tag hatte gut begonnen. Das Land feierte an diesem Tag das Leben von Martin Luther King jr. und die Errungenschaften seiner Bürgerrechtsbewegung. John und seine zwei Freunde hingegen fanden es einfach nur cool, schulfrei zu haben. Sie standen spät auf und beschlossen dann, mit Joshs älterer Schwester Jamie noch einmal hinunter zum See zu laufen. Schließlich hatte das Eis am Vorabend gehalten, als sie ihr Foto geschossen hatten, also war es doch noch einen Versuch wert! Ein gefrorener See – eine Seltenheit in unserer Region – war einfach zu verlockend.
Im strahlenden Licht der Sonne wirkte der See, als wäre er aus purem Glas. Es war ungewöhnlich warm für die Jahreszeit und das Thermometer würde im Laufe des Tages noch auf zehn Grad Celsius klettern. Ein perfekter Tag für Mitte Januar und ein willkommener Ausgleich für den Kälteeinbruch mit Temperaturen unter null.
Nur mit Muskelshirts und kurzen Hosen bekleidet sammelten die Jungs zunächst ein paar Steine am Ufer auf und warfen sie aufs Eis, um die Dicke zu prüfen. Zufrieden, dass es wohl noch stabil genug war, sie auch an diesem Tag zu tragen, wagten sie sich hinaus, mit jedem Schritt ein Stück weiter. Jamie hingegen war die Sache zu riskant und sie blieb am Ufer zurück. Die Jungen lachten, rutschten und fanden es toll, auf dem Wasser »gehen« zu können.
Auf dem Gebiet der Gemeinde St. Louis in Missouri gibt es zwei benachbarte Seen. Mit einer Fläche von etwas mehr als 260 Hektar ist der Lake St. Louis der deutlich größere. Seine kleine Schwester, der Lake Ste. Louise, ist mit nur 28 Hektar zwar nicht sehr groß, aber dennoch tief – an den meisten Stellen zwischen fünfzehn und achtzehn Meter – und der Grund ist mit Schlick und Schlamm bedeckt. Bei Gewässern ist die Größe jedoch nicht der entscheidende Punkt. Unter ungünstigen Bedingungen kann einer Person ein Teich genauso zum Verhängnis werden wie das offene Meer. John hatte dies erst im Sommer hautnah erfahren, als er und Josh Rieger in genau diesem See bis zur Mitte hinausgeschwommen waren und ohne Hilfe nicht mehr allein zum Ufer zurückschwimmen konnten.
Aber heute lag für John der Gedanke an den Vorfall an jenem warmen Sommertag in weiter Ferne und er ließ sich unbekümmert über die Eisfläche gleiten. Er und seine Freunde rutschten und hüpften auf dem Eis herum, ungeachtet der Gefahr, dass es brechen könnte. Es reizte sie auszuprobieren, wie weit hinaus zur Mitte sie sich wagen könnten. Währenddessen blickte nur wenige Meter entfernt an der westlichen Uferseite Ron Wilson, der Manager des Klubhauses am Lake Ste. Louise, aus seinem Bürofenster, sah das Treiben der Jungen und lief hinaus, um sie zur Rede zu stellen.
»Hey Jungs!«, schrie er. »Ihr müsst runter vom Eis! Es ist zu gefährlich da draußen. Kommt sofort zum Ufer!«
Sie nahmen seine Warnung zwar zur Kenntnis, hatten es aber offenbar nicht eilig, darauf zu hören. Schließlich ging Ron zurück in sein Büro. Mittlerweile hatten John und ich uns Textnachrichten geschrieben. Als ich ihn anrief, um mit ihm die Sache mit dem Rec Plex zu klären, stand er gerade fünfzehn Meter vom Ufer entfernt – und ich hatte keine Ahnung!
Eine Eigenart meiner vier Söhne ist, dass sie beim Telefonieren andauernd auf und ab laufen. Wenn ich sie lange genug in der Leitung halten würde, könnten sie es vermutlich zu Fuß bis nach Kalifornien schaffen. Als ich also um 11:26 Uhr an diesem Vormittag mit ihm sprach, im Sitzen und mit festem Boden unter den Füßen, schritt er gedankenlos hinaus auf immer dünneres Eis.
Nur wenig später grollte ein bedrohliches Krachen über den See. Das Eis brach unter Johns Füßen und das Wasser schlug über ihm zusammen. Josh Sander ließ sich sofort auf Knie und Hände fallen und versuchte, Johns Hand zu ergreifen. Aber auch unter ihm brach das Eis. Sofort eilte aus einigen Metern Entfernung Josh Rieger seinen Freunden zur Hilfe. Auf dem Bauch liegend wollte er John aus dem Wasser ziehen, fiel dabei aber selbst hinein.
Die Jungen platschten und strampelten wild in dem verzweifelten Versuch, sich aus dem Zugriff des dunklen, eiskalten Wassers zu befreien.
Um 11:33 Uhr warf Ron Wilson erneut einen Blick aus seinem Bürofenster, aber diesmal wurde er Zeuge, wie das Eis einbrach und die Jungen verschluckte. Er wählte sofort die Notrufnummer 911 und informierte die Polizeidienststelle Lake St. Louis.
Draußen rief John Jamie Rieger zu: »Ruf die 911! Ich will nicht sterben!«
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
2.
AUF DÜNNEM EIS
Montag, 19. Januar 2015
Um 11:35 Uhr ertönte der Alarm bei der Feuerwehr Lake St. Louis und bei der des Nachbarbezirks Wentzville.
Als die ersten Helfer auf dem Weg zum See waren, gelang es Josh Sander gerade, ein Stück festes Eis zu ergreifen und sich aus eigener Kraft herauszuziehen. Halb kriechend, halb rutschend erreichte er schließlich den Bootssteg beim Klubhaus, der der Einbruchstelle am nächsten gelegen war. John und Josh Rieger strampelten immer noch wie wild im Wasser und gingen immer wieder unter. Schließlich schaffte es John, Josh über den Rand der Eisfläche zu schieben, während er verzweifelt versuchte, sich auch selbst herauszuziehen.
Die Polizeibeamten Rick Frauenfelder und Ryan Hall saßen gerade in der Polizeidienststelle Lake St. Louis, schrieben Berichte und arbeiteten die Aktenstapel auf ihren Schreibtischen ab, als der Notruf sie erreichte. Drei Teenager seien auf dem Lake Ste. Louise ins Eis eingebrochen. Augenblicklich ließen sie alles liegen und rannten zu ihren Streifenwagen. Mit Blaulicht und Sirenen rasten die beiden Polizisten zum nahe gelegenen See. Officer Hall fuhr um den See herum zur anderen Uferseite hinüber, Officer Frauenfelder zum Anlegesteg beim Klubhaus. Keiner von beiden wusste, wo die Jungen genau eingebrochen waren. Wenn sie sich aufteilten, würde einer von ihnen die Stelle hoffentlich schnell finden.
Als die Beamten am See eintrafen, befanden sich der Brandmeister des Feuerwehrbezirks Wentzville, Chief Mike Marlo, und seine Frau Kathy gerade mit ihrem Wagen auf dem Weg ins Zentrum von Wentzville zur Parade anlässlich des Martin-Luther-King-Gedenktags. Sie sollten dort die Rettungskräfte ihrer Gemeinde vertreten – eine gute Sache, die sie gern unterstützten. Sie waren fast am Ziel angelangt, als der Feueralarm einen Notruf ankündigte. Chief Marlo horchte genau auf die Ansage: »Eisrettungseinsatz, drei dreizehn bis fünfzehn Jahre alte Jungen, Lake Ste. Louise.« Als Bezirksbrandmeister übernahm Marlo zwar keine Bereitschaftsdienste, er fühlte sich aber irgendwie gedrängt, in diesem Fall selbst dabei zu sein. Ohne genau erklären zu können, warum, wusste er, dass er dort gefragt war.
Er sah seine Frau an und sagte: »Wir fahren zu diesem Einsatz.«
Zu diesem Zeitpunkt hatte gerade die 48-Stunden-Schicht von Tommy Shine, der bereits seit elf Jahren dem Feuerwehrbezirk Wentzville angehörte, und seiner Einheit begonnen. Dies war der ideale Moment für einen Abstecher zum Lebensmittelladen, um für ihre Zeit im Feuerwehrhaus einzukaufen. Die Männer hatten gerade den Supermarkt betreten und ihren Einkaufswagen durch die Obst- und Gemüseabteilung geschoben, als sie ein Notruf erreichte: Kinder seien ins Wasser gefallen, eines davon komplett untergegangen.
Die Feuerwehrmänner ließen ihren Einkauf stehen und rannten hinaus zu ihrem Löschfahrzeug.
Nur Minuten nach dem Notruf traf Officer Frauenfelder um 11:38 Uhr als Erster am Ort des Geschehens ein, dicht gefolgt von den Beamten Ryan Hall, Tyler Christeson, Cody Fry und Detective Sergeant Bret Carbray. Josh Sander rutschte zu diesem Zeitpunkt bäuchlings über das Eis und war schon fast am Bootssteg angekommen, durchnässt und durchgefroren, aber in Sicherheit. Die Beamten sahen, wie sich Josh Rieger verzweifelt an einer Eisplatte – dem größten und stabilsten Eisblock – festklammerte. Er konnte sich aber nur noch mit Mühe halten, denn seine Kräfte ließen nach. John tauchte immer wieder unter, schlug um sich, paddelte platschend mit den Armen und versuchte, irgendetwas Festes zu ergreifen. Aber bei jedem Griff nach dem Eis löste sich ein Brocken und er fand keinen Halt.
»Hilfe! Helft uns!«, schrien Josh und John, als sie die Männer erblickten.
Rick Frauenfelder und Ryan Hall rissen ihre Waffengürtel, Jacken und restliche Montur herunter und rannten zum Seeufer. Ohne Zeit zu verlieren, gingen die beiden Polizisten sofort hinaus aufs Eis. Sie wussten, dass Bret Carbray sie noch mit Rettungsausrüstung aus dem Kofferraum ihrer Streifenwagen versorgen würde. Sie waren ungefähr vier Meter weit gekommen, als Bret ihnen Schwimmwesten und Seile zuwarf. Schnell zogen sie die Westen über und krochen auf allen vieren weiter hinaus, aber Frauenfelder stellte fest, dass das Eis matschig und mürbe war – kein gutes Zeichen. Mit jeder Bewegung gab es etwas mehr nach. In seinen fünfzehn Dienstjahren als Polizeibeamter – acht davon bei der Dienststelle Lake Ste. Louise – war er schon zu unzähligen Einsätzen auf diesen See gerufen worden, aber keiner davon war so ernst gewesen. Diese Teenager waren in Lebensgefahr und er war sich nicht sicher, ob er ihnen helfen konnte. Aber versuchen würde er es.
»Dreht euch auf den Rücken und legt euch flach aufs Wasser! Bleibt ruhig! Und versucht nicht, allein herauszukommen«, rief er den Jungen zu, denn er befürchtete, dass sie sich in ihrer Panik selbst noch mehr schaden würden. Doch die Jungen waren schon so hysterisch, dass sie auf seine Anweisungen nicht mehr hören konnten. Frauenfelder versuchte, schneller vorwärtszukommen, aber das Wasser bildete bereits Pfützen und die Eisfläche wurde zur Mitte hin immer dünner.
Mittlerweile war John in dem eiskalten Wasser so außer Kräften und unterkühlt, dass er sich immer nur für kurze Zeit über Wasser halten konnte. Schließlich ging er ganz unter.
Der Feuerwehr-Rettungswagen Medic 9 und die Einheit 9224 der Feuerwehr Lake St. Charles trafen um 11:43 Uhr ein, als von einem der Jungen nur noch der Kopf aus dem Wasser ragte. Er konnte sich nur mühsam an einer dünnen Eisplatte festklammern, die von dem festeren Eis wegzubrechen drohte. Nach zehn Minuten im Wasser waren seine Muskeln geschwächt, seine Koordination hatte nachgelassen und er war mit seinen Kräften am Ende. Das Blut zog sich von den Extremitäten immer mehr zur Körpermitte zurück, um das Überleben zu sichern. Es war nur eine Frage von Sekunden, bis er untergehen würde.
Inzwischen kümmerten sich die Sanitäter um Josh Sander, der es bis zum Ufer geschafft hatte. Sie wärmten ihn mit einem sogenannten Bair Hugger – einer speziellen Wärmedecke – und behandelten seine Unterkühlung. Die in Eis-Schwimmanzüge gekleideten Feuerwehrmänner packten ein Rettungsbrett und machten sich auf in Richtung offenes Wasser.
Die beiden Polizeibeamten waren bereits durchnässt und durchgefroren, aber erst auf halbem Weg zu den beiden Jungen. Als Rick Frauenfelder sah, dass Ryan Halls Beine schon mit Wasser bedeckt waren, sagte er zu ihm: »Wir müssen zurück.« Langsam drehten sie um und kehrten ans Ufer zurück.
Nur wenig später sprang Chief Marlo aus seinem Wagen und kämpfte sich durch die wachsende Menge an Rettungskräften, Sanitätern und Schaulustigen, um das Kommando zu übernehmen. Der Anblick des Sees mit dem aufgebrochenen Eis und dem offenen Wasser überall erschütterte ihn zutiefst. Ein Junge wurde gerade behandelt. Das Leben des zweiten hing an einem seidenen Faden. Kein Anzeichen vom dritten. Hätte es nur ein einziges Loch im Eis gegeben, hätte er sich ausrechnen können, dass John sich in der Nähe befinden musste, aber das war nicht der Fall. Ein riesiger Bereich der Eisfläche war eingebrochen und es gab keinen Hinweis auf John. Er konnte überall sein, mitgerissen von Unterwasserwellen. Und er war nun schon mehrere Minuten unter Wasser …
Chief Marlo wollte unbedingt herausfinden, wo sich dieser dritte Junge befand. Er ließ Ron Wilson rufen, um im Einzelnen zu erfahren, was der Vereinsmanager beobachtet hatte. »Wo haben Sie diese Kids gesehen? Und vor allem, wo haben Sie sie zuletzt gesehen?«
»Dort draußen«, antwortete Ron und zeigte mit dem Finger über den See.
»Natürlich dort draußen, wo denn sonst?«, entgegnete Chief Marlo genervt. »Aber wie weit dort draußen? Neunzig Meter? Dreißig Meter?«
Officer Frauenfelder kam angelaufen und zeigte ihm die Richtung. Dann rief einer der Feuerwehrmänner: »Chief, wenn die Einheit vierzehn aus Wentzville kommt, lassen Sie sie dort suchen, ungefähr fünfundzwanzig Meter vom Bootssteg entfernt. In dem Bereich ist das Wasser schätzungsweise nur drei Meter tief.«
Drei Meter tiefes Wasser war definitiv besser als fünfzehn Meter tiefes, denn wenn ein Teenager zu ertrinken droht, wären fünfzehn Meter genauso schlimm wie einhundertfünfzig Meter.
Der Brandmeister war noch nicht bereit, die Suche als die Bergung eines Ertrunkenen zu betrachten. Aber zweifellos konnte es dazu kommen, daher war das Tauch- und Bergungsteam schon auf dem Weg. Doch wenn nur irgendeine Chance bestand, dass dieser Junge noch am Leben war, würden die Feuerwehrmänner alles Menschenmögliche tun, um ihn zu finden und zu retten.
Chief Marlo sandte seinen Leuten Anweisungen über Funk. »Holt die Dreimetereinreißhaken! Dort wo ihr suchen müsst, ist das Wasser ungefähr drei Meter tief. Und seht zu, dass ihr eure Eisanzüge anzieht!«
Tommy Shine, der bereits im Wentzviller Löschfahrzeug auf dem Weg war, packte seinen Eisschwimmanzug, als er Chief Marlo hörte. Einmal am Ziel wollte er keine Sekunde verlieren. Während das Fahrzeug mit heulender Sirene im Eiltempo zum Einsatzort raste, legte Shine seine Feuerwehruniform und -ausrüstung ab und zwängte sich in einen hellgelben wasser- und kältedichten Gummianzug, in dem er aussah wie ein Raumfahrer.
Der Feuerwehrmann war dankbar, dass seine Einheit erst in der Woche zuvor ein Eisrettungstraining auf dem Lake St. Louis absolviert hatte. Das Training zeigte seine Wirkung und er zwang sich, gleichmäßig zu atmen und ruhig zu bleiben. Er hatte eine Aufgabe. Er würde nicht an seinen eigenen Sohn im Teenageralter denken, der erst vor einer Woche auf einem privaten See Eishockey gespielt hatte. Sein Sohn hätte ebenso gut mit diesen Jungen hier auf diesem See sein können. Er würde den Lärm und das geschäftige Treiben um sich herum ausblenden. Er würde nicht an den Druck denken, der auf ihm lasten würde, sobald er ins Wasser gestiegen war – den Druck, diesen Jungen lebend zu finden. Und er weigerte sich, darüber nachzudenken, dass das Bergungsteam auch schon zum See unterwegs war. Kurze Zeit nach ihm würde es hier sein – würde warten und sich vorbereiten.
Als das Wentzviller Löschfahrzeug schließlich am See eintraf, waren ein Dutzend Sanitäter im Einsatz, gaben Anweisungen, koordinierten die Rettungsmaßnahmen und machten sich bereit, die Jungen wiederzubeleben und ins örtliche Krankenhaus St. Joseph West zu bringen. Mit dem Einreißhaken in der Hand sprang Tommy Shine aus dem Fahrzeug, als es noch nicht einmal zum Stehen gekommen war, und sprintete an Chief Marlo und den anderen vorbei.
An manchen Stellen war das Eis weniger als fünf Zentimeter dick und Shine war klar: Bei aller Eile, zur Einbruchstelle zu kommen, war Vorsicht angesagt. Sonst würde er am Ende ins Wasser fallen und wertvolle Zeit damit verlieren, sich selbst zu retten. Bei jedem Schritt hörte er das Knacken des Eises unter seinen Füßen. Aus fünf Metern wurden fünfzehn Meter, dann fünfundzwanzig Meter … bis Tommy Shine schließlich fast fünfzig Meter vom Ufer entfernt seinen Einsatzort erreicht hatte.
Inzwischen hatten die Feuerwehrleute Joe Marrow und Mike Terranova von der Feuerwehr Lake St. Louis bereits die Öffnung im Wasser erreicht. Während Marrow begann, nach John zu suchen, kümmerte sich Terranova darum, Josh zu retten. Josh Rieger war von der Kälte bereits verwirrt und desorientiert. Er hatte keine Kraft mehr, um sich selbst hochzuziehen und in Sicherheit zu bringen oder auch nur ein Seil oder irgendetwas anderes zu ergreifen. Er konnte sich kaum mehr bewegen und keine Minute länger durchhalten. Mike Terranova glitt ins Wasser und umklammerte Josh von hinten. Dann rollte er den Jungen aufs Eis und dann auf das Rettungsbrett. Sobald Terranova aus dem Wasser kam, fixierte er Josh auf dem Brett und die Polizisten und andere Feuerwehrmänner zogen ihn und Josh an Terranovas Sicherheitsseil zurück an Land. Dort standen schon Sanitäter bereit, um sich sofort um Josh zu kümmern.
Der zweite Junge war in Sicherheit. Aber noch immer gab es keine Spur vom letzten. Keine Spur von meinem Sohn.
Zwar waren die Jungen im gleichen Bereich ins Wasser gefallen, aber je mehr sie versucht hatten, sich herauszuziehen, umso größer war das Loch geworden. Daher war der Bereich, in dem die Feuerwehrleute nach John suchen mussten, sehr groß.
Tommy Shine rollte vorsichtig bäuchlings ins Wasser, während das Eis um ihn herum weiter einbrach. Er zuckte zusammen. Diese Erschütterungen schlugen im Wasser Kreise, und je mehr das Eis brach, umso größer wurde der Suchbereich.
Sein luftgefüllter Schwimmanzug trieb ihn ein paarmal nach oben, bis das Wasser schließlich seine Schultern bedeckte. Joe Marrow war bereits am Rand des Lochs im Einsatz. Daher begann Tommy Shine auf der entgegengesetzten Seite des Lochs systematisch das Wasser abzusuchen. Joe Marrow, der in diesem See sein Training absolviert hatte, wusste genau, wie der Boden beschaffen war. An vielen Stellen war er schlammig, mit Schlick bedeckt, an manchen Stellen hingegen steinig. Die Feuerwehrmänner befanden sich beide im steinigen Bereich und waren dankbar dafür. Sie hofften, John in diesem Teil zu finden, wo es seichter war und leichter sein würde, ihn vom Boden nach oben zu holen. Einen schlammbedeckten Körper herauszuziehen wäre nicht so einfach.
»Du merkst den Unterschied zwischen einem Stein und einem Menschen«, erklärte Marrow seinem Kollegen.
Trotz Zeitdruck mussten sie langsam vorgehen. Mit den Gummianzügen und den wuchtigen, viel zu großen Gummihandschuhen wurde jede Bewegung zum Kraftakt. Die Männer mussten aber auch aufpassen, das Wasser so wenig wie möglich aufzuwirbeln – nicht nur, weil der vom Boden aufgewühlte Schlamm sonst die Sicht beeinträchtigt hätte, sondern auch, weil die kleinste Bewegung oder Welle Johns Körper von ihnen wegtreiben konnte. Langsam und sorgfältig arbeiteten sie in einem Umkreis von dreißig Metern, um meinen Sohn zu finden. Wegen der Größe des Suchbereichs teilten die beiden Feuerwehrmänner den Kreis in zwei Hälften. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit.
Tommy Shine suchte blind, da er im Wasser nichts als trübe, dunkle Wirbel erkennen konnte. Die gleißenden Strahlen der Sonne, die auf das Eis und das Wasser fielen, machten die Sache nicht unbedingt leichter. Er nahm seinen Einreißhaken – eine Stange, die mit einem größeren Haken am Ende und einem kleineren etwas weiter oben versehen ist – und senkte ihn langsam ab bis auf den Grund des Sees. Wasser spritzte ihm ins Gesicht und die eisige Temperatur machte ihm die Dringlichkeit seiner Aufgabe umso mehr bewusst. Das Wasser reichte bis zum oberen Ende der Stange. Äußerst sorgfältig und langsam schob Tommy Shine den Haken wieder und wieder hinab bis zum Grund des stockdunklen Wassers.
Zu seiner Unterstützung kam Mike Terranova zurück, blieb aber mit dem Rettungsbrett oben, sodass sie John schnell ans rettende Ufer bringen könnten – falls sie ihn fanden, falls sie überhaupt an der richtigen Stelle suchten.
Sooft er sich mit dem Haken auch bis zum Grund vortastete, Tommy Shine stieß immer nur auf harte Steine. Mit jedem erfolglosen Versuch verstrich wieder eine wertvolle Sekunde. Wenn es bei der Rettung von Menschen um Leben oder Tod geht, sprechen Mediziner von der goldenen Stunde. Unfallopfer, die innerhalb der ersten Stunde in ein Krankenhaus gebracht und dort umfassend versorgt werden, haben eine wesentlich höhere Überlebenschance als andere.
John war mittlerweile schon fast zehn Minuten unter Wasser.
Tommy Shine atmete tief ein und zwang sich, ruhig und konzentriert zu bleiben und jedes Geräusch und jede Erschütterung um sich herum auszublenden. Komm schon, sagte er sich selbst. Du kannst das. Genau dafür hast du erst letzte Woche geübt … Komm schon, Junge. Wo bist du?
John hatte alle Faktoren gegen sich. Bedingungen. Zeit. Nach so langer Zeit im Wasser war seine Überlebenschance gleich null – selbst wenn er nicht völlig untergegangen wäre – aber Tommy Shine wehrte sich gegen diese Gedanken.
Er und Joe Marrow arbeiteten sich von den Rändern des Lochs bis zur Mitte vor. Aber jedes Vortasten mit dem Haken blieb erfolglos.
Nun komm schon, dachte er. Wo bist du? Die Taucher vom Bergungsteam mussten jeden Moment eintreffen.
Plötzlich spürte Tommy Shine einen Impuls – es war, als stünde jemand neben ihm und würde ihn führen. Er fühlte sich veranlasst, ja geradezu gedrängt, die Richtung zu ändern und direkt an der dickeren Eisplatte weiterzusuchen.
Was soll ich denn dort?, fragte er sich. Ich bin hier richtig. Wenn dieser Junge dort drüben ist, hat er ohnehin keine Chance mehr.
Doch das Gefühl ließ ihn nicht los, und so bewegte sich Tommy Shine Zentimeter um Zentimeter von der Mitte weg hin zum Eisrand. Falls der Junge unter die Eisfläche gespült worden war, würde er nicht überleben, das war ihm klar.
Er senkte seinen Haken erneut ab bis zum Grund. Nichts.
Er lehnte sich mit dem Rücken gegen den Eisrand und schob erneut den Haken vor. Nun stieß er auf etwas, was sich definitiv nicht wie Stein oder Schlamm anfühlte. Tommy Shine schöpfte wieder Hoffnung.
Freu dich nicht zu früh, dachte er. Das könnte auch dein Stiefel sein … Nein, warte, das kann gar nicht sein, denn ich stehe ja nicht auf dem Boden!
Langsam hob er die Stange an und fühlte einen Widerstand.
Bitte lass es diesen Jungen sein! Bitte lass es nicht einen Reifen oder irgendetwas anderes sein!
Er zog mit beiden Händen gegen heftigen Widerstand an der Stange, um seinen Fund nur ja nicht zu verlieren. Als er sie langsam nach oben zog, erspähte Tommy Shine irgendetwas Weißes.
Johns T-Shirt.
Es war 11:51 Uhr – etwa zwanzig Minuten waren vergangen, seitdem John ins Wasser gefallen war.
»Ich hab ihn!«, schrie der Feuerwehrmann laut zum Ufer hinüber, als er den leblosen Körper meines Sohnes aus dem Wasser hob. Der Haken hatte sich in der Körpermitte verhakt und Tommy Shine hatte John am T-Shirt herausgezogen.
Er hatte sich nur dreißig Zentimeter vom Eisrand entfernt befunden. Jeder noch so kleine Wirbel hätte John unter die Eisdecke treiben können und es wäre vorbei gewesen. Die Taucher vom Bergungsteam hätten den Rest erledigt. Als Tommy Shine John herausholte, waren sie gerade eingetroffen.
Mike Terranova hob meinen halb erfrorenen Jungen auf das Rettungsbrett, schnallte ihn fest und die Männer auf dem nächstgelegenen Bootssteg zogen ihn blitzschnell ans Ufer. Alle Helfer traten nun auf den Plan, hievten John auf den Steg und begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Seine Haut war graublau verfärbt, sein Körper zuerst ganz schlaff, dann jedoch schnell steif von der Kälte. Nasenlöcher und Mundhöhle waren mit Schlamm gefüllt. Die Haare standen ab wie Eiszapfen, Finger und Extremitäten waren steif und unnachgiebig und die Haut so kalt, dass es den Sanitätern nicht gelang, ein Rettungsgerät daran zu befestigen.
Sie warfen eine Wärmedecke über ihn, legten ihm eine Infusionsnadel in den Arm und begannen mit der Herzdruckmassage. Beim ersten Druck auf seine Brust sprudelte das Wasser aus seiner Lunge, als hätte jemand eine Fontäne eingeschaltet. Schmutziges Wasser schoss aus Mund und Nasenlöchern. Die Sanitäter bemühten sich, so schnell sie konnten, Johns Lunge zu entleeren und große Mengen an Luft zurück in sein System zu pumpen. Denn wenn es ihnen gelänge, Herz und Gehirn wieder mit Sauerstoff zu versorgen, könnte der Kreislauf vielleicht wieder in Gang kommen.
Alles vergeblich. Kein Puls. Keine Atmung. Kein Herzschlag.
John war tot.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
3.
WETTLAUF ZUM KRANKENHAUS
»Hi Cindy!«, rief ich fröhlich ins Telefon, überrascht, dass sie früher anrief als vereinbart.
»Joyce.«
Irgendwie klang Cindys Stimme anders als sonst. Hohl, voller Entsetzen, aber ich dachte mir zunächst nicht viel dabei.
»Ich habe deinen Anruf erwartet«, sagte ich.
»Es ist ein Unfall passiert«, begann sie.
»O nein!« Mein Magen drehte sich um. Dieses Gefühl … »Hattet ihr einen Autounfall? Geht es euch gut?«
Cindy sprach mit erstickter Stimme. »Die Jungen waren draußen auf dem Eis. John ist eingebrochen. Sie haben ihn gerade herausgezogen. Joyce … er hat keinen Herzschlag.«
Mein Magen krampfte sich heftig zusammen und der Raum um mich herum fing an, sich zu drehen.
John ist ins Wasser gefallen … Er hat keinen Herzschlag. Aber das war doch gar nicht möglich. Ich hatte doch gerade erst mit ihm gesprochen.
»Joyce«, sagte Cindy. »Komm hinunter zum See.«
»Okay, ja … ich komme.« Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich mich noch verabschiedet habe oder ohne Gruß einfach aufgelegt habe und sofort aufgesprungen bin.
Meine rheumatische Arthritis macht mir zu schaffen und meine geschwollenen Gelenke schmerzen oft bei jeder Bewegung – besonders, wenn das Wetter umschlägt. Aber an diesem Tag war das alles vergessen und ich lief durchs Haus wie von der Tarantel gestochen. Ich schnappte mein Handy vom Küchentisch und rannte ins Wohnzimmer, um meine Handtasche und meine Schlüssel zu holen. Wo waren sie nur?
Hektisch blickte ich mich im Raum um. Nichts.
Fieberhaft riss ich Überwürfe und Kissen vom Sofa und den Sesseln und schob Zeitungen, Bücher und die Fernbedienung des Fernsehers zur Seite. »Wo bitte schön sind meine Schlüssel?« In meinen Ohren hämmerte es, während die Uhr unaufhörlich tickte. Er hat keinen Herzschlag … Er hat keinen Herzschlag … Wo sind bloß meine Schlüssel?
Dann lief ich in die Küche, suchte die ganze Arbeitsplatte ab, schaute auf jeden Stuhl und riss Schranktüren auf.
Mein Magen krampfte sich erneut zusammen und ich musste mich fast übergeben. In meinem Gehirn überschlugen sich die Gedanken – unaufhörlich kreisten Cindys Worte in meinem Kopf, während ich verzweifelt versuchte, mich zu erinnern, wohin ich meine Handtasche und meinen Schlüsselbund gelegt hatte.
»Nun lass dich bloß nicht gehen«, sagte ich schließlich laut zu mir selbst, um gegen mein Schluchzen anzukämpfen. »Atme tief durch. Die Schlüssel müssen hier irgendwo sein. Beruhige dich!« Ich ging nochmals alle Stellen durch, an denen ich schon gesucht hatte. »Gott, du musst mir helfen!«, flehte ich auf dem Weg ins Schlafzimmer.
Innen an der Klinke der Schlafzimmertür hing meine Handtasche. Ich packte sie, schüttelte sie in der Hoffnung, das Klappern meiner Schlüssel zu hören, und wühlte gleichzeitig mit der Hand nach einem Objekt mit gezackten Kanten. Da! Meinen Autoschlüssel in der Hand lief ich zur Garage hinunter, doch meine Füße fühlten sich an, als würde ich über Sand gehen – ich konnte mich einfach nicht schnell genug bewegen. Das Ticken in meinen Ohren wurde lauter und schneller. Ich sprang in unseren Nissan Quest und steuerte ihn aus der Einfahrt.
Zwanzig Minuten Autofahrt lagen vor mir – dabei hatte ich doch eigentlich nur dreißig Sekunden Zeit. Da es ein Feiertag war, betete ich, dass der Verkehr nicht zu dicht wäre, ich an den Ampeln grüne Welle hätte und nicht irgendein Sonntagsfahrer mich aufhielte. Am meisten aber betete ich für John.
Sobald ich gefahrlos mein Telefon herausholen konnte, rief ich Brian bei Boeing an. Mehrmals hörte ich das Freizeichen, bis ich schließlich seinen Anrufbeantworter in der Leitung hatte. Ich unterdrückte ein Schluchzen, legte auf und versuchte es noch einmal. Wieder ertönte nach einigen Freizeichen ein Klicken und die Stimme meines Mannes: »Hier ist der Anschluss von Brian Smith …« Normalerweise ging er ans Telefon, wenn er nicht gerade in einer Sitzung saß oder in die Bearbeitung eines Videos für eine Werbeveranstaltung oder Ähnliches vertieft war. Wenn dies der Fall wäre, würde ich ihn so schnell nicht erreichen. Eigentlich wollte ich auf keinen Fall eine Nachricht hinterlassen, aber irgendetwas musste ich ja tun.
»Brian, John hatte einen Unfall«, sprach ich ihm auf den Anrufbeantworter. »Du musst mich sofort zurückrufen!«
Ich scherte in die Bundesautobahn I-70 ein und wählte die Nummer meiner Schwester in der Hoffnung, Janice’ Stimme würde mich ein wenig beruhigen. Aber auch hier nur der Anrufbeantworter. Als Nächstes probierte ich es bei meinem Schwager Don. Keine Antwort. Ich schluchzte und meine Verzweiflung wuchs mit jedem vergeblichen Versuch. Ich musste mit irgendjemandem sprechen, um jemanden zu bitten, einen Gebetsrundruf zu starten, aber auch schlicht und einfach, um mit meinem Schmerz nicht ganz allein zu sein.
»Gott, ich brauche deine Hilfe«, betete ich laut. »Gott, bitte nimm mir meinen Sohn nicht!«
Gleich wird mich die Polizei anhalten, weil ich am Steuer telefoniere und zu Gott schreie, dachte ich. Wütend war ich nicht auf Gott. Ich wollte nur sichergehen, dass er mich hörte, wollte ihn auf mich aufmerksam machen. Nun, eigentlich ist es mir egal, wenn sie mich anhalten. Vielleicht komme ich dann schneller zum Krankenhaus.
»Ein bisschen mehr Tempo!«, rief ich dem Fahrer vor mir zu, der sich etwas zu pedantisch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielt. In meinen Augen fuhr er eindeutig zu langsam. »Dies ist eine Autobahn. Hier gilt einhundertzehn, nicht nur siebzig!«, schimpfte ich. Ich scherte auf die Überholspur aus und rauschte an ihm vorbei.
Mein Telefon klingelte. Ich griff danach in der Hoffnung, dass Brian oder Janice mich zurückriefen. Es war Cindy. Ich blickte auf die Uhr auf dem Armaturenbrett. Sie zeigte ungefähr zehn Minuten nach zwölf.
»Sie haben John ins St. Joseph West gebracht«, erklärte sie. »Wir treffen uns dort.«
»Gut, ich bin schon unterwegs.«
Das Krankenhaus St. Joseph West liegt etwa eineinhalb Kilometer vom Lake Ste. Louise entfernt, direkt an der I-70, ich war daher bereits auf dem richtigen Weg.
Ich kannte das Krankenhaus, denn Ben und Bryan, die beiden Söhne meines Sohnes Charles, waren beide im St. Joseph West zur Welt gekommen. Das waren freudige Ereignisse gewesen. Ganz im Gegensatz zu heute.
Ich beschloss, Charles anzurufen, der in der Nähe lebte. Sicher würde ich wenigstens ihn erreichen. Aber auch hier wieder nur der Anrufbeantworter. »Das gibt’s doch nicht!«
Nun wurde ich überwältigt von Frustration und Hysterie. »Das rechte Pedal ist das Gaspedal, gnädige Frau. Treten Sie mal kräftig durch!«, trieb ich eine andere Fahrerin an.
Als Nächstes versuchte ich es bei Brians Verwandtschaft. Seine Schwester Miriam hatte gerade eine neue Arbeit aufgenommen und ich hatte ihre Nummer noch nicht. Der nächste Fehlschlag. Ich beschloss, es bei ihrer Tochter Jane zu versuchen und – wie könnte es anders sein – auch hier ertönte die Mailbox.
Nachdem ich nun nahezu alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, wählte ich die Nummer eines Freundes unserer Familie, Brad Carriger, der früher in unserer Gemeinde beschäftigt gewesen war.
»Bitte, bitte nimm ab!«, flehte ich bei jedem Freizeichen.
Wieder ertönte das vertraute Klicken und ich stöhnte innerlich, weil wohl auch hier nur der Anrufbeantworter in der Leitung war.
»Hallo?«
Ich hielt einen Moment inne, um sicherzustellen, dass wirklich ein Mensch am anderen Ende war.
»Hallo?«, fragte die Stimme noch einmal.
»Brad!«, stieß ich hervor.
»Oh, hallo Joyce«, begrüßte mich Brads muntere Stimme.
»Es ist ein Unfall passiert!« Überwältigt von Hysterie faselte ich völlig unverständliche Worte. Ich schaffte es einfach nicht, meine Zunge mit meinem Gehirn zu synchronisieren und sinnvolle Sätze hervorzubringen.
Nachdem ich alles ein paarmal wiederholt hatte, war Brad schließlich in der Lage, sich einen Reim aus meinem Gestammel zu machen. »Okay, ich rufe einige Leute an«, versprach er.
Ich war so dankbar und erleichtert. Gern hätte ich ihm gesagt, wie froh ich über seine Unterstützung war, doch ich brachte nur ein geschluchztes Danke hervor, bevor ich auflegte.
Nur noch ein Anruf, dachte ich, auch wenn ich nach meinem Gestammel bei Brad nicht sicher war, ob ich überhaupt noch imstande wäre, etwas Sinnvolles zu sagen, selbst wenn jemand abnehmen würde.
Das Auto vor mir wurde langsamer und ich rief: »Hey Opa, du musst vor der Ausfahrt nicht auf fünfzig herunterbremsen. Was ist nur mit all diesen Fahrern los?!«
Ich rief meine Schwiegertochter Krista an, Charles’ Frau. Sicherlich würde sie ans Telefon gehen. Tatsächlich nahm sie nach dem zweiten Freizeichen ab. Aber ihre herzliche, warme Stimme machte es mir nicht leichter, mich besser zu artikulieren.
»O nein!«, rief sie aus, als sie begriffen hatte, was vorgefallen war. »Ich muss Charles anrufen. Wir kommen, so schnell wir können.«
Brian hatte noch immer nicht zurückgerufen, also probierte ich es noch einmal. Diesmal nahm er ab und aus seinem ruhigen Ton schloss ich, dass er seinen Anrufbeantworter noch nicht abgehört hatte.
»Du musst sofort ins St. Joseph West kommen. John ist dort. Er hatte einen Unfall«, stieß ich hervor.
»Was? Was sagst du da? Was für einen Unfall?«
»Komm einfach ins Krankenhaus!«
»Ist er –«
»Komm, so schnell du kannst. Ich bin auch auf dem Weg dorthin.«
Seine Stimme wurde unsicher, fragend, als könnte er nicht verstehen, was ich gesagt hatte. »Hm … okay.«
Ich wusste, dass er alles liegen und stehen lassen würde, um so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen, selbst wenn er nicht alles begriffen hatte. Von seiner Arbeit aus waren es zwanzig Minuten mit dem Auto. Ich betete einfach, dass er nicht auch mit solchen gestörten Langsamfahrern zu kämpfen hätte wie ich. »Mal ernsthaft, Leute! Jetzt ist nicht die Zeit für Sightseeing.«
Zwischen all meinen Anrufen betete ich. Kilometer um Kilometer betete ich. Bei jedem angstvollen, bedrohlichen Gedanken, der mir in den Sinn kam, betete ich. Aber jetzt wandte ich meine ganze Aufmerksamkeit Gott zu. Keine Anrufe mehr. Keine Kommentare mehr an andere Autofahrer. Es war nun Zeit für ein ernsthaftes, ungestörtes Gespräch mit Gott. Ich dachte an die Andacht, die ich vor nicht einmal einer halben Stunde auf Facebook gelesen hatte: Es gibt Zeiten, da musst du Gott einfach Gott sein lassen. Ihn brauchte ich – ihn brauchte John – genau in diesem Moment.
»Herr!«, schrie ich laut. »Du kannst das nicht tun! Du kannst mir meinen Sohn nicht nehmen! Bitte nimm mir meinen Sohn nicht! Herr … Das kannst du nicht tun!« Ich war verzweifelt. »Du hast ihn uns geschenkt, Herr«, fügte ich hinzu, als müsste ich unseren mächtigen Gott daran erinnern. Ich dachte vierzehn Jahre zurück, als Brian und ich die lange Reise nach Guatemala unternommen hatten, um diesen stillen, unterernährten, dunkelhaarigen, dunkelhäutigen kleinen Jungen zu uns nach Hause zu holen. »Du kannst ihn uns nicht nehmen. Du kannst es nicht tun. Nicht jetzt!«
Schließlich erblickte ich die Ausfahrt zum Veterans Memorial Parkway, einer Parallelstraße zur I-70, die direkt zum Krankenhaus führt. Wieder verkrampfte sich mein Magen. Ich wollte so schnell wie möglich dort hinkommen. Aber dann überwältigte mich Angst. Was würde ich dort vorfinden? Was würden sie mir sagen?
Als ich in Südwestrichtung auf das Krankenhaus zufuhr, fiel mein Blick sofort auf das riesige Kreuz, das über dem Besuchereingang der Notaufnahme an dem orangefarbenen Backsteinbau angebracht war. Schnell bog ich nach links zum St. Joseph West ab. Ich wollte meinen Wagen auf dem Parkplatz direkt bei der Notaufnahme abstellen.
Natürlich war keine einzige Parklücke frei. Ich fuhr Runde um Runde in der Hoffnung, dass jemand wegfahren würde. Selbst wenn es nur eine kleine Lücke wäre, würde ich meinen Wagen schon irgendwie hineinmanövrieren. Ich musste endlich irgendwo parken.