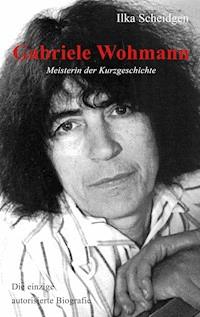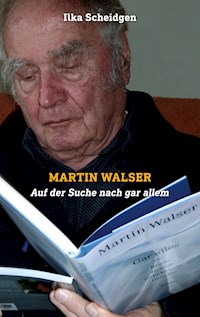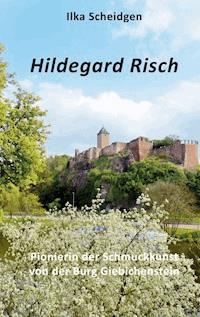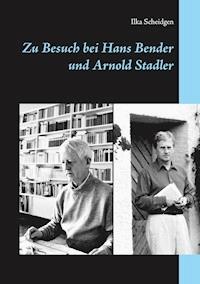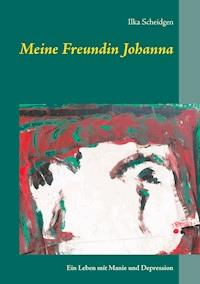3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine Frau, Mitte Vierzig, unternimmt einen Selbstmordversuch, weil ihre Ehe gescheitert ist. Wider Erwarten wird sie gerettet. Nun beginnt für sie der mühsame Weg zurück ins Leben. In dieser schwierigen Zeit findet sie eine Freundin, die ihr beim Aufbruch in ein noch immer ungewolltes Leben hilft. Eine leise und poetische Erzählung über eine Frauenfreundschaft und über die großen Themen der Literatur: Leben, Liebe, Tod. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Ähnliche
Ilka Scheidgen
Aufbruch ins Unbekannte
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Frau in der Gesellschaft
Herausgegeben von Ingeborg Mues
Wir sind ein Tod. Das, was wir als Leben ansehen, ist der Schlaf des wirklichen Lebens, der Tod dessen, was wir wirklich sind. Die Toten werden geboren, sie sterben nicht.
Fernando Pessoa
Ich spreche mit einer Toten. Seit einem Jahr schon spreche ich mit ihr. Vor ihrem Tod habe ich sie noch nicht gekannt. Aber jetzt – nach einem Jahr – kenne ich sie schon recht gut. Obwohl das Gespräch oft mühsam ist.
Schon früh, so mit acht Jahren etwa, habe ich gewußt, daß die Toten leben und viele von denen, die leben, eigentlich tot sind. Ich hatte ein Zimmer für mich. Eine Kammer. Der Raum hatte eine gerade und eine schräge Wand, die sich beim Fenster trafen. In dieser winzigen Stube, in der nicht viel Platz zum Bewegen blieb, fühlte ich mich geborgen. Hier standen ein Regal, mein Puppenwagen, ein Kleiderschrank, eine Holztruhe für meine Spielsachen und vor dem schmalen Fenster ein Tisch.
An diesem Tisch saß ich oft und schaute hinaus. Er war so klein, daß gerade mein Schulheft darauf Platz hatte. Aber er hatte eine Schublade. Die war für mich wichtig. Dort hinein legte ich meine Gedanken. Aufgeschrieben auf winzige Zettel.
Einer von ihnen war nicht wie die anderen mehrfach zusammengefaltet. Er lag vorn, gut sichtbar, sobald man die Schublade öffnete. Darauf hatte ich geschrieben: Wenn ich sterbe, seid nicht traurig. Ich habe keine Angst.
Seit ich dich kenne, spreche ich mit dir.
Die Stadt, in der du wohnst, kenne ich nicht. Sie wird durch einen Fluß geteilt.
Du hast mich eingeladen, dich zu besuchen. Ich möchte der Einladung folgen. Aber ich weiß noch nicht, wann.
Du sagst, ich warte.
Ich kannte dich noch nicht. Denn du lebtest noch. Deine Mutter kannte ich. Als sie mich anrief und sprach und schluchzte und von den Umständen deines Todes erzählte, von einem Abschiedsbrief, vom Aufbrechen einer Tür, von Feuerwehr und Krankenhaus, von Koma und Rettung und sagte, sie lebt, und schrie, sie lebt, hörte ich nur immer Tod und Tod und: Heiteren Gemüts gehe ich.
Ich komme. Und du stehst wirklich da. Du hast auf mich gewartet. Wir erkennen uns sofort. Jetzt sprechen wir nicht. Wir gehen. Wir gehen in deine Stadt. In dein Haus. In das Todeshaus. Als wir es betreten, zeigst du mir die Wunde an der Tür.
Vor uns liegen Tage und Tage, Jahre und Tage. Tausend Jahre sind wie ein Tag. Und du weißt nicht, was du mit der neuen Zeit anfangen sollst. Du sagst, ich muß mir eine neue Bleibe suchen. In meinem Haus kann ich nicht mehr lange wohnen bleiben.
Du zeigst mir deine Stadt, die ich nicht kenne. Leiser Regen fällt. Wir fahren auf einen Berg. Du zeigst und sagst, schau. Unter uns liegt sie, die Stadt. Geteilt durch den Fluß. Eine Brücke verbindet beide Seiten miteinander. Bald wirst du auf der anderen Seite des Flusses wohnen.
Bevor meine Mutter starb, begann sie, in Rätseln zu sprechen. Einmal, in höchster Not, wie es schien, fragt sie, wo ist meine Freundin, und schaut sich im Zimmer um. Als sie meine Stimme hört, sagt sie erleichtert: Da ist sie. Und: Ach, wenn es schon vorbei wäre! Nur noch klares Wasser nimmt sie zu sich. Ach, tut das gut, sagt sie. Es geht schon seit Monaten so. Sie ist abgemagert zum Skelett.
Ich kann hier nicht raus, stöhnt sie, lieber Gott, hilf. Bist du hier, fragt sie oft. Ja, das ist gut, wir müssen doch noch ankommen. Plötzlich lächelt sie entspannt: Kannst du die Uhr erkennen? Wer ist das? Sie schaut in den Raum, einer imaginären Person entgegen. Wer ist da, sagt sie und zeigt zum Fußende ihres Bettes, mir war so, als hätte ich jemanden kommen gesehen.
Mit äußerster Anstrengung richtet sie sich auf.
Wir müssen hier raus, schnell, ich muß aufstehen. Wir brauchen jetzt viel Kraft. Hilfe! Ich kann nichts sehen. Wo bist du, wer ist da? Du mußt dich ausruhen, du bist doch auch nicht die Stärkste. Erschöpft sinkt sie in die Kissen zurück.
Du bist da. Wo bin ich? In welchem Haus wohne ich?
Sie wird von Tag zu Tag schwächer. Ihr Körper ist bis zur Grenze ausgezehrt. Ich weiß das alles gar nicht mehr, haucht sie. Ich streichle den mageren Körper. Wir versorgen sie Tag um Tag. Ihr Gesicht ist schneeweiß. Die Augen sind tief in ihre Höhlen zurückgetreten. Der Puls ist kaum noch fühlbar.
Du bist aus echten Farben gemacht, sagt sie.
Plötzlich ein Stöhnen: Ich sterbe! Die Hände zucken. Sie greift sich ans Herz. Und wie in äußerster Todespein ruft sie: Ich will dieses Buch lesen, dieses Buch will ich lesen!
Der Pfarrer war bei ihr, der Arzt, die Schwester, wie jeden Tag. Ich habe die ganze Zeit gebetet, sagt sie. Die Kerzen werden kürzer.
Stille. Ausruhen. Beten.
Jeder Augenblick kann der letzte sein.
Immer wieder unerwartete Lebensreserven. Einmal sagt sie, ihr Ton klingt geheimnisvoll: Stell dir vor, daß wir beide keine Geschwister sind.
Ein anderes Mal: Ich wußte gar nicht, daß du eine Schwester hast. Und dann in der Nacht der Aufschrei: Mein Schwesterchen, mein Schwesterchen!
Eine letzte vergebliche Anstrengung, sich aufzurichten. Sie wendet sich an mich: Du willst mir doch helfen. Ich will jetzt endgültig aufstehen!
Und nach einer kleinen Pause, nach einer entsetzlichen Mühe, sich mit meiner Hilfe hochzustützen, leise und traurig: Was ist das? Es ist immer noch nicht vorbereitet …
Liegen wie in Geburtswehen. Der Mund ist trocken. Ich benetze ihre Lippen mit Wasser. Alle Worte versagen.
Meine Mutter hatte keine Schwester. Ich auch nicht.
Ich war allein. Ich habe mir meine Welt im Kopf gebaut. Ich lief durch die Straßen. Allein. Ich erfand mir eine Schwester.
Das Haus ist still. Der Fischreiher dreht schon zum dritten Mal seine Runde über dem See. Eis hat den See überzogen. Er ist spiegelblank.
Plötzlich läutet die Schelle an der Haustür. Dem Hund sträuben sich die Haare. Er bellt nicht wie sonst, wenn jemand Fremdes vor der Tür steht.
Ein Unbekannter steht vor der Tür. Seine Haare sind weiß. Auf mein Befragen antwortet er, er suche unsere gemeinsamen Ahnen. Ich bitte ihn herein. Er kam, als hätte ich ihn gerufen.
Gestern beklagte sich mein Mann, daß er immer die Sachen von Toten auftragen müsse. Das Hemd, den Mantel, die Schuhe. Die Dinge bleiben übrig. Und die übrig bleiben, müssen sie weitertragen. Als meine Großmutter starb, sang ich Osterlieder. Mit Inbrunst. Ich spürte Auferstehungsfreude.
Ihre schönsten Kleider, mit eigner Hand genäht, hängen noch immer im Schrank.
Schnee fällt. Als sollte es kein Ende nehmen. Ich Schneeflocke. Ich falle. Aber die Liebe. Loslassen. Sich fallen lassen. In die Liebe.
Diese weiße Welt um mich. Schneeflocken treiben auf mich zu. Ich möchte laufen, laufen, ohne aufzuhören, ohne jemals an ein Ziel zu gelangen. Der Weg ist das Ziel.
Weiße, heile Welt. Ich verträume die Zeit. Ich schaue dem Fluß beim Fließen zu.
Sag mir, wer du bist. Sag auch mir, wer ich bin.
Dein Leben und meins: zwei Geraden wie in der Mathematik.
Sie berühren sich in der Unendlichkeit.
Schmal und sehr ernst sehe ich dich den Raum betreten. Du hattest damals schon den Plan. Viel Zeit hattest du dir nicht mehr gegeben. Ein Fest. Viele Menschen. Dein Blick geht durch sie hindurch. Du bist allein gekommen.
Äußerlich das wohlgeordnete Leben. Eine Ehe, ein Beruf, eine gute Kindheit. Das Leben lieben, aber nicht daran hängen. Wir sind nur Gäste, das sagst du später einmal zu mir.
Du kannst nicht anders. Du hast gründlich überlegt. Du hast den Termin sorgsam gewählt.
Allein im Haus. Ein letzter zärtlicher Blick auf Liebgewordenes. Das Sonnenlicht in den Vorhängen. Der Baum vor dem Fenster. Die Blätter spielen miteinander. Sorglos singt der Vogel sein Lied. Hinlegen. Ausruhen.
Die Musik. Bach, Vivaldi. Sie trägt mich.
Nie mehr die Verletzungen, die Kälte, die Leere, das Schweigen. Das Ende, es wird sanft sein.
Einmal war da eine Hoffnung. Das Kind. Du nahmst es, Gott, falls es dich gibt. Jetzt bleibt mir nichts. Es ist zu spät. Es dauert zu lange. Ich kann nicht mehr warten.
An diesem Tag war ihr Blick anders als sonst. Er ging durch die Dinge hindurch: die afrikanische Eingeborenenplastik auf der Kommode, die Schlafzimmerlampe, die sie nie gemocht hatte, durch die Wände und Zimmertüren, das ganze Haus sah sie wie einen Riesenkokon, in den sie sich nun einspinnen würde.
Noch sah sie den Baum, der sich leise im Wind wiegte, und die weißgeballten Wolken, die den klaren Himmel stückchenweise freigaben. Sie fühlte, daß dies alles nicht wirklich war. Alles, was sie sah, was die anderen und auch sie selbst an allen anderen Tagen des Jahres, vieler vergangener Jahre, für wirklich gehalten hatten, war nur ein Traum.
Sie streifte die Verwunderung über nicht erfüllte Sehnsüchte, nicht übereinstimmende Wege ab. Es bedeutete nichts mehr, wie wenig die meisten von sich selbst und vom anderen wußten.
Es ist ganz leicht, dachte sie und schloß die Augen, um nur noch der Musik zu lauschen.
Die Melodie zog sie hinaus in ein Blau, das es nicht gab.
Ambulanz. Rettung. Patiententestament. Du willst nicht. Sie kämpfen um dein Leben, elf Tage lang.
Du willst noch immer nicht.
Ich habe eine Schwester. Ich darf keinen Moment aufhören, mit ihr zu sprechen.
Wie kann ich dir sagen, daß du gehalten wirst. Du darfst dich ja fallen lassen. Du wirst sehen, etwas Unerklärliches fängt dich auf.
Mit sechzehn unsere Überlegung, ob es einen Selbstmord aus Liebe gebe. Wir hatten eine tote Nonne im Tiber treiben gesehen. Wir lasen Camus. Damals. Camus lehnt den Selbstmord ab. Es galt der Mythos des Sisyphos. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, sagt Camus. Das Absurde freudig ertragen? Glück und Absurdität entstammen ein und derselben Erde, erklärte Camus. Unsere Spekulation über unvereinbare Gegensätze. Wie kam die Nonne in den Tiber? War es ein Unfall, war es eine Verzweiflungstat? Oder war nicht das allein Ausschlaggebende die Sehnsucht? Das fragten wir uns damals. Und wir waren uns sicher, daß der einzige Weg sei, sich selbst zu verlieren und ganz zu lieben.
Du, ich nehme dich an der Hand, wir wollen es gemeinsam versuchen.
Es ist Herbst. Der wundersame Herbst. Die Blätter fallen durch die hervordrängende Knospe.
Ich wage noch nicht, dir von Gott zu sprechen.
Du sagst, ich freue mich auf unsere Begegnung.
Wir haben ein Stück Himmel in uns. Manchmal spüren wir es. Es kann ein Augenblick am Morgen sein, wenn wir hinaustreten in den frühen Nebel und plötzlich die Wiese atmen hören. Oder wenn die Bäume sich färben und sanft sterben.
Ein alter Mann aus unserer Nachbarschaft starb vor drei Tagen ganz so. Er war schwerfällig geworden und nahm die Hilfe seiner Frau gerne und selbstverständlich an. Er war schwerhörig und stellte sich manchmal auch nur so. Er hatte ein kleines, schalkhaftes Lächeln zwischen seinen Zahnlücken. Nun lag er »für uns alle unerwartet« tot im Bett, wie schlafend. Es hatte keines Kampfes bedurft.
Du nimmst das tägliche Leben wieder auf. Du baust dir Brücken und Stege, von denen du hoffst, daß sie haltbar genug sind, dich ans andere Ufer gelangen zu lassen. Du probierst vorsichtig dein neues, zweites Leben. Noch ahne ich nicht, wie zerbrechlich die Stege sind.
Ich schicke dir meine Worte. Jeden Tag. Ich möchte dir Mut machen. Ich sage dir, hab Vertrauen in dein neues Leben.
Noch wissen wir nicht viel voneinander. Doch es gibt da eine Fraglosigkeit, die außerhalb unserer Person liegt. Unsere Geschichte beginnt erst. Wir haben das Spielfeld betreten. Oder wurden wir darauf gesetzt? Sind wir Schachfiguren in der Hand eines anderen?
Wir werden den begrenzten Raum des Spielfeldes verlassen.
Elf Tage lang kein Lebenszeichen.
Sie hat eine Reanimation ausdrücklich abgelehnt. Sie wußte, was die Gifte in einer entsprechend langen Zeit anrichten im Körper. Das Gehirn. Wer kann die Verantwortung übernehmen? Es kann bleibende Schäden geben. Sie können die Persönlichkeit, die gewesene, zerstören. Es gibt Zustände, schlimmer als Totsein.
Sie wird über einen Tubus beatmet. Todesröcheln. Die es miterleben, halten es nicht aus. Die Ärzte riskieren, den Mundtubus zu entfernen und eine Nasensonde einzusetzen. Die Atmung setzt nicht aus. Fünfter, sechster, siebter Tag. Der Zustand ist unverändert, heißt es. Achter, neunter, zehnter Tag. Noch immer kein Zeichen. Koma. Alles ist ungewiß. Sie schwebt im Nichts.
Dann am elften Tag die erste Reaktion des Körpers! Der kleine Finger der linken Hand hat sich bewegt. Tag und Uhrzeit werden in der Krankengeschichte vermerkt. Es bedeutet etwas und doch nichts. Sollte es eine Rettung geben, wie wird der Zustand des Bewußtseins sein. Noch kann keiner die Frage beantworten.
Der Zeitpunkt des ersten Erwachens liegt viel später. Das wird sie feststellen. Es ist ihr wichtig, später, den genauen Zeitpunkt ihrer Rückkehr ins Leben zu erforschen. Sie fordert Einsichtnahme ins Krankenblatt. Die Daten – ihre eigenen – und die niedergeschriebenen stimmen nicht überein. Was war da, in diesem Zeitraum?
Als sie zum ersten Mal die Augen öffnet, ist in ihr nur ein großes Erstaunen. Undeutlich sieht sie neben sich Menschen stehen, die ihr vertraut sind. Sie möchte sprechen. Aber kein Laut verläßt ihren Kehlkopf. Die Besucher registrieren eine leichte Bewegung der Lippen. Sie kommen nahe heran, um verstehen zu können. Schon senken sich die Lider über die müden Augen der Kranken.
In das welke Laub, das ich Stunde um Stunde zusammenkehre, füge ich meine Gedanken über Leben und Tod.
Die Zeit der Nachtfröste hat begonnen. Wenn die Morgensonne sich über die Bäume erhebt, reflektiert das Weiß der bereiften Wiesen dieses schüchterne Licht in die noch teilweise belaubten, farbigen Baumkronen. Weiße Arabesken von Rauhreif auf den Blättern. Ich begebe mich mit Proust auf die Suche nach der verlorenen Zeit.
Die ersten Worte, die sie nach ihrem Erwachen sagte, waren: Nie mehr!
Herbststürme haben die letzten Blätter von den Bäumen gefegt und einige starke Bäume entwurzelt.
Heute nacht bin ich aufgewacht, als wäre ich aufgeweckt worden. Wenn ich einmal wirklich wüßte, daß es das gibt, daß einen jemand aufwecken kann aus dem Schlaf, der nicht anwesend ist. Wenn es gewiß wäre, was nur gefühlt wird als Synchronizität – oder was ist es sonst, das wäre wie: total geöffnete Schleusen. Dieser Strom risse alle mit, die an seinem Rande stehen.
Ich muß noch einmal zurückkehren zum Ausgangspunkt. Das war der Tod. Es war die Nachricht von deinem Tod. Es war mein eigener Tod, den ich plötzlich fühlte, der mich am Herzen packte.
Als mich die Nachricht erreichte am Telefon, warst du dabei, ins Leben zurückzukehren. Ich kannte dich noch nicht und wußte doch, daß eigentlich ich dort liegen könnte unter der Maschinerie der Wiederbelebung.
Von dem Moment an begannen die Fäden unserer beider Leben sich zu verweben. »Sterben ist die geringste Strafe. Eines Tages wird es für uns alle aus sein. Das Haus, in dem man wohnte, der Garten, den man pflegte, die wenigen Menschen, die man liebte, all die kleinen Dinge und Bücher und Fotos, die man sammelte, nichts davon kann man mitnehmen, auch nicht die Erkenntnisse, die Erinnerungen, sich selbst – es ist vorbei, man stirbt. Das weiß man; während man noch lebt, weiß man es, und nur der genaue Zeitpunkt bleibt geheim. Nur das, was nicht lebt, stirbt nicht. Plastikblumen wachsen nicht, verwelken nicht, sterben nicht – aber wer möchte eine Plastikblume sein?« So schreibt Renate Rubinstein.
Es war von Trennung die Rede gewesen, die hast du nicht überleben wollen. Er hatte dir die Tür zugeschlagen, die Tür deines Hauses, und du schlugst die Tür deines Lebens zu, leise, unhörbar, allein. Du hofftest, endgültig von der Last des Nichtverstehen-Könnens befreit zu sein. Daß die Tür zu deinem Leben auch noch eine Klinke von außen hat, hattest du nicht bedacht. Sie wurde geöffnet, ohne daß du »Herein« geantwortet hast. War es Gott? War es vielleicht doch ein erhörtes Kindergebet, irgendwo: Lieber Gott, mach alles wieder gut!
Da sagte gestern jemand: Ist es denn so schlimm, nach einer Trennung allein weiterzuleben?
Ja, habe ich gerufen, ja, es ist schlimm und traurig und fast nicht zu ertragen!