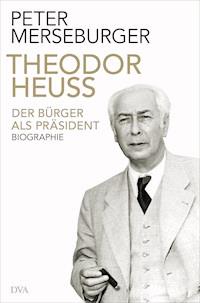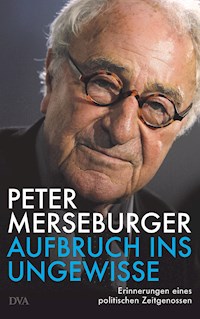
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Jahrhundertleben: Die Autobiographie des großen Publizisten Peter Merseburger
Er war das Gesicht des kritischen Journalismus und die Reizfigur der Mächtigen: Peter Merseburger blickt zurück auf sein Leben und lässt dabei die Geschichte der Bundesrepublik von den Anfängen in Trümmern bis zur Wiedervereinigung lebendig werden. Merseburgers Jahre als Leiter des Fernsehmagazins »Panorama« fielen in eine aufwühlende Zeit: Ostpolitik, RAF, Abtreibungsdiskussion. Seine scharfen Kommentare waren gefürchtet, er übte Kritik an den Regierenden in einer immer noch autoritätsfixierten Zeit. In seinen glänzend geschriebenen Erinnerungen erweist er sich einmal mehr als unabhängiger Kopf, dessen Leben geprägt ist von Aufbrüchen ins Ungewisse: sei es als Jugendlicher in der Sowjetischen Besatzungszone, der sich im Wahlkampf 1946 für die Ost-CDU engagiert und dafür ins Gefängnis wandert, als Korrespondent der ARD in vielen Hauptstädten oder am Ende seiner beruflichen Laufbahn, als er noch einmal einen Neuanfang wagt als Verfasser bedeutender Biographien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Er war das Gesicht des kritischen Journalismus und die Reizfigur der Mächtigen: Peter Merseburger blickt zurück auf sein Leben und lässt dabei die Geschichte der Bundesrepublik von den Anfängen in Trümmern bis zur Wiedervereinigung lebendig werden. Merseburgers Jahre als Leiter des Fernsehmagazins Panorama fielen in eine aufwühlende Zeit: Ostpolitik, RAF, Abtreibungsdiskussion. Seine scharfen Kommentare waren gefürchtet, er übte Kritik an den Regierenden in einer immer noch autoritätsfixierten Zeit. In seinen glänzend geschriebenen Erinnerungen erweist er sich einmal mehr als unabhängiger Kopf, dessen Leben geprägt ist von Aufbrüchen ins Ungewisse: sei es als Jugendlicher in der Sowjetischen Besatzungszone, der sich im Wahlkampf 1946 für die Ost-CDU engagiert und dafür ins Gefängnis wandert, als Korrespondent der ARD in vielen Hauptstädten oder am Ende seiner beruflichen Laufbahn, als er noch einmal einen Neuanfang wagt als Verfasser bedeutender Biografien.
Zum Autor
Peter Merseburger, geboren 1928, war Journalist bei verschiedenen Tageszeitungen, 1960 bis 1965 Redakteur und Korrespondent beim SPIEGEL, moderierte ab 1967 Panorama, wurde 1969 TV-Chefredakteur des NDR und leitete danach die ARD-Studios in Washington, London und Ostberlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter den Longseller Mythos Weimar. Zwischen Geist und Macht. Seine Biografie Willy Brandts wurde 2003 mit dem Deutschen Bücherpreis ausgezeichnet. Heute lebt Merseburger in Berlin und arbeitet als freier Publizist. Zuletzt erschien von ihm Theodor Heuss (2012).
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
PETER
MERSEBURGER
AUFBRUCH INS
UNGEWISSE
Erinnerungen eines
politischen Zeitgenossen
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Regina Carstensen, München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Umschlagabbildung: picture alliance/dpa/Arno Burgi
Satz: Leingärtner, Nabburg
Bildbearbeitung: Reproline Mediateam GmbH, Unterföhring
e-ISBN 978-3-641-22515-5V001
www.dva.de
INHALT
I Eine Kapitulation als Geburtstagsgeschenk
II »So jung und schon so verdorben« – Wahlkampf für Jakob Kaiser
III Muffige Talare, bunte Mützen und ungeliebte Emigranten
IV In der Hochburg trotzigen Beharrens
V Von Wundern, Chancen und fehlender Emanzipation
VI Die Mauer und die Anfänge der Ostpolitik
VII Auf dem Feuerstuhl
VIII Amerika nach dem Trauma von Vietnam und Watergate
IX Ostberlin und London: Von Gegnern und Freunden der Einheit und warum die dann doch gelang
Dank
Anmerkungen
Literatur
Bildnachweis
Rechtenachweis
I
Eine Kapitulation als Geburtstagsgeschenk
Der Duft reifer Himbeeren und Aprikosen in Großvaters Garten, die sich an hohen Gestellen am Hang zum Mühlgraben ranken, der Rauch der Kartoffelfeuer bei der Ernte auf den Feldern, die süßlichen Schwaden, die im Herbst durch die Stadt wabern, wenn die Zuckerfabrik die ersten Rüben verarbeitet – es sind Düfte, Gerüche, Aromen, die Erinnerungen lebendig werden lassen. Da ist der schweflig riechende Dunst der umliegenden Brikettfabriken, der die Stadt einhüllt, wenn der Wind entsprechend steht, da ist der stinkende Holzvergaser, der mangels Benzin selbst einen kleinen Lastkraftwagen nur mit Mühe die sanft ansteigende Straße neben der Drahtseilbahn nach oben hieven kann.
Alltäglich und aller Politik bar etwa der durchdringende Geruch der schwarzen Farbe, mit der mein Vater abends seinen Holzschnitt walzt, um – unter den Augen seines neugierigen Knaben – das Ergebnis auf Japanpapier zu überprüfen; alltäglich auch die Abgase aus Tausenden Heizöfen, die mit Braunkohlebriketts betrieben werden und die er viele Jahrzehnte später als DDR-Korrespondent als die typische Duftnote des realen Sozialismus wiederentdecken wird. In der Erinnerung geradezu lieblich die Wolke aus gutem, nicht aus Braunkohlenteer gewonnenem Benzin und aus dem Rauch der süßlichen Virginia, den die einziehenden Amerikaner über die Stadt legen. Und welch ein Absturz, als mit der Ankunft der russischen Panjewagen, auf denen sich die Betten türmten und an denen meist Kanonen hingen, auf die amerikanischen Virginia-Nebel der kokelige Dunst von Machorka-Tabak, gewickelt in Zeitungspapier, folgt. Die Beispiele zeigen, je deutlicher die Erinnerungen, desto politischer ihr Charakter.
Geboren im Mai 1928, gehöre ich ja zu jenen Jahrgängen, die durch die Ereignisse nahezu zwangspolitisiert wurden – unmerklich zunächst und Schritt für Schritt, bald aber unentrinnbar, wie der Rückblick zeigen wird. Auch wenn diese Kindheit zunächst eine frohe und unbeschwerte war, vielleicht auch eine zu behütete, hat selbst meine früheste Erinnerung schon mit Politik zu tun: Ich gehe an der Hand meiner Mutter die Straße hinunter auf das kleine Stadtzentrum zu, als sie plötzlich auf dem Absatz kehrtmacht und eine Nebengasse wählt, weil auf der Kreuzung, die wir nach links hätten überqueren müssen, Demonstranten mit verschiedenen Fahnen in eine Prügelei verwickelt sind. Da nach den Wahlen 1933 und dem folgenden Verbot anderer Parteien nur Hakenkreuz-Aufmärsche geduldet wurden, muss dies wohl im letzten Jahr der Weimarer Republik gewesen sein, als ich gerade einmal vier Jahre alt war.
In der Tat standen sich damals in der Industriestadt Zeitz zwei nahezu gleich starke rechte und linke Lager gegenüber – die Linke gespalten in Sozialdemokraten und Kommunisten, im rechten Lager waren die Nationalsozialisten vor den Deutschnationalen spätestens seit 1930 die bei Weitem stärkste Partei. Aber die Linke hatte in Zeitz und Umgebung traditionelle Wurzeln – schon zu Kaisers Zeiten war der Wahlkreis Naumburg/Weißenfels/Zeitz mit seinen Brikettfabriken, Braunkohletagebauen und seinem hohen Anteil von Industriearbeitern durch einen Sozialdemokraten im Reichstag vertreten. Da es damals ein Mehrheitswahlrecht ähnlich dem jetzigen der Franzosen gab, verdankte er seinen Sieg in der Stichwahl einer – heute würden wir sagen: sozialliberalen – Allianz der SPD mit der Fortschrittlichen Volkspartei. Und wenn ich »unmerklich zwangspolitisiert« schrieb, denke ich auch an Bilder aus den damaligen Kino-Wochenschauen – etwa an die Reportage vom Staatsbegräbnis eines im Text zum mythischen Helden stilisierten Feldmarschalls Paul von Hindenburg, der im Tannenberg-Denkmal, einem an die Deutschordensritter gemahnenden turmbewehrten Festungsbau, im August 1934 mit militärisch-nationalem Pomp in Ostpreußen beigesetzt wurde. Ich habe die Bilder, wenn auch vage, noch heute vor Augen.
Zeitz, im südlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts, einem der ärmsten Bundesländer, kämpft heute mit den Folgen der Deindustrialisierung nach der Wende, mit Abwanderung, Arbeitslosigkeit und traurigem Verfall seiner Altstadt. Das Zeitz meiner Jugend dagegen war eine intakte mittlere Industriestadt mit 35 000 Einwohnern, weithin bekannt als Geburtsstätte des Kinderwagens, der dort von einem Stellmacher namens Ernst Albert Naether erstmals gebaut, weiterentwickelt und, von seinen Söhnen zum Exportschlager gemacht, in alle Welt verkauft worden war. Es gab eine Eisengießerei, eine Zuckerfabrik, mehrere Pianofabriken und Buchdruckereien, dazu eine Reihe mittlerer und kleiner Betriebe, die Werkzeugmaschinen, Schokoladenartikel, Textilien oder Schuhe produzierten.
Kennern der DDR-Geschichte mag die Stadt vor allem als der Ort bekannt sein, an dem Pfarrer Oskar Brüsewitz im August 1976 mit seiner Selbstverbrennung vor der Michaeliskirche ein Fanal gegen die Repression in der DDR setzen wollte – eines, das Erich Honecker, der »Mann mit dem Strohhut« (Klaus Bölling), einmal als einen »der größten konterrevolutionären Akte gegen die DDR« bezeichnet haben soll. Märtyrer Brüsewitz, der eine Milchkanne voll Benzin über sich ausgegossen hatte, verbrannte sich vor jener altehrwürdigen Kirche, deren Fundamente aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammen und in der ich getauft und später konfirmiert worden war.
Als Bistum 968 gegründet, um – wie die gleichzeitig ins Leben gerufenen Bistümer Meißen und Merseburg – die Christianisierung der unterworfenen Slawen voranzutreiben, verfügt Zeitz noch heute über stolze Zeugen seiner gut 1200-jährigen Geschichte – barocke Bürgerhäuser mit prächtigen Portalen und ein gotisches Rathaus mit seltenem Giebel, wie er ähnlich nur in Breslau zu finden war. Mein Vater, Grafiker und Heimatkünstler, hat ihn wie andere historische Zeugen der Zeitzer Vergangenheit, seien dies nun romantische Winkel oder mittelalterliche Wehrtürme an verbliebenen Resten der Stadtmauer, gleich mehrfach in Holz gestochen oder auf Lithografien gebannt. Ihm verdanke ich einen Sinn für historische Abläufe, das Wissen um die Stile und die Gedankenwelten früherer Epochen, wahrscheinlich auch jene Portion Einfühlungsvermögen, über die ein Journalist trotz eines kritischen Blicks immer verfügen sollte. Er war ein durch und durch musischer Mensch, dem eine Ausbildung an der Kunstakademie versagt geblieben war, denn sein Vater, der Anteileigner einer Druckerei gewesen war, starb früh und hinterließ wenig. Weil mein Vater weder mit seiner Kunst noch mit seiner Gebrauchsgrafik eine Familie unterhalten konnte, verdingte er sich zunächst als Postbeamter und machte sich erst spät selbstständig.
Er war ein eher weicher Charakter, ganz im Gegensatz zu meiner Mutter, einer energischen Person par excellence, die liebevoll-autoritär den Ton im Hause angab. Als nach dem Einmarsch der Russen unsere Sechszimmerwohnung requiriert wurde und wir sie binnen eines halben Tages räumen mussten, verstaute sie alle Wertsachen – Tafelsilber, kostbare Vasen, Bilder, Tischlampen und natürlich das in jedem gutbürgerlichen Haushalt damals obligate »gute Meissener Porzellan« mitsamt den seinerzeit nicht minder geschätzten hochstieligen bunten kristallenen Weingläsern, Römer genannt – in einem kleineren Zimmer, schloss es ab, stellte sich ebenso trotzig wie mutig vor die Tür und erklärte: »Niemand betritt diesen Raum.« Ich stand dabei und hielt den Atem an – würde das gut gehen, sich dem Vertreter der siegreichen Besatzungsmacht so entschieden entgegenzustellen? Doch der Deutsch radebrechende russische Offizier, an dessen Ehre und Anstand hier appelliert wurde, versprach, das Zimmer nicht zu öffnen. Mutter zog den Schlüssel ab, und als die Wohnung einige Wochen später freigegeben wurde, fand sie die Tür unaufgebrochen und ihre im Zimmer gestapelten Wertsachen unberührt vor. In der Wohnung hatten die Russen keinen größeren Schaden angerichtet, nur die hölzerne Platte auf dem Balkontisch war von Axthieben übersät und roch intensiv nach Hammel. Die siegreichen Rotarmisten hatten hier offenbar Zicklein und Schafe für ihre Mahlzeiten zerlegt.
Rückblickend will mir scheinen, meine drei Jahre ältere Schwester Hella und ich seien Produkte einer klassischen Mesalliance gewesen. Denn Mutter kam aus einer höchst betuchten Familie, war wie so manche »höhere Tochter« vor dem Ersten Weltkrieg nach Lausanne ins Pensionat geschickt worden, um Französisch parlieren zu lernen, danach kam sie in ein Pensionat in Wiesbaden, in dem vorwiegend Englisch gesprochen wurde. Die Rittergutsbesitzer, mit denen ihr Vater sie verheiraten wollte, lehnte sie verächtlich ab und tat sich lieber mit einem armen Künstler zusammen. Nicht zufällig lag eine alte Ausgabe des Zupfgeigenhansel – das Liederbuch der Jugendbewegung – obenauf in dem Schrank, in dem die Zeichnungen und Holzschnitte verwahrt wurden, die Vater abends bis spät in die Nacht anfertigte. Immer wieder von Lokalzeitungen veröffentlicht und von Buchhandlungen vertrieben, hatte er sich damit in der kleinen Stadt einen Namen gemacht.
Vater und Mutter lernten sich beim Wandervogel kennen, und ihre jugendbewegte Liebe zur Natur wurde uns Kindern förmlich eingetrichtert – im gemieteten Garten oder bei sonntäglichen Fahrradausflügen in den Forst oder an die Saale mit ihren Burgen am – leider nur im Lied – so »hellen Strande«. Nach außen waren wir die intakte Kleinfamilie, die jedes Jahr vier Wochen Urlaub machte – als wir Kinder klein waren, meist an der Ostsee in Bansin oder auf Hiddensee. Doch die Eltern, Mitglieder des Alpenvereins, liebten die Höhe und die Berge, und so ging es, kaum dass wir mitwandern konnten, im Sommerurlaub ins Allgäu, ins Lech-, Ötz- oder Stubaital, an den Arlberg oder zuletzt nach Gries am Brenner.
Vom Vater entworfene Einladung zur Taufe, die einst als wichtiges Fest für Familie und Freunde gefeiert wurde – mit Geschenken, der Bestallung von Paten und üppigen Menüs
Als dreizehn Monate alter Knirps am Arm der drei Jahre älteren Schwester Hella
Ich erinnere mich, dass wir auf der Reise nach Gries auf dem Abstellgleis eines Bahnhofs hinter Innsbruck endlos warten mussten, weil der »Führer« sich mit dem Duce am Brenner treffen wollte – auch an die ehrfurchtsvoll-neugierigen Blicke der Mitreisenden, die an die Fenster drängten und vergeblich hofften, einen Blick auf Hitler zu erhaschen, als sein Zug an uns vorüberrauschte. Das war unser letzter gemeinsamer Familienurlaub mitten im Krieg 1942. Weil wir Deutschen diesen Krieg in andere Länder getragen hatten, konnten wir im eigenen Land, wenn auch mit Lebensmittelkarten, anfangs noch Urlaub machen wie zu Friedenszeiten. Sollten wir das vielleicht sogar?
Von der Horrorvision geplagt, der Rübenwinter 1917 und die lähmende Kriegsmüdigkeit am Ende des Ersten Weltkriegs könnten sich wiederholen und der Armee werde diesmal nicht der Dolch von Marxisten, wie fälschlich behauptet, sondern von einer hungernden Heimat in den Rücken gestoßen, duldete oder ermöglichte die Führung dies. Allerdings nur, bis das Kriegsglück sich im Osten und in Afrika wendete, die Mobilisierung für den »totalen Krieg« erfolgte und alliierte Bomberflotten nun die Deutschen in ihren Städten über die Grauen eines Krieges belehrten, den Hitler entfesselt hatte.
Ich wuchs nahezu elf Jahre im Frieden auf, und doch war Krieg für mich Heranwachsenden früh präsent, wenn auch zunächst in Form der unübersehbaren Spätfolgen des letzten großen Völkermordens. Amputierte waren im Stadtbild häufig präsent. Und als Vater und ich auf dem Weg zu unserem Buchhändler einmal auf einen offenbar geistig Gestörten mit merkwürdigen Gesten trafen, einen Mann aus einer befreundeten Familie, wurde mir sein Verhalten damit erklärt, er sei als Soldat vor Verdun verschüttet worden und leide seither unter einer Behinderung. Ich lernte in der Grundschule damals Sütterlin – eine an die alte gotische Kanzlei- und Kurrentschrift angelehnte Schreibweise, in der einst unsere Klassiker geschrieben hatten. 1941, als ich längst auf der Oberschule war, wurde plötzlich die lateinische Schrift obligatorisch – qua »Führererlass«. Und mit der Sütterlinschrift wurde gleich die Fraktur mit abgeschafft, weil die meist gebräuchlichen Schwabacher Frakturlettern angeblich die Erfindung jüdischer Druckereibesitzer seien. Nichtkenntnis des Sütterlin erschwert heute manchen Forschern das Entziffern älterer Schriftsätze. Mir dagegen erleichterte meine Kenntnis später die Archivarbeiten zu mehreren Büchern – nicht zuletzt die für eine Biografie über Rudolf Augstein, in dessen Nachlass im Spiegel-Archiv ich sein Kriegstagebuch in Sütterlin aufstöberte.
Anders als heutigen Schülern war uns damals auch der Dreißigjährige Krieg noch präsent – und zwar mit all seinen Schrecken, etwa dem sogenannten Schwedentrunk, einem extrem grausamen Vorläufer des Waterboardings, bei dem Urin plus Jauche durch einen Trichter direkt in den Mund eingeführt wurden. An die seinerzeit so kriegerischen Schweden erinnerten nicht nur Wehrmauern und unterirdische Gänge, in denen die Stadtbürger sich und einen Teil ihrer Habe zu retten suchten. Es gab damals pro Klasse je einen obligatorischen Schulausflug auf das Schlachtfeld von Lützen und zum Grabmal des Schwedenkönigs Gustav Adolf. Er, der vielen als Retter des Protestantismus galt, war dort 1632 im Kampf gegen den kaiserlich-katholischen Generalissimus Wallenstein gefallen.
Als Krieg nicht mehr nur Unglück von gestern, also das der Vätergeneration war, sondern erstmals auch als neue, drohende Gefahr für heute und morgen am Familientisch diskutiert wurde, muss ich sieben oder acht Jahre alt gewesen sein. Was Hitler als frühe außenpolitische Erfolge feierte – die Einführung der Wehrpflicht, die Rheinlandbesetzung 1936, der »Anschluss« Österreichs, die »Heimholung« der Sudetendeutschen ins »Reich« –, waren ja riskante Manöver und mit Kriegsgefahr verbunden, auch wenn der Krieg selbst, wie im Fall des Sudetenlands, in letzter Minute in München doch noch gebannt werden konnte. Vieles, was damals in unserer Stadt geschah, hatte – im Rückblick – mit dem NS-Programm der Aufrüstung und Militarisierung zu tun. Mit der Errichtung neuer Kasernen und dem Einzug des Militärs wurde Zeitz 1937 Garnisonstadt, und im selben Jahr begann der Bau eines Hydrierwerks in Tröglitz, wenige Kilometer vor seinen Toren, das Braunkohle in Benzin umwandeln sollte. Das rohstoffarme Reich müsse unabhängig von Erdölimporten werden, hieß die offizielle Begründung. In Wahrheit ging es um die Produktion von Treibstoff für die Luftwaffe und die neu aufzustellenden Panzerdivisionen.
Und wurden wir nicht als zehnjährige Pimpfe systematisch auf Krieg vorbereitet, auch wenn wir das in seiner vollen Bedeutung damals überhaupt nicht wahrgenommen haben? Prangte nicht in unserer Schule eine Ehrentafel mit den Namen der im Krieg 1914–1918 gefallenen Gymnasiasten und der Inschrift: »Dulce et decorum est pro patria mori« (»Süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben«)? Sangen wir nicht zum hellen Schmettern der Fanfaren: »Jugend! Jugend! Wir sind der Zukunft Soldaten«? Oder über das Stück Tuch, das uns beim Marschieren voranflatterte: »Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit! Ja die Fahne ist mehr als der Tod!«? Baldur von Schirach, der Reichsjugendführer persönlich hatte das für uns gedichtet – Sohn eines kaiserlichen Offiziers, nach 1919 Weimarer Theaterintendanten, und einer amerikanischen Mutter, die mit ihm in den ersten Jahren seiner Kindheit fast nur Englisch sprach.
Ja, ich wurde als Zehnjähriger Pimpf wie nahezu alle Jungen meiner Generation, nur ein Jahr später verkündete ein Gesetz die allgemeine Dienstpflicht der Jugend. Ja, ich trug im »Dienst« an jedem Samstagnachmittag die schwarze Diensthose mit Lederriemen und Koppelschloss, Braunhemd und ein Halstuch mit ledernem Knoten – aber ein guter oder gar überzeugter Pimpf war ich nie und konnte es gar nicht sein. Denn fast alles, was das Jungvolk oder später die HJ mit uns unternahmen – Geländespiele, Märsche, Exerzieren mit vormilitärischem Drill –, lief auf körperliche Ertüchtigung hinaus. Bewundert wurde, wer überlegene physische Stärke und besondere sportliche Fähigkeiten zeigte. Aber Sport war nie mein Fall – im Gegenteil: In der Turnhalle hing ich an Reck und Barren wie ein nasser Sack, beim Hundertmeterlauf schnitt ich bestenfalls als Vorletzter, wenn nicht als Letzter ab und war damit so etwas wie das bemitleidete Gegenstück des idealen Pimpfs. Der sollte ja rank und schlank wie die Windhunde sein, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl, wie der »Führer« es verlangte. Aber ich war dazu nicht geeignet, schon weil ich völlig andere Interessen hatte, die mich gefangen nahmen: Ich verschlang damals nicht nur, wie bei Jungens meines Alters üblich, Karl Mays Winnetou, James Fenimore Coopers Lederstrumpf, Felix Dahns Kampf um Rom oder Gustav Freytags Die Ahnen, bei denen mir die Erzählungen von Ingo und Ingraban – wohl weil ihr Stamm im nahen Thüringen siedelte – die liebsten waren. Ich verschlang auch alles, was über das sagenhaft umwobene Atlantis greifbar war. Geschichte und Vorgeschichte nahmen mich früh gefangen, und so suchte ich auf den umliegenden Feldern und Äckern nach Feuersteinsplittern – hätten die nicht von Werkzeugen oder Pfeilspitzen stammen können? Auch nach Tonscherben der Bandkeramiker aus der Jungsteinzeit fahndete ich, wohl in der völlig verwegenen Hoffnung, ich könnte eines Tages auf eine unentdeckte Grabstätte aus der Jungsteinzeit stoßen.
Die große Bücherwand der Eltern enthielt etliche Titel und Autoren, die damals offiziell verpönt waren. Neben Hermann Hesses Knulp (einer Weltkriegsausgabe mit schrecklichem, teils schon vergilbtem und bröselndem Papier) standen natürlich die Buddenbrooks von Thomas und Diekleine Stadt von Heinrich Mann, Lion Feuchtwangers Die häßliche Herzogin fand sich neben den Biografien Emil Ludwigs über Napoleon oder Goethe; in Erinnerung sind mir auch Jakob Wassermanns Romane Etzel Andergast und Das Gänsemännchen, die dicken Buchrücken Romain Rollands und der eines Modephilosophen der Zwanzigerjahre namens Hermann Graf Keyserling. Natürlich fehlte Franz Kuglers Geschichte Friedrichs des Großen mit den Zeichnungen Adolph Menzels nicht, aber daneben standen auch Douaumont des extrem nationalkonservativen Frontsoldaten-Sängers Werner Beumelburg und die Armee hinter Stacheldraht. Das Sibirische Tagebuch des kitschigen Ostlandreiters Edwin Erich Dwinger. Da war zusammengekommen, worüber das einigermaßen gebildete Bürgertum sprach und was es las, aber versteckt wurden NS-anstößige Titel keineswegs, schon weil meine Mutter Konzessionen an das NS-System hasste. Am meisten beeindruckt hat mich damals – ich muss da fünfzehn oder sechzehn gewesen sein – ein Roman Rabindranath Tagores, in dem er ein Ereignis aus den verschiedenen Perspektiven der Beteiligten schildert, eine Lektüre, durch die ich das Relative aller persönlichen Wahrnehmungen und Motive begreifen lernte.
Als ich mit vierzehn wie vorgesehen vom Jungvolk in die Hitlerjugend wechseln musste, meldete ich mich zur Nachrichten-HJ, denn dort hatte die technische Ausbildung Vorrang vor Geländemärschen, Sportwettkämpfen oder langweiligen ideologischen Heimabenden. Wir lernten das Bedienen stationärer Funk- und Morsegeräte und das Morsealphabet, kletterten mit Steigeisen an Telefonmästen hoch, um Leitungen zu verlegen oder sie zu reparieren; und wir stellten Verbindungen zwischen den klassischen, leider sehr schweren Feldtelefonen in ihren länglichen, empfindlichen Bakelitgehäusen her, deren Kurbeln man kräftig drehen musste, um der Gegenseite einen Gesprächswunsch zu signalisieren. »Geborgenheit in der Gruppe«, die der von mir sehr geschätzte Schriftsteller Peter Schneider später einmal als typisch für die Sozialisierung der HJ- und Flakhelfer-Generation konstatieren wird, mag für viele gelten, aber bei mir konnte davon nicht die Rede sein – geborgen habe ich mich dort nie gefühlt.
Wir Geschwister wuchsen mit Büchern auf, und in den großen, überfüllten Regalen der Eltern fanden sich auch viele Werke NS-verfemter Autoren
Knapp fünfzehnjährig mit Mutter Gertrud und Vater Karl-Erich
Als der Krieg dann schließlich kam, gab es weder Jubel noch nationales Hurrageschrei wie 1914, die Stimmung war durchweg bedrückt. Ich sehe die Szene vor mir: Fassungslos, niedergeschlagen, ja entsetzt schauen sich meine Eltern an; Mutter drückt mich an sich und sagt: »Du bist Gott sei Dank zu jung für diesen Krieg« – ein Irrtum, wie sich nur wenige Jahre später herausstellen sollte. Da war nichts von Begeisterung, aber alles Sorge und großes Erschrecken: zu lebendig die Erinnerung an das vier Jahre währende große gegenseitige Abschlachten, das erst einundzwanzig Jahren zuvor geendet hatte, die Erinnerung auch an die Nöte des Hungerwinters mit Steckrüben statt Kartoffeln. Es war eine Gefühlslage, die auch in den Elternhäusern der Schulfreunde vorherrschte. Hatte Hitler bis dahin nicht gerade deshalb so viel Zuspruch erfahren, weil es ihm gelungen war, unblutig viele der verhassten Fesseln des Vertrags von Versailles zu sprengen? Nun plötzlich doch Krieg?
Im Rückblick scheint mir allerdings, dass sich schon nach den ersten Erfolgen in Polen, nach jedem neuen, mit Liszts Fanfarenklängen als Sondermeldung im Radio hinausposaunten Sieg die Stimmung änderte. Bald überwog der Stolz auf die schnellen Erfolge der Wehrmacht, und in diesem Stolz steckte natürlich auch der auf »unsere Jungens« – schließlich gab es in fast jeder Familie einen Sohn, Neffen oder Enkel, der Kriegsdienst leisten musste. Der Stolz wuchs geradezu ins Unermessliche, als die Wehrmacht im Frankreichfeldzug die Briten zur Flucht über den Kanal und die Franzosen zur Kapitulation zwang. Es war die Zeit des Fähnchensteckens, mit dem der schier unaufhaltsame Vormarsch auf Landkarten in der Schulklasse, aber ebenso in vielen Bürgerstuben nachvollzogen wurde – mit Begeisterung und Respekt auch von der älteren Generation. Gelang den Söhnen nicht mit geringen Verlusten in sechs Wochen, woran die Väter in vier Jahren der Grabenkämpfe und Materialschlachten vor Verdun und in Flandern trotz riesiger Opfer gescheitert waren?
Durch unsere Familie ging damals ein Riss, wie ich erinnere – Vater, der aus dem letzten Krieg als Leutnant heimgekommen, Mitglied des »Stahlhelm« geworden und von Hitlers außenpolitischen Erfolgen bis 1939 beeindruckt war, zeigte sich von der Siegesstimmung angesteckt und hatte Hochachtung vor der militärischen Leistung der Wehrmacht. Ich versuche, ihn heute als einen Mann mit milder deutschnationaler Grundtönung zu verstehen, aber einer, dem alles »Fanatische« fremd war. Auf einigen seiner Holzschnitte ließ er schon mal eine Hakenkreuzflagge vom Rathausturm wehen. Mutter dagegen, welche die Nationalsozialisten und vor allem ihre SA als schreckliche Plebejer und Rabauken verachtete, blieb prinzipiell bei der absoluten Ablehnung des Krieges, selbst als er anderen schon so gut wie gewonnen schien. Sie hatte die Stimmung von 1914/1918 noch in Erinnerung und warnte: Auch der letzte Krieg habe mit lauter Siegen begonnen, nur um schließlich mit dem deutschen Zusammenbruch zu enden. Wenn sie einkaufen ging und mit einem »Heil Hitler« begrüßt wurde, weigerte sie sich konstant, mit dem sogenannten deutschen Gruß zu antworten. Trotzig sagte sie »Guten Tag« oder »Guten Abend«, sodass meine Schwester, die oft mit ihr unterwegs war, manchmal Angst um sie bekam. Der Boykott jüdischer Warenhäuser war ihre Sache nicht, Schuhe kaufte sie, solange es ihn gab, bewusst nur in einem jüdischen Laden. Ein wichtiges Motiv war sicher die Qualität des Angebots, aber stiller, verhaltener und innerlich überzeugter Protest hat dabei zweifellos mitgeschwungen.
Die jüdische Gemeinde in Zeitz war gering an Zahl, es gab keinen jüdischen Friedhof, jüdische Verstorbene wurden meist in den rund vierzig Kilometer entfernten Städten Leipzig oder Halle bestattet. Eine Synagoge war nicht vorhanden, stattdessen nur ein Betsaal in einem Hinterhof. Das Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum beziffert die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder in Zeitz für das Jahr 1925 auf fünfundneunzig, bis 1933 schrumpfte sie auf siebenundvierzig. Schon Ende des 15. Jahrhunderts hatte die Stadt den Bischof des Bistums Naumburg-Zeitz gebeten, alle Juden auszuweisen, und dafür die Verpflichtung übernommen, die von ihm bisher von den Juden kassierte Schutzsteuer alljährlich bar zu ersetzen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts siedelten sich dann wieder die ersten jüdischen Kaufleute an. Ich kann mich nicht erinnern, dass unsere Eltern je mit uns Kindern über Juden gesprochen hätten – jedenfalls nicht vor den letzten Kriegsjahren, in denen halb verhungerte jüdische Häftlingsgestalten sich nach jedem Bombenangriff in Kolonnen, von der SS bewacht, elendiglich durch die Stadt schleppten, um die Straßen wieder freizuschaufeln und Mutter sich entsetzt abwandte: Sie könne das schreckliche Elend nicht mehr mit ansehen.
Wie immer man das Schweigen der Eltern heute bewerten mag – meine Schwester meint, sie hätten versehentlichem Ausplaudern durch uns vorbeugen wollen. Tatsache ist allerdings, dass uns am Morgen nach der Pogromnacht vom 9. November strengstens verboten wurde, in die Stadt zu gehen. Offenbar sollten wir die Verwüstungen der wenigen noch vorhandenen jüdischen Geschäfte – es gab 1938 noch etwa zwölf oder fünfzehn davon – nicht sehen. Möglich, dass sie aus Scham und Erschrecken über diesen von Staat und Partei geförderten Bruch mit allen geheiligten Normen bürgerlicher Rechtsordnung handelten, gewiss aber sollten wir Kinder daran gehindert werden, plötzlich unangenehme, höchst unbequeme Fragen zu stellen. Heldenhaft war das nicht, aber es entsprach wohl einer im Bürgertum damals weitverbreiteten Haltung, schweigend hinzunehmen, was man nicht billigte oder verwarf, um Konflikte mit einer sich immer brutaler gebenden Partei- und Staatsgewalt zu meiden.
Vaters anfangs so optimistische Fähnchensteckstimmung schlug allerdings drastisch um, als Hitler den Feldzug »Barbarossa« begann. Da erzählte er uns wieder und wieder vom Schicksal des großen Korsen. Hatte Napoleon nicht auch versucht, Russland niederzuwerfen, hatte er nicht sogar Moskau erobert und war seine Grande Armée trotz anfänglicher Siege nicht dennoch in den Weiten des russischen Raums und im Kampf gegen General Winter kläglich untergegangen? Kamen die wenigen Überlebenden nicht als halb erfrorene, zerlumpte Gestalten zurück? Als die bis dahin so siegesgewisse Wehrmacht im Dezember 1941 vor Moskau ihre erste große Niederlage erlitt und sich zeigte, wie fahrlässig schlecht sie für die eisigen russischen Temperaturen gerüstet war, rief der Propagandaminister Joseph Goebbels die Bevölkerung zum Spenden von Winterkleidung und Skiern auf. Schweren Herzens trennte auch ich mich von meinen Brettern. Winterfreuden waren fortan auf Schlittschuhlaufen und Schlittenfahren begrenzt.
Wermutstropfen gegen den Optimismus der offiziellen Propaganda gab es immer wieder bei meinem Großvater mütterlicherseits, der an Fest- und Feiertagen regelmäßig Familie und Freunde um sich versammelte. Er warnte stets, die Engländer, ihre Zähigkeit und die Kräfte des Empire zu unterschätzen, denn er kannte seine Briten. Als junger Kaufmann hatte er zwei Jahre in England verbracht. Als Erbe einer kleinen Textilfabrik, später als einer der wichtigsten Direktoren des größten Kinderwagenbetriebs der Stadt, hatte er ein stattliches Vermögen gemacht – und es war ihm erstaunlicherweise gelungen, es sicher durch Krieg und Inflation zu bringen. Festliche Einladungen bei ihm erscheinen mir heute wie ein letztes, fernes Echo aus Stefan Zweigs Welt von Gestern – sicher auf provinziellerem Niveau, aber doch in einer Welt von Wohlstand und Sicherheit. In der war er, Jahrgang 1863, ja auch groß geworden. Seine Villa ließ er nach Plänen eines Architekten, der viele Wohnhäuser im Berliner Viertel Grunewald gebaut hatte, auf ererbtem Terrain 1904 errichten – und zwar im englischen Landhausstil. Bei großen, feinen Essen saßen meine Schwester und ich an einem kleinen Extratisch – dem »Katzentisch«. Den Cognac nahmen die Herren später im Rauchsalon, und ich durfte Kiebitz sein, Beobachter, wenn sie sich dort versammelten und ihre Zigarren qualmten. Die Damen nahmen Mokka und Pralinen im Salon nebenan. Diese Freunde im Rauchsalon, meist liberalkonservative, stockbürgerliche Herren, die in der Weimarer Zeit höchstwahrscheinlich alle Gustav Stresemann und seine Deutsche Volkspartei gewählt hatten, sprachen erstaunlich offen über die politische Lage. Dunkel erinnere ich mich, dass sie Franz von Papen lobten, der – ich muss damals sechs Jahre alt gewesen sein – in einer Rede in Marburg die Exzesse der neuen NS-Herrschaft kritisiert hatte. Auch Hjalmar Schacht, der 1923 als Reichsbankpräsident unter Stresemann geholfen hatte, die Hyperinflation zu beenden, genoss ihren Respekt. Hitler hatte ihn 1933 wiederum zum Reichsbankpräsidenten berufen, und willig finanzierte er jahrelang die Aufrüstung, bis er sich wegen ihrer ausufernden Kosten 1939 mit dem »Führer« überwarf.
Es war Weihnachten 1941, wenige Wochen nach Hitlers Kriegserklärung an die USA, als mein Onkel Walter – Jahrgang 1880, also ebenfalls ein Mann der Gründerzeit, Chef und Besitzer der Naether’schen Kinderwagenfabrik – mich, den damals dreizehnjährigen Knirps über die riesigen Ressourcen der Amerikaner aufklärte. Ich hatte wohl unziemlich vorlaut gefragt, ob unsere doch so erfolgreichen U-Boote die USA nicht daran hindern würden, mit ihren Soldaten je über den Atlantik nach Europa zu kommen. Onkel Walter, der in erster Ehe mit einer Amerikanerin verheiratet gewesen war, sagte nur: »So etwas haben wir schon im Ersten Weltkrieg vergeblich versucht, mein Junge – die werden schneller Schiffe bauen, als unsere Boote sie versenken können.« Der Onkel, übrigens der Sohn der Schwester meines Großvaters, musste es wissen, hatte er doch vor dem Ersten Weltkrieg in Amerika moderne Produktionsmethoden studiert, um sie in dem Unternehmen seines Vaters einzuführen.
Seit Amerika Kriegsgegner war, sah jedenfalls keiner der im Rauchsalon versammelten Herren noch eine Chance für ein siegreiches Ende dieses Krieges. An Wunder oder gar Wunderwaffen glaubte hier niemand, und den Gröfaz (»Größter Feldherr aller Zeiten«) hielt keiner von ihnen für ein militärisches Genie. Doch setzten manche – jedenfalls bis zum 20. Juli 1944 – noch auf die Einsicht der Generäle und, damit verknüpft, blieb eine, wenn auch vage Hoffnung auf einen irgendwie ausgehandelten Frieden. Hatte man nicht einige Trümpfe in der Hand, stand man nicht tief in Feindesland?
Übrigens war dieses so ferne Amerika für mich immer gegenwärtig in unserer Familie. Der älteste Bruder meiner Mutter, Großvaters Sohn Werner, war 1913 nach Amerika ausgewandert, um dort sein Glück zu versuchen. Ihr jüngerer Bruder Kurt baute sich nach dem Ersten Weltkrieg in Chile eine Existenz als Kaufmann auf. Es war ein stets spektakuläres Ereignis, wenn einer ihrer raren Briefe an meine Mutter bei uns im Briefkasten lag. Seit Ende 1941 kamen sie ja aus dem feindlichen Ausland auf dem Umweg über das Rote Kreuz in der Schweiz zu uns und trugen meist die Stempel der Zensur. Aber es gab noch eine andere Verbindung mit dem fernen Amerika. Der Bruder meines Großvaters, ein aktiver Offizier, hatte sich Ende des 19. Jahrhunderts seinen Jugendtraum wahrgemacht: einmal in seinem Leben durch den Yellowstone-Nationalpark zu reiten, und von diesem Urlaub war er mit einer Amerikanerin als Braut zurückgekommen. Für seinen Ruhestand hatte er sich ein stolzes Haus am Waldrand in Wernigerode gebaut, in dem seine inzwischen verwitwete Frau lebte – für meine Schwester und mich war dies unsere amerikanische Tante Elli, die wir in den Ferien gelegentlich besuchten.
Im Spätsommer 1943, ich war fünfzehn Jahre und drei Monate alt, begann für mich eine seltsame Doppelexistenz als Schüler und Soldat: Zusammen mit den Schulkameraden meiner Klasse an einem Realgymnasium, der Humboldt-Oberschule, wurde ich zu den Luftwaffenhelfern einberufen. Längst waren die Zeiten vorbei, als die Deutschen fröhlich Fähnlein steckten: Die 6. Armee hatte Ende Februar 1943 in Stalingrad und der Rest des einst so stolzen Afrikakorps im Mai in Tunis kapituliert, Goebbels hatte den »totalen Krieg« ausgerufen, und die Amerikaner waren im Juli auf Sizilien gelandet. Schmale Kriegskost hatte die gesetzten Herren in Großvaters Rauchsalon zu hageren Gestalten werden lassen, die jetzt nur noch über Möglichkeiten spekulierten, wie sich der Krieg im Westen beenden ließe, um sich ganz darauf zu konzentrieren, die Russen am Vordringen auf die deutschen Grenzen zu hindern. Ein Abschied von dem strengen Lateinpauker oder dem hageren, kleinwüchsigen und ach so peniblen Mathelehrer bedeutete die Einberufung als Luftwaffenhelfer keineswegs (auch wenn ich, des Bruchrechnens und Wurzelziehens völlig unbegabt und überdrüssig, ihn nur zu gern für immer losgeworden wäre). Wir wurden in Blusen und Hosen gesteckt, die im Blaugrau der Luftwaffenuniform gehalten waren, in sauberen Baracken nahe den Flakstellungen kaserniert und erhielten meist viel zu große Stahlhelme, die etwas wacklig auf unseren Köpfen saßen. Nach kurzer Grundausbildung wussten wir ziemlich gut, wie man die 3,7-cm-Flakgeschütze zu bedienen hatte, die rund um die Brabag – ein Kürzel für das Hydrierwerk der Braunkohle-Benzin Aktiengesellschaft – in Stellung gingen. Doch nach Abschluss der Ausbildung gab es Schulunterricht wie gehabt: Wir schwangen uns auf unsere Fahrräder, fuhren von unseren Baracken zur wenige Kilometer entfernten Schule, lasen Cäsars De bello Gallico mit dem berühmten Eingangssatz »Gallia est omnis divisa in partes tres« (»Gallien zerfällt in seiner Gesamtheit in drei Teile«), lernten Dreisatz oder schrieben Aufsätze bei ebenjenen Lehrern, denen ich so gern entronnen wäre. Kaum aber kam aus Berlin die Meldung »Feindliche Bomberverbände im Anflug über der Nordsee«, wurde der Unterricht abrupt abgebrochen. Wir kletterten umgehend auf unsere Fahrräder, sausten quer durch die Stadt zur Batterie zurück, setzten die Stahlhelme auf. Wir standen in Alarm-, und wenn die Bomber auf die mitteldeutschen Hydrierwerke Leuna, Böhlen und Zeitz-Tröglitz Richtung nahmen, schließlich in Feuerbereitschaft an den Geschützen. Sie waren von relativ hohen Erdwällen umgeben, und der Boden, auf dem wir an unseren 3,7-cm-Abwehrkanonen standen, war mit Lattenrosten versehen.
Ursprünglich waren wir Luftwaffenhelfer wohl nur als Hilfspersonal gedacht, das erwachsene Soldaten an Fernsprechern, im Schreibstubendienst und an den Funkmess- und Kommandogeräten ersetzen sollte. Mit ihnen wurden ja Entfernung, Kurs, Höhe und Geschwindigkeit der anfliegenden feindlichen Bomber für ein möglichst wirkungsvolles Abwehrfeuer der Flakbatterien geschätzt. So jedenfalls liest sich heute in den Akten eine erste Dienstanweisung Hermann Görings über die Verwendung des »jugendlichen Hilfspersonals«. Aber das änderte sich schnell, vor allem bei den Einheiten der leichten Flak, zu der wir ja gehörten. Gab es anfangs neben dem Batteriechef, einem Hauptmann, der im Zivilberuf Studienrat war und viel Verständnis für uns »Helfer« zeigte, noch etliche Unteroffiziere und mehrere Gefreite in unserem Zug, standen bald nur noch Luftwaffenhelfer an den Geschützen. Der Hauptmann blieb, aber bis auf einen oder zwei Unteroffiziere waren fast alle »erwachsenen« Soldaten ausgekämmt und zum Fronteinsatz abkommandiert. Nach einem Übungsschießen auf einem Manövergelände in Pommern, wo wir nach Kräften auf einen von einem Fieseler Storch gezogenen Luftsack gefeuert hatten, saß also ein Klassenkamerad als Richtkanonier auf dem Drehsitz der 3,7, zu dessen Bedienungsmannschaft ich gehörte. Als Ladekanonier hatte ich Kassetten oder Metallrahmen mit jeweils acht Granaten ins Geschütz zu schieben, und die Kassetten wiederum reichte mir ein weiterer Klassenkamerad zu. Später übernahm diese Funktion allerdings ein ukrainischer Hilfswilliger, der sich bei den Deutschen dienstverpflichtet hatte.
Natürlich bedeutete die Kasernierung Abschied vom »Hotel Mama«: Wir lebten jetzt in Baracken mit Doppelstockbetten, der Alltag begann mit Wecken um 6:30 Uhr, Stubenreinigen, »Bettenbauen« und Frühsport. Und natürlich kontrollierte der Unteroffizier beim Stubenappell, ob das Bett richtig »gebaut« und ob im Spind, in dem wir die Ausgehuniform, Unterwäsche, Stiefel, Stahlhelm, Persönliches und unsere Schulbücher aufbewahrten, auch peinliche Ordnung herrschte. Es gab in jeder Baracke ein oder zwei Tische, an denen wir Schularbeiten machen konnten, und wir hatten ebenso die Möglichkeit, einmal wöchentlich Ausgang zu nehmen – Tagausgang währte bis 21:00 Uhr, Nachtausgang bis frühmorgens zum Wecken.
Die meisten von uns steckten damals wohl noch mitten in der Pubertät, und so kam es zu manch merkwürdiger Demonstration gewollter Frühmännlichkeit. Einer unserer Kameraden prahlte nach seinem Nachtausgang damit, einen Besen vor der Barackentür aufzustellen, dessen Stilende er mit einem Kondom geschmückt hatte – offensichtlich zum Trocknen gedacht. Statt Wehrsold zahlte man uns eine tägliche Abfindung von 50 Pfennigen. Im Stellungsdienst trugen wir das Drillichzeug der Flakkanoniere, zur Schule fuhren wir in der Ausgehgarnitur – einer hüftlangen, blusigen Jacke, einer Hose mit Rundbund und einer Schirmmütze. Dazu gehörte offiziell eine HJ-Armbinde mit Hakenkreuz, die wir auf dem Weg zur Schule oder nach der Abmeldung zum Ausgang in der Schreibstube meist verschwinden ließen. Mit der HJ wollten wir nichts mehr zu tun haben – und hatten es in der Tat ja nicht mehr. Wir fühlten uns schon eher als Soldaten und wollten als solche wahrgenommen werden. Weil wir uns in dieser Rolle gefielen, begann auch so etwas wie der Abbau aller bisherigen Autorität: die der Lehrer, die wir nicht mehr als so wichtig erachteten, aber auch die der Eltern (und da vornehmlich des Vaters), deren belehrende Sprüche, Ermahnungen und gutbürgerliche Weisheiten wir in vielem nicht mehr ernst nehmen konnten. Allerdings hinderte mich das nicht, auf dem Rückweg von der Schule zur Stellung kurz zu Hause vorbeizuschauen, falls kein Alarm im Verzuge war. Mutter steckte mir dann ein Stück Kuchen zu oder gab die Unterhosen und -hemden zurück, die ich – wie sehr viele Helferkameraden – doch lieber im alten »Hotel Mama« waschen ließ. Sie besorgte mir auch richtige Socken, mit denen ich die grässlichen Fußlappen ersetzen konnte, die wir in den Stiefeln oder Schnürschuhen tragen sollten. Solche gelegentlichen, meist auf fünfzehn oder zwanzig Minuten begrenzten Stippvisiten daheim waren möglich, bis diese merkwürdige Doppelexistenz als Schüler und Soldat im Dezember 1944 jäh endete, weil unsere Batterie in die Gegend links des Rheins, nahe Prüm in der Eifel, verlegt wurde.
Der Bombenkrieg, gegen den wir die Brabag in Tröglitz sichern und verteidigen sollten, hatte uns zunächst etliche Monate verschont. Zwar gab es immer häufiger Alarm- und auch Feuerbereitschaft, weil die alliierten Bomberflotten seit Mitte 1943 den Krieg bereits bis tief nach Mitteldeutschland tragen konnten. Aber die Angreifer waren meist britische Lancaster-Geschwader, die nicht unser Hydrierwerk zum Ziel hatten, sondern nachts die Innenstädte Kassels oder des nur vierzig Kilometer entfernten Leipzig in flammende Infernos verwandelten. Die ganze Grausamkeit dieses Luftkriegs erlebten wir erst im Mai 1944, als die Amerikaner ihre Luftoffensiven gegen die deutsche Treibstoffindustrie begannen. Die ersten dieser großen Tagesangriffe erinnere ich genau: die anfliegenden Pulks der B-24-Bomber, die langen, unzähligen Kondensstreifen am Himmel, das unaufhaltsam näher kommende, immer lauter werdende tiefe, unheimliche, unheilverkündende Brummen und Dröhnen der Motoren, das Fallen der Zielmarkierungsbomben und das Pfeifen und Rauschen der ersten Bombenteppiche – vor allem aber unsere ohnmächtige Hilflosigkeit. So hatten wir Schüler uns das nicht vorgestellt: Zwar standen wir feuerbereit in unseren Stellungen, richteten unsere Geschütze auf die Pulks der anfliegenden Bomber, aber zum Schuss kamen wir nie, denn die Angreifer flogen in der für sie sicheren Höhe von über 6000 Metern, das Abwehrfeuer aus unseren 3,7-cm-Flakkanonen reichte aber maximal 4800 Meter hoch.
Typische Stellung eines unserer 3,7-cm-Flakgeschütze, mit denen unsere Batterie, rund um das Hydrierwerk Zeitz/Töglitz platziert, aus Braunkohle gewonnenes Benzin für die Wehrmacht sichern sollte. Erwachsene Soldaten wurden für den Fronteinsatz ausgekämmt, und so standen bald nur noch Luftwaffenhelfer an den Geschützen.
Als Luftwaffenhelfer im Spätherbst 1944
Riesige Rauchschwaden standen tagelang über dem Werk, das schwer getroffen wurde. Benzintanks explodierten, immer wieder gingen Bomben mit Zeitzündern hoch, aus unserer Stellung sahen wir ein Gewirr aus Gestängen, umgestürzten Schornsteinen und zu Skeletten verbrannten Kühltürmen. Als ehemaliges Mitglied der Nachrichten-HJ wurde ich einem Trupp zugeteilt, der die zerstörten Telefonverbindungen reparieren sollte. Ich sehe mich auf Äckern und Wiesen voller Bombentrichtern umgestürzte Masten aufrichten, zersplitterte durch neue ersetzen, mit Steigeisen nach oben klettern und neue Leitungen verlegen.
Unvergesslich aber bleibt mir vor allem der zweite Großangriff etwa zweieinhalb Wochen später. Es war ein strahlender Pfingstsonntag, als eine fliegende Armada in der Sonne glitzernder amerikanischer Bomber direkt Kurs auf das Werk und auf uns nahm. Wieder standen wir gefechtsbereit an unseren Geschützen, wieder flogen die Angreifer unerreichbar hoch – doch aus lauter Frustration riss meinem Schulkamerad Richtkanonier – ich meine, er hieß Appel – die Geduld. Ohne jeden Befehl gab er mit seinem Fuß den Abzug frei und feuerte voller Wut einfach drauflos, bis der völlig überraschte zuständige Offizier »Feuer einstellen« brüllte.
Welle auf Welle kamen die Bomber, der Angriff währte drei Stunden; einige Bomben gingen direkt vor unserer Stellung nieder, Splitter verletzten den ukrainischen Hilfswilligen, der mir die Granaten zureichte und nun laut stöhnend um Hilfe schrie. Was sich mir jedoch für immer einprägte, waren Beobachtungen, die ich die ersten zwei Tage nach dem Angriff machen konnte. Da kamen russische Kriegsgefangene, halb verhungerte Gestalten, die in einer Baracke mit vergitterten Fenstern nahe unserer Stellung hausten, uns die schwersten Arbeiten abnahmen und nun die Erdwälle um unsere Geschütze auszubessern hatten.
Am ersten Tag nach dem Angriff kreiste ein Fieseler Storch auffällig lange über den rauchenden Trümmern des Werks, dessen Insassen wohl den entstandenen Schaden abschätzen sollten. Am späten Nachmittag des zweiten standen dann plötzlich lauter Zelte in nächster Nähe zu den zerstörten Fabrikationsanlagen, etwa 200 oder 250 Meter entfernt von unserer Stellung, hinter einem schnell hochgezogenen doppelten Stacheldrahtzaun.
Als ich nachts, das viel zu lange und schwere französische Beutegewehr umgehängt, Wache an unseren Geschützen schob, sah ich Gestalten in gestreifter Häftlingskleidung, die sich dem von Scheinwerfern grell erleuchteten Zaun zu nähern suchten, aber von SS-Aufsehern immer wieder zurückgescheucht wurden. Direkt angrenzend an das Werk, dessen Produktion die Bomber nach diesem zweiten Angriff zu etwa 75 Prozent ausgeschaltet hatten, war wie über Nacht ein Außenlager des KZ Buchenwald entstanden. Die Häftlinge, meist ungarische Juden, wurden bald in Baracken im nahe gelegenen Rehmsdorf untergebracht und hatten Trümmer zu beseitigen, Aufräumarbeiten zu leisten, Kabel zu legen und die zerstörten hölzernen Kühltürme unter Aufsicht wieder zusammenzunageln. Ihre Bewacher waren Männer der Waffen-SS, an ihrem Dialekt unschwer als Österreicher zu erkennen, die auf einer Anhöhe nicht weit von uns neu errichtete Baracken bezogen hatten. Fünf Jahrzehnte später las ich von einem der Häftlinge, der nach dem Morgenappell in diesem Zelte-KZ mit einem Arbeitskommando in das Werk marschieren musste: »… da grüßt die Fabrik – mit dem Labyrinth ihrer Haupt- und Querstraßen, mit ihren vorwärts holpernden Kränen, den Erde fressenden Maschinen, ihren vielen Schienen, Kesseln, Rohren, Kühltürmen, Werkstätten viel eher eine richtige Stadt. Zahlreiche Krater und Mengen von hervorquellenden Kabeln deuten auf den Besuch von Flugzeugen hin.« So schrieb es mit ironisch-melancholischem Understatement der spätere Nobelpreisträger Imre Kertész in Romaneines Schicksallosen, das 1996 auf Deutsch erschien.1 Er und ich waren also nach Pfingsten 1944 bei Tröglitz nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt, er fünfzehnjährig, ich gerade sechzehn geworden – und doch trennten uns Jugendliche nicht nur der schwer von der SS bewachte Zaun, es trennten uns Welten: er Opfer eines Verbrechersystems mit seinem rassistischen Wahn, ich der 1938 verkündeten Jugenddienstpflicht gehorchend und noch nicht recht begreifend, woran mitzuwirken ich gezwungen war.
Bei einem Essen, bei dem wir uns beide ein Jahrzehnt nach der Wende bei gemeinsamen Freunden in Berlin trafen, tauschten wir uns über die kurze Zeit dieses uns damals nicht bewussten »Gegenüberseins« aus, ohne dass Kertész den geringsten Anflug von Bitterkeit dabei spüren ließ. Die Bilder von damals, die der gestreiften Elendsgestalten vor dem zerstörten Werk, die Bilder mühevoll sich dahinschleppender Häftlingskolonnen, die unter strenger Bewachung durch die Stadt zogen, wann immer Bomben auf sie gefallen waren, um Straßen und Gehwege freizuschaufeln – sie zeugten von der dunklen, bösen, von der menschenverachtenden Seite des Regimes. Und wenn ich zurückdenke, sind es diese unauslöschlichen Bilder, die bei mir am Anfang eines kritischen politischen Bewusstseins stehen, das sich langsam zu entwickeln begann. Dazu kam, dass ebenjener Onkel Walter, der mich Weihnachten 1941 über die unerschöpflichen Möglichkeiten Amerikas aufgeklärt hatte – die Tagesbombardements der U.S. Air Force führten vor Augen, wie recht er damit gehabt hatte –, wegen Abhörens der BBC ein halbes Jahr zuvor denunziert, von der Gestapo verhaftet und ohne jedes ordentliche Verfahren in das Straf- und Arbeitserziehungslager Torgau deportiert worden war. Die Familie, die Herren im Rauchsalon und die Damen beim Mokka nebenan waren natürlich entsetzt, und in der Stadt kursierten die wildesten, auch unsinnigsten Gerüchte über ihren wohl reichsten und bis dahin angesehenen Bürger – etwa, dass er vor dem Bombardement Leipzigs den Amerikanern per Funk mitgeteilt hätte, die gesamte Flak sei nach Berlin abgezogen worden. Aber des Onkels Verhaftung hinderte meinen Vater und mich nicht, wenn ich Nachtausgang hatte, die Berichte der BBC zu hören, die mit ihren klassischen vier Paukenschlägen – drei kurzen und einem darauffolgenden langen – und dem Satz: »Hier ist England« begannen. Über unsere Köpfe und den Volksempfänger hatten wir natürlich eine Decke gezogen, damit die typischen drei Paukenschläge für Nachbarn über oder unter uns auch ja unhörbar blieben.
An ein Ende dieses Krieges mit einem erträglichen Friedensschluss glaubte inzwischen kaum einer mehr – keiner jedenfalls im Kreise des Großvaters. Doch auch bei mir hatten sich längst erhebliche Zweifel gemeldet. Im Herbst 1943 wurde ich als Luftwaffenhelfer zur Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang an der Luftwaffennachrichtenschule in Halle abkommandiert. Einem »Feldpostbrief«, datiert vom 7. November 1943, den ich damals an die Eltern nach Hause schickte und den meine Schwester aufbewahrt hat, entnahm ich diese Zeilen: »Hoffentlich gibt es kein zweites Stalingrad, denn die Russen sind ja dabei, unsere ganze Südfront in Richtung Odessa zurückzuwerfen und ins Meer zu schmeißen.« Siegesgewiss las sich das nicht. Aber wieso auch? Waren früher die Siege kündenden, hellen und aufrüttelnden Liszt-Fanfaren erklungen, wurden Kriegsszenen der Wochenschau zunehmend mit tragischer Musik unterlegt – mit Klängen aus WagnersGötterdämmerung, SchubertsUnvollendeter oder BeethovensNeunter Sinfonie. Im Rückblick weiß ich: Die nicht enden wollenden Niederlagen bei Kriegsende wurden in Film und Wochenschau von Goebbels wie große Opern eines tragischen, schicksalhaften Untergangs inszeniert – aber nicht nur von ihm. Ich erinnere mich deutlich der Rede Görings, die wenige Tage vor der Kapitulation der 6. Armee an der Wolga aus dem Volksempfänger kam und mir als Fünfzehnjährigem eine Art Schauer über den Rücken jagte. Sprach der »Reichsmarschall« – jener, der hatte Meier heißen wollen, wenn ein feindliches Flugzeug je eine Bombe über Deutschland abwerfen sollte –, sprach dieser Meier nicht von Stalingrad als einem »gewaltigen Heldenlied«? Vergleichbar nur dem Kampf der Nibelungen, die in einer »Halle voll Feuer und Brand« kämpften und – so Göring – »den Durst löschten mit dem eigenen Blut«? Und beschwor er nicht die Schlacht bei den Thermopylen, wo 300 Spartaner unter ihrem König Leonidas etwa 500 vor Christus, sich für den unbehelligten Rückzug ihrer Armee opfernd, ein übermächtiges persisches Heer tagelang aufgehalten hatten? Zitierte er nicht, NS-konform abgewandelt, was ihnen zu Ehren auf eine griechische Stele eingemeißelt worden war: »Wanderer, kommst du nach Stalingrad (Sparta), so berichte, du habest uns liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl?«
Luftkrieg wurde für uns zum Alltag, auf die ersten beiden Großangriffe folgten größere Tagesangriffe im August und November 1944. Am 21. Dezember, einen Tag nach Beginn der Verzweiflungsoffensive gegen die Westalliierten in den Ardennen, wurden wir, mitsamt Geschützen und Munition auf Güterwagen verladen, in Richtung Eifel in Marsch gesetzt. »Räder müssen rollen für den Sieg«, stand in großen weißen Lettern auf der Lok, die uns als sozusagen letztes Aufgebot gen Westen zog. Unsere Einheit war, schreibt der Militärhistoriker Jürgen Möller, für die Abwehr eines alliierten Angriffs Richtung Rhein vorgesehen. Schon am dritten Tag unserer Reise, unser Zug steht auf einem Abstellplatz des Bahnhofs von Kelsterbach, fliegen Bomberverbände den angrenzenden Frankfurter Flughafen an – und ein Bombenteppich geht auch auf uns im Bahnhof nieder. Vier Luftwaffenhelfer unter den Toten, drei unter den Verwundeten. Eine solche Bescherung – es war ja der 24. Dezember – hatten wir uns zu Heiligabend nicht vorgestellt. Bomben fallen auch auf einen weiteren Bahnhof, auf dem wir Station machen – bis wir schließlich Anfang Januar, auf Lkws umgeladen, an unserem neuen Einsatzort links des Rheins ankommen: Niedermendig in der Eifel mit dem nahe gelegenen Flugplatz Thür, den wir gegen Tiefflieger sichern sollen.
Was folgt, schon um ewige Wiederholungen zu vermeiden, nur noch in Kurzfassung: Stellungsbau bei minus fünfzehn Grad Celsius, der Boden tiefgefroren, unsere Spaten dafür schlecht geeignet. Bombenabwürfe die Regel – Jagdbomber kommen fast täglich; einmal gelingt unserer Batterie der Abschuss einer britischen Spitfire; einmal ein Volltreffer in einer unserer Geschützstellungen bei einem Bombenangriff Ende Januar, dann Verlegung der Batterie ins rechtsrheinische Nassau an der Lahn. Aufgabe: eine Brücke schützen. Unsere 3,7 haben wir noch nicht in Stellung gebracht, da greifen hundert der gefürchteten, schnellen und zweimotorigen amerikanischen Marauder-Bomber Brücke, Bahnlinie und Stadt an. Bei uns zwei tote Luftwaffenhelfer, ein dritter stirbt am Tag darauf schwer verletzt im Lazarett, drei von sechs unserer Geschütze zerstört. Unsere Unterkunft, erinnert mein Mithelferkamerad Horst Wohlfahrt, ein großer Kinosaal, wurde in der Stadt ebenfalls getroffen – an einer Stirnwand konnte man in den Himmel sehen, auf allen Klamotten lag »eine Staubschicht aus Kalk und Mörtel«.
Nachts stehe ich noch einmal Wache auf der Wiese, auf der unsere Munitionskisten lagern – ausgerüstet jetzt nicht mehr mit dem schweren französischen Beutegewehr, sondern mit einem leichteren italienischen Karabiner mit Magazin – und bei Mondschein gebe ich damit auf einen Schatten, hinter dem ich einen feindlichen Agenten vermute, mehrere Schüsse ab. Hatte es sich vielleicht nur um eine Katze gehandelt, hatte ich mir damit selbst Mut machen wollen in den Stunden, die auf die Schrecken des langen Bombardements folgten?
Die Schüsse stehen jedenfalls am Ende meiner ungewollten Karriere als Luftwaffenhelfer. Denn wie einige andere Schulkameraden in unserer Einheit erkrankte ich wenige Tage später an der Ruhr und musste etliche Wochen im Lazarett in Montabaur verbringen. Halbwegs wieder auf den Beinen, untersuchte mich ein junger Stabsarzt und kam zu dem Befund: »Sie sind viel zu schwach, um zu Ihrer Einheit zurückzugehen. Und außerdem« – und lachte dabei leise – »viel zu jung, um Krieg zu spielen.«
Mit einem Marschbefehl zurück nach Zeitz, wohl zur Wiederherstellung der Kräfte, genauer der Wehrkraft – wurde ich Ende Februar aus dem Lazarett entlassen. Ich hatte Glück, denn unsere Einheit wurde von Nassau noch zur Abwehr von Panzern an die Autobahn Limbach-Köln verlegt. Eine zuständige Luftwaffenhelfereinheit, bei der ich mich, nach einigen Wochen Gesundungsurlaub hätte zurückmelden können, gab es in Zeitz nicht mehr. Als ich einmal, vom schlechten Gewissen als möglicher Drückeberger geplagt, mit dem Fahrrad zum zuständigen Wehrkreisersatzamt im dreißig Kilometer entfernten Naumburg fahren wollte, um mich dort zu melden, geriet ich unterwegs in einen Jagdbomberangriff und musste Schutz unter einer Brücke suchen. Den braven Vorsatz, bis nach Naumburg zu kommen, gab ich schließlich auf, weil immer wieder amerikanische Mustangs über der Straße kreisten und alles beschossen, was sich bewegte. Erst Jahrzehnte später las ich bei Durchsicht meiner Stasiakten, wovon ich damals nicht das Geringste erfahren oder geahnt hatte: dass gegen mich ein Ermittlungsverfahren wegen Wehrdienstverweigerung angestrengt worden sei.
Wenn dies schließlich keine Folgen für mich mehr hatte, verdanke ich das der U.S. Army, die Mitte April, etwa fünf oder sechs Wochen nach meiner Rückkehr aus dem Lazarett, die Stadt einnahm. Es hatte nur schwachen Widerstand an den Elsterbrücken gegeben, hart wurde dagegen um den Zeitzer Kasernenkomplex gekämpft, den ein Durchhalteoberst mit einer Handvoll Soldaten verteidigte. Vater war als Kommandeur einer kleineren Volkssturmeinheit verpflichtet worden – aber er und die Männer, die am Stadtrand Position beziehen sollten, kämpften nicht, sie vergruben ihre Panzerfäuste und gingen klammheimlich nach Hause. Der Krieg war, zumindest für uns, vorüber.
Einen Tag nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht gegenüber den westlichen Alliierten in Reims am 7. Mai wurde sie in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai in Berlin-Karlshorst in Anwesenheit der Sowjets »ratifiziert«, wie man diese protokollarische Wiederholung nannte. Und an ebendiesem 9. Mai wurde ich siebzehn Jahre alt. Ich fühlte mich befreit, wenn auch noch nicht in dem Sinn, den ihm – spät und zu Recht – Richard von Weizsäcker mit seiner berühmten Rede zum 8. Mai 1945 gegeben hat. Was ich fühlte, kam eher dem nahe, was Theodor Heuss über diesen 8. Mai vor dem Parlamentarischen Rat 1949 sagen sollte. Dort sprach er ja von der tragischen und fragwürdigsten Paradoxie der deutschen Geschichte, fragte, warum, und gab selbst die Antwort: »Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind.« Wie für die meisten Erwachsenen rundum stand das Datum für die Besiegelung einer Niederlage, die einer Katastrophe gleichkam – aber es bedeutete eben auch Erlösung: frei zu sein von den Schrecken des Krieges und frei zu sein für eine Zukunft, die schlimmer als das in den letzten Jahren Erlebte kaum sein konnte. Der Historiker Rolf Schörken, ein Luftwaffenhelfer meines Jahrgangs, wird später urteilen: »In einer Lebensphase, in der sich (normalerweise) dadurch Weltvertrauen herausbildet, dass man sich auf die Außenwelt verlassen kann«, erlebten wir Luftwaffenhelfer, dass die Welt nicht verlässlich war, weil sich alles »immer nur zum Schlimmeren und Katastrophalen hin« entwickelte.2
In der Tat war die Welt, in die wir hineinwuchsen, alles andere als verlässlich. Doch anders als die meisten Erwachsenen rundum bedrückten mich nicht Zukunftsängste. Ich fühlte mich endlich frei vom Marschieren und vom automatisch Gehorchen-Müssen, frei von einer Welt, in der nur physische Stärke zählte, einer Welt der Bomben, der Befehle und der Gewalt. Eine solche Welt wollte ich nie wieder haben. Ich war frei und offen für etwas völlig anderes und Neues, das da kommen und an dem ich teilhaben würde.
II
»So jung und schon so verdorben« – Wahlkampf für Jakob Kaiser
Sie bewegten sich leise und lässig, die amerikanischen Eroberer. Das rhythmische Knall-Knall der genagelten Knobelbecher deutscher Marschkolonnen hatte durch Straßen und Gassen gehallt, die GIs, wie wir sie bald zünftig nannten, kamen auf Gummisohlen daher. Marschierte ein Platoon der Sieger durch die Stadt, war ein zwar rhythmisches, aber doch eher verwischtes Klatsch-Klatsch zu hören. Ihre Jeeps hatten – vergleichsweise – gedämpfte, benzingetriebene Motoren, selbst ihre Sherman-Panzer verursachten weniger Geräusche als die deutschen, denn ihre Stahlketten waren mit einer Kautschukauflage versehen.
Dass sie und nicht die Russen die Stadt Zeitz im Kampfe nahmen, hatte die große Mehrheit der Bevölkerung aufatmen lassen, blieb ihr doch damit erspart, was Gerüchte behaupteten, die sich hinter der russischen Front oft genug bewahrheiten sollten: dass auf die Einnahme einer Ortschaft durch die Sowjets Massenvergewaltigungen folgten. So ganz traute meine Mutter jedoch auch den Amerikanern nicht – weshalb meine zwanzigjährige Schwester Hella, in hässlich-abschreckende Kleider gesteckt, auf alt geschminkt und unter einem riesigen Kopftuch versteckt im Keller sitzen musste, bis die Gefechte vorüber waren.
Die Amerikaner blieben nur zweieinhalb Monate. Spuren hinterließen sie nicht, ausgenommen einige gute Erinnerungen, die sich ins Gedächtnis der Bürger einnisteten, vor allem, als ihre Nachfolger Einzug gehalten hatten. Zwar kam es zu einigen Plünderungen durch befreite Zwangsarbeiter (damals noch, dem Nazi-Slang entsprechend, meist »Fremdarbeiter« genannt), die sich in der barocken Moritzburg einquartiert hatten und gegen die der US-Stadtkommandant zunächst nichts unternahm. Die NSDAP-Funktionäre hatten sie, soweit sie nicht geflohen waren, inhaftiert und in Internierungslager geschickt, und so schien, wenn auch mit allen Anzeichen des Behelfsmäßigen und unter dem Vorbehalt der Launen der Besatzungsmacht, die alte bürgerliche Ordnung ohne NS-Überbau wieder in Kraft gesetzt. Zum kommissarischen Oberbürgermeister hatte der Stadtkommandant – nach Prüfung durch den US-Militärgeheimdienst CIC – den konservativen Verleger Arthur Jubelt ernannt. Offenbar stand er auf der »weißen Liste« unbelasteter Persönlichkeiten, die in den USA mithilfe von deutschen Emigranten erstellt worden war. Pflichteifrig kümmerte er sich bald um das Allernötigste – die Beseitigung von Kriegstrümmern, die notdürftige Instandsetzung von Brücken oder die Wiederaufnahme des Zahlungsverkehrs.
Doch dann, nach einer Nacht unheimlicher Stille, begrüßte uns am 1. Juli vormittags das Hufeklappern zahlloser Panjepferde und das laute Rumpeln größerer Leiterwagen, an denen Kanonen hingen. Ohne jede Vorwarnung hatten die Amerikaner die Stadt verlassen, und friedlich hielt die Rote Armee nun Einzug in jene Teile Mitteldeutschlands, die in Jalta ihrer Besatzungszone zugeschlagen, aber von den schneller vorstoßenden Amerikanern erobert worden waren. Im Austausch dafür übernahmen die Westalliierten ihre Sektoren in der Viermächtestadt Berlin. Die russischen Kommandeure hatten Anfang Juli ihre Truppen im Griff, der Einmarsch geschah diszipliniert, die befürchteten Exzesse im Siegesrausch gehörten der Vergangenheit an – und doch trennten Welten die Besatzer von gestern von denen, die nun gekommen waren. Da ging es um mehr als nur um die ärmlich wirkende technische Rückständigkeit, wie sie jedem unübersehbar die Ankunft der mit Beutemöbeln beladenen Panjewagen bezeugt hatte. Fast über Nacht entstanden an den Eingängen zum Kasernengelände riesige, hölzerne, schreiend bunt bemalte, beinahe exotisch-fernöstlich wirkende Triumphbögen mit Stalinbildern, und nachts erklangen hinter den Kasernenmauern schwermütige russische Lieder. Auch nahm die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD), der die Stadt nun unterstand, in engem Kontakt mit den Genossen der heimischen KPD entschlossen die Umgestaltung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Angriff.
Erstes Opfer dieser engen Zusammenarbeit von SMAD und KPD in Zeitz, dieser von der DDR später gern und propagandistisch positiv zitierten »antifaschistisch-demokratischen Umwälzung«, wurde der von den Amerikanern als kommissarischer Bürgermeister eingesetzte konservative Verleger. Nach der Demonstration einer kommunistisch geführten Antifa-Gruppe zur Säuberung der Verwaltung von »faschistischen und reaktionären Elementen« enthob ihn am 18. Juli der sowjetische Stadtkommandant seines Amtes und ersetzte ihn durch einen Kommunisten. Gute sechs Wochen danach vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet, landete Jubelt schließlich im NKWD-Speziallager Buchenwald und sollte dort Anfang Dezember 1947 eines elenden Todes sterben. Seine Buchdruckerei und sein Verlag waren bereits im Winter 1945/1946 enteignet worden. Jubelt zählt zu den mehr als 7000 Gefangenen, die aufgrund mangelnder Ernährung (Dystrophie), Entkräftung, Ruhr oder Typhus allein in diesem Lager des Innenministeriums der Sowjetunion zwischen 1945 und 1950 umkamen. Verhaftet und gefangen gehalten wurde er ohne jedes Verfahren, und weil sich in den russischen Archiven weder eine Anklage noch ein Gerichtsurteil gegen ihn finden ließen, konnte er – obschon er es wahrlich verdient hätte – nach der Implosion der Sowjetunion und dem von der Russischen Föderation unter Boris Jelzin erlassenen Gesetz als politisch Verfolgter in den Neunzigerjahren auch nicht »rehabilitiert« werden.
Nun war der Verleger Jubelt von Hause aus gewiss kein geborener oder gar überzeugter Demokrat, im Gegenteil – der ehemalige kaiserliche Oberleutnant, der Monokel trug, weil er im Krieg ein Auge verloren hatte, war ein Nationalkonservativer par excellence, ein geradezu glühender Monarchist und alles andere als ein Freund der Weimarer Republik. Aber ein Nazi oder gar ein Mitglied ihrer Partei war er nie, dafür hatte er viel zu viel Achtung vor dem Rechtsstaat, den die Nazis mit Füßen traten. Und als Naziverächter und -gegner half er in den zwölf NS-Jahren nachweislich Verfolgten, stellte Verwandte von linken inhaftierten NS-Gegnern und »Halbjuden« in seinem Betrieb ein, was damals nicht wenig Courage erforderte. Übrigens machte einer, der während der NS-Zeit bei ihm als angehender Industriekaufmann lernte, unter Erich Honecker später Karriere: Werner Jarowinsky, erst als Kandidat, dann Mitglied des SED-Politbüros zuständig für Handel und Versorgung. Gegner der Weimarer Demokratie waren allerdings auch Jubelts erbitterte Feinde und Denunzianten bei der SMAD, die Kommunisten, gewesen. Zusammen mit der NSDAP stürmten sie 1931/1932 gegen die demokratische preußische Regierung von Braun und Severing an, sie kollaborierten mit den Nazis auch beim wilden Verkehrsarbeiterstreik in Berlin im November 1932, weil sie ihre Hauptfeinde damals in den Sozialdemokraten, den »Sozialfaschisten«, nicht in den Nationalsozialisten sahen. War es nicht Clara Zetkin, die als Alterspräsidentin bei der konstituierenden Sitzung des Reichstags im August 1932 sich als Gegner der Demokratie bekannte, als sie hoffte, das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin auch den Ersten Sowjetkongress Deutschlands eröffnen zu können?
Zu meinen Kindheitserinnerungen gehören die penetrant nach Druckerschwärze riechende Rotation in Jubelts Verlag und die große Handpresse, auf der mein Vater den von ihm bearbeiteten weißen Stein montierte, um Lithografien zu drucken. Viele seiner Zeichnungen oder Holzschnitte erschienen in Jubelts Zeitzer Neuesten Nachrichten, einem konservativ-bürgerlichen Blatt, das noch 1935 mit der Zeitzer Ausgabe der mitteldeutschen NS-Zeitung in Fehde lag. Vater war ein enger Freund von Jubelts älterem Bruder Reinhold gewesen – Grund genug, an der Tragödie des Verlegers und engagierten Heimatforschers Anteil zu nehmen.
Noch näher betraf uns allerdings das Schicksal eines zweiten Opfers der Zusammenarbeit von SMAD und KPD – das Walter Naethers, jenes Onkels, der mich 1941 über die riesigen Ressourcen Amerikas aufgeklärt hatte. Auf Anordnung des russischen Stadtkommandanten wurde er schon im August 1945 als Generaldirektor der Naether-Werke abgesetzt und durfte seither seinen Betrieb nicht mehr betreten. Wenn die Aktion gegen ihn fast ein ganzes Jahr vor jenem Volksentscheid über die Verstaatlichung von Betrieben in der SBZ, der Sowjetischen Besatzungszone, begann, die »Naziverbrechern, aktiven Nazis oder Kriegsinteressenten« gehörten, hatte das wohl damit zu tun, dass er als Chef der neben der Zemag-Eisengießerei wichtigsten großen Fabrik der Stadt mit mehr als 1500 Arbeitern und Angestellten (1936) den Kommunisten seit Langem ein Dorn im Auge war. Sein Betrieb wurde zunächst sequestriert, also unter Zwangsverwaltung gestellt, und ging Mitte 1946 zunächst in das Eigentum der Provinz Sachsen, später des Landes Sachsen-Anhalt über. Formelle Begründung war der von Marschall Georgi Schukow unterzeichnete Befehl 124, der das Eigentum der NSDAP, ihrer Amtsleiter sowie der Wehrmacht beschlagnahmte.
Nun war Walter Naether nie ein Freund der Nazis, geschweige denn Mitglied ihrer Partei gewesen. Im Gegenteil: Länger und zäher als andere Zeitzer Unternehmer hatte er nachweislich versucht, seine Firma von allen Rüstungsaufträgen freizuhalten. Dennoch befahl ihm das Rüstungskommando der Wehrmacht schon ab 1940, Kisten für Patronen, Granaten und Panzerfäuste herzustellen, und auf die Verkündigung des »totalen Krieges« 1943 folgte das absolute Verbot, jenes Produkt herzustellen, das die Firma groß und weltbekannt gemacht hatte: Kinderwagen. Gezwungen, seine Gesamtkapazität an Arbeitskräften und Maschinen vollständig der Rüstung zur Verfügung zu stellen, musste der Betrieb jetzt hölzerne Bauteile für Transportflugzeuge der Firma Junkers in Dessau produzieren. Sich diesen Anordnungen zu widersetzen, hätte im »Dritten Reich« und mitten im Krieg den Verlust der Firma, ebenso sicher aber auch den der persönlichen Freiheit bedeutet.
Ich erinnere mich eines kurzen Besuchs in diesem Sommer oder Frühherbst 1945: Plötzlich stand, und das war nun wirklich eine große Ausnahme in jenen Tagen, ein ziviler Wagen mit einem Chauffeur vor unserem Haus. Ihm entstieg Dr. jur. Heinrich Troeger, den die Amerikaner zum Oberbürgermeister von Jena bestellt hatten und die Sowjets bis Herbst 1946 im Amt belassen sollten – ein Cousin (zweiten Grades) meiner Mutter, einer geborenen Troeger. In Zeitz 1901 zur Welt gekommen und aufgewachsen, war er andere Wege als die Mehrheit der in seiner Geburtsstadt verbliebenen Troeger-Sippe gegangen und hatte sich früh den preußischen Sozialdemokraten um Otto Braun angeschlossen. Von 1926 bis 1933 Erster Bürgermeister des schlesischen Neusalz und beim NS