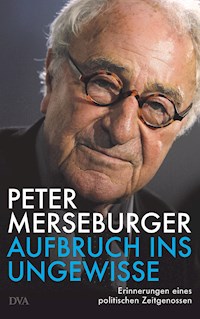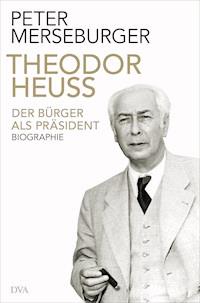
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Liberal, gebildet, charakterstark Theodor Heuss, der Ausnahmepolitiker
Als Theodor Heuss am 12. September 1949 zum ersten Bundespräsidenten gewählt wurde, war das Amt nicht viel mehr als ein »Paragraphengespinst«. Er füllte es mit seiner Person und seinen politischen Erfahrungen und setzte Maßstäbe, die bis heute gelten. Heuss wurde zu einem »Erzieher zur Demokratie« und verschaffte der jungen Bundesrepublik Ansehen im Ausland. Als »Papa Heuss« wurde er populär und genoss die Sympathie der Bevölkerung.
Peter Merseburger, Verfasser mehrerer großer und viel gelobter Biographien, zeichnet das Leben dieses Politikers nach, der seine Wurzeln im Kaiserreich hatte und die Brücke zur Bundesrepublik schlug. Heuss war Journalist, Schriftsteller, Intellektueller, ein klassischer Bildungsbürger. Seine Lebensgeschichte ist zugleich eine Politik-, Kultur- und Zeitgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 975
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Peter Merseburger
Theodor Heuss
Der Bürger als Präsident
Biographie
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. 2. Auflage
Copyright © 2013 Deutsche Verlags-Anstalt, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Alle Rechte vorbehalten
Typografie und Satz: DVA / Brigitte Müller
Gesetzt aus der Sabon
ISBN 978-3-641-04157-1V003
www.dva.de
Für Sabine
Inhalt
Vorwort
Die Legenden der 1848er Revolution
Eine Kindheit und Jugend im Schwäbischen
Kathedersozialisten, Werkbund und Aufbruch zur Moderne
Studiosus zwischen Politik, Kunst und Bohème in München
Um die Reform des Reichs
Redakteur bei Friedrich Naumann und eine moderne Ehe
Patriotismus und der Versuch, nüchtern zu bleiben
Chefredakteur während des Ersten Weltkriegs in Heilbronn und die Mitteleuropa-Idee
Großdeutscher auf dem Boden der jungen Republik
Demokratie und Nation – Hochschule für Politik
Aufgeputzte Ladenhüter der Wilhelminischen Epoche
Reichstagsabgeordneter, Kampf um die Demokratie und sein Buch Hitlers Weg
Ein Ja, das aus der Lebensgeschichte nicht auszulöschen ist
Ermächtigungsgesetz, innere Emigration und Biograph einer bürgerlichen Welt
Ein US-Leutnant fährt vor
Neubeginn: Journalist, Kultminister und Verfassungsvater
Der Präsident füllt ein Paragraphengespinst
Adenauer, Heuss’ Feldzüge gegen das Vergessen und das Stiften einer demokratischen Tradition
Wiederwahl auf der Höhe seiner Popularität
Repräsentant eines neuen Deutschland nach außen, Erzieher zur Demokratie nach innen
Anhang
Dank
Auswahlbibliographie
Personenregister
BILDTEIL 1
BILDTEIL 2
BILDTEIL 3
Bildnachweis
Vorwort
An Theodor Heuss zu erinnern heißt, an die Anfänge der zweiten deutschen Demokratie zurückzukehren, in eine Zeit, in der es alles andere denn gewiss war, ob diesem neuen Staat je ein glücklicher Stern leuchten würde. Die Städte lagen in Trümmern, Zehntausende Flüchtlinge lebten in Lagern, wichtige Teile der Industrie wurden demontiert, und Demokratie war für die Mehrheit der Deutschen damals keineswegs ein positiv besetzter Begriff: Die Erfahrung von Weimar mit seiner Parteienzerrissenheit bestimmte die kollektive Erinnerung, bei einem Teil der Deutschen war die nationalsozialistische Indoktrination gegen alles Demokratische noch virulent, und die wahren Herren über Westdeutschland, die Alliierten Kommissare, thronten hoch über Bonn auf dem Petersberg.
Wenn dieser zweite deutsche Demokratieversuch, allen Schwierigkeiten des Anfangs zum Trotz, schließlich so gut geglückt ist, dass er bis heute den festen institutionellen Rahmen selbst für das vereinte Deutschland gibt und zu einer Epoche der Freiheit führte, wie es sie in der deutschen Geschichte bisher nie gegeben hat, ist dies nicht zuletzt das Verdienst von Theodor Heuss. Er half an entscheidender Stelle mit, das Fundament zu legen, auf dem die deutsche Demokratie bis heute steht. Nach zwei verlorenen Kriegen und der ersten, gescheiterten Republik, nach zwölf Jahren des totalitären Terrors und aufpeitschender Durchhalteparolen erscheint er im Rückblick als die ideale Besetzung des höchsten Amtes der zweiten deutschen Demokratie.
Erstmals stand mit ihm an der Spitze eines deutschen Staates ein klassischer Bildungsbürger mit unerhört großem Fundus, der eine Symbiose von Geist und Macht zu repräsentieren schien, auch wenn von der Machtfülle eines Präsidenten der Weimarer Republik fast nichts geblieben war. Weil Hindenburg die seine zur Berufung Hitlers hatte nutzen können, entschieden die Väter der Verfassung, zu deren wichtigsten ja Theodor Heuss selbst gehörte, dass der künftige Präsident nicht mehr über die besondere Legitimation der Wahl durch das Volk verfügte. Auch über die Richtlinien der Politik hatte er nichts mehr zu sagen – die bestimmte jetzt allein der vom Parlament gewählte Bundeskanzler. Im erheblich geschrumpften Arsenal der politischen Waffen blieb dem neuen Präsidenten vor allem die Rede, aber gerade sie wusste Heuss so überzeugend zu nutzen wie nach ihm bisher nur Richard von Weizsäcker. Heuss wurde zur moralischen Instanz, gab dem neuen Staat Konturen und ein geistiges Gesicht. Er trat ein Amt an, das über keinerlei Tradition verfügte, aber durch sein Amtsverständnis und seine präsidiale Praxis vermochte er eine Tradition zu schaffen, an die sich seine Nachfolger gebunden fühlen. Bis heute ist die politische Kultur der Bundesrepublik nicht zu denken ohne die Akzente, die Theodor Heuss am Anfang setzte.
Dieser Präsident war ein echter Bürger, durch und durch zivil, ein Mann des Maßes, allen Ausschweifungen abgeneigt und mit einfachen Vorlieben ausgestattet: eine gute Brasil und zwei, auch mal drei Viertele Lemberger mussten es für den Schwaben schon sein. Als Bürger wurde er populär in einer Zeit, in der nach Jahren totalitärer Gewaltexzesse und des Chaos die Sehnsucht nach Bürgerlichkeit und ziviler Ordnung dominierte. Und wenn sich bald sein »Bürgerbauch« unter der Weste zu dehnen begann, machte ihn das erst recht zum ersten Repräsentanten im Wirtschaftswunderland. Allem Pomp und großem Zeremoniell abgeneigt, empfand er Etikette oft als Zwang, und nicht immer beugte er sich ihr. Bei Staatsjagden erschien er nicht in grünem Loden, sondern in bürgerlichem Zivil und spazierte in Halbschuhen mit Stock neben den Jägern und ihren Flinten einher. Von Soldaten im Manöver verabschiedete er sich mit seinem berühmten: »Nun siegt mal schön!« – ein Satz, eingegangen in die deutsche Sprichworttruhe. Er predigte nicht nur Demokratie, er lebte sie vor: Stets natürlich bleibend, wurde er mit der Heuss-typischen Mischung von volksnah und behäbig-humorvoll ein Präsident zum Anfassen, ein überall gefragter Fest- und Eröffnungsredner, und mit der bei ihm hochentwickelten Neigung zu Ironie und Selbstironie brachte er seine Popularität selbst auf die Formel: Von München, Kiel bis Neuss – keine Feier ohne Heuss.
Dieser erste Präsident der neu geschaffenen Bundesrepublik war nicht nur bekennender Demokrat, dem schon der Vater die Ideale der Paulskirche und der 1848er-Revolutionäre in die Kinderseele eingepflanzt hatte. Er war ein nicht minder überzeugter Nationaler, nach dessen Verständnis Demokratie und Nation untrennbar zusammengehörten. Einerseits mahnte er in seinen Reden deutsche Selbstläuterung an, forderte Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und Mut zur Wahrhaftigkeit. Er erinnerte an das tragische Schicksal der Juden (den Begriff Holocaust gab es noch nicht) und setzte gegen das Wort von der Kollektivschuld das von der Kollektivscham. Andererseits aber hoffte er auf eine Zeit, in der die Deutschen nach moralischer Läuterung wieder Stolz empfinden könnten. Wegen zwölf Jahren nationalsozialistischer Verbrechen wollte er, der Nationale, nicht gleich die ganze deutsche Geschichte verdammt und verleugnet sehen, und so setzte er – gegen den modischen Strom jener, die ein verhängnisvolles Erbe von Luther über Friedrich und Bismarck zu Hitler in der Geschichte walten sahen – die positiven Seiten der »an Größe reichen Geschichte der Deutschen« und ihrer Kultur. Mit diesen beiden Grundpositionen in seinen Reden, dem Mut zur Aufarbeitung der Vergangenheit und der Rückbesinnung auf die positiven Traditionen der deutschen Geschichte, wies er einem Volk, das nach dem Zusammenbruch aller bisherigen Autorität in Rat- und Orientierungslosigkeit verharrte, den Weg zur Demokratie und half, die junge Republik geistig zu fundieren. Er wollte seine Deutschen aus der Schockstarre von 1945 befreien, sie lockern, dafür sorgen, dass sie wieder »normal« würden, und sie »entkrampfen«, wie er dieses Ziel einmal umschrieb.
Theodor Heuss schlägt die Brücke vom Kaiserreich zur Bundesrepublik, in seinem Leben spiegeln sich sieben dramatische Jahrzehnte deutscher Geschichte. Als der »Lotse von Bord« geht, als Bismarck von Wilhelm II. entlassen wird, ist er ein siebenjähriger Knabe, als er sich Friedrich Naumann anschließt, dem Mann, der zwar mehr Demokratie will, aber diesen Kaiser lange idealisiert und bestimmend für Heuss’ Denken wird, ein neunzehn Jahre alter Jüngling. Als Journalist kommentiert er die – vergebliche – Hoffnung auf Reformen und die Parlamentarisierung des wilhelminischen Reichs. Als Anhänger des Werkbunds unterstützt er den Durchbruch zur Moderne in Architektur und Kunst, und seine Ehe mit Elly Knapp trägt für die damalige Zeit unerhört aufgeklärt-moderne Züge, auch wenn es eine Moderne ist, die sich, wie alles bei Heuss, stets in angemessenen bürgerlichen Formen vollzieht. Als Journalist und später als Parlamentarier erlebt er Aufstieg und Niedergang der Weimarer Republik, die Nationalsozialisten stellen nach ihrer Machtübernahme zwei seiner Bücher an den Pranger des »undeutschen Geistes«, Heuss erhält als Hochschullehrer Berufsverbot und geht in die innere Emigration. Nach dem Krieg beginnt dann unverhofft die zweite Karriere, die vom Zeitungsherausgeber über den Kultminister (wie man den Kultusminister im Ländle nannte) von Nord Württemberg-Baden und den Parlamentarischen Rat schließlich in die Villa Hammerschmidt führt. Sein demokratisch-politisches wie persönliches Leben kennt, all dem zeitbedingten und dramatischen Auf und Ab zum Trotz, keine Brüche – fast jedenfalls.
Fast, denn da gibt es jene Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz, von der Heuss sagt, er habe schon während der Abstimmung gewusst, dass er »dieses ›Ja‹ nie mehr aus seiner Lebensgeschichte auslöschen« könne. Unter welchem Druck die winzige Gruppe der fünf linksdemokratischen Abgeordneten bei dieser Abstimmung stand, dass der Reichstagsabgeordnete Theodor Heuss es ursprünglich nicht befürworten, sondern sich der Stimme enthalten wollte – davon wird ausführlich zu handeln sein. Aber dass dieses Ja, welches die Grundrechte außer Kraft setzen half und der Regierung Hitler den Freibrief erteilte, Gesetze ganz nach ihrem Belieben ohne parlamentarische Zustimmung zu erlassen, eine Erzsünde war, deren er sich schuldig gemacht hatte – dieses Gefühl hat den Demokraten Heuss nie verlassen, auch wenn er nach dem Krieg versuchte, die Auswirkungen des Gesetzes und damit auch sein eigenes Votum nach Kräften herunterzuspielen.
Konnte ein Mann, der an der Zerstörung der demokratischen Strukturen der Weimarer Verfassung mitgewirkt hatte, dem Aufbruch zu einem demokratischen Neubeginn glaubhaft präsidieren? Würde ein Ja-Sager vom 23. März 1933 als erster Mann im Staat nicht ein Schönheitsfehler sein, musste er nicht den ganzen Neubeginn belasten, ja ihn unglaubwürdig machen? Hätte die heutige Generation das Sagen gehabt, als es darum ging, im Jahr 1949 einen Präsidenten zu wählen – eine Generation, die aus der Distanz von Jahrzehnten härter, ja gnadenlos urteilt –, Theodor Heuss wäre nie Staatsoberhaupt der jungen Republik geworden.
Wenn er dennoch der ideale Präsident der ersten Stunde gewesen ist, dann gilt das trotz seiner Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz. Wie wir sehen werden, war der Bürger Heuss frei von vielen, vielleicht den meisten, aber keineswegs frei von allen politischen Irrtümern des deutschen Bürgertums. In einem Volk, das in seiner großen Mehrheit Hitlers außenpolitische Erfolge bis 1939 und den Sieg über Frankreich bejubelt hatte und das sich nach dem Krieg im Beschweigen übte, konnte der politische Irrtum des Reichstagsabgeordneten Heuss vom März 1933 kaum zu Glaubwürdigkeitsverlusten führen. Und dass Heuss trotz seines Jas ein überzeugter Gegner Hitlers war und blieb, kann so wenig bezweifelt werden wie das Misstrauen der Nationalsozialisten, die in Heuss stets den Gegner, ja den Feind ihrer Sache sahen.
»Am Anfang war Adenauer« – das klassische Diktum Arnulf Barings stimmt noch immer, aber Adenauer war eben nicht allein. Die alte Bundesrepublik hat, alles in allem, viel Glück gehabt mit der Wahl ihrer Führungsfiguren – das gilt für Kanzler von Adenauer bis hin zu Brandt, Schmidt und Kohl, für Präsidenten von Heuss über Heinemann bis zu Weizsäcker, aber es gilt vor allem für die beiden »Wilhelminer«, die prägenden Figuren des Neubeginns, die beide ihre Sozialisation im Kaiserreich erlebten. Dass es mit Heuss und Adenauer eine Generation der Großväter ist, welche in die Spitzenpositionen der jungen Bundesrepublik rückte, hat seinen tieferen Sinn: Beide sind in einer Welt groß geworden, in der – wilhelminischer Hypertrophie und dem fatalen Drang nach Weltgeltung und Weltmacht zum Trotz – nach innen mit Rechtsstaat, Meinungsfreiheit und einem allgemeinen, gleichen Reichstagswahlrecht alles festgefügt und geordnet erschien. Beide erlebten zwei deutsche Zusammenbrüche, aber sie setzten ihnen, wie Hans-Peter Schwarz einmal bemerkt hat, ein »unerschüttertes System stabiler, vielleicht fragwürdiger, aber immerhin vernünftiger Werte« entgegen. Der eine stellte politische Weichen und besaß die Macht, der andere, der Intellektuelle mit dem Hang zur Reflexion, hatte Soft Power, wie man heute sagen würde – er wirkte nach innen, festigte die junge Demokratie durch sein Beispiel, durch traditionsstiftende Reden und manchmal durch seine bloße Existenz. »Der weißhaarige Herr mit dem freundlichen, großflächigen Gesicht«, so Gerhard Stadelmaier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, »wurde dieser wunden Nation aus [im Krieg] verlorenen Vätern eine Art Ersatzvater. Und was immer im Land geschah: Er überstrahlte es.« Rudolf Augstein rief ihm im Spiegel nach: »… wo hundert Minister und tausend Vereinsmeier den Allerweltsquark des Tages breittraten, da kam der Heuss und sagte mit seinem orphischen Bass irgendetwas Gescheites, ein Wort, das leuchtete – seit Friedrich Wilhelm IV. umnachtet der Krone entsagte, hatte Preußen-Deutschland keinen originellen Kopf mehr zum Staatsoberhaupt, außer eben diesem Heuss.«
Wenn wir damals einen Bundespräsidenten brauchten – brauchen wir ihn auch heute? Ist das Amt eines Präsidenten nicht verzichtbar geworden und das Kapital der Präsidentschaft im letzten Jahrzehnt verbraucht? Heuss galt fälschlich als unpolitischer Präsident, weil er von den Reservevollmachten, die das Grundgesetz für sein Amt bereithält, nie Gebrauch machen konnte. Was das angeht, war er ein Opfer der frühen Stabilität der Bundesrepublik: Weder gab es ein Patt zwischen den Kräften der Regierung und denen der Opposition noch ein Misstrauensvotum gegen einen Kanzler, das ihn zur Auflösung des Bundestags veranlasst hätte; es gab auch keinen Wahlausgang, der es ihm möglich machte, den einen oder anderen Kanzlerkandidaten vorzuschlagen.
In der heutigen Situation, in der fünf, wenn nicht gar sechs oder sieben Parteien in den Bundestag einziehen könnten, ist die Rolle einer unparteiischen Autorität über den Parteien, ist ein Präsident, der das Ganze im Blick behält, wichtiger denn je. Freilich müsste er auch eine Persönlichkeit sein, die über auctoritas verfügt und Orientierungshilfe geben kann – Voraussetzungen, die nicht jeder Kandidat erfüllen wird.
Die Legenden der 1848er Revolution
Eine Kindheit und Jugend im Schwäbischen
Spuren, die nie verwehen sollen: Schon der Bub Theodor Heuss wächst mit Geschichten aus der demokratischen Revolution von 1848 auf. Es ist sein Vater, der die Legenden vom Kampf um die Freiheit in die junge Seele pflanzt, und ihre Helden sind nicht selten wackere Neckarschiffer mit dem Namen – Heuss. Nach der Familiensaga haben gleich zwei Vorfahren in der Revolution ihr Leben für Demokratie und gegen Fürstenwillkür gewagt – als Anführer einer revolutionären Freiwilligen-Kompanie im Badischen Aufstand im Frühjahr 1849, den Preußens »Kartätschenprinz« Wilhelm dann mit seinen Truppen niederschlagen half. Dabei hört sich das Wort Kompanie militärisch wohlgeordnet an, in Wirklichkeit handelte es sich wohl eher um einen revolutionären Haufen, bewaffnet mit Flinten, Hieb- und Stichwaffen, dem – immerhin! – die Eroberung des Schlosses in Gemmingen unweit von Heilbronn gelang und der anschließend die Preußen bei Hirschhorn am Übergang über den Neckar hindern wollte – dies allerdings vergeblich, wie sich nur zu bald erwies. Der Chef dieser Schar militanter Demokraten, Hauptmann genannt, war des Buben Theodor Urgroßonkel Fritz, dem sein Neffe Ludwig, des Vaters Vater, mithin also der Großvater des späteren Bundespräsidenten, als Adjutant gedient hat. Nach der Niederlage versucht dieser Fritz Heuss, sich den Verfolgern durch Flucht in die Schweiz zu entziehen. In Heilbronn, das im Sommer 1848 an die württembergische Nordbahn angeschlossen worden war, besteigt er einen Zug nach Süden. Aber da die Büttel der königlich-württembergischen Obrigkeit ihn an seinem Schlapphut erkennen, schicken sie ihm eine Lokomotive mit Polizei hinterher, die ihn in Ludwigsburg einholt und verhaftet.
Besonders beeindruckt hat den Knaben Theodor offenbar die Geschichte mit der Lokomotive, die in seiner Phantasie zum Beweis für die Bedeutung des Urgroßonkels und Vorbilds geriet. Jagt man mit einer so mächtigen Dampfmaschine auf Rädern etwa Ladendiebe und andere Kleinkriminelle, gilt so großer Aufwand nicht vielmehr einem unstrittig wichtigen Mann, der Großes bewirken wollte? Urgroßonkel Fritz muss zunächst auf dem Hohenasperg einsitzen, wo siebzig Jahre zuvor schon Christian Friedrich Daniel Schubart, Dichter und Herausgeber eines scharfzüngigen, aristokratiekritischen Journals, hatte schmachten müssen, und darf dann, an Baden ausgeliefert, »in den Kasematten von Rastatt über die Kehrseite eines missglückten Freiheitskampfes meditieren«. So beschreibt es Theodor Heuss selbst in seinen Jugenderinnerungen und fügt ironisch hinzu: Nach einigen Jahren wieder freigelassen, habe dieser Fritz Heuss am unteren Neckar bis zu seinem Tode den Spitznamen »Der Napoleon« geführt – »die halbe Tragik« sei damit in den »nachsichtigen Spott einer gelassenen Resignation« gemündet.1
Der Vater gehörte der damals in Württemberg oppositionellen Volkspartei an und war, kein Zweifel, eifrig bemüht, seinen Kindern viel von dem Geist, dem Pathos, aber auch von dem Zorn der 1848er-Revolutionäre auf die damaligen politischen und gesellschaftlichen Zustände zu erzählen. So wird Theodor mit Gedichten Georg Herweghs groß, mit den Balladen Ludwig Uhlands, der in der Paulskirche ja die Abschaffung des Adels forderte, vor allem mit den Versen und Liedern Ferdinand Freiligraths. »… es gehört zu meinen enthusiastischen Erinnerungen«, schreibt der 22-jährige Theodor Heuss an die befreundete Dichterin Lulu von Strauß und Torney, »wenn unser Vater abends seinen drei Buben schauerlich-schön aus ›Ça ira!‹ vorlas«.2 Etwa das Lied »Vor der Fahrt«, das von einem Schiff handelt und zur Melodie der Marseillaise gesungen werden soll?
Ihr fragt erstaunt: Wie mag es heißen?
Die Antwort ist mit festem Ton: Wie in Oesterreich so in Preußen Heißt das Schiff: »Revolution!« Heißt das Schiff: »Revolution!« Es ist die einz’ge richt’ge Fähre – Drum in See, du kecker Pirat Drum in See, und kapre den Staat, Die verfaulte schnöde Galeere!3
»Kolossal als Kunstleistungen wie als Bekenntnisse« nennt Heuss das Schaffen aus Freiligraths früher revolutionärer Periode – für jenes aus der späten Zeit, in der sich der Dichter zum Bewunderer Bismarcks und zum Hurrapatrioten wandelte, hat er nur den Kommentar übrig: »fast alles Schwindel und unerträglich«. Es ist vor allem das Gedicht »Die Toten an die Lebenden« aus dem Juli 1848, dessen Lektüre er der Freundin empfiehlt. Da sprechen aus ihren Gräbern die gefallenen Kämpfer der Revolution:
Die Kugel mitten in der Brust, die Stirne breit gespalten
So habt ihr uns auf blutgem Brett hoch in die Luft gehalten
Hoch in die Luft mit wildem Schrei, daß unsre Schmerzgebärde
Dem, der zu töten uns befahl, ein Fluch auf ewig werde.
Und die Lebenden mahnen sie:
Oh, steht gerüstet! Seid bereit! Oh, schaffet, daß die Erde,
Darin wir liegen strack und starr, ganz eine freie werde!
Daß fürder der Gedanke nicht uns stören kann im Schlafen:
Sie waren frei: doch wieder jetzt – und ewig! – sind sie Sklaven!4
Das war die Zeit, erinnert sich Heuss, in der er »jeden Fürsten oder sonstigen Großen für einen gemeinen Menschen und des Totschlags würdig hielt«, zugleich aber sei es seine »schönste Zeit« gewesen. Er schreibt das im Jahre 1906, versichert jedoch, wohl zur Beruhigung der eher konservativen Freundin, er sei längst »nicht mehr so gefährlich«, denn »allerhand Erkenntnisse und Einsichten« hätten seinen »fröhlichen und düsteren Radikalismus angewelkt«. In der Tat: Vom revolutionären Feuer der frühen Jugend sollte nicht viel bleiben – Heuss setzt schon bald auf friedliche Entwicklung, auf Evolution statt Revolution zum Ausbau der Demokratie im wilhelminischen Deutschland. Revolution, davon träumt vielleicht der marxistische Flügel der Sozialdemokratie, und mit dem hat er – wie überhaupt mit dem klassischen Sozialismus, der die Wirtschaft umkrempeln will – schon als Studiosus nichts im Sinn.
Düster sind die ersten zehn bis fünfzehn Jahre seiner Jugend gewiss nicht, ganz im Gegenteil, in seinen Jugenderinnerungen, die er Vorspiele des Lebens nennt, ist immer wieder der Hauch liebevoller Nostalgie zu spüren. Als Jüngster von drei Brüdern ist er das Nesthäkchen der Familie, geboren 1884 in Brackenheim unweit von Heilbronn, als der »Kartätschenprinz«, den der Urgroßonkel Fritz am Neckar nicht hatte aufhalten können, schon dreizehn Jahre als Kaiser Wilhelm I. an der Spitze des preußisch geführten deutschen Nationalstaats steht. Brackenheim Ende des 19. Jahrhunderts – das ist ein »abseitiges Oberamtsstädtchen« von 1500 Einwohnern, ohne Bahnanbindung, ohne Industrie, mit vorwiegend landwirtschaftlichem Charakter.5 Im Zabergäu zwischen zwei bewaldeten Hügelketten in einem breiten, fruchtbaren Tal gelegen, weist es, als die größte Weinbaugemeinde Württembergs, noch heute idyllische Züge auf. Vor allem einem der Rotweine, die dort gedeihen, wird Heuss bis an sein Lebensende treu bleiben: dem Brackenheimer Zweifelberg, einem kräftigen, runden Lemberger; er wird viele seiner Präsidentenreden inspirieren, die er in langen Nächten in der Villa Hammerschmidt in Bonn selbst entwirft.
Heuss wächst in einem Haus mit Garten auf, das inzwischen abgerissen und der Weinkelterei einer Winzergenossenschaft gewichen ist. Gegenüber liegt ein massiv gebautes, etwas finster und klobig wirkendes Renaissanceschloss, in das die württembergischen Landesherren gern lästig werdende Witwen ihres Geschlechts abschoben. Aber Heuss erinnert dieses Schloss als eine »wundervolle Nachbarschaft mit dem ständig rauschenden Brunnen, dem hallenden dunklen Torgang, den offenen Holzarkaden, tiefen Kellern und unermesslichen Dachräumen«.6 Als Kind muss er lange Zeit in Röcken herumlaufen, weil die Mutter sie leichter nähen kann als Hosen. Mehr an der Rolle des Benjamins missfällt ihm aber, dass er die Kleidung der drei und zwei Jahre älteren Brüder Ludwig und Hermann auftragen muss – bis er plötzlich so in die Höhe schießt, dass sie ihm nicht mehr passen will. In Brackenheim besucht er die »Kinderschule« mit ihrem die Kreativität anregenden Fröbel-Spielzeug, und mit fünf Jahren verdient er sein erstes Geld beim Hopfenzupfen – 18 Pfennige für drei Maß, für die er sofort Zuckerzeug kauft.
Der Vater Louis Heuss, ein Regierungsbaumeister, der rund um Brackenheim Straßen baut, entstammt einer Sippe von Neckarschiffern, deren Anfänge sich bis in den Dreißigjährigen Krieg zurückverfolgen lassen. Sie ist über Generationen im badischen Haßmersheim ansässig und bringt es zu einigem Wohlstand. Vor allem der Urgroßvater – eine dieser ganz alten verblassten Daguerreotypien im Familienalbum zeigt einen vierschrötigen, sehr selbstbewusst und alles andere als gutmütig dreinschauenden Mann – war offenbar in seinem Beruf besonders erfolgreich: Er ließ das erste große Schiff bauen, mit dem er dann von Haßmersheim aus nicht nur den Neckar, sondern auch den Rhein bis Rotterdam befuhr. Dessen Sohn – Theodors Großvater, der die Preußen bei Hirschhorn bekämpfte – wird Kaufmann; als er die Ehe mit der Tochter des Ochsenwirts in Ingersheim bei Marbach schließt, deren Mutter wiederum aus dem »Hirschen« in Lauffen stammt, bringt dies ein neues, buntes Element in die Heuss’sche Familienchronik. Allerdings hat er kein Glück, als er sich am Unternehmen eines der angeheirateten Verwandten beteiligt, denn es geht bankrott, und so arbeitet er den Rest seines Lebens als Buchhalter in einer großen Holzhandlung. Eine Universität hat dieser eingefleischte 1848er nie gesehen, und doch weist sein Bücherschrank ihn als den ersten (Selfmade-)Bildungsbürger im Stammbaum der Familie aus. Gymnasiast Theodor findet dort Bachofens Mutterrecht, Kant und Spinoza, theologische Schriften von David Friedrich Strauß, Protokolle der Paulskirche, dazu Werke von Lassalle, Proudhon, Louis Blanc, Karl Marx und Friedrich Engels, den geistigen Vätern der Sozialdemokratie; aber auch Schriften des Liberalen Schulze-Delitzsch, des Vorkämpfers der Genossenschaftsidee, oder des Mainzer Bischofs Ketteler, des Begründers der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, stehen in den Regalen. Später erkennt er die Sammlung des Großvaters als »Spiegelung der sozialistischen und sozialreformerischen Auseinandersetzungen« in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts und denkt sich ihren Besitzer, seinen Großvater, als einen Mann, »der nach seinen nüchternen Kontorgeschäften über seinen Büchern saß und überlegte, wie Deutschland und die Welt in Ordnung gebracht werden könnten«.7
Eine völlig andere, nämlich kirchenfromme und konservative Gesinnung herrscht dagegen in der Pfälzer Sippe vor, aus der Theodors Mutter Elisabeth Gümbel kommt. Bei ihren Vorfahren überwiegt der Beruf des Försters – sie selbst ist ja Tochter eines Forstbeamten –, aber es gibt auch Schuhmacher und Küfer, Geologen und Pfarrer in ihrer Ahnentafel. Wenn Theodors Großmutter Gümbel von 1849 erzählt, wie man erlöst gerufen habe: »Die Preußen kommen!«, dann, so Heuss, »klang das anders als bei den Geschichten, die wir von den Kämpfen am Neckar hörten. Hier galten sie als Feinde, in der mütterlichen Familie als die Befreier.« Hat vielleicht hier, in diesen Kontrasten der Familienüberlieferungen, jenes abwägende, tolerante, historische Verstehenwollen, das ihn später kennzeichnet, seine Wurzel?8
Gediegen und gutbürgerlich ist also das Milieu, in dem Heuss aufwächst, er selbst nennt es, um es bewusst vom Verdacht des Kleinbürgertums abzusetzen, wiederholt mittelbürgerlich. Bei aller Sparsamkeit sollte doch am Essen keinem etwas »abgehen«, wie Heuss das nennt – die Kinder durften sich immer holen, wozu sie Lust hatten, nie war etwas abgeschlossen, der »Hausbetrieb war im allgemeinen wohlhäbig und gepflegt«.9
Das Musische, seinen Kunstsinn und das Einfühlungsvermögen, das viele seiner späteren Feuilletons auszeichnet, hat Heuss von der Mutter geerbt, einer sehr behütet aufgewachsenen, zarten, zierlichen, überaus musikalischen Person, die regelmäßig am Klavier sitzt und – »in stiller Besinnlichkeit« – Stücke von Haydn, Mozart, aber auch Beethoven spielt. Vom Interesse und vom Temperament her trennen Vater und Mutter Welten: Sie besucht den Gottesdienst, er meidet die Kirche; sie geht gern in Konzerte, er ist völlig unmusikalisch und begleitet sie dabei nie; sie liebt die Geselligkeit, er hasst alle Konvention, lehnt die Gesellschaft ab und geht fast nie aus; er liebt lange Touren in den Tiroler Alpen, sie ermüdet schnell und kann nicht mithalten, so dass an ihrer Stelle, kaum dass er kräftig genug ist, der mittlere Bruder Hermann mitwandern muss. Weil es zur gutbürgerlichen Erziehung jener Zeit gehört, dass Kinder ein Instrument spielen lernen, wird des Vaters alpinistische Leidenschaft seinem Sohn Theodor zum Verhängnis: Damit es im Hause Heuss wenigstens im Winter ein »Quentchen Sennhüttenromantik« gibt, muss er als Dreizehnjähriger zweimal wöchentlich seinen Zitherkasten zu einem zitherkundigen Postsekretär schleppen, der ihm das Zupfen beibringen soll. Doch zu einer besonderen Fertigkeit habe er es nie gebracht, erinnert sich Heuss und seufzt: »O, wie verfluchte ich die ganze Defreggerei!«10
Die Geschichte mit der Zither spielt schon in Heilbronn, denn dorthin wird der Vater, die alles dominierende, übermächtige Person für den Knaben Heuss, im Jahr 1890 versetzt, um die Leitung des Tiefbauamts zu übernehmen. So wird die alte Reichsstadt mit dem barocken Rathaus und der Kilianskirche, mit ihren verwinkelten Gassen, gotischen Fachwerkfassaden und mittelalterlichen Giebeln zur »Heimat seines Jugendglücks«. Hier geht er – und gerne, wie er bekennt – auf das humanistische Karlsgymnasium, wo Altphilologen auch die Wahlfächer Französisch und Englisch unterrichten, mit der Folge, dass er in keiner der modernen Sprachen, auch wenn er sie einigermaßen lesen kann, »eine erträgliche Sprachfertigkeit« erreicht.11 Wenn er im Rückblick betont, er sei als Gymnasiast einige Jahre ein obstinater und rebellischer Bursche gewesen12 und habe als Untersekundaner gleich zweimal innerhalb von drei Wochen im Karzer gesessen, dann wohl auch, um seinen Lesern nicht allzu brav zu erscheinen. Denn er ist ohne den geringsten Zweifel ein sehr guter Schüler, der sich im Unterricht oft unterfordert fühlt und beim Abitur wegen guter schriftlicher Leistungen von der mündlichen Prüfung befreit wird.
Und wenn er ironisch anmerkt, auf dem Karlsgymnasium sei er mit fünfzehn Jahren zum frühen »Schulreformer« geworden, hat das mit seiner Lust am Zeichnen zu tun, der er selbst auf seinen Reisen als Bundespräsident frönen wird. Fotos zeigen den Staatsbesucher, auf einem Schemel sitzend, mit Stift und Zeichenblock vor antiken Tempeln in Griechenland und Italien, ganz im Stile des 19. Jahrhunderts Eindrücke festhaltend, die andere längst mit ihren Kameras verewigen. »Schulreformer« wurde er als Gymnasiast, weil der Zeichenunterricht, entsprechend dem Lehrplan, ab Untertertia entfiel. Deshalb wendet er sich mit einer Eingabe an den Gemeinderat, bittet um einen Raum, in dem interessierte Schüler weiter im Zeichnen unterrichtet werden könnten – und hat Erfolg damit. Als kostenloser Lehrer bot sich ein älterer Landschaftsmaler an, der Heuss getroffen hatte, als er gerade ein Weinberghäuschen zeichnete, und ihm Ratschläge gab.13
Aber nicht nur das geschichtsträchtige Heilbronn, in der Weingärtner, die auf den Hügeln rundum Wein anbauen, aus alter Tradition noch immer eine bedeutende Rolle spielen, ist die Stadt seiner Jugend. Im Gegensatz zum idyllischen, ländlichen Brackenheim lernt der Knabe Theodor hier auch die Probleme der Moderne kennen, denn dank seiner vielen Neckar-Mühlen hat sich Heilbronn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur wichtigsten Industriestadt eines Württembergs gemausert, das – im Gegensatz zu heute – in der industriellen Entwicklung seinen Nachbarn hinterherhinkt. Mitte der neunziger Jahre zählt die Stadt 25000 Einwohner und wird oft das »schwäbische Liverpool« genannt.
Der Tiefbauinspektor Heuss plant und beaufsichtigt den Bau einer Kanalisation samt moderner Wasserversorgung, legt Ringstraßen an und lässt, am Rande der Stadt, ein Haus für die eigene Familie errichten: eine halb ländliche, teils zwei-, teils eingeschossige Villa, die mit ihrem Erker und einem spitzen Turm beinahe viktorianisch anmutet. Der Blick von ihr schweift über Äcker und Obstgärten, über der Tür zum Haus prangt der Spruch »Erst wägen, dann wagen«, über der inneren hat der Vater als stolzer Erbauer die Sentenz »Klein, aber mein« angebracht. In seinen Kinderjahren habe ihm das Haus gut gefallen, doch später, ganz von der gediegenen Moderne des Werkbunds geprägt, wird Heuss schreiben, es sei »im Stil der Zeit, einem schlechten Stil« gebaut, im Grundriss und in der Ausnutzung der Fläche vor allem »miserabel überlegt«.14 In den von der Funktion her völlig überflüssigen »Schmuckturm«, wie er ihn nennt, sei man nur durch eine Falltür gelangt. Der Vater hat auch eine Turnanlage mit Reck und Barren vorgesehen, in der die größeren Brüder, beide Burschenschaftler, dann das Fechten mit Schläger und Säbel üben.
Familie Heuss zählt inzwischen zu den Honoratioren der Stadt, denn in der Lerchenstraße, wo sie ab Dezember 1893 lebt, wohnt vorwiegend gehobenes Bürgertum, ihre Nachbarn sind Professoren und Offiziere, höhere Beamte und Kaufleute. Wie sehr bei den Heuss allerdings die bürgerliche Tugend der Sparsamkeit auch beim Bau dieses Hauses regiert, zeigt sich darin, dass in der ganzen Villa mit ihren fünf Zimmern im ersten und vier Zimmern bzw. Kammern im zweiten Stock nur ein Klosett vorhanden ist. Der Einbau eines weiteren, der nach den Bauvorschriften hätte erfolgen müssen, wurde »aus Kostengründen erlassen«.15
Entscheidender als die Schule hat den jungen Theodor Heuss das Elternhaus geprägt – und hier wieder der übermächtige Vater, der sich aber rührend um die Erziehung seiner Söhne kümmerte. Die Jugendbewegung, die mit der Gründung des Wandervogels Mitte der 1890er Jahre in Steglitz (das damals noch ein märkisches Dorf war) ihren Ausgang nahm, hat Theodor Heuss nie beeinflusst, aber der Vater nahm eines ihrer wichtigsten Elemente – »die singende, anspruchslos streifende Erwanderung der deutschen Heimat«16 – vorweg. Allerdings fehlen bei Vater Heuss und Söhnen nicht nur die Klampfe, die Wanderkluft oder der Wille einer Jugend, selbst über sich zu bestimmen, es fehlt vor allem, was als Potenzial im jugendbewegten Wandervogel schlummert: die Romantisierung ländlicher Idylle, die Tendenz zum Völkischen und die Emanzipation vom überkommenen Bürgertum – im Gegenteil, alles geschieht innerhalb einer festgefügten Familie. Beim Vater wird hier ein Zug sichtbar, der später auch das Leben des Sohnes bestimmen wird: Theodor Heuss hält dies und jenes für überholt und ist für viele Reformen aufgeschlossen, verlässt indes bei allem Streben nach Veränderung nie den wohlgeordneten bürgerlichen Rahmen.
Der Vater habe beim Wandern einen »guten Schritt« gehabt, schreibt er, es sei ihm nicht darauf angekommen, seine Pläne auf acht oder zehn Marschstunden einzurichten, und seine Söhne habe er auf diesen Ausflügen gelehrt, »die Heimat zu sehen und zu lieben«. Er macht ihnen das historisch Wichtige lebendig, etwa in Wimpfen die Stauferzeit, oder das architektonisch Bedeutsame, am Beispiel der Abtei Amorbach im Odenwald. Auf die Erkundung des schwäbischen Umlands folgen später zwei- bis dreiwöchige Fußwanderungen durch Schwarzwald und Schwäbische Alb, Odenwald und die Vogesen, und den Söhnen war aufgegeben, Erlebnisse und Eindrücke, die sie dabei sammelten, jedes Jahr als Weihnachtsgeschenk für den Vater niederzuschreiben. In welchem Elternhaus gäbe es heute noch solchen zielstrebigen, pädagogischen Eifer?
Von Ort zu Ort – Wanderungen mit Stift und Feder heißt eines der auflagenstärksten Bücher von Theodor Heuss, das in seiner Präsidentenzeit erscheint und eine Sammlung von Reisefeuilletons aus mehreren Jahrzehnten enthält. Wenn man so will, setzt dieses Büchlein voller kunst- und kulturhistorischer Betrachtungen, ergänzt durch diese oder jene seiner Bleistiftskizzen, das fort, was der Vater schon vom Jüngling gefordert hat. Die frühen Wanderungen gleichen pädagogischen Streifzügen durch die hügelige Landschaft und die reiche Geschichte Schwabens und helfen, ihn tief im Schwäbischen zu verwurzeln. Heuss vergisst nie, woher er kommt und was die schwäbische Heimat bedeutet, ja er ist stolz auf sie. So schreibt er als Zwanzigjähriger an Lulu, die Freundin aus Münchner Tagen, von einem Besuch in Heilbronn: »Luft und Wald waren so wundervoll, und unsere Berge hingen so schwer und süß von Reben. Haben Sie schon ein gutes Jahr in einer Weingegend mitgemacht? Nein. Sie Arme.«17
Die Erziehung des Vaters macht aus seinem Sohn Theodor eine festgefügte Persönlichkeit: Das Selbstverständnis bleibt ungebrochen, Selbstzweifel beschleichen den Festverwurzelten nicht (mit Ausnahme vielleicht der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz 1933), von Identitätskrisen bleibt er offenbar verschont. Dazu kommt das Bewusstsein, politisch auf der richtigen Seite zu stehen, denn dass dem Gedanken der Demokratie, den ihm der Vater immer wieder nahebringt, langfristig die Zukunft gehört – das steht für ihn außer Frage.
War der Vater ein politischer Fanatiker? Sein Eintreten für seine politischen Vorstellungen und Ziele muss jedenfalls eifernd, seine Agitation gelegentlich radikal gewesen sein. Erschreckt hat Heuss als Drei- oder Vierjähriger mitangesehen, wie sich Louis Heuss auf einer Wirtshausterrasse mit einem politischen Gegner, einem »stämmigen, rotbärtigen Sägmüller namens Schwarzkopf«, geprügelt hat, bis die übrigen Gäste »die hitzigen Männer auseinanderrissen«. Im konservativen Brackenheim erregte derart politische Heftigkeit auf die Dauer Anstoß, isolierte Louis Heuss und seine Familie – Grund genug für den Präsidenten der Straßenverwaltung, dem von ihm als Fachmann geschätzten Tiefbauingenieur Heuss eine Stelle in dem viel größeren, weniger konservativen Heilbronn anzudienen.18
Schon in den 1848er Jahren hatte diese Stadt als besonders gefährlicher Herd des Aufruhrs in Württemberg gegolten, zumal das dort in Garnison liegende Regiment sich von den Ideen der Revolutionäre infizieren ließ und bei der königlichen Regierung in Stuttgart als unzuverlässige Truppe eingeschätzt wurde. Die Württembergische oder Demokratische Volkspartei, der Louis Heuss angehört, wurde Mitte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts von ehemaligen 1848ern ins Leben gerufen. Sie hatten teils in Festungshaft gesessen, sich teils in die Schweiz geflüchtet und waren, nach der Württembergischen Amnestie von 1863, freigelassen worden oder aus dem Exil zurückgekommen. Einer von ihnen, Ludwig Pfau, wurde von Vater Heuss wegen seiner bissigen Polemik besonders verehrt. Von ihm stammt der »Wahlspruch der schwäbischen Demokraten« (Langewiesche), die allesamt in der Wolle gefärbte Antipreußen sind: »Ceterum censeo, Borussia esse delendam.« Pfau hatte 1847 in Stuttgart das satirische Blatt Der Eulenspiegel gegründet und war durch seine politischen Gedichte bekannt geworden – etwa das über den »Gottesgnadenfritz« oder sein »Badisches Wiegenlied«:
Schlaf, mein Kind, schlaf leis,
Dort draußen geht der Preuß …
Pfau war Schüler des Heilbronner Karlsgymnasiums wie Heuss, und wenn die Stadt Heilbronn ihn 1891 zu ihrem Ehrenbürger ernannte, beweist dies nur, dass man am württembergischen Industriestandort Heilbronn sehr viel aufgeschlossener, sehr viel demokratischer dachte als im Wein- und Agrarstädtle Brackenheim. Vater Louis Heuss’ Volkspartei verficht als »einzige Partei im Kaiserreich ein eindeutig parlamentarisch-demokratisches Programm«, sie ist großdeutsch und antipreußisch orientiert und steht, zunächst wenigstens, in klarer Opposition zum Bismarckstaat.19 Mit ihrer großdeutschen Orientierung knüpft sie an eine Haltung an, welche die offizielle Politik des Königreichs Württemberg noch bis 1866 bestimmt hat. Denn im preußisch-österreichischen Krieg hatte Württemberg – wie Sachsen, Bayern und Baden – auf Seiten Österreichs gekämpft, musste allerdings, wie alle süddeutschen Staaten, nach der Niederlage gegen die Preußen ein Schutz- und Trutzbündnis schließen, das es im Deutsch-Französischen Krieg automatisch an die Seite des Norddeutschen Bundes und des früheren Gegners Preußen führt. Als nach dem triumphalen Sieg über das Frankreich Napoleons III. sich eine Welle patriotischer Begeisterung über ganz Deutschland ergießt, die natürlich – und kräftig – nach Württemberg schwappt, fällt es den Volksparteilern schwer, ihre Ablehnung eines kleindeutschen, preußisch geführten Nationalstaates auf Dauer beizubehalten. Weil sie lernen mussten, sich »halbwegs« mit dem preußischen Regiment abzufinden, so Heuss, seien sie den norddeutschen Liberalen darin gefolgt, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm, den Kaiser der 99 Tage, zu glorifizieren. Weil Wilhelm I. sein Denkmal in Heilbronn längst erhalten hat, soll nach dem Willen der Demokraten nun endlich auch sein liberaler Sohn in Erz gegossen werden, und Vater Louis Heuss ist ausersehen, die Festrede bei der Denkmalsweihe zu halten. Sohn Theodor, Zeuge seines öffentlichen, halbpolitischen Auftretens, empfindet zunächst Stolz, der jedoch bald jämmerlichem Mitleid weicht. Ein heilloser Regen geht herunter, »hinter dem erhöhten Rednerpult stand ein blasser Mann und suchte das Geprassel auf den Schirmen zu überschreien« – sein Manuskript wurde durchweicht und »alle dachten, wann hört er denn endlich auf«.
Noch lange habe man sich daheim gescheut, von dieser missglückten Denkmalsweihe zu sprechen, zumal Louis Heuss an seiner Rede lange gearbeitet hatte – es galt ja, in die »vom Anlaß geforderte Staatsloyalität« ein eindeutiges politisch-demokratisches Bekenntnis einzuarbeiten.20 Zwar suchen die Heilbronner Demokraten auf dem Umweg über diesen liberalen Kaiser, den der Kehlkopfkrebs schon nach drei Monaten Regentschaft dahinrafft, auch ihren Frieden mit der Dynastie der Hohenzollern zu schließen – aber zweifellos sollte mit seiner Statue ein unübersehbares Signal gesetzt werden.21 Der liberal denkende Kronprinz, mit Victoria, Tochter von Queen Victoria und ihres Prinzgemahls Albert von Sachsen-Coburg, verheiratet, hatte für viele Liberale die Hoffnung auf eine Monarchie nach britischem Muster verkörpert. Schriftlich hatte er Bismarck einmal erklärt, dass er ihn für den allergefährlichsten Ratgeber für Krone und Vaterland erachte.22 Seine Gemahlin, die sich in ihren Briefen an die königliche Mutter in London über den steifen, sporenklirrenden preußischen Stil bei Hofe lustig machte, zählte Bismarck zu ihren erbittertsten Gegnern, denn sie suchte ihren Gemahl in seinen liberalen Vorstellungen zu bestärken. Der Eiserne Kanzler bekämpfte ihren Einfluss und sah in ihr schlicht den bösen Geist, der vom Thronfolger Besitz zu ergreifen drohte.
Dass daheim viel politisiert wird, dafür sorgt natürlich schon der Vater, der einmal sagt: Der »Dorle« – so der Kosename seines Sohnes Theodor – solle später ein Haußmann werden, also jenem Conrad Haußmann nacheifern, der als Journalist, Rechtsanwalt und Führer der Württembergischen Volkspartei für die Umwandlung des noch ständisch gegliederten Stuttgarter Landtags in eine reine Volkskammer und für das allgemeine Wahlrecht kämpft. Man liest im Hause Heuss die liberale Frankfurter Zeitung, den Beobachter, das Blatt der Stuttgarter Demokraten, und – seit dessen Erscheinen 1896 – auch den satirischen Münchner Simplicissimus, den Theodor Heuss einmal als seinen »Miterzieher« bezeichnet.
Zwischen dem Vater und den Söhnen herrscht meist Einigkeit, erst die Politik des »Flottenkaisers« Wilhelm II. (Stürmer) führt zu Auseinandersetzungen. Die Schulklassen des Gymnasiums sollten zu einer Marineausstellung nach Stuttgart fahren, und da die Beteiligung freiwillig ist, rät der Vater zum Verzicht. Schließlich ist er Anhänger von Eugen Richter, einem der Führer der linksliberalen Freisinnigen im Reichstag, bewundert oder gefürchtet als ebenso beredter wie gnadenloser Kritiker der Regierung. Richter macht Front gegen die nationale Kampagne nach dem Platz an der Sonne, jene Flotten- und Kolonialbegeisterung, die weite Teile des Bürgertums und auch die rechten Liberalen im ausgehenden Jahrhundert ergriffen hat. Weder will er Kolonien noch eine große Kriegsmarine. Es ist, als ob er das schreckliche Verhängnis ahnt, in das die Flottenpolitik Wilhelms II. und seines Chefs des Reichsmarineamts, Alfred Tirpitz, letztlich münden wird. Gewiss, ein paar Schiffe brauche man zur Verteidigung der Küsten, meint Richter, nicht aber jene Schlachtschiff-Geschwader, mit denen Tirpitz die Briten herausfordert und die England nur dazu bringen, sich bei den Gegnern des Reichs einzureihen.23 Theodor folgt dem Rat des Vaters, aber Ludwig, der Älteste, verteidigt die Flottenpläne und besteht auf dem Ausflug nach Stuttgart. Er hat sich zur Marine gemeldet und nimmt, als Vorbereitung auf die Laufbahn des Seeoffiziers, schon fleißig Privatunterricht im Englischen. (Wegen mangelnder Sehschärfe wird er dann als Bewerber abgewiesen, studiert Medizin und wird später Stadtarzt in Heilbronn.) Der Streit zwischen Vater und Sohn um die Flotte verdiente kaum Erwähnung, träte nicht Sohn Theodor als Anhänger Naumanns später auch für den Ausbau der Flotte ein. Diese Auseinandersetzung im Hause Heuss spielt nach der ersten Tirpitz’schen Flottenvorlage – also 1898, einer Zeit, in der Louis Heuss schon schwer von Krankheit gezeichnet ist. Sein Sohn schreibt in seinen Erinnerungen vom »düsteren Schatten«, der auf die munter bewegte Jugend durch die »frühe Erkrankung des Vaters« gefallen sei. »Erschöpfungsmattigkeiten« und »Erregungszustände« hätten einander abgewechselt und erst zur Beurlaubung, dann zur vorzeitigen Pensionierung des Vaters geführt.
Man schickt Louis Heuss Ende Oktober 1899 für ein Vierteljahr ins Sanatorium für Nervenleidende in Pfullingen, aber sein Zustand bessert sich dort nicht. Er wird nach einigen Monaten wieder in der Familie gepflegt, bis auch seine »körperliche Frische« verfällt. »Es war ein grausamer Herbsttag«, heißt es in den Erinnerungen des Sohnes beinahe lapidar, »als der Wagen vorfuhr, um ihn in eine Pflegeanstalt zu bringen. Der älteste Sohn, damals Medizinstudent, begleitete ihn.«24
Es gibt eine schwarz-weiße Tuschzeichnung des zwanzigjährigen Heuss vom Vater – Stehkragen mit Krawatte, strenger Blick –, welche eine Hälfte des scharf geschnittenen Gesichts dunkel verschattet zeigt. Legt sie den Gedanken nahe, es handele sich um eine gespaltene Persönlichkeit? Akten geben genauer Auskunft über die Krankheit, die in der Familie, eher verschleiernd, als Nervenleiden bezeichnet wird. Aus ihnen geht aber auch hervor, wie sehr es den jungen Theodor Heuss belastet haben muss, den fortschreitenden geistigen und körperlichen Verfall des immer liebevoll respektierten Vaters, über den er in seinen Jugenderinnerungen nur andeutungsweise und schonend schreibt, über zwei, drei Jahre täglich mitanzusehen.
Schon das Sanatorium Pfullingen, das Louis Heuss Anfang 1900 nach Hause entlässt, nennt als Diagnose »beginnende Paralyse«, also eine Spätform der Syphilis; bereits im Sommer sei der Familie des Patienten aufgefallen, dass dieser »so herumgesessen sei, nicht gesprochen und öfter grimassiert habe«; sein Gedächtnis zeige Lücken, die Intelligenz sei bereits ziemlich geschwächt. Der behandelnde Arzt in Heilbronn weist ihn dann zwei Tage vor Heiligabend des Jahres 1900 wegen Dementia paralytica in die Königliche Heil- und Pflegeanstalt Winnenthal ein. Der Gang sei äußerst schwankend, der Patient stoße sich meist am Türrahmen und knicke häufig ein; »körperlich sehr herabgekommen«, verhalte er sich ganze Tage völlig teilnahmslos gegen seine Umgebung, spreche dann plötzlich wieder von Geldangelegenheiten und könne dabei »sehr heftig« werden. Da er nachts immer aus dem Bett falle und sich dabei verletze, auch weil er anfange, unreinlich zu werden, könne die häusliche Pflege nicht länger genügen. Wie sehr dieser Verfall der Persönlichkeit des Vorbildvaters seinen jüngsten Sohn berührt, befremdet, geschmerzt hat – darüber schreibt er nichts.
In Winnenthal, jener großen, in einem einstigen Schloss untergebrachten Heilanstalt, die im 19. Jahrhundert als besonders fortschrittlich galt, dämmert der Vater, seit der Einlieferung fast vollständig bettlägerig, mit fortschreitender Demenz vor sich hin und stirbt im Frühjahr 1903. In einem ärztlichen Zeugnis, das die Angehörigen für die Lebensversicherung benötigen, wird als Todesursache »Lungenentzündung bei fortgeschrittener Gehirnerweichung« angegeben.25 Über Besuche beim Vater in der Pflegeanstalt findet sich in Heuss’ Erinnerungen nichts, und ausweislich der Akten hat es sie wohl nie gegeben. Da finden sich lediglich einige Briefe seiner Frau und des ältesten Sohnes. Vermutlich wollte die Mutter ihrem Jüngsten den Anblick eines Vaters ersparen, der im Endstadium einer progressiven Paralyse ja nur ein erschreckender und unendlich trauriger hätte sein können.
Nach allem, was Heuss später, und oft liebevoll, schreibt, nahm das Bild des Vaters – eines strengen, gelegentlich schroffen Mannes, tatkräftig, bildungsversessen, liebevoll um die Erziehung der Söhne besorgt und unbeirrbar in seinen demokratischen Überzeugungen – an der schrecklichen, die Persönlichkeit bis zur Unkenntlichkeit zerstörenden Krankheit keinen Schaden. Selbst in der Rede, die er nach seiner ersten Wahl zum Bundespräsidenten vor der Bundesversammlung hält, auf dem Gipfel einer politischen Karriere, die er früher für sich selbst für unvorstellbar gehalten hätte, wird er den Vater rühmen: Der habe die Legenden des Jahres 1848 in die Seelen seiner jungen Söhne gegossen und ihnen einen Begriff davon gegeben, »daß die Worte Demokratie und Freiheit nicht bloß Worte, sondern lebensgestaltende Werte sind«.26
Als der Wagen vorfährt, um den Vater in die Pflegeanstalt zu bringen, ist Heuss gerade noch sechzehn, Ende des nächsten Monats, am 31. Januar 1901, wird er siebzehn Jahre alt. Ludwig, der Älteste, studiert bereits in Tübingen, Hermann, der mittlere Bruder, bereitet sich auf das Abitur vor, und weil die Mutter den Jüngsten für besonders praktisch veranlagt hält, soll nun er sie – an Vaters statt – in vielen Dingen beraten. So wird er zu einer »Ersatzautorität« für sie: »Wenn ich in den Studentenjahren oder später nach Hause kam, hing immer, mit einer Nadel an einer Gardine des Erkers befestigt, ein Stück Papier, dessen Überschrift lautete: ›Theodor fragen‹, darunter eine Serie von Notizen: was dieses Fremdwort oder dieser Fachausdruck bedeute, um was es sich bei einer politischen Debatte eigentlich gehandelt habe, was ich über Bebel denke, ob sie dem oder jenem Verein beitreten könne, Fragen zu Grundsteuern und Stadtobligationen, den Bankvorschlag eines Aktienkaufs. Über diese Zettel gab es oft fürchterlichen Spott, aber sie kehrten immer wieder.«27
Als ihr Mann 1903 stirbt, muss Elisabeth Heuss das Haus in der Lerchenstraße verkaufen – mit drei studierenden Söhnen bleibt ihr keine andere Wahl. Offenbar leben die angehenden Akademiker Heuss alle von einem häuslichen Wechsel; sich das Studium durch Arbeit nebenher oder in den Semesterferien selbst zu verdienen, mag heute gängig sein, damals entsprach es nicht dem Stil der Zeit. Nur der Student Theodor verdient sich, als »Münchner Correspondent« für die Neckar-Zeitung seines späteren Freundes Ernst Jäckh, ein wenig Geld nebenbei. Elisabeth Heuss wohnt, nun als Mieterin, zunächst im Erdgeschoss ihres verkauften Hauses und zieht drei Jahre später in eine Dreizimmerwohnung im zweiten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses um.28
Schon im Sommer 1901 – der Vater ist inzwischen in die Anstalt eingewiesen – nimmt Theodor mit Bruder Hermann, der gerade Abitur gemacht hat, die Fußwanderungen wieder auf. Von Rüdesheim bis Bonn ziehen beide gemächlich am linken Rheinufer entlang und machen Abstecher zum Benediktinerkloster Maria Laach und zur Ruine der Are-Burg in Altenahr. Hermann, der Architekt werden will, Aquarelle malend, indes Theodor zeichnet und sich in Versen versucht. Das Reimeschmieden hatte er, dem Pennäler-Usus der damaligen Zeit entsprechend, schon früh geübt, und es begann mit Skaldensängen der Nordmänner und Stabreimen. Von der Lektüre der Ahnen Gustav Freytags, aber auch von Walhall, den germanischen Götter- und Heldensagen Felix Dahns, in seiner Phantasie beflügelt, schrieb er »die Seiten eines steifen grauen Schulhefts« mit Szenen einer erdachten Familiengeschichte voll. Da sich die Sippe bis 1640 zurückverfolgen lässt, wollte die Familien-Fama wissen, der Ahnherr mit dem im deutschen Südwesten seltenen Vornamen Hartmann sei einst mit Gustav Adolfs Truppen im Dreißigjährigen Krieg aus Schweden gekommen. So führen die Eingangsszenen seines dramatischen Romans, in dem natürlich auch die 1848er Legenden nicht fehlen, in die heldische Zeit der Wikinger mit ihren gehörnten Helmen zurück. Von einem sehr entfernten, übrigens ihm bis dahin völlig unbekannten Neffen, der sich beim Bundespräsidenten meldet, erfährt Heuss Jahrzehnte später, dass jener vermeintlich nordische Ahnherr namens Hartmann Heuss im Jahr 1604 in Haßmersheim das Licht der Welt erblickte und er seinen jugendlichen Roman höchstwahrscheinlich auf einen »frommen Schwindel« gegründet hatte.29
Vor der gemeinsamen Rheinwanderung hatten die beiden Brüder Darmstadt besucht, um das deutsche Bauwunder der Moderne, die Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe, und das »Dokument deutscher Kunst« zu besichtigen, wie die dort vom Mai bis Oktober 1901 gezeigte Jugendstil-Ausstellung hieß. »Wir mussten dies sehen«, erinnert sich Heuss, »es war gar nicht denkbar, daß wir an einem solchen Bekenntnis zu neuer Formgesinnung vorbeigehen würden …« Was die Brüder bewundern, verdankte sich dem Kunstsinn des Darmstädter Großherzogs, der sich auf Besuchen in England von der von William Morris und John Ruskin initiierten Arts-and-Crafts-Bewegung beeindruckt zeigte, aber auch die Bauten des Wiener Jugendstils schätzte. Um die Jahrhundertwende lud er sieben junge Künstler ein, eine Kolonie in einem Park auf der höchsten Erhebung der Stadt, der Mathildenhöhe, zu errichten, und beauftragte den Wiener Architekten Joseph Maria Olbrich mit dem Bau eines Ateliergebäudes, das den Künstlern außer Arbeitsräumen auch einen Fest- und Versammlungsaal bot. Von der neuen Baugesinnung zeugt noch immer der Eingang, zu dem eine Freitreppe führt und der von zwei sechs Meter hohen Kolossalstatuen des Bildhauers Ludwig Habich flankiert wird, genannt »Kraft und Schönheit« oder »Mann und Weib«, beide den Kopf einander zugewandt, die Portalnische hinter ihnen über und über mit goldenen Pflanzenornamenten geschmückt.
Noch heute gilt die Mathildenhöhe mit diesem, jetzt Ernst-Ludwig-Haus genannten, ursprünglichen Ateliergebäude, ihren Künstlerhäusern und auch dem Hochzeitsturm, der allerdings erst 1908 von Olbrich gebaut wurde, als wichtigstes deutsches Jugendstilensemble. Er sei froh über dieses »jugendliche Dabeigewesenseinmüssen«, schreibt Heuss, denn bis zu ihrem Darmstadt-Besuch hatten die Brüder Heuss über den Abschied von der üblichen historisierenden Form des Bauens nur durch Artikel und Abbildungen in Zeitschriften erfahren. »Über dem Versuch lag ein unwiderstehlicher Reiz des enthusiastischen Glaubens, im Bau, im Hausgerät, im Ornament aus der subjektiven Besinnung und Phantasie des Künstlers heraus den Ausdruck unserer Zeit zu finden, ahistorisch, antihistorisch.« Für Heuss entsteht »eine sinnenhaft erregte Beziehung zu einem Lebens- und Arbeitsbereich«, der zwei Jahrzehnte später, als einer der Geschäftsführer des Deutschen Werkbunds, zu einem Kernstück seines beruflichen Schaffens wird.30
Fragen der Kunst und Literatur, der Aufbruch zur Moderne um die Jahrhundertwende fallen im Hause Heuss der Politisiererei nicht zum Opfer, sie werden, womöglich mit der in einer Provinzstadt üblichen Verspätung, durchaus zur Kenntnis genommen und diskutiert. Aus jedem erreichbaren Buch, aus Monographien und Zeitschriften bilden sich die Brüder Hermann und Theodor ihre Vorstellungen von Kunst und Literatur der Gegenwart und einer Moderne, die für das Gymnasium offenbar nicht existiert. Ihre Lehrer, so Heuss, hätten von dem, was in den neunziger Jahren an geistiger Spannung allmählich in der Provinz sich zeigte, nichts gewusst.31
Von ihrem bescheidenen Taschengeld erstehen Hermann und Theodor Drucke von Max Klinger und Hans Thoma. Theodor, der unermüdliche Bücherfresser, entdeckt Gerhart Hauptmann und Hermann Sudermann, aber auch den damals von der offiziellen Germanistik noch weithin unbeachteten Gottfried Keller, er wagt sich an Dichter des Naturalismus wie Arno Holz und Johannes Schlaf heran, ja selbst an Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtungen. Einem Oktavheft, in das er Notizen eingetragen hat, ist zu entnehmen, dass er als Sechzehnjähriger in fünf Monaten rund zwanzig Bücher und Gedichte studiert hat, darunter etwa Tolstois Krieg und Frieden, Hauptmanns Die Weber und Emile Zolas Der Zusammenbruch.32 Als im Frühsommer 1902 eine Tante in Karlsruhe stirbt und Theodor als einziger Sohn seine Mutter zum Begräbnis begleiten muss (der älteste studiert, der mittlere Bruder leistet inzwischen seinen Wehrdienst beim Regiment ab, das in Heilbronn in Garnison liegt), stiehlt er sich nach der Beerdigung vom Friedhof und treibt sich stundenlang in den Sälen der internationalen Karlsruher Jubiläums-Kunst-Ausstellung herum. Dann schreibt er einen »langen, langen Aufsatz«, der sich liest, als ob er sich in den Ateliers von München und Dresden, mit den französischen Impressionisten und den Skandinaviern bestens auskenne, und bietet ihn dem Chefredakteur der Neckar-Zeitung an. Der, von Fragen der modernen Kunst offenbar völlig unbeleckt, schmeißt den Primaner nicht etwa in hohem Borgen aus seinem Büro, sondern druckt den Artikel in zwei Fortsetzungen. Mit Namen Heuss gezeichnet, erscheinen sie etwa vier Wochen vor Theodors Abitur. Früh also beginnt seine journalistische Karriere, und voller Stolz flaniert er nun durch die Stadt, nur um zu erfahren, »was so viele Autoren erlebt haben und erleben werden«: Kein Mensch nimmt Notiz davon – ausgenommen der Latein- und Griechischlehrer, der kopfschüttelnd meint, er solle sich besser um Thukydides kümmern.33
Als Heuss erfährt, Detlev von Liliencron, der von ihm verehrte Dichter, werde nach Heilbronn kommen, fährt er zum Bahnhof, um ihn zu empfangen, stellt sich ihm als eine Art Stadtführer zur Verfügung, zeigt ihm »Kirchen, Gassen, Höfe, Winkel« der alten Reichsstadt und erzählt, ein alter Schulfreund von ihm sei ein Urenkel jenes Käthchens von Heilbronn, das Kleist zum Modell für sein Theaterstück gedient habe. Es ist der Liliencron, der sich seiner ewigen Geldnöte wegen dem Kabarett »Überbrettl« von Ernst von Wolzogen angeschlossen hat und nun, im biederen Gehrock, als Attraktion zwischen Sängern und Diseusen, Sketchen und frivolen Liedern auftritt. Die Rolle, die der verehrte Dichter hier spielen muss, ruft im jungen Heuss, verständlich, nur ein bitteres »Gefühl der Unangemessenheit« hervor.34 Doch bleibt er mit Liliencron in Kontakt, der ihn in einem seiner Briefe ermahnt, der »Heimatkunst« nicht aufzusitzen und die Maße der Weltliteratur nicht zu vergessen. »Heimatkunst« ist ein Kampfbegriff; von Friedrich Lienhard und dem übel antisemitischen Adolf Bartels wird er um die Jahrhundertwende von Weimar aus als eine Art Blut-und-Boden-Innerlichkeit gegen die Literatur des sogenannten materialistischen Berliner Asphalt-Dschungels ins Feld geführt, unter die natürlich die Werke des jungen Gerhart Hauptmann oder Frank Wedekinds fallen.
Theater spielt im Erziehungsroman des Gymnasiasten Heuss keine wichtige Rolle – jedenfalls das Heilbronner kaum, dessen Repertoire an alten Singspielen und Komödien seine »literarische Wachheit«35 nicht befriedigen konnte. Das ändert sich erst, als er die Stuttgarter Bühne besucht, und mit diesen Theatereindrücken wandelt sich auch sein Bild vom württembergischen König Wilhelm II. Der hatte 1897 anlässlich einer großen Gewerbeausstellung erstmals Heilbronn besucht und die Schulbuben »vorübergehend zu Hurrah brüllenden Royalisten gemacht«. Seinem Vater freilich passte die Sache nicht: Einerseits fühlte er sich geschmeichelt, weil er dem König seine Amtsabteilung – Brückenentwurf, Stadterweiterung – zeigen und erklären musste; andererseits brachte es ihn auf, denn vor Majestät hat Louis Heuss im Frack zu erscheinen – und der von seiner Hochzeit passte nicht mehr.36 Wenn sich bei Theodor das Bild vom König wandelt, hat dies vor allem mit dessen Förderung der Künste zu tun. So beruft er den Mannheimer Sezessionisten Leopold von Kalckreuth an die neue Königliche Akademie der bildenden Künste, an der bald auch Bernhard Pankok lehrt und Oskar Schlemmer Mitglied wird. Und unter Leitung des neuen liberalen Intendanten Wolfgang Gans Edler Herr von Putlitz gelingt dem Hoftheater in Stuttgart der Anschluss an die Kulturmetropolen Berlin, Dresden, München und Wien, wo einer seiner wichtigsten Schauspieler, Raoul Aslan, später Intendant des Burgtheaters wird. Putlitz führt vor allem die Skandinavier Ibsen und Strindberg auf, er spielt – mit königlicher Billigung – viele naturalistische und impressionistische Stücke, die in anderen deutschen Ländern verboten sind. So etwa Über die Kraft des norwegischen Literaturnobelpreisträgers BjØnstjerne BjØrnson, das wegen seiner revolutionären Tendenzen in Berlin der preußischen Zensur zum Opfer gefallen ist.37 Mit Nachhilfestunden verdient sich Heuss das Geld, um zu wichtigen Aufführungen nach Stuttgart zu fahren – etwa zu Tolstois Macht der Finsternis, einer deutschen Erstaufführung, die ihn stark beeindruckt, oder zur BjØrnson-Premiere, die »geradezu aufregend wurde … Der Norweger selbst war anwesend und es gab eine ungeheure Huldigung für ihn. Man klatschte sich die Hände wund, um die eindrucksvolle Erscheinung immer wieder auf die Bühne zu zwingen, und durfte sich dabei als Assistent der Weltliteratur empfinden!« Manche Aufführungen des wilhelminischen Stuttgart, meint Heuss, hätten so »den Charakter des Protestes gegen das wilhelminische Berlin« gewonnen.38
In der Tat konnten die Gegensätze zwischen den beiden Wilhelminismen, dem von Berlin und dem von Stuttgart, kaum größer sein. Der junge Heuss wächst zwar in einem Königreich auf, aber dessen korpulente Majestät gibt sich, sehr zum Unmut des kaiserlichen Namensvetters, betont unmilitärisch, verzichtet meist auf die Uniform und zieht bürgerliche Kleidung vor. Ohne Leibwache geht er mit seinen zwei Hunden spazieren und hat stets Bonbons in den Taschen, um sie den Kindern zu schenken, denen er begegnet. Wilhelm II. in Berlin soll oft verächtlich von der »königlichen Republik Württemberg« gesprochen und in des Königs langjährigem Ministerpräsidenten Mittnacht einen »verkappten roten Demokraten« gesehen haben.39 Bei Hofveranstaltungen erschien der letzte württembergische König nicht mit ordensübersäter Brust, sondern im schwarzen Gehrock mit weißem Hemd und weißer Weste, das Monokel im rechten Auge, die linke Jackettseite nur mit dem preußischen Adlerorden geschmückt. In seiner Regentschaft gelingt der Württembergischen Volkspartei schließlich der entscheidende Durchbruch: Während der Preußische Landtag bis 1918 nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählt wird, macht die Reform von 1906 die zweite – entscheidende – Kammer des Stuttgarter Landtags zur reinen Volkskammer, die nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht gewählt wird.40
Im württembergischen Halbmondsaal, dem Tagungsort des Landtags, herrschte eine versöhnlichere Atmosphäre als in norddeutschen Landesparlamenten, und das Amtsverständnis des Stuttgarter Wilhelm II. entsprach viel stärker der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie in Großbritannien als dem des Kaisers und preußischen Königs in Berlin. So urteilt Jürgen Mittag und zitiert einen besonders süddeutsch-gemäßigten Sozialdemokraten, den Finanzexperten Wilhelm Keil, einen langjährigen Landtags- wie Reichstagsabgeordneten, der »seinem« König zum 25-jährigen Thronjubiläum im Jahre 1916 in der Stuttgarter sozialdemokratischen Tagwacht ein kleines Denkmal setzte: »Nehmen wir alles nur in allem«, schrieb Keil, »so will uns scheinen, daß unter den gegebenen Verhältnissen gar nichts geändert würde, wenn morgen in Württemberg an die Stelle der Monarchie die Republik treten würde. Kein zweiter würde, wenn alle Bürger und Bürgerinnen zu entscheiden hätten, mehr Aussicht haben, an die Spitze des Staates gestellt zu werden, als der jetzige König.«41 Nach den Besuchen im Königlichen Hoftheater rückt Theodor Heuss den Stuttgarter Wilhelm auf Platz zwei seiner Rangliste der deutschen Fürsten, den ersten hält – seit seiner Kunstpilgerfahrt zur Mathildenhöhe mit Bruder Hermann – weiterhin der Darmstädter Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein.
Mit Friedrich Naumann, der später eine Art Ersatzvater und Mentor, ja als übermächtiges, stets unumstrittenes Vorbild für »seine innere Entwicklung schlechthin lebensbestimmend« wird, schließt Heuss schon in den letzten Pennälerjahren Bekanntschaft, zumindest literarisch, denn Bruder Ludwig, der seinen Militärdienst beim Heilbronner Regiment ableistet, hat dessen Wochenschrift Die Hilfe abonniert. Ihre Lektüre lehrt den Gymnasiasten, die Wechselwirkungen zwischen innerer Politik und der äußeren Machtstellung zu erkennen, auch beeindruckt ihn Naumanns Aufgeschlossenheit für die soziale Frage, aber wichtiger scheint für ihn beinahe die Zeit gewesen zu sein, ein zweites Periodikum, das Naumann herausgab, aber aus Kostengründen bald einstellen musste. Hier schrieb der zum Politiker mutierte evangelische Pastor Naumann über Bildwerke, Gemälde, Architektur, und der junge Heuss meinte nicht nur, dass dieser Autor »alle Fragen spürte, die ein junges Herz beunruhigten«, er hatte auch Antworten zur Verfügung – »nicht mit apodiktischer Selbstgewißheit, sondern im lauten, suchenden Mitdenken«. Es sei wunderbar gewesen, einen solchen Mann am Werk zu wissen, »alle kritischen Einwände oder Vorbehalte schmolzen dahin«. Naumann hat Heuss allerdings nicht gleich erobert, einige Zeit fühlt sich der Gymnasiast eher zu den Sozialdemokraten hingezogen. Über Person, Einfluss und auch über die keineswegs unproblematische Politik Friedrich Naumanns wird später noch ausführlich zu handeln sein – hier genügt der Hinweis, dass der junge Heuss dessen Buch Demokratie und Kaisertum geradezu verschlingt und, als er sich dem winzigen Naumann-Kreis in Heilbronn anschließen will, von diesem trotz seiner Jugend »wohlgelitten« wird. Für die Hilfe schreibt er einen ersten kleinen Beitrag über Wilhelm Busch, und die Neckar-Zeitung bringt – unter dem Titel »Neudeutsche Wirtschaftspolitik« – einen Artikel von Heuss über eine Vortragsreihe Friedrich Naumanns. Von Minderwertigkeitskomplexen ist der Oberprimaner Theodor Heuss wahrlich nicht geplagt.42
Nach dem Abitur 1902 geht er erst mal auf Entdeckungsreise, fährt mit dem Zug nach Eisenach, wandert allein über die Höhenzüge des Thüringer Waldes nach Weimar, von dort nach Quedlinburg und über den Harz nach Goslar und Braunschweig und von dort schließlich nach Hannover. Viel Freude macht ihm das »wandernde Einzelgängertum«, wie er es in seiner heute oft betulich wirkenden Schreibe nennt, da er »eine sehr geringe Begabung zur Langeweile besitze«. Die »vorgekragten, bunten Fachwerke in den Gassen Braunschweigs« entzücken ihn, er denkt an Wilhelm Raabe und dessen Chronik der Sperlingsgasse und hätte nur zu gern gewusst, wo dieser seinen Abendschoppen getrunken hat. Unterwegs macht er einen Abstecher zu einem Harzer Mädchenpensionat, um als »Vetter« Tanzstundendamen aus Heilbronn zu besuchen. »Mit bekannter Unverschämtheit« sei er eingedrungen, schreibt er etwas angeberisch einem Freund in Stuttgart und schildert ihm die Szenerie als »hochkomisch«: Sechs hübsche, junge, fremde Mädchen hätten zu seinen beiden Seiten gesessen, indes er im Präsidium darauf geachtet habe, »gentlemanlike zu essen«.
In seinen Jugenderinnerungen, mehr als fünfzig Jahre danach, scheint er von solch schneidigem Auftreten weniger überzeugt. Da liest man, er sei noch ein halber Bub gewesen, habe sich fremden Damen gegenüber linkisch benommen, unter der eigenen Schüchternheit und Hilflosigkeit in »solcher Umrahmung« gelitten und bei dem ganzen Unternehmen einen »unguten Geschmack« gehabt.43
Das große Ziel der Reise ist freilich das Treffen der Nationalsozialen in Hannover, wo Anfang Oktober die »Vertreter« (heute würden wir sagen: die Delegierten und Funktionäre) des Vereins von Friedrich Naumann zusammenkommen. Dass ein achtzehnjähriger Bursche vom Neckar bis zur Leine gewandert ist, bloß um dabei zu sein, verfehlt seinen Eindruck nicht. Bei Tisch setzt man das »jüngste Kind« zwischen Naumann und seine Frau, und damit beginnt eine Nähe, ja eine Freundschaft, die das Leben von Theodor Heuss schicksalhaft prägen wird.44
Übrigens darf Heuss bei dieser Wanderung über Thüringer und Harzer Höhen auf Anraten des Arztes keinen Rucksack tragen, sondern muss sich mit einer alten Stofftasche aus Großmutters Besitz behelfen, die er sich mit einem Riemen über seine unversehrte Schulter hängt. Denn bei einer Schulkneipe im alten Deutschordensstädtchen Gundelsheim, wo seine Klasse das Abitur feiern will, ist er gestürzt. Die Trinkfestigkeit, mit der er »ein Leben lang prahlt«, hat offenbar bei der Feier ausgesetzt.45 Beim Sturz wird ein Arm ausgekugelt und verschiebt sich unter dicken Schwellungen – Luxation nennen dies die Ärzte –, und auch wenn das Einrenken unter Betäubung schließlich gelingt: Zurück bleibt ein lebenslanger Schaden. Der Arm ist nicht mehr verlässlich, ihm fehlt die Kraft; wenn er Halt bei einem Geländer sucht, kugelt er unerwartet wieder aus.
So wird Heuss ausgemustert, wie man das damals nennt, er bleibt – und dies mag sein großes Glück gewesen sein – lebenslang militäruntauglich. Auch das Fechten – und damit die Mitgliedschaft in der Burschenschaft Germania in Tübingen, der die Brüder angehören und die ihn schon hat keilen wollen – ist damit ausgeschlossen.46 Aber in Tübingen einer nichtschlagenden Verbindung beizutreten oder gar als »Finke«, als Nichtkorporierter, zu studieren, will er den Brüdern nicht antun. Nicht Tübingen, sondern München ist deshalb die Universität, die er wählt, und prägen wird ihn dort ein sogenannter Kathedersozialist, der Friedrich Naumann nahesteht.
1 Theodor Heuss: Vorspiele des Lebens. Jugenderinnerungen, Stuttgart / Hamburg 1966, S. 23–25 (künftig: Vorspiele)
2 Theodor Heuss / Lulu von Strauß und Torney: Ein Briefwechsel, Düsseldorf / Köln 1965, S. 102–105 (künftig: Heuss / Torney)
3