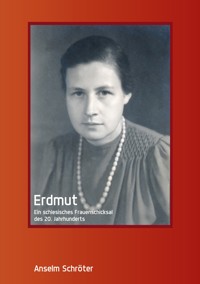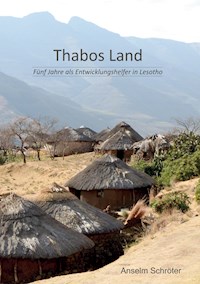Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Anselm Schröter hat in seinem reichhaltig bebilderten Buch versucht, auf sehr subjektive Weise seine Kindheit und Jugend in der Zeit des Wirtschaftswunders zu durchleuchten. Im Hintergrund dieses Buches steht die Frage, durch welche Faktoren eine Jugend im Nachkriegsdeutschland beeinflusst werden konnte. In eine Flüchtlingsfamilie wird er 1954 hinein geboren, als jüngstes von fünf Geschwistern. Der Vater baut mühsam eine Existenz auf. Die 68er Jahre hinterlassen bei dem Heranwachsenden bleibende Spuren, die sich bis zum Studium weiter verfolgen lassen. Ein großer Traum ist bereits angelegt: Die Welt zu erobern, im Ausland zu leben. Im Bildteil zeigt der Autor mit beeindruckenden Fotos Menschen fremder Kulturen, die ihm auf seinen frühen Reisen begegnet sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Erster Teil: Prägungen – Kindheit (1954 – 1962)
Vorspiel
Die Wohnung
Leben in der Kindheit
Das Jahresende
Die Eltern
Die Geschwister
Musik
Zweiter Teil: Kleine Freiheiten – Jugend (1965 – 1972)
Leben in der neuen Wohnung
Die Tilemannschule
Geld verdienen!
Einflüsse der Kirche: Israelreise, Orgeln
Privatleben
Das Reisegen
Dritter Teil: Training fürs Leben – Ausbildung (1972 – 1980)
Weichen werden gestellt
Studium
Kriegsdienstverweigerung
Zu Zweit
Vierter Teil: In die weite Welt hinaus – Reisen (1970 – 1980)
Warum nur?
Indien 1973
Marokko 1974
Südamerika 1975
Südostasien 1976
Nordindien 1977
Alpen-Radtour und Hochzeit 1978
Bulgarien 1979
Unsere Freunde in Dresden
Indien und Nepal 1980
Fünfter Teil: Warten auf DED (1980 – 1982)
Vater werden
Bildteil
Vorwort
Seit Jahren treibt mich zunehmend die Frage um, welche Anteile meines Lebens durch meine Erbanlagen bedingt genau so ablaufen mussten, wie es passiert ist. Noch viel intensiver kümmert mich, welche Umwelteinflüsse mich prägten. In der Rückschau und mit meinem ganzen versammelten Wissen als Biologielehrer bin ich noch immer unschlüssig. Sicher hätte ich mit meinen Genen einige alternative Leben genießen oder erdulden können. Allerdings verrennt man sich nur allzu schnell in spekulativem Denken. Viel interessanter und beachtbarer kommen mir die Menschen und Zeitläufe daher, die als Ensemble meiner Umwelt mich immer wieder in die eine oder andere Richtung schubsten.
Je mehr ich in die Vergangenheit meines Lebens eintauche, desto mehr Konturen erheben sich wieder aus der Unschärfe. Interviews mit meinen Geschwistern, eigene Recherchen, alte Tagebücher – all das erhöht die Spannung, zu erfahren, was alles noch in meinem Unterbewussten gespeichert und wieder hervor geholt werden kann. Ich spaziere durch eine dunkle Höhle der Vergangenheit auf der Suche nach glitzernden Spuren und Edelsteinen. Manchmal dienen alte Fotos als Taschenlampe, um in einem Seitengang fündig zu werden. Überhaupt bin ich dankbar für Bilder und Tagebücher aus alter Zeit, die dann Erinnerungskaskaden auslösen.
Meine Eltern haben uns Kindern leider kaum schriftliche Erinnerungen an ihre Kindheit, Jugend, Kriegszeit und Nachkriegswirren hinterlassen. Mit meiner fast 90-jährigen Mutter entzifferte ich mühsam die Aufzeichnungen meines Vaters während seiner bitteren Gefangenschaft in Frankreich und übertrug sie aus der gekritzelten Miniatur-Sütterlinschrift in lesbaren Text. Vater selbst konnte und wollte uns Kindern wenig aus seiner dunklen Zeit des Krieges berichten. Das empfand ich zunehmend als ein Defizit, vor allem auch nach dem Tod meines Vaters. Umso mehr habe ich das Bedürfnis, mein Leben für meine Nachwelt in geeigneter Form zu konservieren. Dies verursacht in mir ein Bedürfnis darüber zu fabulieren.
Erster Teil: Prägungen – Kindheit (1954 – 1962)
Vorspiel
Sicherlich begann alles in dem Moment, als ich in eine halbwegs geordnete Nachkriegswelt hinein plumpste. Der Vater krabbelte gerade recht mühsam auf seiner Karriereleiter in ungeahnte Höhen empor. Als ein Nazi-Sünder und Kriegsoffizier war er nach dem Krieg durch ein Tal der Tränen in verschiedenen Lagern Frankreichs gegangen. Ende 1948 fand er sich in der niemals vorgesehenen Rolle des arbeitslosen Heimkehrers und Flüchtlings wieder. Nur mit tätiger Unterstützung seiner Familie, vornehmlich seines jüngsten Bruders, und mit einem gnädigen Urteil im Entnazifizierungs-Verfahren konnte er sich mühsam seinem eigentlichen Beruf – dem des Lehrers – hinwenden.
In Etappen schritt er quer durch Hessen, über Neuengronau, Hintersteinau nach Linter. Er strandete schließlich als Rektor einer Hauptschule in Limburg an der Lahn. Sein evangelischer Glaube half bei der Besetzung der Stelle: Im tief katholischen Limburg benötigte der Proporz einen geeigneten evangelischen Kandidaten.
So weit waren wir noch nicht, als ich im zugigen Kirberger Krankenhaus Anfang Februar 1954 von meiner armen Mutter entbunden wurde, als letztes von fünf überlebenden Kindern. Bei Schnee und bitterer Kälte war sie von meinem Vater mit dem Motorrad von Linter zur Entbindung gebracht worden. Hier im Krankenhaus beginnt meine Leidenszeit als kränkelndes Kind, was wohl als erster massiver Umwelteinfluss auf mein Leben zu betrachten ist. Erste schlimme Infektionen traten schon im Säuglingsalter auf.
Am 11.9.53, also knapp 5 Monate vor meiner Geburt, schrieb meine Großmutter an ihre Tochter: „Möge Gott dir beistehen, wenn du aus dem Wochenbett aus einem warmen Heim in Euer kaltes Haus zurückkehrst, so bete ich jetzt schon unter Tränen. Eins müsst Ihr beide ganz klar sehen, dass die heutige Müttergeneration nicht verglichen werden kann, was die Leistungsfähigkeit anbelangt, mit den Müttern meiner Generation, die wir ohne Hilfe wie nebenbei unsere Kinder kriegten...Denn wir kamen noch aus Vorkriegsjahren hervor, während Ihr alle heute in Mangeljahren zur Welt kamt...und dann noch eure Kinder in Mangeljahren zur Welt brachtet. Bis das Kindchen (also ich, der Autor!) da ist, wird ja alles gut gehen; aber dann, wenn du geschwächt zurückkehrst mitten im kalten Winter, hoffentlich ohne Infektion im Krankenhaus (!), dann musst du behandelt werden wie ein rohes Ei. Möge euch das ganz klar sein, Ihr Lieben!“
Abb.1: Krank
Soweit sah meine Großmutter die Gefahren voraus, die dann auch zu der einen oder anderen Katastrophe führten. Wie viele Heiligabende verlebte ich hochfiebrig!? Wie viele Fotos existieren von mir als krankes Kind im Bett liegend. Bis ins Studentenalter hinein nervten mich beispielsweise Hohlräume, sogenannte Kavernen in der Lunge, die wohl aus einer verheilten Lungentuberkulose stammten. Bei jeder Routine-Röntgenaufnahme nötigte der Befund mich zu einem Extratermin im Gesundheitsamt.
Bedingt durch meinen schlechten Allgemeinzustand genehmigte das Gesundheitsamt meinen Eltern, mich noch vor Schuleintritt für unglaubliche sechs Wochen im Frühjahr 1960 auf die Insel Spiekeroog zur Kur zu schicken. Als mit Abstand jüngstes Kind war ich dort einer Horde halbwüchsiger, frecher Jungs ausgeliefert. Während dieser Zeit der ersten, knallharten Trennung von meiner Familie lernte ich den Schmerz des Heimwehs von Grund auf kennen. Könnte es sein, dass ich auf Spiekeroog in der Atmosphäre des Fressens und Gefressen Werdens geprägt wurde, in Zukunft Rangordnungskämpfen aus dem Wege zu gehen und dominanten Menschen zu misstrauen? Für mich liegt da eine Verbindung – traumatische Erlebnisse in einem solchen Alter prägen sicherlich nachhaltig!
Zu meiner Geburt traten an: Neben Eltern auch vier Geschwister, drei von ihnen Kriegsgewächse, einer, nämlich Rainer, das Produkt der „glücklichen Heimkehr“. Dazu noch eine Cousine, Beni, die in den ersten Wochen nach der Geburt bei der Hausarbeit half. Immerhin wurde sie als Belohnung dann zu einer meiner Patentanten ernannt. Man erzählt sich sogar noch von einer Fehlgeburt nach mir. Als Wunschkind würde ich mich nicht bezeichnen. Das beichtete mir jedenfalls meine Mutter Jahrzehnte später ganz schuldbewusst. Man hatte schon einen Namen für mich bereit: Selma. In der Überraschung, doch nur wieder ein Junge zu sein, wurde der Name dann geringfügig abgewandelt.
Im Sommer des Jahres zogen wir von Linter, einem kleinen hessischen Bauerndorf, in dem Vater die Volksschule geleitet hatte, nach Limburg zu seinem neuem Wirkungskreis. Er schaffte sich einen Namen als Rektor, GEW-Vorsitzender, Kirchenvorsteher, Funktionär beim Schlesierverband. Währenddessen gedieh die Flüchtlings-Familie zuhause und schuf sich eine neue Heimat.
Abb. 2: Abschied vor der Kur
Die Wohnung
Wenn ich unsere Mietwohnung in der Wiesenstraße 13 in Limburg beschreibe, die mir in den folgenden 13 Jahren als Heimat diente, bin ich mir bewusst, dass zu dieser Zeit viele Familien ähnliche Lebensumstände zu bewältigen hatten.
Die Altbauwohnung war auffallend geschnitten: Die Entree-Tür (unser Fachausdruck in Französisch – wir waren „gebildet“!) öffnete auf einen vielleicht acht Meter langen Gang; der eignete sich hervorragend zu Zeitvertreib wie Nachlauf und Klickerspielen. Über uns wohnte die Schwester unserer Vermieterin, die Jungfer Fräulein Harbach. Sie war eine widerliche Person, die nach der schmerzhaften Erfahrung mit uns als Mietern sich wohl in ihrer Entscheidung bestätigt fühlte, niemals geheiratet oder Kinder in die Welt gesetzt zu haben! Kinderlärm und Ehestreit klangen nur zu häufig durch die Wände nach oben!
Vom Gang führten links und rechts Türen in die bewohnten Räume. Als hochmoderne Konstruktion kann man die separate Toilette in der Wohnung bezeichnen, neu eingebaut! Das Klo auf der halben Treppe war endgültig Geschichte! Mit einem langen Metallzug konnte man bei Geruchsbelästigung in einigen Metern Entfernung hinten oben ein Fenster aufschieben. Auf der linken Seite folgte die Küche, mit neumodischem Gasherd, herkömmlichem Kohleherd und einem großen Eisschrank von Bosch. In der Mitte stand ein stabiler Holztisch – multifunktional! Auf ihm wurde Essen vorbereitet, manchmal daran gegessen, darauf gebacken – und Rainer und ich wurden als kleine Steppkes in einer Zinkwanne auf diesem Tisch samstagabends gebadet.
Wenn vor dem ersten Advent echter Lebkuchen ausgerollt und Plätzchen ausgestochen wurden, so brachen für uns die schönsten Momente des Jahres in dieser Küche an. Für Rainer und mich war es ein herrlicher, ein privilegierter Termin; denn da hatten eigentlich die älteren Geschwister nichts verloren! Und ein Rest Teig blieb immer übrig, mit dem wir beiden unserer Backfantasie freien Lauf lassen konnten. Mmmmh!
Das nächste Zimmer hieß Badezimmer. Allerdings wurde es erst nach einer „Modernisierung“ aufgewertet: Eine dünne Pappwand mit Durchgang und Vorhang war längs durch das Zimmer gezogen worden. Hinter der Pappe stand danach unter einem Gasboiler eine Badewanne. Wenn es sich „lohnte“, badeten wir Kinder in der Badewanne. Das Abwasser aus der Waschmaschine und der Wäscheschleuder, die auch noch in diesem schmalen „Raum“ Platz fanden, entleerte sich in die Badewanne.
Vor der Pappwand hatte Bettina, meine einzige Schwester, ihr Reich, mit geringer Aussicht auf „Privacy“. Bald fiel meine Schwester allerdings als ständige Bewohnerin weg, weil sie ihre Krankenschwesterausbildung in Bad Ems absolvierte. Bei Wochenendbesuchen war dieses Zimmer allerdings für sie reserviert, nur selten schlief mal ein Gast hier!
Am Ende des Gangs schloss sich das Elternschlafzimmer an. Mein weißes Gitterbett stand am Fußende des Elternbettes. Ich habe wenig romantische Erinnerungen an dieses Bettchen. Die Kratzer und Lackflecken an den Innenwänden bereicherten meine Fantasiewelt, wenn ich nach dem Mittagessen zu einem Pflichtschlaf dort hinein gesteckt wurde. Ganze Geschichten entwickelten sich da aus Fingernagel-Graffiti vor mir, während ich auf das Aufstehen wartete! Vor dem Schlafen abends kam Mutti ausnahmslos ans Bett für ein Lied, ein Gebet und zwei bis drei Sätze – nur für mich allein. Eine Gebetsfloskel bleibt für mich immer mit dieser abendlichen Routine verbunden und unvergesslich (was muss da alles vorgefallen sein!) : „Lieber Gott, mach, dass Knut nicht so brutal zu uns ist.“ Ich empfand wohl in diesem frühkindlichen Alter meinen Bruder Knut häufig als Beeinträchtigung unserer Sicherheit.
Wie oft wurde ich nachts geweckt, wenn die Eltern sich in ihrem Bett mit unterdrückter Stimme stritten - immer mit Vati in der Rolle des Angreifers, Mutti als Verteidigerin.
Auf der anderen Seite des langen Ganges lagen drei Zimmer. Gleich neben dem Eingang hausten im Bubenzimmer die drei Brüder. Später stieß ich dazu, als Volker das Abitur hinter sich hatte und zur Bundeswehr abwanderte. Dann mussten wir nur an Wochenenden ein Bett für ihn räumen. Oft genug teilten Rainer und ich uns eine Matratze! In diesem Zimmer liefen viele gesellschaftlichen Ereignisse ab, die wir auch heute noch gern aus der Erinnerung abrufen: Allweihnachtlich baute Volker eine erstaunlich große, nackte Märklin-Eisenbahn auf. Sie war von allem schnöden Tand wie Landschaft oder Faller-Häuschen befreit; das Ziel war es, vollautomatisch mehrere Züge gleichzeitig über kompliziert angelegte Gleisanlagen fahren zu lassen und das Kollisionsrisiko dabei zu minimieren. Meist hatte Volker schon einen Plan zu Papier gebracht, der dann zur Ausführung gelangte. Wir Kleinen bewunderten die Komplexität unseres ältesten Bruders, durften sogar, wenn wir brav waren, auch mal an den Trafo!
Volker hatte unterm Bett eine umfangreiche Chemikaliensammlung aufgebaut, die er nach und nach als Chemiestudent aus der Universität Gießen „dauer-entliehen“ hatte. Mit ihr zauberte er manche Überraschung. Die Fabrikation von Silvester-Feuerwerk, von kleinen explosiven oder stinkenden Kostbarkeiten gehörte zu seinem Handwerk. Wie lachten wir zum Beispiel, nachdem wir ein zähes Geschmier, bestehend aus Iod und Ammoniak, auf dem Bürgersteig vor unserm Haus verschmiert hatten. Nachdem das Stickstofftriiodid trocknet, reagiert es sehr explosiv auf Erschütterungen. Dementsprechend erschreckten sich die Passanten, die achtlos über die schwarzen Flecken auf dem Gehweg spazierten und von scharfen, grellen Explosionen begleitet wurden.
Als Rainer glaubte, die Rezepte seines Bruders kopieren zu können, führte seine Fehleinschätzung zu einem einschneidenden Erlebnis auf dem nahen Stephanshügel, unserm Abenteuerrevier. Dorthin hatten wir das selbst gebraute Teufelszeug aus Schwefel, Magnesium, Kohlenstoff und vielen anderen Zutaten gebracht. Rainer zündete es stilgerecht mit einem Magnesiumband an, doch wollte der Haufen nicht plangemäß in die Luft fliegen. So musste Rainer aus der Deckung und rührte mit einem Stäbchen in dem Gemisch herum. Das explodierte ihm daraufhin ins Gesicht. Er erlitt höllische Schmerzen durch die Magnesiumstreusel, die in seinem Gesicht verglühten. Zum Glück bewahrte seine Brille ihn vor Schlimmerem. Abends lief der schmerzgeplagte Bruder in unserm langen Hausgang hin und her und jaulte. Leider hatte er dabei weniger mit Mitgefühl seines Vaters als mit Schadenfreude zu rechnen.
Im Bubenzimmer erregten immer wieder Bücher unsere Fantasie, allen voran der rassistische Schinken „Gari-Gari“, der von einer Afrikareise handelte und junge, unbekleidete Damen, Trophäen aus der Kolonialzeit, zeigte. Irgendwann merkte Volker unser dem Alter nicht angemessenes Interesse an dem Buch. Danach verschwand es spurlos. Heute bin ich natürlich stolzer Besitzer einer Kopie des Buches, selbstverständlich nur aus sentimentalen Gründen.
Weitere Erinnerungen ans Bubenzimmer kann ich nur in kurzen Auszügen wiedergeben. So hatte ein Bett sehr lange eine mit Stroh gefüllte alte Matratze, die einen stechenden Bettnässer-Geruch verströmte. Sie wurde in späteren Jahren ersetzt. Das Schlafen zu dritt oder zu viert erforderte eine gewisse Disziplin, vor allem bei einem Altersunterschied von 14 Jahren. Als wir für das Wohnzimmer ein neues Radio erhielten, kam das alte Schwarze aus Bakelit ins Bubenzimmer. Rainer und ich hörten manchmal abends im Bett irgendwelche Hörspiele im Dunkeln.
Ans Bubenzimmer schloss sich das Wohnzimmer als Lebensmittelpunkt an. Dieser Raum stand uns als Esszimmer, sowie als Aufenthalts-, Hausaufgaben-, Unterhaltungs-, Lese- und Spielraum zur Verfügung. Das Radio krönte den Schreibtisch in der Ecke, unser mediales Fenster zur Welt. Solange Volker im Raum war, wurde hier nur klassische Musik geduldet. Sobald er aber verschwunden war, dominierte Knut den Raum mit Radio Luxemburg in ungleich massiver Lautstärke – zumindest so empfanden wir Kleinen. Da half kein Klagen, der Platzhirsch bestimmte das Programm. Rainer störte die Musik häufig bei der Erledigung seiner Hausaufgaben. Unweigerlich folgte dann ein Handgemenge, in dem Knut klar stellte, wer im Wohnzimmer die Entscheidungen trifft. Rainer wurde immer wieder mal ordentlich verprügelt. Und ich schaute heulend zu. So herrschte damals bei uns in der Familie das Gesetz der Wildnis – meist mit einem guten Ende für mich, denn Rainer stand als fast vier Jahre älterer Bruder selbstverständlich für unsere gemeinsamen Verfehlungen gerade – bei Knut wie auch bei unserm Vater, wenn wir wieder mal zu spät zum Abendessen kamen. Der Leser kann sich nun leicht vorstellen, dass unser Vater es grundsätzlich vorzog, seine Nachmittage in der Schule zu verbringen; denn dort standen ihm Ruhe und alle Annehmlichkeiten zur Verfügung!
Abb. 3: Am Esstisch im Wohnzimmer
Trotz aller Einschränkungen galt das Wohnzimmer immer als zentraler Schauplatz unseres Familienlebens. Als einziger Raum wurde es im Winter regelmäßig beheizt, zuerst mit Kohle, später mit der modernen Variante Heizöl. Nachschub musste aus dem Kohlekeller geholt werden.
Das Frühstück sah unsern Vater hinter der Zeitung – bitte nicht stören! Mutti kümmerte sich derweil um die Haferflocken und das Schulbrot. Mittagessen und Abendbrot wurden grundsätzlich gemeinsam eingenommen. Wehe, wir kamen nicht spätestens um 19 Uhr vom Stromern zurück! Dann konnte Vati auch mal handgreiflich werden! Altersbedingt wurde ich bei körperlichen Strafen von Vati weitgehend verschont.
Ich denke beim Thema Strafen besonders an eine für alle Seiten sehr peinliche Situation: Ich stand, im Alter von 7 oder 8, an der Süßwarentheke bei Theile, dem Kaufhaus Limburgs. Meinen Groschen wollte ich in eine Schaum-Maus investieren. Das Geld hatte mir Mutti als Belohnung für zu erledigende Besorgungen zuerkannt. Das Schicksal wollte es nun, dass die Bedienung hinter der Theke mich mit der leckeren weißen Maus in der Hand übersah, bis ich die Geduld verlor und das Kaufhaus ohne zu bezahlen verließ. Natürlich mit der Schaummaus in der Hand! Der zuständige Detektiv hatte mich kleinen Steppke natürlich schon längst als Verbrecher ausgemacht und zog mich in sein Büro. Es folgte definitiv ein peinlicher Resttag: Von meiner inzwischen nassen Hose über das peinliche Verhör bis zum Rapport bei Vati in der Schule. Der mild gestimmte Vater bestrafte mich mit einem völlig angemessenen Besinnungsaufsatz über das Thema „Warum soll man keine Süßigkeiten stehlen?“
Mit vier Jahren wurde ich schlaues Bürschchen in die Kunst des Lesens eingeweiht, ohne Druck, spielerisch, durch Imitation und Neugier. Das führte dann dazu, dass ich abends den Kalenderzettel des Neukirchener Kalenders vorlesen durfte. Erst später wurde mir richtig bewusst, dass ich durch diese Fähigkeiten das Leben meines älteren Bruders Rainer nicht gerade angenehmer machte, eine dunkle Spur in unserer Familie, die sich erst durch seine Abnabelung nach dem Abitur langsam verlor.