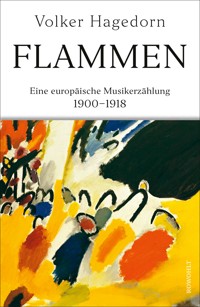10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Johann Sebastian Bach kennt jeder. Aber dass er der Spross einer 150 Jahre alten Dynastie von Musikern war, ist kaum im Bewusstsein. Dieses Buch erzählt die Geschichte eines erstaunlichen Clans in einem Europa des Umbruchs, das geprägt war von Kriegen und Seuchen. Im 17. Jahrhundert wurde Musik ein Mittel gegen Elend und Tod, und die Bachs vor Bach beherrschten diese Kunst mit zunehmendem Genie. Volker Hagedorn verfolgt ihren Weg über Hochzeiten und Todesfälle, Notenblätter und Orgelbänke, bis schließlich der große Ausnahmekomponist in Erscheinung tritt. Zugleich schlägt das Buch den Bogen in die Gegenwart. Wie sieht es heute dort aus, wo die Bachs lebten und Johann Sebastian zum Wunderkind wurde? Hagedorn beschreibt die Arbeit der Forscher, für die unscheinbare Aktennotizen zu Leuchtspuren durchs Barock werden. Und er schildert einen der faszinierendsten Forschungskrimis der Musikgeschichte, der im zerbombten Berlin beginnt und an dessen Ende in der Ukraine das legendäre «Altbachische Archiv» auftaucht – eine Notensammlung der Bachs vor Bach, das Fundament von Johann Sebastians Genie. Hagedorns Buch entwirft ein farbenfrohes und facettenreiches Zeit- und Sittengemälde, das die Wurzeln des Musikers Bach erstaunlich lebendig werden lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Volker Hagedorn
Bachs Welt
Die Familiengeschichte eines Genies
Über dieses Buch
Johann Sebastian Bach kennt jeder. Aber dass er der Spross einer 150 Jahre alten Dynastie von Musikern war, ist kaum im Bewusstsein.
Dieses Buch erzählt die Geschichte eines erstaunlichen Clans in einem Europa des Umbruchs, das geprägt war von Kriegen und Seuchen. Im 17. Jahrhundert wurde Musik ein Mittel gegen Elend und Tod, und die Bachs vor Bach beherrschten diese Kunst mit zunehmendem Genie. Volker Hagedorn verfolgt ihren Weg über Hochzeiten und Todesfälle, Notenblätter und Orgelbänke, bis schließlich der große Ausnahmekomponist in Erscheinung tritt.
Zugleich schlägt das Buch den Bogen in die Gegenwart. Wie sieht es heute dort aus, wo die Bachs lebten und Johann Sebastian zum Wunderkind wurde? Hagedorn beschreibt die Arbeit der Forscher, für die unscheinbare Aktennotizen zu Leuchtspuren durchs Barock werden. Und er schildert einen der faszinierendsten Forschungskrimis der Musikgeschichte, der im zerbombten Berlin beginnt und an dessen Ende in der Ukraine das legendäre «Altbachische Archiv» auftaucht – eine Notensammlung der Bachs vor Bach, das Fundament von Johann Sebastians Genie.
Hagedorns Buch entwirft ein farbenfrohes und facettenreiches Zeit- und Sittengemälde, das die Wurzeln des Musikers Bach erstaunlich lebendig werden lässt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Media Agentur, München;
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildungen «Reiterschlacht am Waldrand», Jacob Martsen (1646); «Bach», Gemälde um 1715 von J.E. Rensch d.Ä./akg Images
Karte und Stammtafel Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-644-03811-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Was heißt eigentlich tot, verflossen?
Für welche Art Dinge existiert Zeit
und für welche nicht?
Alfred Döblin
Kapitel 1Die Ankunft
Wie ein Bäckermeister aus Pressburg nach Thüringen flieht und eine Wirtstochter sich in einen Musiker verliebt
Die Männer kommen eine Meile hinter Nürnberg aus einem Feld, zwei Wegelagerer mit spärlichem Bartwuchs, mittelgroß, der eine bewaffnet mit einer Radschloss-Arkebuse, der Hahn ist gespannt. Er richtet sie auf Veit. Der andere greift den Pferden in die Zügel, die ohne den geringsten Widerstand den Karren von der Straße ins Feld ziehen. Veit muss absteigen und vor dem Gewehrlauf knien, während seine Söhne, zehn und vierzehn Jahre alt, vor Angst zitternd, dem anderen Mann helfen, die Kisten und Säcke zu durchwühlen. Inzwischen ist ein dritter Mann erschienen, mit Degen bewaffnet, der ein Stück weiter Schmiere steht, ob niemand von der Straße her kommt. Aus den besten Sachen machen sie ein Bündel, auch Veits Geldbeutel nehmen sie, enttäuscht über den Inhalt. Die paar Instrumente interessieren sie nicht. Als sie den neuen Mantel finden, den er sich gerade erst hat machen lassen, stellt sich heraus, dass er beiden zu lang ist, sie werfen ihm das schwere Tuch vor die Füße. Ein so schweres Tuch, dass sie Verdacht schöpfen. Doch als sie nachsehen wollen, gibt der Mann mit dem Degen Laut, er hat eine Staubwolke gesehen, Reiter vielleicht; sie schultern ihre Beute und schlagen sich in die Büsche. Als Veit und seine Söhne eine Woche später mit heiler Haut ihr Ziel erreichen, ist ihnen das noch immer höchst gegenwärtig, aber jedes Mal, wenn sie sich davon erzählen, wächst die Erleichterung, bis zum Lachen.
Es hätte auch anders kommen können, ganz anders. Die Reise hätte hier enden können. Oder gar nicht beginnen müssen. Veit Bach hätte die Risiken, die eine Reise von 100 Meilen oder 740 Kilometern durch das Mitteleuropa des Jahres 1591 mit sich bringt, vermeiden können. Er hätte Pressburg nicht verlassen müssen, nicht sein Geschäft verkaufen, die vom Vater übernommene Bäckerei, nicht das nötige bewegliche Hab und Gut auf einen Pferdekarren packen und die Münzen in den neuen Mantel einnähen lassen, nicht den beiden Söhnen eine so weite Reise zumuten. Es hätte sich zumindest aushalten lassen in Pressburg, so viel ist sicher, auch wenn sonst kaum etwas sicher ist über die lange Reise des Veit Bach. Schon dass sie in Pressburg beginnt und in jenem Jahr, ist nur durch Indizien einzugrenzen. Mit Wegelagerern musste dabei gerechnet werden. Ein bewaffneter Überfall, wie er dem Komponisten Claudio Monteverdi 1613 in Norditalien widerfuhr, präzise in einem Brief geschildert, ist im Süddeutschland von 1591 nicht minder denkbar. Dabei sind das Jahrzehnte, in denen man sich noch «in der Ruhe des Rechts», wie Günter Barudio die Lage umschreibt, durch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation bewegen kann. Aber für Veit Bach war es nicht mehr auszuhalten in Pressburg, aus mehr als einem Grund, und so sind er und seine Söhne Caspar und Hans auf ihrem vollgepackten Karren an einem Sommermorgen die lange Gasse entlanggerollt in das tunnelartige, finstere, wie ein Fass gewölbte Weidritzer Tor nach Westen und am Fuß des Burgbergs hinaus, durch die schmale Vorstadt, rechts aufsteigend der weinbepflanzte Hang hinauf zum Hrad und dahinter die Karpaten, links die Donau, an der entlang es nach Wien geht.
Die letzte von hundert Meilen ist nach etwa drei Wochen erreicht, sie reisen entlang der Apfelstädt, «Apfelstet flu.», wie es auf einer Karte jener Zeit bei «Waichmar» steht, vorher an der Ohra, durch «Ordruff». Sanftes Land, schwarz-weiße Häuser, auf nicht zu hohen Bergen hier und da eine Burg, kleinteilig alles, nicht zu vergleichen mit den Ausläufern der Karpaten, die Pressburg umfangen und an die breite Donau drängen, wo auf einem Felsen der breitschultrige, viertürmige Hrad über der Stadt sitzt, nicht vergleichbar mit allem, was Vater und Söhne sahen auf den zwölf Meilen bis Wien und weiter über Linz die Donau entlang bis Regensburg, in Nürnberg dann auf der alten Handelsroute, die bis nach Hamburg führt und auch manchen Wegelagerer ernährt. Über Bamberg, Coburg, Eisfeld, Schleusingen haben Veit, Caspar und Hans ihren Pferdekarren auf die Waldstraße über den Thüringer Wald gelenkt, die über Wandersleben nach Erfurt zur via regia geht. In Oberhof haben sie sie verlassen nach Norden auf die uralte Meinboldestraße, auf der schon Bonifatius nach «Ordorp» kam, nach Ohrdruf. An vier Mühlen vorbei, seit sie am Nachmittag die Ohra verlassen haben; jetzt erscheint links der Apfelstädt die Hammermühle.
Sie wundern sich über die Frauen, die nah und fern auf den Feldern knien, immer vier oder fünf um einen zwei Fuß hohen grünen Haufen, in langen Röcken, helle Tücher um den Kopf gebunden, die Unterarme frei. Was tun die da? Ernten sie? Es sieht aus, als formten sie Semmeln, findet Hans, der Zehnjährige, und Bäckermeister Veit hält an und steigt ab, um sich zu erkundigen. «Semmeln? Ach, Brietchen!», sagt eine lachend. «Joa, farr eine von dann Brietchen do krieste e gaanzn Sack voll rechtche Brietchen. Ihr kommt wu von wiet haar, wenn ihr das nech kennt? Oaber gegass dörft ihr nech zuvääl dodavoon, das is nämlich e Zaubermettel.» Sie hält ein grünes Bällchen hoch, es ist etwas feucht, gerade so, dass es nicht auseinanderfällt, und Veit sieht, dass es aus Blattresten besteht. «Weid!», sagt sie. «Färberweid, do drues machn me blaue Farbe!» Die Waidkaufleute seien im nahen Gotha die reichsten überhaupt, sie hätten ein Kaufhaus gebaut, prächtiger als ein Schloss. Dann setzt sie das Bällchen behutsam auf einen wachsenden Hügel weiterer Bällchen, zum Trocknen. Es ist Mitte Juli und kein Regen in Sicht. «Ihr kommt wu von wiet haar?», wiederholt jetzt eine andere, so spreche ja keiner von hier! Pressburg, sagt Veit, der sie mit Mühe versteht. Von Pressburg hat sie noch nie gehört. Wien, ja. Sie guckt misstrauisch, und Veit beantwortet ihre unausgesprochene Frage: «Wir sind keine Katholischen. Darum kommen wir her.»
Das ist sehr vereinfacht gesagt. Seit einem Menschenalter, seit der Schlacht von Mohács 1526, lebt man in Pressburg im Schatten des bis nach Kreta hinabreichenden Osmanischen Reiches, dessen Grenze 80 Kilometer südöstlich von Pressburg verläuft, keine elf Meilen donauabwärts. Auf dem Papier herrscht ein labiler Stillstand, der im Belieben der Türken steht. Der nächste Krieg mit ihnen, der fünfzehn Jahre dauern wird, liegt schon in der Luft. Sie drängen die Donau empor, Gran haben sie längst. Wien fehlt das Geld für sein aus allen Abenteurern Europas bestehendes Mietheer, Kaiser Rudolf im fernen Prag ist zur hilflosen Gestalt geworden. Seit die alte ungarische Hauptstadt Ofen (heute bekannt als Buda, Teil von Budapest) unter türkischer Verwaltung steht, seit 1536 also, ist Pressburg das Zentrum des nicht besetzten Teils, der etwa dem Gebiet der heutigen Slowakei entspricht. Gerade deshalb haben es die Anhänger der Reformation hier schwerer als in allen anderen Städten Ungarns, zudem ist der königliche Vogt in Pressburg kein anderer als der aus Gran vertriebene Erzbischof Kutasy. In den Händen der oberen Geistlichkeit liegen das Finanzwesen und die Administration, unter bizarren Vorwänden werden ungarische Adlige ihrer Güter beraubt, vorzugsweise Protestanten.
Die haben es schon als Erleichterung empfunden, als 1581 der evangelische Geistliche Andreas Reuß ins nahe Ratzersdorf zog, um dort in der Kirche zu predigen – in Pressburg sind solche Gottesdienste nur in Privathäusern möglich. Viele Anhänger der Augsburger Konfession pilgern allsonntäglich zu Reuß nach Ratzersdorf, auch Veit und seine Familie haben das sicher getan. Wer freilich dort gesehen wird, wer das Heilige Abendmahl dort auf reformierte Weise genießt, muss in Pressburg mit Schwierigkeiten rechnen, obwohl der Magistrat selbst die Lutheraner unterstützt. Dazu noch beginnen sich die Protestanten untereinander zu spalten, zur Freude der von Rom aus agierenden Jesuiten. Die meisten Magyaren sind Anhänger des helvetischen Reformators Calvin und den deutschsprachigen Lutheranern fremd in ihrer Strenge. Gleichwohl sind das alles zu dieser Zeit nur erst Spannungen, mit denen es sich leben lässt – schon lange werden in Pressburg keine Protestanten mehr gefoltert und verbrannt wie zu der Zeit, als Veits Großvater dorthin kam. Es ist noch etwas anderes, was Veit fortgetrieben hat, über Wien und Nürnberg bis hierher, nach Thüringen.
Wien, sagt die Frau, das sei sicher etliche Tage weit weg? «Ein paar Wochen», sagt Veit, «drei Wochen mit diesem Wagen.» «Das glaubt dech kei Mensch!», ruft sie. «Wu wollt ihr henn?» «Nach Wechmar.» «Wachmar! Bi ons!?!» «Zu UNS», sagt Veit, «mein Großvater ist da geboren, der war ein Bach, wie ich. Veit Bach.» Sie kennen den Namen. Ein Lips Bach sei Wegemeister hier und vor kurzem sei Hans Bach gestorben, sein Vater, betagt, über sechzig Jahre geworden, der hatte die Fischerei im Mühlgraben. «Der war wohl mein Onkel. Da habt ihr noch einen Hans», er streicht ihm über den Kopf, «und der hübsche Kerl da ist mein Caspar, und …» Stumm und in sich fährt er fort: «… und die Schönste da, das ist meine Marie.» Er sieht seine Frau vor sich, das schmale Gesicht, über dessen Wangen sich mitunter feine Röte zog wie Morgenröte, er war sehr glücklich mit ihr, auch unglücklich, als sie zwei Kinder verloren, die nach Hans und Caspar kamen. Als Marie im vorigen Winter am Kindbettfieber starb, gleich nach ihrem kleinen Mädchen, mit 37 Jahren, wurde für Veit die ganze brodelnde Stadt Pressburg zum Kirchhof. Alles tot, alles leer, die Berge wie Mauern, der Himmel eng und kalt. Es traf ihn so, dass er nichts fühlen konnte, bei allem Gottvertrauen.
Veit denkt nicht in Begriffen wie «Glück» und «fühlen», das tut im Jahre 1591 eine winzige, reiche Handvoll von Fürsten, für die in Italien Madrigale komponiert werden, die freilich schon den Norden inspirieren, und William Shakespeare in London tut es, von dem Veit sein Lebtag nicht erfahren wird, und Michel de Montaigne denkt auf seinem Schloss im Périgord darüber nach, aber kein deutscher Bäckermeister. Natürlich fühlt er, natürlich hat er Lieder. Die ganze Reise über, hundert Meilen weit, war seine Seele ruhig, hinter aller Angst und Ungewissheit. Jetzt, vor dieser derben Arbeiterin mit dem breiten Gesicht, kurz vor dem Ende der Reise, springt es ihn an, zerreißt es ihm das Herz, und im selben Moment hört er sich heiter sagen: «Ich bin Bäckermeister, vielleicht kann ich euch Semmeln backen, Brietchen!, die man essen kann.» «Dar Isser kann bestemmt enn gebruch», sagt sie, «klopf e mo bi dann oan.»
«Was mahlt der da?», fragt Caspar und blickt zu einem mit breitkrempigem Hut, der ein Pferd um eine steinerne Mühlpfanne trotten lässt, einen aufrechten, gezähnten Mühlstein im Kreis bewegend, der auf dem unteren Stein rollt, mit Achse in einfachem Gerüst befestigt. Das sei der Müller für die grünen Brietchen, sagt die Waidfrau. Da werden die zuvor in der Apfelstädt gewaschenen, angewelkten Blätter der isatis tinctoria zu Mus gemahlen, das der Mann immer wieder aus der Mühlpfanne kratzt und auf einem Haufen fest zusammenschlägt. Die schon begonnene Gärung setzt ein sonderbares Aroma frei, später, bei den Färbern in den Städten und an ihren Flüssen, wird es bestialisch stinken, aber jetzt und hier, in der späten Julisonne, vermischt mit dem Duft der Felder, hat der Geruch für Veit etwas von neuer Welt. Wenn selbst die Luft anders riecht, hat er das für ihn tot und leer gewordene Pressburg, die drohenden Osmanen, die Würgehand Roms, die bitteren Gefolgsleute Calvins hinter sich gelassen, aber nicht seine Marie. Und für seine Söhne, die so viel von ihr haben, kann hier die Zukunft beginnen.
Mein Gott, hier wird mein Herze sein:
Ich öffne dirs in meines Jesu Namen;
So streue deinen Samen
Als in ein gutes Land hinein.
Mein Gott, hier wird mein Herze sein:
Lass solches Frucht und hundertfältig bringen!
O Herr, Herr, hilf!
O Herr, lass wohlgelingen!
Diese Verse seines Zeitgenossen Erdmann Neumeister hat Johann Sebastian Bach rund 120 Jahre später komponiert, als recitativo accompagnato in einer Kantate, mit zwei Flöten und vier Bratschen zum basso continuo altertümlich instrumentiert für die Zeit. Man kann es hören, als begebe er sich zurück in die frühesten Tage seiner Familie, die hier hunderfältig gedeihen wird.
Zum zweiten Mal an diesem Januartag klingele ich am alten Schulhaus, das am Kirchplatz steht. Vorwinde eines Orkans jagen Wolken wie im Zeitraffer über Wechmar. «Er müsste da sein», hat mir die Dame im Museum versichert und die richtige Telefonnummer herausgesucht, denn die in meinem Block war falsch. Niemand hat abgehoben. «Er müsste da sein», hat am Abend vorher auch der Oberbürgermeister von Gotha gesagt, der ihn bestens kennt. Dann ist er gleich aufgesprungen und zu seinem großen Schreibtisch geschritten, um mich anzumelden, aber keiner nahm ab. Es darf ja auch nicht zu einfach sein, einen Mann zu treffen, der in direkter Linie von Johann Sebastian Bach abstammt, dem Ururenkel des Veit, und sich in dem Alter, in dem Bach starb, entschloss, mit seiner Frau hierherzuziehen, nach Wechmar, dahin, wo alles begann. Hier bin ich von der Haltestelle des 354ers, der von Gotha bis nach Arnstadt fährt, durch die menschenleere Brückstraße über den Fluß gegangen, vorbei an einer gewaltigen blau-weißen «Kondombox», einer Errungenschaft, die zu spät kam, um Europa seine musikalischste Familie und der Welt einen ihrer größten Komponisten zu ersparen. Und an der Kurve eine Treppe hoch …
Über Veits Frau, die Mutter seiner Söhne, wissen wir nichts. Weder die spärlichen Wechmarer Akten noch die grundlegende Quelle kennen sie. Marie? Der Name steht hier für die ungenannten Frauen nicht nur in der Geschichte der Bachs, für alle Menschen, die der Geschichte nicht erreichbar sind oder durch sie überschrieben werden. Unsere Quelle ist eine Abschrift von jenem guten Dutzend Seiten, auf denen der Thomaskantor 1735 die erste jemals verfasste Genealogie einer Musikerfamilie hinterlassen hat. 53 männlichen Personen und ihren Familien sind die Einträge gewidmet, rund 130 Jahre umfassen sie. Schwungvoll, kraftvoll, schräg nach rechts gelehnt, beginnt das unter der Überschrift «Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie.» mit «No. 1»: «Vitus Bach, ein Weißbecker in Ungern, hat im 16ten Seculo der lutherischen Religion halben aus Ungern entweichen müßen. Ist dannenhero, nachdem er seine Güter, so viel es sich hat wollen thun laßen, zu Gelde gemacht, in Tëutschland gezogen; und da er in Thüringen genungsame Sicherheit vor die lutherische Religion gefunden, hat er sich in Wechmar, nahe bei Gotha niedergelaßen, und seine Beckers Profession fortgetrieben.» So weit der Beginn der Notiz zu Veit in jener kraftvollen Schrift, die nicht etwa die von Johann Sebastian Bach ist, sondern die seiner Enkelin. Anna Carolina Philippina Bach hat das verschollene Original kopiert, Tochter des Carl Philipp. Und ihre Bückeburger Cousine Anna Philippina Friederica ist jene Enkelin des Thomaskantors, ohne die es den jetzigen Besitzer der Alten Schule nicht gäbe. Ich klingele wieder.
Veit und seine Söhne nähern sich Wechmar. Keine Autobahn schneidet ihnen den Blick auf das Dorf ab, das mit seinem gedrungenen Kirchturm auf einer Anhöhe rechts von ihnen sichtbar wird, südlich des Flusses. Und links von ihnen ein einzelnes Gehöft, massig, wie eine kleine Festung, davor Pferde und Wagen. «Ein Ausspann, Vater», ruft Caspar, «da können wir unterkommen und essen, mich hungert!» Veit blickt zum Dorf hoch, nach rechts, zu dem gegenüber vom Ausspann eine steinerne Brücke führt, von einer Schranke versperrt. Dort oben will er heute noch absteigen und ausspannen, nicht unten, vor einer Schranke, wie ein Fremder vor dem Dorf, aus dem sein Vater kam. Irgendwo werden sie schon unterkommen, beim Vetter oder bei diesem Isser, Eißer, dem Bäckermeister. Der Gasthof hier am Fluß gehört den Grafen von Gleichen, den Lehnsherren des Dorfs. An der steinernen Brücke muss Veit Zoll entrichten, dann fahren sie über den Fluss, leicht bergauf, links eine Kurve, wieder rechts, auf dem Marktplatz hält er an, und gleich finden sich ein paar Bauern ein. Er fragt nach Lips, seinem Vetter, wie er vermutet, so wissen sie schon, dass der hochgewachsene Mann nicht ganz fremd ist, trotz seiner merkwürdigen herben Sprechweise, und macht sich zu Fuß auf die Suche nach Lips’ Haus, während die Söhne beim Wagen bleiben. Teppichwirker sei Lips, haben sie ihm gesagt, aber Bauer ist er wohl auch. Der Vater sei noch auf dem Feld, die Mutter krank, sagt ihm ein Knabe von vielleicht sechs Jahren, der ihn so scheu ansieht, dass Veit nicht wagt, sich als entfernter Großonkel vorzustellen, und sagt, er werde morgen wiederkommen. Müde geht er zurück, die Schatten der Häuser reichen jetzt über die Straße, am Markt sieht er seine Söhne mit einem untersetzten Mann seines Alters. Dem gehört das Haus, vor dem sie angehalten haben, es ist der Oberbäcker Hein Eißer, und während der zehnjährige Hans still danebensteht, hat Caspar, der Vierzehnjährige, in seiner munteren Art den Bäcker so eingenommen, dass sie hier für heute unterkommen. Und nicht nur für heute.
Wie es wirklich begann, welcher Veit Bach wann nach Wechmar kam, ob überhaupt ein Veit der Vater oder doch der Großvater jener Brüder Hans und Caspar war, welche der in Wechmar schon ansässigen Bachs mit den Neuankömmlingen wie verwandt waren – darüber weiß man noch immer nicht viel mehr als das, was der Thomaskantor selbst aus seiner Familie erfuhr. Bach kam nicht aus einem Adelshaus, in dem die präzise Überlieferung der Familiengeschichte politisch überlebenswichtig war. Er trug für die frühe Zeit zusammen, was man sich in der Familie erzählte, und zumindest die Kirchenbücher in Wechmar beginnen erst im Jahre 1618, die aus der Zeit davor sind verloren. Dazu kommt noch der Hinweis des Gehrener Johann Christoph Bach im Jahre 1727, die «weltbekannte Bachsche Familie» sei in Wechmar schon im Jahre 1504 anzutreffen. Das alles wird nicht übersichtlicher durch die Tatsache, dass der Name Bach in Thüringen schon im Mittelalter auftaucht.
Aber da ist der Hinweis auf Ungarn. «Ungern», schreibt Johann Sebastian in barock freier Orthographie. Damit meinte er das nicht von den Osmanen besetzte Gebiet, die jetzige Slowakei. War dorthin ein und derselbe Veit von Wechmar aus gezogen und zurück? Hätte er dann Zeit gehabt, «Güter» anzusammeln, genug für einen Neubeginn in Thüringen? Das schon. Da seine Söhne um 1580 geboren sein müssen, konnte er vom Jahrgang 1555 sein, wäre mit 20 Jahren ausgewandert – nur: warum? –, hätte in gut fünfzehn weiteren Jahren sich etablieren und in den 1590ern zurückkehren können. Dazu passt aber nicht, dass sich in der Familie nur die Legende hielt, er sei ein «Weißbecker aus Ungern». Das würde man über einen gebürtigen Thüringer kaum sagen. Doch warum wandert er aus dem Gebiet der jetzigen Slowakei, in dem er geboren sein muss, ausgerechnet nach Wechmar aus, anstatt beispielsweise von Pressburg nach Osten ins protestantisch beherrschte Kaschau zu ziehen? Warum legt er mit Mitte dreißig 740 Kilometer zurück, um sich in einem Örtchen von 600 Einwohnern anzusiedeln und nicht – wenn es schon das Reformationsgebiet sein soll – in einer auch für seine Söhne chancenreicheren nahen Stadt wie Gotha oder gar im blühenden Erfurt? Es muss Verbindungen ins Dorf gegeben haben.
1526 wird in Wechmar die Reliquie des Sankt Vitus aus der ihm geweihten Kirche geholt und davor mit dem Sühnekreuz verbrannt. Ist die Vorstellung abwegig, dass nicht alle darüber jubelten? Dass es Angst machen konnte, wie die alte Welt in Flammen aufging, unmittelbar nach den blutigen Bauernkriegen, dass es Menschen gab, die sich nicht von der sie umgebenden Mehrheit mitreißen ließen? Dass schon hier ein Bach den Trotz entwickelte, den wir in der Familie immer wieder finden? So, wie wir die Bachs wahrnehmen, müssen sie seit Menschengedenken lutherisch gewesen sein – aber das waren sie ebenso wenig wie der Reformator selbst. Das Gedankenspiel sei erlaubt, dass Veit Bachs Großvater mit Anfang zwanzig vor der Reformation floh, der sich sein Enkel dann unter ganz anderen Umständen zuwandte, und Wechmar gen Pressburg verließ, schon damals eine katholische Hochburg im sonst recht reformationsfreudigen Ungarn, wohin tatsächlich eine weitere Spur führt.
1780 nennt der Pressburger Schriftsteller Matthias Korabinsky, der eine Abschrift der Bach’schen Familienchronik besitzt und nicht nur deswegen vermutlich Kontakt mit dem auch in österreichischen Kreisen gefeierten Carl Philipp Emanuel Bach hat, Veit ohne weiteres einen «Weißbeck von Preßburg» und verweist auf etliche deutsche Familien mit Namen Bach, die noch immer in der Stadt leben. Die Bachforscher waren später akribisch genug, um in Stadtarchiv und Zunftbüchern des heutigen Bratislava, Hauptstadt der Slowakei, herauszufinden, dass ab 1580 auffallend viele Bäcker in der Stadt Bach heißen und teils Immobilien in bester Lage besitzen. Bis ins 19. Jahrhundert backen diese Bachs an der Donau, und es scheint, als sei hier eine Dynastie erfolgreicher Bäcker parallel zur Musikerfamilie in Thüringen entstanden. 1569 legen die Bäcker von Pressburg ihr Zunftbuch an, das keinen Veit nennt, allerdings schlampig und lückenhaft geführt ist, viele Seiten sind leer.
Hein Eißer führt die Erschöpften hinüber in die Schenke, nachdem sie in seinem Hof den Wagen abgestellt haben. Das Schenkhaus am Markt ist längst baufällig, aber hier brodelt durch die offene schiefe Tür das abendliche Leben der Wechmarer Handwerker und Bauern. Bestimmt zwanzig Männer sind versammelt. Ihr lautes Reden und Lachen überm Bier verstummt, als Oberbäcker Eißer mit dem hochgewachsenen Mann und zwei Knaben die Stube betritt und ruft, hier seien drei, die seien fremd und doch von hier, sie seien von der Familie Bach, der Sohn und die Enkel eines Veit, dessen Großvater vor einem Menschenalter schon von hier nach Ungarn ging, und sie sollten Platz machen für die Weitgereisten, und nach Hein Schmied ruft er, der solle zusehen, was er an gutem Braten noch finde, und gleich eine Kanne Bier bringen. Veit und Caspar finden sich schnell ins wachsende Getöse neugieriger Fragen, die sie oft kaum verstehen. Caspar ist immer schon auf die Menschen zugelaufen wie sie auf ihn, und sein Vater, den die trauernde Sehnsucht nach seiner Frau nicht mehr verlassen hat seit den Minuten am Nachmittag auf dem Waidfeld, taucht gern ein in die dröhnende Geselligkeit zwischen geröteten Gesichtern. Für Hans, den Zehnjährigen, ist alles wie ein Traum, ein wildes Theater nach der wochenlangen Reise, bis er mit roten Wangen auf der Bank einschläft.
Und während der feiste Wirt, Hein Schmied, den Braten hereinbringt, erklären die Wechmarer durcheinander, wer in diesem Ort das Sagen hat. Namen prasseln, die sich die müden Weitgereisten gar nicht alle merken können, von Spitznase, von Weidensee, von Kromsdorf, von Berga und Marschalk, all diese Adelsfamilien haben ihre Güter hier, teils verpachtet. Einer der Männer in der Wirtsstube dient bei Hans Hertel, dem Pächter der Wasserburg, die einmal dem ältesten Geschlecht hier gehörte, denen von Wechmar, die denen von Gleichen bedingungslosen Gehorsam schwören mussten, erzählt er, aber das sei zweieinhalb Jahrhunderte her, und deren Wasserburg durch Heirat an die Familie von Berga ging, und ob sie die Wasserburg nicht gesehen hätten, nur wenige Schritte von hier? Dieses hoch aufragende Bauwerk? Veit denkt an den Hrad auf seinem Berg an der Donau, größer als dieses ganze Dorf zusammen. Die Wasserburg, sagt da ein Älterer verächtlich, vor dem sie besonderen Respekt zu haben scheinen, sie sollten besser die Sägemühle vom Hein Frossen sehen, so eine Maschine sei wichtiger als alles alte Gemäuer. Das, murmelt der Pächtersknecht neben Veit, sage der Obermüller nur, weil er vor Stolz platze, seit ihm der Frossen das Holz für seine teure Bohlenstube gesägt habe, die werde ihm der Kritzmann schon noch vorführen. Ja, das wird er, und die Bachs werden Wechmar und seine Leute bis zum letzten Winkel kennenlernen.
Was Veit aus Pressburg erzählt, denn natürlich fragen sie den Fremden aus, das können sie kaum glauben. Dass man dort, um das Heilige Abendmahl zu genießen so, wie sie es hier tun, die Stadt verlassen müsse, eine Stunde weit bis nach Ratzersdorf, oder aber Freund des Grafen Kollonich sein, der in Pressburg ein Haus, beinahe schon Schloss mit Graben und Zugbrücke besitze und einen evangelischen Hofgeistlichen habe, der dort im Schutze gräflicher Macht predige, dass einem christlichen Paar die Trauung verweigert worden sei, weil man es in Ratzersdorf beim Gottesdienst gesehen habe. Dass einem keine zwei Tagesmärsche weiter schon die Türken an der Donau entgegenkämen. «On dinn Wieb?», fragt Hein, der Bäcker, «und dein Weib?» Da hält Veit die Hände vors Gesicht, und sie verstehen, werden leiser und stellen keine Fragen mehr.
«100 Sitzplätze» und «7 schöne Doppelzimmer» verheißt heute das Schild, auf dem der «Goldene Löwe», Café, Restaurant und Pension, schon in der Straßenkurve beworben wird, die zum Marktplatz hochführt. Oben quietschen die Schilder am Wappenbaum im Januarwind, und mehr ist nicht zu hören auf dem leeren Platz. Das stattliche Haus, sanftgelb gestrichen, eine Uhr auf dem Dach, steht hier seit 1767 anstelle der Gemeindeschänke, und überhaupt gibt es kaum noch eins von den Gebäuden, die die Bachs hier sahen, bewohnten, in denen sie arbeiteten. Auch die Bäckerei sah anders aus, als ihr Besitzer dem Veit und seinen Söhnen dort Wohnung und Arbeit gab. Der Backofen stand frei gegenüber der Schänke, das Haus war kleiner, es wurde erst 1627 in den Bau integriert, der jetzt am Markt dem Wind trotzt, so langgestreckt wie gedrungen, mit dem wuchtigen Fachwerk im ersten Geschoss, der «Thüringer Leiter». Es blieb immer eine Bäckerei, drei Jahrhunderte hindurch, bis in die 1960er Jahre.
Es ist der Sohn eines Polsterers aus Wechmar, der ein Museum daraus werden ließ. 1966 geboren, stöbert Knut Kreuch schon mit vierzehn Jahren leidenschaftlich in der Geschichte seines Dorfs, mit achtzehn fordert er die zuständige DDR-Behörde auf, im einstigen Backhaus endlich ein Museum für die Bachs einzurichten. «Alle gingen gern dorthin, weil es die Fleischerei des Dorfes war, man kriegte auch schön was unterm Ladentisch bei Ede, so hieß der.» Man habe ihm dann mitgeteilt: «Schön, dass sich junge Leute mit Geschichte beschäftigen, aber die Versorgung der Bevölkerung ist wichtiger.» So erzählt es mir Knut Kreuch am Abend vor der Fahrt nach Wechmar oben im Rathaus von Gotha, denn dort amtiert er jetzt als Oberbürgermeister. Er ist nicht groß, aber um so energischer, zum Rückzug neigen bei ihm nur die knappen schwarzen Haare auf dem Kopf, zu dunklem Anzug und weißem Hemd trägt er eine rot-weiß schräggestreifte Krawatte. Die Passage aus dem «Ursprung» zitiert er auswendig und rasend schnell, nur bei Bachs Worten «hat er sich in Wechmar nahe bei Gotha niedergelassen» drosselt er das Tempo nachdrücklich.
Mit der deutschen Einheit ging das Backhaus an den Altbesitzer zurück, und von dem konnte es die Gemeinde kaufen. Seitdem ist es als «Stammhaus der Bachs» die größte Attraktion des Ortes. Im Erdgeschoss hängt der große Namensbaum, den eine freundliche ältere Dame aus Wechmar erklärt. «Die Mädchen hat man alle weggelassen», sagt sie nüchtern. Oben gibt es ein Foto von 1929, da heißt die Bäckerei «Ludwig» und hat eine Persilreklame neben dem Eingang, womöglich an eben der Stelle, an der bis zu diesem Jahr die erste Gedenktafel hing, noch aus der Kaiserzeit. Die fand man 1997 drinnen im Obergeschoß, als Ofenblech am Schornstein auf den Fußboden genagelt. So schnell wirft man in Wechmar nichts weg, auch wenn sich die Zeiten ändern. Karajans Aufnahme der h-Moll-Messe von 1966, in der Box der Deutschen Grammophon, hat noch einen Platz hinter Glas, zusammen mit einer Mandoline und einer Maultrommel. Und natürlich gibt es auch eine Vitrine, in der man Zistern sehen kann, altertümliche Zupfinstrumente. Denn damit begann die Musik der Bachs.
Für Johann Sebastian Bach stand fest, dass «Weißbecker» Veit, die Nummer 1 seiner Genealogie, nicht nur lutherisch, sondern auch musikalisch war. In seinem «Ursprung» fährt er fort: «Er hat sein meistes Vergnügen an einem Cythringen gehabt, welches er auch mit in die Mühle genommen, und unter währendem Mahlen darauf gespielet. (Es muß doch hübsch geklungen haben! Wiewol er doch dabey den Takt sich hat imprimieren lernen.) Und dieses ist gleichsam der Anfang zur Music bey seinen Nachkommen gewesen.»
Veit besaß also eine Zister, ein Zupfinstrument der Renaissance mit vier Doppelsaiten. Dass er im Mühlenrasseln gelernt haben soll, darauf den Takt zu halten, zeigt, dass sein Nachfahr Johann Sebastian wie jeder Biograph zur nachträglichen Sinnstiftung neigte: Die Mühle wird schon eingebaut ins Universum der Musik, fast zum Instrument geadelt, mindestens zum Metronom. Eine erstaunlich moderne Vorstellung, die an Stücke des 20. Jahrhunderts denken lässt, in denen Motoren und Industrieklänge eingesetzt werden. Bachs Interesse an der Mühle ermuntert dazu, Musik und Realität zu verbinden. Das gelingt den Wechmarern des Jahres 2000 buchstäblich mit der Axt in der Hand.
Zuerst hatte Kreuch herausgefunden, dass es Verbindungen zwischen den Eißers und den Bachs gab und dass Familie Eißer seit 1600 auch die Obermühle besaß. Dort also muss Veit gezupft und gesungen haben. Die ältesten erhaltenen Teile sind zwar offenbar erst von 1685, aber die stolzen Wechmarer beschließen trotzdem, das marode Mühlengebäude als Attraktion zu erhalten. Zu der Zeit ist der Schlosser und Betriebswirt Kreuch ihr Bürgermeister. Das Wohnhaus soll abgerissen werden. «Als das schon teilweise abgebrochen war, kriegte ich ’n Anruf, da hieß es, komm sofort in die Mühle, da is’ was.» Einem Arbeiter ist die Axt in der Wand stecken geblieben. Die ist ganz aus Holz, «es kamen riesige Balken zum Vorschein. Stopp, hab ich gesagt, was machen wir jetzt? Das Denkmalamt anrufen!» Es sind Bohlen aus Tannenholz, sehr genau gesägt, fast alle in identischer Breite und Höhe, die eine ganze Bohlenstube bilden, eine Thüringer Spezialität. Wer sich zu Veits Zeit so etwas leisten konnte, ließ die Bohlen extra ein wenig aus dem Haus ragen. Die bei der Mühle können auf 1585 datiert werden, mithin eine der frühesten Thüringer Sägegatterarbeiten, mit Wasserkraft auf Maß gebracht. In dem Jahr also haben die Kritzmanns die Bohlenstube an ihre Mühle anbauen lassen, die sie 1600 den Eißers verkauften. Jetzt steht der Bau perfekt saniert und etwas einsam am Rand des Dorfes.
Veit hat seine Zister schon in den Tagen nach der Ankunft ausgepackt und Caspar seinen lederbezogenen Zink und Hans seine Flöte, und sie sind mit ihrer Neigung nicht allein. «Es ist sonderlich heut bey Tage in Thüringen / da die Bawren Knechte und Jungen / ob sie schon die Woche lang hinder dem Pfluge hergehen / doch Sonn- vnd Festtage vor das Polt treten / und so wol Instrumentis als vocibus vivis musicieren / machen Federhansen / wo nicht pronunciatione jedoch arte weit zuvor thun …» 1626 wird so die musikalische Praxis jenseits der Profis beschrieben, betrieben wird sie schon länger. Viele Bauern in Thüringen singen und spielen demnach besser als mancher Gelehrte, und Noten lesen können sie auch. Das passt schlecht zu der gängigen Vorstellung, es habe im deutschsprachigen Raum einen breiten Strom mündlich überlieferter Volkslieder und Volksmusiken gegeben, denen dann die Komponisten das Material mehrstimmig gesetzter Lieder für die gehobenen Stände entnahmen, während weniger betuchte Leute schlichte Weisen aus dem Gedächtnis sangen.
Besonders den Musikologen des «Dritten Reiches» gefiel die schon von den Romantikern gepflegte Vorstellung einer «Kernweise», die aus dem Volk heraufstieg. Der «Traum vom kollektiven Gedächtnis eines Volkes», aufgehoben in «amorpher Mündlichkeit», ist erst in jüngsten Jahren den Belegen für eines der größten Geschäfte der «Galaxis Gutenberg» gewichen: Es gab eine kommerzielle Popularmusik, auf die schon Martin Luther traf, als es um die Konzeption neuer geistlicher Gesänge ging, und die in der Regel vierstimmig war. Das «Volkslied» für eine Stimme mit Begleitung geht ihr nicht etwa voraus, es ist eine ihrer reduzierten Formen. Lieder werden im 16. Jahrhundert in Abertausenden Flugschriften verbreitet, in Einblattdrucken oder mehrseitigen Heftchen, die für die meisten erschwinglich sind, wenn sie auch nur die Texte zu Liedern bieten, die von fahrenden Musikanten vorgetragen werden – und sich auf mehrstimmig Komponiertes beziehen. Die Stimmen dazu sind seit rund 1500 gedruckt zu haben, vorerst im aufwendigen Mehrphasendruck.
In den 1530ern, als mit besserer Technik der Notendruck billiger wird, folgt einer gebundenen Liedersammlung die andere, als wohl populärste «Ein außzug guter alter und newer Teutscher liedlein / einer rechten Teutschen art / auff allerley instrumenten zubrauchen / außerlesen». So hat der Nürnberger Komponist und Musiksammler Georg Forster 1539 überschrieben, was schließlich ein Schatz von 380 Sätzen von 50 Komponisten geworden ist, bis 1565 in mehreren Auflagen erschienen. Diese «Teutschen Liedlein» sind mehrstimmige Sätze von Heinrich Isaac bis zur Gegenwart. Dass solche Sammlungen sich nicht an Experten oder Gebildete wenden, zeigt das Vorwort zum ersten Liederbuch des Hans Ott von 1534: «Es hat auch diese kunst den vortheil, das gleich wie ein grober pawer [Bauer], wie wenig er des gemels [Gemäldes] grundt verstehet, dannoch ein wolgemacht bilde gern und mit lust anschawet.» Damit auch der Bauer oder Bäckermeister in den Genuss dieser Gesänge kommen kann, muss er sie allerdings selbst anstimmen. Die Popmusik der frühen Neuzeit setzt Notenkenntnisse weit größerer Bevölkerungsteile voraus, als man sie vierhundert Jahre später findet.
In einem Dorf wie Wechmar kann man solche Noten nicht erwerben, wohl aber in einer Stadt wie Pressburg oder Gotha, und in Wechmar gibt es zudem die Spielleute in der Familie Eißer, die auf populäres Repertoire angewiesen sind. Man kann es mehrstimmig singen oder nur den «Tenor» oder spielen, «auff allerley instrumenten». Auf einer Zister wie der von Veit Bach ist polyphones Spiel kaum möglich, und das Instrument beginnt darum gerade aus der Mode zu kommen, aber natürlich kann man auch einen mehrstimmigen Gesang akkordisch begleiten. Veits Söhne Caspar und Hans können auf Zink und Flöte den Diskant und Alt dazu spielen – oder singen.
Ich sag adieu, wir zwei, wir müssen scheiden,
bis auf ein andermal all nähern Umgang meiden,
ich lass bei euch das Herze mein,
dort, wo ihr seid, werd ich auch sein,
und drücket oft auch Not und Pein,
allzeit sollt ihr die Liebste sein.
Vor einem halben Jahrhundert hat Georg Forster das gesetzt. Als Veit es singt und Hans der Stimme behutsam auf der Flöte vorangeht, wissen sie alle, wem das Sehnsuchtslied gilt, denn noch immer hat Veit sich hier keine Frau gesucht. Und sie fragen sich, ob es zu Hans, dem nachdenklichen Jungen, denn passt, dass er hier lernen soll, wie man den Teig anrührt. Als sein älterer Bruder Caspar dann noch auf dem Zink figuriert, steht ein Spielmann der Familie Eißer auf, Bastian vielleicht, und sagt: «Caspar, du gehörst uff’n Turm!» Beim Stadtpeifer in Gotha müsse Caspar in die Lehre gehen.
Für den Türmerdienst, die ursprüngliche Aufgabe der Stadtpfeifer, ist der Zink unabdingbar. Damit werden zu den vollen Stunden Signale geblasen, aber auch Alarm – weswegen gewöhnlichen Bürgern in den Städten das Zinkspiel untersagt ist –, und zu bestimmten Stunden werden Choräle vom Turm «abgeblasen». Aber nur ein Instrument genügt nicht. «Erstlich ist er ein guter trompeter, zum anderen ein guter zinckenbläser, zum dritten geiget er einen guten discant, pfeiffet eine gute querpfeiffe, auff dulcian, auf der quart posaune tenor und alt posaune, in summa auff allerley instrumenten gar perfect.» Was 1607 der Stralsunder Kunstpfeifer Jonas Depensee über seinen Sohn schreibt, lässt verstehen, warum die Zunft fünf Jahre Lehrzeit verlangt und drei Jahre Wanderschaft.
Da Caspar Bach schon 1600 als Stadtpfeifer in Gotha verzeichnet ist, muss er bald dorthin gezogen und in die Lehre gegangen sein, in einer florierenden Stadt. In ihrer Mitte steht seit 1574 eines der prachtvollsten Kaufhäuser Europas, jenes der Waidhändler, von dessen Turm der Stadtpfeifer bläst, unter dessen Dach er mit seiner Familie und den Lehrlingen lebt. Täglich geht Caspar nun an Lamm und Lindwurm vorbei, die als steinerne Reliefs das Kaufhausportal schmücken. Diese Symbole schreiben die Gothaer den Goten zu, die sie für die Gründer ihrer Stadt halten. «Das Lamb die Gotten in ihren Fahnen geführt in Friedens Zeitenn, den Lindwvrm aber wieder ihren Feind in Krieg vnd Streitten», steht da in Versalien zu lesen. Allerdings geht der Name Gotha auf «Gothaha» zurück, «gutes Wasser», obwohl die Stadt an keinem Fluss liegt. Das Wasser in den Gräben, die die gewaltige Stadtmauer breit umschließen, für die Mühlen, die es auch innerhalb der Stadt gibt, das Trinkwasser und das Löschwasser – es kommt aus einem Kanal, der es vom Thüringer Wald herführt, auch aus der Apfelstädt speist er sich.
Es ist ein brodelndes, solides, kleines Zentrum an der Handelsstraße von Frankfurt nach Leipzig, in dem Caspar seine Kunst erlernt. Die Leute sind hier besser angezogen. Die Luft ist geschwängert vom Geruch der Färberwerkstätten, die die Wolltuchmacher beliefern, den Gerbereien, deren Leder von Sattlern, Riemern, Beutlern, Täschlern verarbeitet wird, man hört unablässig Geklirr und Gehämmer aus den Schmieden: Schwerter, Nägel, Nadeln, Schlösser werden hergestellt. Alle diese Handwerker sind in Zünften organisiert, auch die Musiker, außer denen mit «unehrliche instrumenta, als da seyn Sackspfeiffen, Schafsböcke, Leyern und Triangeln», wie sie die Bettler benutzen.
Als ich am Tag vor meiner Fahrt nach Wechmar in Gotha ankomme, auf dem Bahnhof, nieselt es. Die Straßenbahn fährt um den Stadtkern herum, die Befestigung gibt es seit zweihundert Jahren nicht mehr. Am Bertha-von-Suttner-Platz steige ich aus, gehe nach Süden hinein in die Altstadt, es ist so still, dass mir das Geräusch des Rollkoffers peinlich ist. Über die Jüdenstraße, ältestes Gebiet, komme ich zum Augustinerkloster, im Mittelalter gegründet, Luther hat hier 1521 gepredigt. Es gibt ein Seitentürchen mit einem weißen Kasten und einer Tastatur, da tippe ich einen Zahlencode ein, Fach zwei mit dem Zimmerschlüssel springt auf. Das Kämmerchen oben hat zwei Fenster, die in meterdicker Mauer stecken, sofort fühlt man sich geborgen zwischen den Zeiten. Aber hier, per WLAN, erfahre ich, dass an diesem Vormittag in Paris zwölf Menschen erschossen worden sind, bei einem Überfall fanatischer Moslems auf die Redaktion der Satirezeitschrift «Charlie Hebdo». Es ist die Gegenwart, und ich kann es mir nicht vorstellen. Dann gehe ich zum nahen Kaufhaus, das seit langem das Rathaus ist, und wie einst Caspar Bach die Treppen hoch, nicht mehr die alten, und mit Kurt Kreuch sitze ich dann in seinem Amtszimmer im obersten Stockwerk, ungefähr da, wo die Stadtmusiker auch gewohnt haben.
«Umb der Musica willen und gemeiner Stadt zur Ziehr» werden sie angestellt. Der Stolz ist groß im Gewerbe, vorbei die Zeit, als Musiker jenseits der Höfe und Kantoreien nicht mehr Rechte hatten als Gaukler, entlaufene Mönche, Bettler. Sie musizieren bei Bürgermeisterwahlen, Ratsschmäusen, Ratsabschieden, Fürstenbesuchen, Huldigungsmusiken, Wachaufzügen, bei Grundsteinlegungen, Richtfeiern, Schützenfesten, Schulfeiern. Die Bürger dürfen nur Stadtpfeifer für ihre Hochzeiten, Taufen, Begräbnisse engagieren. Sie liefern Tanzmusik, helfen bei der Kirchenmusik, sie spielen den Verurteilten am Galgen das Lied vom Tod. Dafür kann ihr Jahresgehalt um 1600 – die Akzidentien, die zusätzlichen Einkünfte bei privaten Auftritten, nicht gerechnet – bis zu 26 Gulden betragen, was vierzig Schweinen oder einer guten Posaune entspricht. Wer da als Lehrling einsteigt, muss einiges aushalten.
«Im Anfang wurde mir / alle Tage eine Stunde / zugelassen / mich zu exercieren / bis ich ein schlechtes Stück mit machen kunte / und einen rechten Ansatz auf der Posaune bekam. Hernach aber kriegte ich sonsten so viel zu thun / daß ich das Exercitium wohl auff die Seite setzen mußte. Doch hielte der Herr alle Sonnabend / nach der Vesper, eine Exercirstunde / so wohl mit den Gesellen / als mit mir. Wenn ich dann nur eine Note fehlete / so bekam ich ein gantz Dutzt. Ohrfeigen. Das beste war / daß ich singen kunte. Dieses hat mir so viel geholffen / daß ich den Tact wohl in acht nehmen / und meine Stimme zimlich mit weg stümpeln [stümpern] kunte. Wenn dieses nicht gewesen / hätte ich unmöglich auslernen können. Denn mein Lehr-Herr war ungeduldig und verdrießlich / und gedachte die Kunst seinen Jungen mit lauter Schlägen einzubringen.»
So erinnert sich hundert Jahre später ein Dresdner Musiker an seine Lehrzeit. Vielleicht hat Caspar in Gotha mehr Glück mit seinem Meister. Während er lernt und eine Catharina kennenlernt, von der wir wissen, dass er sie 1597 heiratet, vielleicht eine Handwerkertochter, wird Hans in Wechmar vom Vater zum Bäcker ausgebildet, in den letzten Jahren des Jahrhunderts, und wächst heran wie gegenüber die etwas jüngere Wirtstochter Anna, wird zwölf, vierzehn, sechzehn, spielt Flöte zu Veits Zister und gemeinsam mit den Spielleuten, wandert mit seinem Vater auch die eine Meile nach Gotha, wo sie am Stadttor wie alle männlichen Reisenden in ein Fass urinieren müssen, ein Wegzoll, der von den Färbern der Stadt zur Fermentierung des Waid gebraucht wird, und erlebt tief beeindruckt, wie sein großer Bruder, der Lehrling, dort auf dem Turm des Kaufhauses schon einmal die Stunde blasen darf, auf jenem Prachtbau, der später zum Rathaus wird, gebaut mit dem Gold der blauen Farbe, dem Geld der Waidhändler. Vom Gothaer Kantor Johannes Lindemann könnten sie die 1598 frisch gedruckten «Fröhliche Madrigalia und Balletti auch andere liebliche Italienische Gesänglein zu Fünff Stimmen» hören und kaufen. So schwierig ist es in Thüringen nicht, eine «sonderliche Zuneigung zur Music» zu fassen, wie sie Johann Sebastian später seinem Urgroßvater Hans zuschreibt.
Die Reformation hat eine Revolution des Musiklebens in Thüringen und Sachsen mit sich gebracht. Luther ist von allen Religionsbewegern der musikalischste und ein Komponist, dessen fünfzehn Choräle (nicht die gerechnet, für die er auf Modelle zurückgriff) bis heute gesungen werden. Seine Mutter entstammt der musikalischen Dynastie der Lindemanns in Gotha. Schon den Schüler Martin Luther unterstützte mit Kost und Logis eine Bürgerin seiner schönen Stimme wegen, als Erwachsener soll er «eine fein reine Stimme, beides zu singen und zu reden» gehabt haben, er spielt hervorragend Laute und Flöte, gern auch bei Tisch. Als der 27-jährige Augustinermönch 1510 im Auftrag seines Ordens von Erfurt nach Rom reist, macht er zwei folgenreiche Entdeckungen: zum einen die Dekadenz und Korruption der Geistlichkeit, zum andern die Musik von Josquin Desprez, dieses Größten aus dem Burgund, von dem er später sagt: «Josquin ist der noten meister, die habens müssen machen, wie er wolt; die anderen Sangmeister müssens machen, wie es die noten haben wöllen.» Josquins Mehrstimmigkeit vertieft Luthers Überzeugung von der Musik als einem «Geschenk Gottes», das anspruchsvoll realisiert werden muss. Immer wird er auch auf die katholische Kirchenmusik zurückgreifen, mit der er groß geworden ist. Viele hochkarätige Musiker sind unter seinen Freunden.
Den sächsischen Kantor Johann Walter, den er als Hofmusiker auf der Wartburg kennengelernt hat, macht er zu seinem Vertrauten, zum Komponisten der Reformation. Mit ihm erarbeitet er eine Deutsche Messe, ihm schreibt er das Vorwort zum «Geystliche gesangk Buchlein», 1524 in Wittenberg gedruckt: «(…) Vnd sind dazu auch in vier stimmen bracht / nicht aus anderer ursach / denn das ich gern wolte die jugent / die doch sonst sol vnd mus in der Musica vnd andern rechten künsten erzogen werden / etwas hette / damit sie der BulLieder [Liebeslieder] vnd fleischlichen Gesenge los würde / vnd an derselben stat / etwas heilsames lernete / vnd also das gute mit lust / wie den jungen gebürt / einginge.» Womit gemeint ist, dass die unters Volk zu bringenden Choräle attraktiver sind, wenn sie wie die marktbeherrschenden «fleischlichen Gesenge» vierstimmig gesungen werden können. Musik wandert in die Lehrpläne der Schulen, bei deren Lehrern Martin Luther sängerische Fähigkeiten voraussetzt. Während vor der Reformation die Kantoreien an Klöster, Hofkirchen, bischöfliche Kirchen angeschlossen waren – wie die traditionsreichen Leipziger Thomaner und der Dresdner Kreuzchor –, soll nun jede Stadt ihren «chorus musicus» haben, dessen Nachwuchs die Schule liefert.
Im kleinen Wechmar haben sie nun einen großen Mann, der als Pfarrherr die Gemeinde und die Schüler tief beeindruckt. Zwei Jahre nach Veit und seinen Söhnen ist er hier angekommen, eine Berühmtheit, mit 50 Jahren, Verfasser etlicher flammender Traktate. Hans hat schon Respekt vor ihm, ehe er ihn in der Predigt donnern hört und in der Schule als schier allwissend bestaunt. Man zeigt ihm den Mann, wie er vom Pfarrhaus zur Kirche geht, zügig, aber nicht beeilt, hochgewachsen wie Veit, im langen Mantel mit steifer, krempenloser, die Ohren bedeckender schwarzer Kappe, weißer Halskrause und vor allem dem brustlangen Bart unter der gewaltigen Nase: Michael Sachse, einer der furiosesten Polemiker wider die Gegenreformation und Verfasser jenes «Christlichen Zeitvertreibers», der gerade erst erschienen ist und ein Megaseller wird – 35 Auflagen erleben bis 1620 der erste und der nach dessen Erfolg verfasste zweite Teil dieses «Retzelbuchs», das mit Hunderten Fragen und Antworten quer durch die Bibel führt und durch den Alltag.
«Wie vieler Heyrathen», fragt er da, «haben sich bey Brunnen angefangen?» Da ist er schon mitten im Leben, Brunnen sind Zentren, Kontaktbörsen, die Leute holen hier das Wasser, sie waschen Wäsche – auch wenn das in Wechmar neuerdings verboten ist –, man trifft sich hier. Sachse schreibt, wie Abraham «seinen Knecht außgeschickt hatte / seinem Sohn Isaac ein Weib zu freuen»: «Da findet der Knecht die Rebeccam bey eim Brunne. Unnd wiewohl sie ihm unbekandt war / so vernimpt er doch/durch eingebung unnd wunderliche schickung GOttes / das sie es sey / die GOTT seinem Herrn bescheret habe / gibt ihr alsbald ein güldene Spange und zwei Armringe bey dem Brunne / Gen. 24.» Oder wie dann Isaaks Sohn Jakob seine Rahel «auch bey einem Brunnen» findet, «unnd wiewol er vorhin viel Jungfrauen gesehen / jedoch ward sein Hertz allein gegen dieser in ehelicher Liebe also entbrandt / daß er ihrem Vater sieben Jahr umb sie dienete / unnd solche sieben Jahr däuchten ihn als werens eintzelne Tage / so lieb hatte er sie / Gen. 29.» Sachs folgert daraus, durchaus gegen die Praxis, dass die Ehe nicht der Ökonomie folgt: «Hauß und Güter [ver]erben die Eltern / Aber ein vernünfftig Weib kömpt vom HErrn her.» Neugierig durchstöbern die Leute das Inhaltsverzeichnis und finden das Leben gespiegelt. Das Tanzen kommt vor, der Reichtum, das Verbrechen, die Hurerei, die Macht, die verhassten «Pfaffen», sämtliche Zünfte vom Bäcker bis zu den «Geigern und Pfeiffern», für schlechthin alles weiß Sachse mindestens eine Bibelstelle.
Bei Hans bahnt sich nichts am Brunnen an. Aber das Backhaus steht von der Schänke nur einen Katzensprung weit weg. Als er ein Brett voller Brote vom Ofen zum Haus trägt, er mag dreizehn sein, da rast Anna mit einer Freundin über den Platz, lachend, wird von der geschubst, fällt gegen ihn, und er kann das große Brett nicht halten, die Brote fallen, er blickt fassungslos darauf, sagt kein Wort, während Anna sich aufrappelt und weint. Er legt die Brote wieder auf das Brett und geht. Nach einer Woche schreibt er, langsam, sorgsam, wie er es gelernt hat, den ersten Brief seines Lebens, an Anna. Aber sie kann nicht lesen, eine Schulpflicht für Mädchen und Jungen wird hier erst vierzig Jahre später eingeführt. Er liest ihr vor. Es reue ihn, ihr nicht aufgeholfen zu haben, da sie gefallen war. Sie schenkt ihm einen Schmetterling, ausgeschnitten aus dem Rest eines hellblauen, eines kostbaren Stoffs. Mehr nicht. Als Anna vierzehn ist, sieht es ihr Vater gern, dass der Enkel des Niedermüllers ihr Augen macht, Stefan Gläser, eine gute Partie, und längst rennt sie nicht mehr über den Marktplatz, sie wird in der Schänke gebraucht. Hans hat den Schmetterling vielleicht vergessen, als er mit seinem Vater wieder einmal in der Schänke sitzt zwischen den lärmenden Bauern, nun sechzehn Jahre alt. Da ist Anna fünfzehn.
Als sie ihm den Krug hinstellt und er aufblickt, sieht sie die Ferne in seinen Augen, eine blaue Ferne, wie sie sie noch nie sah in den vielen Blicken, die ihr hier schon gefolgt sind. Nichts Forderndes und Werbendes und Prüfendes ist darin, ob er sie überhaupt sieht? Wie er sich bedankt, immer noch mit dem herben Beiklang der Pressburger Redeweise! Stefan Gläser, der auch da sitzt, merkt eher als Hans, dass da etwas geschieht. Was Hans bemerkt, als die ersten Schlucke ihn in die Nähe der Männer um ihn herum heruntergeholt haben und er Anna in der Tür zur Küche verschwinden sieht, ist, dass das rund um ihren Kopf geschlungene weiße Tuch ein paar schwarze Haare sehen lässt und das Kleid ihre Knöchel über den absatzlosen Schuhen. Die spanische Mode hat inzwischen auch die bäuerlichen Stände deutscher Lande erreicht, weniger streng als in Spanien, wo die Füße der Frauen unsichtbar bleiben müssen, und anders als bei vornehmen Bürgerinnen noch mit einer Taille, von der aus sich der Rock nach unten hin glockenförmig erweitert. Aber eine ganz schmale weiße Halskrause trägt auch Anna über ihrem dunklen Kleid, weiß wie die eng anliegenden Ärmel.
Dein Kleider riechen lieblich schön
Wie Spica und Lavendel
wie Rosmarin und Maioran
wie Thymian und Quendel …
Damit weiß die Wirtstochter Anna etwas anzufangen, sie weiß, dass Spica auch Lavendel ist, breitblättriger, und Quendel jener kleinere Thymian, der eine größere Heilkraft hat, bei Kopfweh und Husten und wenn einer etwas Giftiges gegessen hat, besonders viel kann sie aber anfangen mit den ersten Strophen, die sie in der Mühle, wo sie Mehl holt für die Schänkenküche, von sechs oder mehr Männern und Knaben singen hört, von Veit und Hans, zum Beispiel, und Wendel, dem älteren Sohn des Lips, und den Spielmannsverwandten des Bäckers Eißer, wenn sie nicht sogar selbst mitsingt.
Holdseliger meins hertzens trost,
mein Blümlein von der liebe,
dein lieb mich hat aus not erlost
darumb will ich mich ube,
Das ich Je länger Je lieber dich
von hertzen möchte gewinnen,
bey dir mich frewen ewiglich
in deiner liebe brinnen.
Sie weiß wohl, dass der «Holdselige» der Herr Jesus ist, und um ganz sicherzugehen, hat Johann Walter in seiner Sammlung «Das Christlich Kinderlied D. Martini Lutheri» zu dieser Motette noch geschrieben, «obs wol weltlich scheint, wird alles geistlich doch gemeint». So können sie sich reinsten Gewissens dieser sechsstimmigen Hingabe hingeben, 1566 zu Wittenberg gedruckt, dieser erotischen Kräuterlehre voller Balsam und Melisse, jenem «hertzkraut», das Anna dem einen gern geben möchte, den sie mit den andern singen hört:
Ich denke an dich tag und nacht,
von deiner lieb ich singe,
mein seel und geist dein frölich lacht,
für freuden offt ich springe.
Mein höchster schatz, ich bitte dich,
du wölst dich mein erbarmen,
Gib mir dein kuss und hertze mich,
las mich bey dir erwarmen.
Noch immer dreht sich die Sonne um die Erde, und das Leben ist tief mit Religion verwoben. Wenn an den Sonntagen Pfarrer Sachse predigt, ist die Kirche voll, und kein Mann kommt mehr, wie noch vor ein paar Jahren, auf die Idee, während der Predigt draußen spazieren zu gehen oder zu zechen oder gar drinnen zu plaudern. Zu gern hören sie, wie Sachse wider Rom wettert, «die neue Wundergeburt der babylonischen Huren, die Jesuiten, die grobe Sauen, so der Pabst allenthalben als seine treue höllische Apostel aussendet und ihrer in allen Ländern als starker viereckigter Klotze und Stutzen seines wankelnden und sehr knackenden Stuhles gebrauchet!» Besonders empört ihn der Zölibat, mit dem er die Ehe diskreditiert sieht. «Gott schuf sie ein Männlein und ein Fräulein und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erden! Da höret man ja klärlich», ruft der Pfarrer und blickt funkelnd in die Gemeinde, «wozu Gott Mägdlein und Jüngling, Männer und Frauen erschaffen habe, nämlich nicht zu dem Ende, dass man damit alle Stifte und Klöster in der weiten Welt füllen, alle Jünglinge und Männer zu Mönchen, alle Mägdlein und Weiber zu Nonnen machen soll und also ehelos sie in der feurigen Brunst stecken und in greuliche heimliche Sünde und Schande soll fallen lassen, sondern dass sie nach Gottes Ordenung ehelich werden!» Wer aber die eheliche Beiwohnung verdamme, der sei «nicht Freund, sondern Feind der Keuschheit, weil er denen, so sich drinne züchtig und mäßig halten, ihr Lob nimmt. Denen aber, so sich nicht keusch halten können, weil er ihne die Arzenei des Ehestandes raubet, Ursach gibt, in Unzucht und Hurerei zu fallen. Wie dann auch ihre Bischöfe so keusch leben, daß sie kaum mit sechsunddreißig Huren sich behelfen können!»
Da geht ein Raunen durch die Kirche, ein befreites, denn Pfarrer Sachse scheint sie zu kennen, die feurige Brunst, die ihren Weg sucht, er lehnt auch das Tanzen nicht ab, und er warnt davor, die Frauen gering zu schätzen. Von einem Mönch zu Meißen erzählt er, der vor hundert Jahren dem weiblichen Geschlecht so bitter feind gewesen sei, dass er bei der Taufe ein Mädchen ertränkt habe und bald darauf selbst von einer Brücke in die Elbe gestürzt und ersoffen sei. «Wer wünscht, dass alle Weiber ersäuft werden mögen, der ersäuft selber – und geschieht ihm recht.» Würde man Michael Sachse heute einen Hassprediger nennen? Oder einen Aufklärer? Für Veit müssen diese Gottesdienste nach der Pressburger Bedrückung reine Freudenfeuer gewesen sein. Vielleicht haben sie ihn sogar abgehalten, nach Gotha zu ziehen, von wo an manchen Sonntagen auch Caspar kommt. Die Bachs geraten in Wechmar unter den unmittelbaren Einfluss eines der kämpferischsten und wortmächtigsten Lutheraner ihrer Zeit.
Die Musik wird unterdessen von einem Doppelmörder in entlegenste Bereiche der Harmonik geführt. Der italienische Fürst Carlo Gesualdo, der 1590 seine Frau und ihren Liebhaber hat abschlachten lassen unter Anwendung von Messern, Dolchen, Hellebarden, Schwertern und Handfeuerwaffen, entfaltet nun, als reuiger Sünder und juristisch unbehelligt, sein musikalisches Genie in glühenden Madrigalen. Claudio Monteverdi ist ein anderer großer Italiener, jetzt noch Bratscher am Herzogshof der Gonzagas in Mantua, der eine andere Richtung einschlägt, hin zur Erfindung der Oper. Für San Marco in Venedig, in einer der drei Republiken in Europa, schreibt Giovanni Gabrieli seine Sacrae Symphoniae für zwei bis vier Chöre, räumlich konzipiert, von ungeheurer Wirkung und vollendet im selben Jahr 1597 wie eine andere bahnbrechende Sammlung, nämlich das «First Booke of Songes or Ayres» des Engländers John Dowland. Er lässt die Noten so drucken, dass sie von einem Sänger zur Lautenbegleitung ebenso vorgetragen werden können wie von vier Sängern, die sich um den Tisch versammeln, auf dem das Notenbuch liegt. Aber nicht nur deshalb wird das «Booke» ein rasender Erfolg. Der 34-jährige Londoner nutzt die Mehrstimmigkeit der Italiener für eine emotionale Spannweite, die jeder versteht. Zwischen diesen Polen bewegt sich das musikalische Europa jener Jahre, hier wird die Musik des 17. Jahrhunderts vorgeprägt.
In den unteren Rängen tummelt sich da auch schon ein Bach, ein Johannes. Den verbindet mit unserer Familie freilich nur, dass ein Kupferstich mit seinem Porträt in der Sammlung von Carl Philipp Emanuel landete. Dort firmiert er als «Bach, (Hans) ein Gothaischer Musikus». Aber Thüringen hat dieser Mann nie gesehen, der 1555 in Andelsbuch in Vorarlberg zur Welt kam, am Stuttgarter Hof Geiger war und von dort nach Nürtingen wechselte, wo er 1615 starb. Auf dem Stich von 1617 sieht man ihn mit einer Tanzmeistergeige und einem Pokal, umgeben von Schreinerwerkzeugen und der lateinischen Inschrift «Hans Bach; berühmter und witziger Narr, arbeitsamer Mann, bescheiden und fromm». Ein früherer Holzschnitt bestätigt die Doppelbegabung des Mannes, der vielleicht über eine Schreinerlehre ins musikalische Narrengewerbe geraten war:
Hie siehst du geigen / Hansen Bachen
Wenn du es hörst / so mustu lachen
Er geigt gleichwohl / nach seiner Art
Vnd tregt ein hipschen / Hans Bachen Bart.
Dass er – mit Knebelbart über spanischem Kragen und kurioser Stirnsträhne über grimmigem Blick – hartnäckig seinen Platz in allen Büchern über die Bachs behauptet, oft als Verwandter oder sogar Bruder von Veit, entspricht wohl dem Bedürfnis nach Porträts aus dieser frühen Zeit und nach einem Kontrast zum Ernst, den viele mit dem Namen Bach verbinden. Aber in dieser Familie wird zu allen Zeiten gescherzt, eher mehr als weniger derb. Sie hätten diesen Hans wohl gemocht, der letztlich nur dreierlei belegt: den Einsatz der Geige als des Trivialinstruments, das sie im 16. Jahrhundert weitgehend noch ist, die große Verbreitung des Namens Bach außerhalb der Musikerfamilie – und die Ungewissheit der späteren Familie über ihre frühesten Mitglieder.
Bis Hans und Anna «nach Gottes Ordenung ehelich werden» können, dauert es noch. Wann genau Hans was tat, darüber hat sein Urenkel Johann Sebastian etwas Verwirrung gestiftet oder, besser gesagt, überliefert. «No. 2 Johannes Bach, des vorigen [Veit] Sohn, hat anfänglich die Becker Profession ergriffen. Weilen er aber eine sonderliche Zuneigung zur Music gehabt, so hat ihn der StadtPfeiffer in Gotha zu sich in die Lehre genommen. Zu der Zeit hat das alte Schloß Grimmenstein noch gestanden, und hat sein Lehrherr, damaligem Gebrauch nach, auf dem Schloß Thurme gewohnet. Bey welchem er auch nach ausgestandenen Lehrjahren noch einige Zeit in condition gewesen; nach Zerstöhrung des Schloßes aber, (so Anno 15.. geschehen) und da auch mittelst der Zeit sein Vater Veit gestorben, hat er sich nach Wechmar gesetzt, allda Jfr. Anna Schmiedin, eines Gastwirths Tochter aus Wechmar, geheirathet, und des Vaters Güter in Besitz genommen …»
Mit der ermittelbaren Realität passt die Notiz nur teilweise zusammen. Das erwähnte Schloss ist 1567 geschleift worden nach einem bewaffneten Verwandtschaftsstreit der Wettiner um die Kurwürde. Kurfürst August von Sachsen hatte seinen Herausforderer Wilhelm von Grumbach besiegt und ihm auf dem Marktplatz von Gotha bei lebendigem Leib das Herz herausreißen lassen, ehe er mit seinen Mitstreitern gevierteilt wurde, und soll es dem Sterbenden ins Gesicht geschlagen haben mit den Worten: «Sieh Grumbach! Dein falsches Herz!» Es mag sein, dass ein Bach aus anderer Wechmarer Linie für den Ritter von Grumbach musiziert hat, ehe die Kühe von Gotha auf dem Gelände der geschleiften Festung weideten. Aber sicher war es nicht jener Hans, dessen erstes Kind 1604 zur Welt kam und der, hätte er auf Grimmenstein gelernt, mit gut 60 Jahren erstmals Vater geworden wäre – ein für jene Zeit absurd hohes Alter für eine Familiengründung, der ja noch mindestens drei weitere Kinder folgten, und zwar zu Lebzeiten ihres Großvaters Veit.
Auch der dritte Eintrag im «Ursprung», der dem Bruder von Hans gilt, ohne dessen Namen zu nennen, ist unstimmig. «No. 3. Deßen Bruder ---- Bach, ist ein Teppichmacher worden, und hat 3 Söhne gehabt so die Music erlernet und welche der damahligst regierende Graf zu Schwartzburg Arnstadt auf seine Unkosten nach Italien hat reisen laßen, um die Music beßer zu excoliren. Unter diesen dreyen Brüdern ist der jüngste durch einen Unfall blind und der blinde Jonas genennet worden, und von welchem man damahligst viel Abentheuerliches gesprochen hat. Da nun dieser unverheyrathet gestorben, so stammen vermuthlich von deßen anderen 2 Brüdern die Namens- und Geschlechtsverwandten her, so ehedem in Mechterstädt (zwischen Eisenach und Gotha liegend) und der Orten herum gewohnet. Der Anno 1730 in Meinungen verstorbene Capellmeister Johann Ludewig Bach, deßen seliger Vater, Jacob Bach, Cantor in der Ruhl gewesen, war von diesem Stamme …»
Einen Vornamen weiß Bach nicht, schreibt dem «Teppichmacher» aber musizierende Söhne zu, wie Stadtpfeifer Caspar in Gotha sie hatte, «vermuthlich» auch jenen Sohn, der die Meininger Linie begründete, Wendel heißt er, der aber, um 1580 geboren, ein Sohn von jenem Lips sein dürfte, der in Wechmar 1577 als «Inwohner» verbucht ist. Von «Caspar Bachen uffn Kaufhaus» wissen die Archive Gothas, dass er dort ab 1600 Stadtpeifer war, während das Erbbuch der Grafschaft Gleichen für Wechmar 1610 vermerkt: «Hans Bach zahlt Zins auf Äcker an der Wasserleiten, die ihm von seinem Bruder Caspar verehret …»: Amtlicher Beleg dafür, dass Hans und Caspar Brüder waren und dass die Familie Besitz in Wechmar hatte. Und aus dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts stammt eine Akte, die «Veit Bach und Hans Bach, Musicus» als Bewohner desselben Hauses in Wechmar verzeichnet. All das legt nahe, dass Caspar jener «Stadtpfeiffer in Gotha» war, zu dem dessen Bruder Hans in die Lehre ging, ohne sich dann aber in Gotha anzusiedeln. Er hat auch nie eine Stadtpfeiferstelle gehabt. Hans teilte sich mit seinem Vater ein Haus in Wechmar, und offenbar war es groß genug, um dort eine Familie zu gründen.