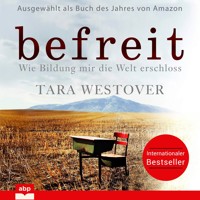9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von den Bergen Idahos nach Cambridge – der unwahrscheinliche »Bildungsweg« der Tara Westover. Tara Westover ist 17 Jahre alt, als sie zum ersten Mal eine Schulklasse betritt. Zehn Jahre später kann sie eine beeindruckende akademische Laufbahn vorweisen. Aufgewachsen im ländlichen Amerika, befreit sie sich aus einer ärmlichen, archaischen und von Paranoia und Gewalt geprägten Welt durch – Bildung, durch die Aneignung von Wissen, das ihr so lange vorenthalten worden war. Die Berge Idahos sind Taras Heimat, sie lebt als Kind im Einklang mit der grandiosen Natur, mit dem Wechsel der Jahreszeiten – und mit den Gesetzen, die ihr Vater aufstellt. Er ist ein fundamentalistischer Mormone, vom baldigen Ende der Welt überzeugt und voller Misstrauen gegenüber dem Staat, von dem er sich verfolgt sieht. Tara und ihre Geschwister gehen nicht zur Schule, sie haben keine Geburtsurkunden, und ein Arzt wird selbst bei fürchterlichsten Verletzungen nicht gerufen. Und die kommen häufig vor, denn die Kinder müssen bei der schweren Arbeit auf Vaters Schrottplatz helfen, um über die Runden zu kommen. Taras Mutter, die einzige Hebamme in der Gegend, heilt die Wunden mit ihren Kräutern. Nichts ist dieser Welt ferner als Bildung. Und doch findet Tara die Kraft, sich auf die Aufnahmeprüfung fürs College vorzubereiten, auch wenn sie quasi bei null anfangen muss … Wie Tara Westover sich aus dieser Welt befreit, überhaupt erst einmal ein Bewusstsein von sich selbst entwickelt, um den schmerzhaften Abnabelungsprozess von ihrer Familie bewältigen zu können, das beschreibt sie in diesem ergreifenden und wunderbar poetischen Buch. » Befreit wirft ein Licht auf einen Teil unseres Landes, den wir zu oft übersehen. Tara Westovers eindringliche Erzählung — davon, einen Platz für sich selbst in der Welt zu finden, ohne die Verbindung zu ihrer Familie und ihrer geliebten Heimat zu verlieren — verdient es, weithin gelesen zu werden.« J.D. Vance Autor der »Hillbilly-Elegie«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Tara Westover
Befreit
Wie Bildung mir die Welt erschloss
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tara Westover
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tara Westover
Tara Westover wurde 1986 in Idaho, USA, geboren und lebt heute in Großbritannien. 2008 erwarb sie den Bachelor of Arts an der Brigham Young University. Am Trinity College, Cambridge, machte sie 2009 einen Abschluss als Master of Philosophy und promovierte 2014, nach einem Abstecher an die Harvard University, in Cambridge in Geschichte. »Befreit« ist ihr erstes Buch.
Eike Schönfeld, Jahrgang 1949, lebt als Übersetzer in Paris. Er hat u.a. Werke von Vladimir Nabokov, J. D. Salinger, Jeffrey Eugenides, Joseph Conrad, Oscar Wilde, Katherine Mansfield, Henry Fielding, Jerome Charyn, Nicholson Baker, Martin Amis, Richard Yates, Saul Bellow, Daniel Mendelsohn und Charles Darwin ins Deutsche übertragen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Berge Idahos sind Taras Heimat, sie lebt als Kind im Einklang mit der grandiosen Natur, mit dem Wechsel der Jahreszeiten – und mit den Gesetzen, die ihr Vater aufstellt. Er ist ein fundamentalistischer Mormone, vom baldigen Ende der Welt überzeugt und voller Misstrauen gegenüber dem Staat, von dem er sich verfolgt sieht. Tara und ihre Geschwister gehen nicht zur Schule, sie haben keine Geburtsurkunden, und ein Arzt wird selbst bei fürchterlichsten Verletzungen nicht gerufen. Und die kommen häufig vor, denn die Kinder müssen bei der schweren Arbeit auf Vaters Schrottplatz helfen, um über die Runden zu kommen. Taras Mutter, die einzige Hebamme in der Gegend, heilt die Wunden mit ihren Kräutern. Nichts ist dieser Welt ferner als Bildung. Und doch findet Tara die Kraft, sich auf die Aufnahmeprüfung fürs College vorzubereiten, auch wenn sie quasi bei null anfangen muss …
Wie Tara Westover sich aus dieser Welt befreit, überhaupt erst einmal ein Bewusstsein von sich selbst entwickelt, um den schmerzhaften Abnabelungsprozess von ihrer Familie bewältigen zu können, das beschreibt sie in diesem ergreifenden und wunderbar poetischen Buch.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Educated
© 2018 by Second Sally, Ltd.
All rights reserved
Aus dem amerikanischen Englisch von Eike Schönfeld
© 2018, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, basierend auf dem Originalumschlag von Random House
Covermotiv: © Patrik Svensson
ISBN978-3-462-31668-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Vorbemerkung
Prolog
I. Teil
1. Kapitel Das Gute wählen
2. Kapitel Die Hebamme
3. Kapitel Cremefarbene Schuhe
4. Kapitel Apachenfrau
5. Kapitel Ehrlicher Dreck
6. Kapitel Schild und Schutz
7. Kapitel Der Herr wird’s geben
8. Kapitel Kleine Huren
9. Kapitel Ohne Tadel in seinen Zeiten
10. Kapitel Federschild
11. Kapitel Instinkt
12. Kapitel Fischauge
13. Kapitel Stille in den Kirchen
14. Kapitel Meine Füße berühren die Erde nicht mehr
15. Kapitel Kein Kind mehr
16. Kapitel Illoyaler Mensch, ungehorsamer Himmel
II. Teil
17. Kapitel Damit es heilig bleibt
18. Kapitel Blut und Federn
19. Kapitel Am Anfang
20. Kapitel Vorträge der Väter
21. Kapitel Helmkraut
22. Kapitel Was wir flüsterten, was wir schrien
23. Kapitel Ich bin aus Idaho
24. Kapitel Ein fahrender Ritter
25. Kapitel Die Wirkung von Schwefel
26. Kapitel Auf fließendes Wasser warten
27. Kapitel Wäre ich eine Frau
28. Kapitel Pygmalion
29. Kapitel Abschluss
III. Teil
30. Kapitel Die Hand des Allmächtigen
31. Kapitel Tragödie, dann Farce
32. Kapitel Zankende Frau im großen Haus
33. Kapitel Hexerei der Physik
34. Kapitel Die Substanz der Dinge
35. Kapitel Westlich der Sonne
36. Kapitel Vier lange Arme, rudernd
37. Kapitel Wetten um Erlösung
38. Kapitel Familie
39. Kapitel Die Prinzessin
40. Kapitel Gebildet
Dank
Für Tyler
Die Vergangenheit ist schön, weil man darin nie ein Gefühl erkennt. Später erweitert sie sich, & deshalb haben wir bezüglich der Gegenwart nie vollständige Gefühle, nur bezüglich der Vergangenheit.
Virginia Woolf
Letztlich glaube ich, dass Bildung als andauernde Rekonstruktion der Erfahrung betrachtet werden muss, dass Prozess und Ziel von Bildung ein und dasselbe sind.
John Dewey
Vorbemerkung
Diese Geschichte handelt nicht vom Mormonentum. Auch nicht von einer anderen Form religiösen Glaubens. Vielerlei Leute kommen darin vor, manche gläubig, manche nicht, manche freundlich, andere nicht. Die Autorin bestreitet jede Korrelation, positiv wie negativ, zwischen beiden.
Die folgenden Namen – in alphabetischer Reihenfolge – sind Pseudonyme: Aaron, Audrey, Benjamin, Emily, Erin, Faye, Gene, Judy, Peter, Robert, Robin, Sadie, Shannon, Shawn, Susan, Vanessa.
Prolog
Ich stehe auf dem roten Eisenbahnwaggon, der verlassen neben der Scheune abgestellt ist. Der Wind rauscht, peitscht mir die Haare übers Gesicht und schickt mir ein Frösteln in den offenen Hemdkragen. So nahe am Berg stürmt es oft kräftig, als atmet der Gipfel selbst aus. Das Tal unter mir ist friedlich, ungestört. Derweil tanzt unsere Farm: Die schweren Koniferen wiegen sich langsam, Wüstenbeifuß und Disteln dagegen beben, neigen sich vor jedem Windstoß, jedem Luftloch. Hinter mir steigt sanft ein Hügel an, heftet sich an den Fuß des Berges. Wenn ich den Blick hebe, sehe ich die dunklen Umrisse der Indianerprinzessin.
Der Hügel ist mit wildem Weizen überzogen. Sind Koniferen und Wüstenbeifuß Solisten, die einzigartige Bewegungen zur Szenerie beitragen, so ist das Weizenfeld das Ballettkorps, in dem jeder Halm den anderen in ihren Bewegungsstößen folgt und Millionen Ballerinas sich eine nach der anderen neigen, wenn Böen ihre goldenen Köpfe biegen. Diese Kuhlen währen nur einen Augenblick, und allein durch sie kann man Wind sehen.
Wende ich mich zu unserem Haus am Hang, sehe ich andersartige Bewegungen, hohe Schatten, die steif durch die Ströme stoßen. Meine Brüder sind wach, schauen nach dem Wetter. Ich stelle mir meine Mutter am Herd vor, wie sie die Kleiepfannkuchen brät. Ich stelle mir meinen Vater vor, wie er gebeugt an der Hintertür steht, die Stiefel mit den Stahlkappen schnürt und die schwieligen Hände in Schweißerhandschuhe schiebt. Unten auf dem Highway rollt der Schulbus vorbei, ohne anzuhalten.
Ich bin erst sieben, aber mir ist klar, dass meine Familie mehr als alles andere dadurch abweicht: Wir gehen nicht zur Schule.
Dad hat Angst, dass die Regierung uns dazu zwingt, aber das kann sie nicht, weil sie gar nichts von uns weiß. Vier der sieben Kinder meiner Eltern haben keine Geburtsurkunde. Wir haben keine Patientenakte, weil wir zu Hause geboren wurden und nie einen Arzt oder eine Schwester zu Gesicht bekommen haben. Auch Schulakten haben wir nicht, weil wir nie einen Fuß in ein Klassenzimmer gesetzt haben. Mit neun bekomme ich dann eine nachträgliche Geburtsurkunde ausgestellt, aber jetzt gibt es mich immer noch nicht, jedenfalls nicht für den Staat Idaho oder die Bundesregierung.
Aber natürlich gab es mich. Wir waren damit aufgewachsen, uns auf die Tage des Gräuels vorzubereiten, darauf, dass die Sonne sich verdunkelt und vom Mond etwas wie Blut tropft. Im Sommer weckte ich Pfirsiche ein, im Winter erneuerte ich die Notvorräte. Sollte die Welt der Menschen scheitern, würde meine Familie davon unberührt weitermachen.
Ich war mit den Rhythmen des Berges vertraut, Rhythmen, deren Wandel nie grundlegend war, immer nur zyklisch. Jeden Morgen erschien dieselbe Sonne, schwenkte übers Tal und ging hinterm Gipfel wieder unter. Der Schnee, der im Winter fiel, schmolz stets im Frühling. Unser Leben war ein Kreislauf – der Kreislauf des Tages, der Kreislauf der Jahreszeiten –, Kreisläufe immerwährenden Wandels, die, wenn abgeschlossen, bedeuteten, dass sich rein gar nichts verändert hatte. Ich glaubte, dass meine Familie ein Teil dieses unsterblichen Musters war, dass wir in gewisser Hinsicht ewig waren. Doch die Ewigkeit gehörte nur zum Berg.
Mein Vater erzählte oft eine Geschichte über ihn. Er sei ein großes, altes Ding, ein Dom von einem Berg. In der Kette gebe es noch weitere Berge, größere, imposantere, unserer aber, Buck Peak, sei am besten gestaltet. Sein Sockel erstrecke sich über mehr als einen Kilometer, seine dunkle Form schwelle sanft aus der Erde und erhebe sich zu einer makellosen Turmspitze. Von fern könne man am Hang des Berges den Eindruck eines Frauenkörpers erkennen: die Beine aus gewaltigen Schluchten geformt, die Haare ein Strauß Kiefern, der sich über dem Nordkamm des Gipfels ausfächere. Ihre Haltung sei beherrschend, ein Bein in einer machtvollen Bewegung nach vorn gereckt, eher ein Schreiten als ein Schritt.
Mein Vater nannte den Berg die Indianerprinzessin. Er sagte, sie erscheine jedes Frühjahr am Beginn der Schneeschmelze, und sie blicke nach Süden und halte nach den Büffeln Ausschau, die ins Tal zurückkehren. Dad sagte, die Prärie-Indianer hätten ihr Erscheinen als Zeichen des Frühlings begriffen, als Signal dafür, dass der Berg taute, der Winter vorbei war und es Zeit war, nach Hause zu gehen.
Alle Geschichten meines Vaters drehten sich um unseren Berg, unser Tal, unseren struppigen kleinen Flecken Idahos. Nie erzählte er mir, was ich tun solle, wenn ich den Berg verließe, wenn ich Meere und Kontinente überquerte und mich auf fremdem Terrain befände, wo ich den Horizont nicht mehr nach der Prinzessin absuchen konnte. Nie sagte er mir, wie ich wüsste, wann es Zeit sei, nach Hause zu kommen.
1. KapitelDas Gute wählen
Meine früheste Erinnerung ist keine. Vielmehr etwas, was ich mir eingebildet hatte und mich dann daran erinnerte, als wäre es tatsächlich so geschehen. Das Erinnerte entstand, als ich fünf war, kurz vor meinem sechsten Geburtstag, aus einer Geschichte, die mein Vater derart detailliert erzählt hat, dass jeder von uns – meine Brüder, meine Schwester und ich – seine eigene Kinoversion davon gebastelt hat, einschließlich Gewehrschüssen und Schreien. In meiner waren Grillen. Diesen Ton höre ich, als unsere Familie sich vor den FBI-Leuten, die unser Haus umstellt haben, in der Küche verschanzt, Licht aus. Eine Frau greift nach einem Glas Wasser, ihre Silhouette wird vom Mond erhellt. Ein Schuss knallt wie ein Peitschenhieb, sie fällt. In meiner Erinnerung fällt immer Mutter, und sie hat ein Baby im Arm.
Das Baby ist völlig unsinnig – ich bin das jüngste der sieben Kinder meiner Mutter –, aber wie schon gesagt, nichts davon ist geschehen.
Ein Jahr, nachdem mein Vater uns diese Geschichte erzählte, versammelten wir uns eines Abends, um ihn aus Jesaja vorlesen zu hören, eine Prophezeiung über Immanuel. Er saß auf unserem senffarbenen Sofa, auf dem Schoß eine große Bibel. Neben ihm saß Mutter. Wir übrigen waren auf dem zotteligen braunen Teppich verstreut.
»Butter und Honig wird er essen«, leierte Dad leise und monoton, müde von einem langen Tag des Schrottschleppens, »wann er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen.«
Es entstand eine lastende Pause. Wir saßen stumm da.
Mein Vater war kein hochgewachsener Mann, aber er war durchaus fähig, einen Raum zu beherrschen. Er hatte Präsenz, die Feierlichkeit eines Orakels. Seine Hände waren dick und ledrig – die Hände eines Mannes, der sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hatte –, und sie hielten die Bibel fest umfasst.
Er las den Abschnitt ein zweites, dann ein drittes, dann ein viertes Mal. Mit jeder Wiederholung stieg seine Stimme höher. Seine Augen, noch Augenblicke zuvor vor Müdigkeit geschwollen, waren nun groß und wach. Das da sei eine göttliche Lehre, sagte er. Er werde den Herrn befragen.
Am folgenden Tag säuberte er unseren Kühlschrank von Milch, Joghurt und Käse, und als er am Abend nach Hause kam, war sein Pick-up mit zweihundert Litern Honig beladen.
»Jesaja sagt nicht, welches böse ist, Butter oder Honig«, sagte Dad und grinste, während meine Brüder die weißen Eimer in den Keller schafften. »Aber wenn ihr fragt, wird es der Herr euch sagen!«
Als Dad den Vers seiner Mutter vorlas, lachte sie ihm ins Gesicht. »Ich hab ein paar Pennys im Geldbeutel«, sagte sie. »Nimm sie. Mehr Sinn kannst du nicht kriegen.«
Oma hatte ein schmales, kantiges Gesicht und eine unüberschaubare Sammlung falschen Indianerschmucks, alles Silber und Türkis, der in Klumpen um ihren knochigen Hals und die Skelettfinger lag. Da sie unterhalb von uns wohnte, am Fuß des Berges, nahe dem Highway, nannten wir sie Oma-von-unten. Damit wollten wir sie von der Mutter unserer Mutter unterscheiden, die wir Oma-in-der-Stadt nannten, weil sie zwanzig Kilometer weiter südlich wohnte, in der einzigen Stadt im Bezirk, in der es eine Ampel und einen Lebensmittelladen gab.
Dad und seine Mutter kamen so gut miteinander aus wie zwei Katzen, denen man die Schwänze zusammengebunden hat. Sie konnten eine Woche lang reden und in nichts übereinstimmen, doch sie waren verbunden durch ihre Hingabe an den Berg. Die Familie meines Vaters hatte seit über einem Jahrhundert am Fuß des Buck Peak gelebt. Omas Töchter hatten geheiratet und waren fortgezogen, mein Vater dagegen war geblieben, hatte ein schäbiges gelbes Haus gebaut, das nie ganz fertig wurde, es stand ein Stück höher am Berg als ihres, und einen Schrottplatz hingeklatscht – einen von mehreren – direkt neben ihren gepflegten Garten.
Sie stritten sich täglich, über den Dreck vom Schrottplatz, häufiger aber über uns Kinder. Oma fand, wir sollten in der Schule sein und nicht, wie sie es formulierte, »wie Wilde durch die Berge ziehen«. Dad sagte, die staatliche Schule sei ein Trick der Regierung, um die Kinder von Gott wegzuführen. »Da kann ich meine Kinder doch gleich dem Teufel persönlich übergeben«, sagte er, »und muss sie nicht erst in diese Schule da schicken.«
Gott beschied Dad, seine Offenbarung mit den Leuten zu teilen, die im Schatten des Buck Peak lebten und Landbau betrieben. Sonntags versammelten sich fast alle in der Kirche neben dem Highway, einer hickoryfarbenen Kapelle gleich mit dem kleinen, bescheidenen Turm, der allen Mormonenkirchen gemein war. Dad bedrängte Väter, wenn sie aus ihrer Bankreihe kamen. Er begann bei seinem Vetter Jim, der ihm gutmütig zuhörte, während Dad mit seiner Bibel wedelte und die Sündhaftigkeit der Milch erklärte. Jim grinste, schlug Dad dann auf die Schulter und meinte, kein rechtschaffener Gott werde einem an einem heißen Sommernachmittag sein selbst gemachtes Erdbeereis wegnehmen. Jims Frau zerrte ihn am Arm. Als er an uns vorbeilief, bekam ich einen Misthauch ab. Da fiel es mir wieder ein: Die große Milchfarm einen Kilometer nördlich vom Buck Peak, die gehörte Jim.
Als Dad anfing, gegen Milch zu wettern, stopfte Oma ihren Kühlschrank voll damit. Sie und Opa tranken eigentlich nur Magermilch, aber schon bald war alles da – zweiprozentige, Voll-, sogar Schokomilch. Offenbar fand sie, dass diese Stellung unbedingt gehalten werden musste.
Das Frühstück wurde zum Loyalitätstest. Jeden Morgen aß meine Familie an einem großen Tisch aus umgearbeiteter Roteiche entweder ein Sieben-Körner-Müsli mit Honig und Melasse oder Sieben-Körner-Pfannkuchen, ebenfalls mit Honig und Melasse. Da wir zu neunt waren, waren sie nie ganz durchgebacken. Ich hatte nichts gegen das Müsli, wenn ich es in Milch einweichen konnte, wo sich dann die Sahne auf dem Schrot sammelte und in die Körnchen sickerte, doch seit der Offenbarung aßen wir es mit Wasser. Es war, als äße man eine Schale Schlamm.
Es dauerte nicht lange, bis ich an die viele Milch dachte, die in Omas Kühlschrank verdarb. Dann gewöhnte ich mir an, jeden Morgen das Frühstück sausen zu lassen und direkt in die Scheune zu gehen. Ich fütterte die Schweine und füllte die Tröge der Kühe und Pferde, dann sprang ich über den Korralzaun, lief um die Scheune herum und betrat Omas Haus durch die Seitentür.
An einem solchen Morgen, ich saß am Tresen und schaute zu, wie Oma mir Cornflakes machte, sagte sie: »Würdest du denn nicht gern zur Schule gehen?«
»Nein, eigentlich nicht«, sagte ich.
»Woher willst du das wissen?«, blaffte sie. »Du hast’s doch noch gar nicht probiert.«
Sie goss die Milch dazu, reichte mir die Schale, setzte sich mir gegenüber an den Tresen und schaute zu, wie ich mir die Cornflakes in den Mund schaufelte.
»Morgen früh fahren wir nach Arizona«, sagte sie, aber das wusste ich schon. Sie und Opa fuhren immer nach Arizona, wenn sich das Wetter drehte. Opa fand, er sei zu alt für den Winter in Idaho, die Kälte tue ihm in den Knochen weh. »Steh ganz früh auf«, sagte Oma, »so gegen fünf, dann nehmen wir dich mit. Stecken dich in die Schule.«
Ich rutschte auf meinem Hocker herum. Ich versuchte, mir die Schule vorzustellen, doch ich schaffte es nicht. Ich dachte an die Sonntagsschule, die ich jede Woche besuchte und die ich hasste. Ein Junge namens Aaron hatte allen Mädchen erzählt, ich könne nicht lesen, weil ich nicht in die Schule ginge, und daraufhin wollte keines mehr mit mir sprechen.
»Hat Dad gesagt, ich darf?«
»Nein«, sagte Oma. »Aber wir sind längst weg, bevor er merkt, dass du fehlst.« Sie stellte meine Schale in die Spüle und schaute aus dem Fenster.
Oma war eine Naturgewalt – ungeduldig, aggressiv, beherrscht. Wenn man sie ansah, wich man unwillkürlich einen Schritt zurück. Sie färbte sich die Haare schwarz, was ihre ohnehin schon strengen Züge noch betonte, besonders die Augenbrauen, die sie jeden Morgen als dicke tintenschwarze Bögen nachzog. Sie machte sie zu groß, was ihr Gesicht gedehnt erscheinen ließ. Auch zu hoch waren sie gezogen, was ihren Zügen einen Ausdruck von Langeweile, fast Sarkasmus verlieh.
»Du solltest zur Schule gehen«, sagte sie.
»Aber sagt Dad dann nicht, dass du mich wieder zurückbringen sollst?«, sagte ich.
»Dein Dad kann mir verdammt gar nichts sagen.« Oma stand auf und straffte sich. »Wenn er dich haben will, muss er dich schon selber holen.« Sie zögerte, und einen kurzen Moment lang sah es aus, als schämte sie sich. »Ich hab gestern mit ihm gesprochen. Er kann dich eine ganze Weile lang gar nicht holen. Er ist mit dem Schuppen, den er in der Stadt baut, im Rückstand. Da kann er nicht mal eben nach Arizona fahren, nicht, solange das Wetter hält und er und die Jungs viele Stunden am Tag arbeiten können.«
Omas Vorhaben war gut geplant. Dad arbeitete in den Wochen vor dem ersten Schnee immer von Sonnenaufgang bis -untergang, um mit Schrott und Schuppenbauen genügend Geld zusammenzukratzen, damit wir über den Winter kamen, wenn die Arbeit knapp war. Selbst wenn seine Mutter mit seinem jüngsten Kind fortlief, könnte er nicht aufhören zu arbeiten, erst wieder, wenn der Gabelstapler eingefroren war.
»Bevor wir gehen, muss ich noch die Tiere füttern«, sagte ich. »Er merkt’s bestimmt, dass ich weg bin, wenn die Kühe auf der Suche nach Wasser den Zaun durchbrechen.«
In der Nacht schlief ich nicht. Ich saß auf dem Küchenboden und sah zu, wie die Zeit verging. Ein Uhr. Zwei Uhr. Drei Uhr.
Um vier stand ich auf und stellte meine Stiefel an die Hintertür. Sie waren mit Mist verkrustet, und so ließ Oma mich bestimmt nicht in den Wagen. Ich stellte mir vor, wie sie verlassen auf ihrer Veranda standen, während ich ohne Schuhe nach Arizona fortlief.
Ich stellte mir vor, was passieren würde, wenn meine Familie merkte, dass ich weg war. Mein Bruder Richard und ich verbrachten oft Tage auf dem Berg, wahrscheinlich würden sie es also erst bei Sonnenuntergang merken, wenn Richard zum Essen nach Hause kam und ich nicht. Ich stellte mir vor, wie meine Brüder rausliefen, um mich zu suchen. Als Erstes würden sie sich den Schrottplatz vornehmen, massive Eisenplatten hochwuchten, falls eine verrutscht war und mich eingeklemmt hatte. Dann würden sie rausgehen, die Farm absuchen, auf Bäume und auf den Dachboden der Scheune klettern. Danach würden sie auf den Berg steigen.
Inzwischen wäre die Dämmerung längst vorbei – jener Augenblick, kurz bevor es Nacht wird, wenn die Landschaft nur noch als Dunkel und helleres Dunkel erkennbar ist und man die Welt um einen herum mehr fühlt als sieht. Ich stellte mir vor, wie meine Brüder über den Berg ausschwärmten und die schwarzen Wälder absuchten. Niemand würde sprechen, jeder hätte die gleichen Gedanken. Auf einem Berg kann Schlimmes passieren. Plötzlich tauchten Steilhänge auf. Wildpferde, die meinem Großvater gehörten, rannten zügellos über dichten Wasserschierling, und es gab nicht wenige Klapperschlangen. So eine Suche hatte es schon gegeben, wenn ein Kalb in der Scheune fehlte. Im Tal fand man dann ein verletztes Tier, auf dem Berg nur ein totes.
Ich stellte mir vor, wie meine Mutter in der Hintertür stand und den Blick über den dunklen Kamm schweifen ließ und wie dann mein Vater kam und ihr sagte, sie hätten mich nicht gefunden. Meine Schwester Audrey würde sagen, jemand solle doch mal Oma fragen, und Mutter würde sagen, Oma sei erst am Morgen nach Arizona abgereist. Das würde einen Augenblick lang in der Luft hängen, und dann wüssten alle, wo ich hin bin. Ich malte mir das Gesicht meines Vaters aus, die dunklen Augen geschrumpft, wie er mit zusammengekniffenem Mund zu meiner Mutter sagte: »Glaubst du, sie ist da freiwillig mit?«
Leise und kummervoll verhallte seine Stimme. Dann wurde sie von Geräuschen aus einer anderen Erinnerung überlagert – Grillen, dann Schüsse, dann Stille.
Es war ein berühmtes Ereignis, wie ich später erfahren sollte – wie Wounded Knee oder Waco –, aber als mein Vater uns die Geschichte zum ersten Mal erzählte, war es, als wüsste außer uns niemand auf der Welt davon.
Es begann am Ende der Einmachzeit, die andere Kinder wahrscheinlich »Sommer« nannten. Meine Familie verbrachte die warmen Monate immer damit, Obst einzumachen, das wir, wie Dad sagte, in den Tagen des Gräuels bräuchten. Eines Abends kam Dad sehr angespannt vom Schrottplatz. Er lief beim Essen in der Küche auf und ab und rührte dabei kaum einen Bissen an. Wir müssten alles in Ordnung bringen, sagte er. Wir hätten nur wenig Zeit.
Den nächsten Tag verbrachten wir damit, Pfirsiche zu kochen und zu schälen. Bei Sonnenuntergang hatten wir dann Dutzende Einmachgläser voll; sie standen in Reih und Glied da, noch warm vom Dampfdrucktopf. Dad musterte unsere Arbeit, zählte die Gläser und murmelte vor sich hin, dann sagte er zu unserer Mutter: »Das reicht nicht.«
An dem Abend berief Dad ein Familientreffen ein, und so setzten wir uns an den Küchentisch, weil der breit und lang genug für uns alle war. Wir hätten ein Recht zu wissen, was uns bevorstehe, sagte er. Er stand am Kopfende des Tischs, wir anderen hockten auf Bänken und betrachteten die dicken Roteichenplanken.
»Nicht weit von hier lebt eine Familie«, sagte Dad. »Das sind Freiheitskämpfer. Die lassen ihre Kinder nicht vom Staat das Gehirn waschen, also ist jetzt das FBI hinter ihnen her.« Dad stieß lange und langsam die Luft aus. »Die FBI-Leute haben die Hütte der Familie umzingelt und sie wochenlang drin eingeschlossen, und als sich ein hungriges Kind, ein kleiner Junge, rausschlich, um was zu jagen, haben sie ihn erschossen.«
Ich schaute zu meinen Brüdern hin. Nie zuvor hatte ich auf Lukes Gesicht Angst gesehen.
»Sie sind immer noch in der Hütte«, sagte Dad. »Sie machen kein Licht, und sie kriechen über den Fußboden, weg von den Türen und Fenstern. Ich weiß nicht, wie viel Essen die dort noch haben. Vielleicht verhungern sie, bevor die FBI-Leute aufgeben.«
Keiner sagte etwas. Schließlich fragte Luke, der zwölf war, ob wir ihnen helfen könnten. »Nein«, sagte Dad. »Das kann niemand. Die sind in ihrem eigenen Haus gefangen. Aber sie haben ihre Waffen, deshalb haben die FBI-Leute das Haus noch nicht gestürmt, das könnt ihr mir glauben.« Er hielt inne, um sich auf die niedrige Bank zu setzen, was er mit langsamen, steifen Bewegungen tat. Er wirkte alt auf mich, verhärmt. »Ihnen können wir nicht helfen, aber uns selbst. Wenn die FBI-Leute zum Buck Peak kommen, sind wir bereit.«
Noch in der Nacht schleppte Dad einen Stapel alter Armeerucksäcke aus dem Keller herauf. Das seien unsere »Ab in die Berge«-Rucksäcke, sagte er. Wir verbrachten die Nacht damit, sie mit Notvorräten vollzupacken – Kräutermedizin, Wasserreiniger, Feuerstahl. Dad hatte uns eine ganze Pick-up-Ladung Armeerationen besorgt, und davon steckten wir so viele wie nur möglich in die Rucksäcke, wobei wir uns vorstellten, wie wir sie aßen, nachdem wir aus dem Haus geflüchtet waren und uns bei den wilden Pflaumenbäumen am Bach versteckt hatten. Einige der Jungen steckten in ihre Rucksäcke auch Waffen, ich hatte nur ein kleines Messer, und trotzdem war mein Rucksack, als wir mit Packen fertig waren, so groß wie ich. Ich bat Luke, ihn auf ein Regal in meiner Kammer zu hieven, aber Dad sagte, ich solle ihn unten lassen, damit ich schnell drankäme, also schlief ich damit auf meinem Bett.
Ich übte, den Rucksack anzulegen und damit zu rennen – ich wollte ja nicht zurückbleiben. Ich malte mir unsere Flucht aus, nachts in die Sicherheit der Prinzessin. Der Berg war, wie ich es sah, unser Verbündeter. Zu denjenigen, die ihn kannten, war er freundlich, aber für Eindringlinge war er einfach nur tückisch, und das wäre unser Vorteil. Aber wenn wir uns in den Bergen verstecken wollten, wenn das FBI käme, warum machten wir dann diese ganzen Pfirsiche ein? Wir konnten doch keine tausend schweren Einmachgläser auf den Berg schleppen. Oder brauchten wir die Pfirsiche, damit wir sie wie die Weavers im Haus bunkern und uns dem Kampf stellen konnten?
Ein Kampf schien wahrscheinlich, erst recht einige Tage später, als Dad mit über einem Dutzend Gewehren aus Armeebeständen nach Hause kam, zumeist SKS, deren dünne silberne Bajonette säuberlich am Lauf befestigt waren. Die Gewehre waren in schmalen Blechkisten verpackt und mit Cosmoline versehen, einem bräunlichen schmalzartigen Korrosionsschutz, der entfernt werden musste. Nachdem wir sie gereinigt hatten, nahm mein Bruder Tyler eins, schlug es in eine schwarze Plastikbahn ein und klebte es mit einem silbrigen Isolierband zu. Er hob es auf die Schulter, ging damit den Berg hinab und warf es neben den roten Eisenbahnwaggon. Dann grub er. Als das Loch groß und tief genug war, legte er das Gewehr hinein und bedeckte es mit Erde. Er arbeitete verbissen, seine Muskeln schwollen von der Anstrengung an.
Bald danach kaufte Dad eine Maschine, mit der man aus verbrauchten Patronenhülsen Kugeln machen konnte. Jetzt könnten wir einer Belagerung länger standhalten, sagte er. Ich dachte an meinen »Ab in die Berge«-Rucksack, der in meinem Bett wartete, und an das Gewehr, das beim Waggon versteckt lag, und machte mir Sorgen wegen der Kugelmaschine. Sie war sperrig und an eine eiserne Werkbank im Keller genietet. Bei einem Überraschungsangriff hätten wir nicht die Zeit, sie zu holen. Ich überlegte, ob wir sie nicht ebenfalls beim Gewehr vergraben sollten.
Wir machten weiter Pfirsiche ein. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage vergangen waren oder wie viele Gläser wir noch eingelagert hatten, als unser Vater die Geschichte weitererzählte.
»Sie haben auf Randy Weaver geschossen«, sagte Dad mit dünner, schwankender Stimme. »Er ist aus der Hütte, um die Leiche seines Sohnes zu holen, und da haben die FBI-Leute auf ihn geschossen.« Ich hatte meinen Vater noch nie weinen sehen, aber jetzt tropften ihm die Tränen in einem steten Strom von der Nase. Er wischte sie nicht ab, ließ sie einfach aufs Hemd tropfen. »Seine Frau hörte den Schuss und lief ans Fenster, das Baby auf dem Arm. Dann kam der zweite Schuss.«
Mutter saß mit verschränkten Armen in der Ecke, eine Hand über der Brust, die andere vor dem Mund. Ich starrte auf unser geflecktes Linoleum, während Dad uns erzählte, wie sie der Mutter das Baby aus den Armen nahmen, sein Gesicht mit ihrem Blut beschmiert.
Bis dahin hatte etwas in mir gewollt, dass das FBI kam, hatte das Abenteuer herbeigesehnt. Jetzt empfand ich echte Furcht. Ich stellte mir Mutter vor, wie sie, müde und durstig, vom Fenster zurücktrat. Ich stellte mir vor, wie ich stumm und reglos auf dem Boden lag und auf das schrille Zirpen der Grillen auf dem Feld horchte. Dann sah ich, wie Mutter aufstand und nach dem Wasserhahn griff. Dann ein heller Blitz, lautes Gewehrfeuer, sie fiel. Ich sprang hin, um das Baby aufzufangen.
Dad erzählte uns nie, wie die Geschichte ausging. Wir hatten weder Fernseher noch Radio, weswegen er vielleicht selbst nie erfuhr, wie sie endete. Ich weiß nur noch, dass er als Letztes sagte: »Das nächste Mal könnten wir dran sein.«
Diese Worte setzten sich in mir fest. Ich hörte ihr Echo im Zirpen der Grillen, in den Pfirsichen, wenn sie ins Glas klatschten, in dem metallischen Klirr, wenn ein SKS gereinigt wurde. Ich hörte sie jeden Morgen, wenn ich an dem Waggon vorbeiging und noch bei der Vogelmiere und den Stechdisteln stehen blieb, wo Tyler das Gewehr vergraben hatte. Lange noch, da hatte Dad die Offenbarung in Jesaja längst vergessen und Mutter lud wieder Plastikflaschen mit »Western Family 2%«-Milch in den Kühlschrank, dachte ich an die Weavers.
Es war fast fünf Uhr morgens.
Ich kehrte auf mein Zimmer zurück, den Kopf noch voller Grillen und Gewehrfeuer. Im unteren Bett schnarchte meine Schwester, ein leises, zufriedenes Summen, das mich aufforderte, es ihr gleichzutun. Stattdessen stieg ich zu meinem Bett hinauf, verschränkte die Beine und schaute aus dem Fenster. Fünf verging. Dann sechs. Um sieben erschien Oma, und ich beobachtete sie, wie sie auf der Veranda auf und ab ging und immer wieder zu unserem Haus hinaufschaute. Dann setzten sie und Opa sich in den Wagen und fuhren auf den Highway.
Als der Wagen weg war, stand ich auf und aß eine Schale Kleie. Draußen wurde ich von Kamikaze begrüßt, Lukes Ziege, die mir auf dem Weg zur Scheune am Hemd knabberte. Ich passierte das Go-Kart, das Richard aus einem alten Rasenmäher baute. Ich fütterte die Schweine, füllte den Trog und brachte Opas Pferde auf eine neue Weide.
Danach stieg ich auf den roten Bahnwaggon, der neben der Scheune stand, und blickte ins Tal. Es war nicht schwer, mir vorzustellen, dass er fuhr, weit weg, dass jeden Moment das Tal hinter mir verschwand. Stundenlang hatte ich diese Fantasie im Kopf durchgespielt, aber heute wollte es mir nicht gelingen. Ich schaute nach Westen, weg von den Feldern, auf den Gipfel.
Die Indianerprinzessin strahlte am hellsten im Frühjahr, unmittelbar nachdem die Koniferen aus dem Schnee lugten, wenn ihre tief grünen Nadeln vor dem Goldbraun von Erde und Rinde fast schwarz waren. Jetzt war Herbst. Ich konnte sie noch sehen, doch sie verblasste schon: Das Rot und Gelb des sterbenden Sommers verdeckte ihre dunkle Form. Bald würde es schneien. Im Tal würde der erste Schnee noch schmelzen, aber auf dem Berg würde er liegen bleiben, die Prinzessin bis zum Frühjahr bedecken, bis sie wieder erschien und über uns wachte.
2. KapitelDie Hebamme
»Haben Sie Ringelblume?«, fragte die Hebamme. »Ich brauche auch noch Lobelie und Zaubernuss.«
Sie saß am Küchentresen und sah Mutter zu, wie sie unsere Sperrholzschränke durchwühlte. Zwischen ihnen auf dem Tresen stand eine elektrische Waage, auf der Mutter hin und wieder getrocknete Blätter abwog. Es war Frühling. Trotz der hellen Sonne war der Morgen kühl.
»Ich habe erst letzte Woche frische Ringelblume gemacht«, sagte Mutter. »Tara, hol sie doch mal schnell.«
Ich holte die Tinktur, und meine Mutter packte sie mit den getrockneten Kräutern in eine Plastiktüte. »Noch etwas?« Mutter lachte. Das Lachen war schrill, nervös. Die Hebamme schüchterte sie ein, und wenn meine Mutter eingeschüchtert war, bekam sie etwas Gewichtloses, fuhr jedes Mal herum, wenn die Hebamme eine ihrer langsamen, behäbigen Bewegungen machte.
Die Hebamme ging ihre Liste durch. »Das ist alles.«
Sie war eine kleine, füllige Frau Ende vierzig, die elf Kinder hatte und eine rostfarbene Warze am Kinn. Sie hatte die längsten Haare, die ich je gesehen hatte, eine Kaskade von der Farbe von Feldmäusen, die ihr bis auf die Knie fiel, wenn sie ihren straffen Dutt löste. Ihre Züge waren streng, die Stimme von starker Autorität. Sie hatte keine Lizenz, besaß keine Urkunden. Sie war Hebamme einzig kraft ihrer eigenen Behauptung, was mehr als genug war.
Mutter sollte ihr assistieren. Ich weiß noch, wie ich sie an jenem ersten Tag musterte, sie verglich. Mutter mit ihrer Rosenblütenhaut, die Haare zu weichen Wellen gerollt, die um ihre Schultern wippten. Ihre Lider schimmerten. Mutter trug jeden Morgen ihr Make-up auf, und wenn sie keine Zeit dafür hatte, entschuldigte sie sich den ganzen Tag dafür, als wäre sie dadurch allen lästig gefallen.
Die Hebamme sah aus, als hätte sie ihr Äußeres seit zehn Jahren nicht mehr beachtet, und durch die Art, wie sie sich gab, kam man sich blöd vor, dass man es überhaupt bemerkt hatte.
Die Hebamme verabschiedete sich mit einem Nicken, die Arme voll mit Mutters Kräutern.
Beim nächsten Mal brachte die Hebamme ihre Tochter Maria mit. Sie stand neben ihrer Mutter, ahmte ihre Bewegungen nach, ein Baby an ihre drahtige neunjährige Gestalt geklemmt. Ich schaute sie hoffnungsfroh an. Außer Audrey war sie das erste Mädchen wie ich, das ich getroffen hatte, das erste, das auch nicht zur Schule ging. Langsam näherte ich mich ihr, aber sie war völlig in die Worte ihrer Mutter vertieft, die gerade erklärte, wie Herzspannkraut bei Kontraktionen nach der Geburt angewandt werden sollte. Marias Kopf wippte zustimmend; ihr Blick wich nicht vom Gesicht ihrer Mutter.
Ich trottete allein zu meinem Zimmer, doch als ich die Tür schließen wollte, stand sie da, noch immer das Baby auf der Hüfte. Es war eine fleischige Masse, und sie musste ihren Körper scharf an der Taille beugen, um sein Gewicht auszugleichen.
»Gehst du?«, fragte sie.
Ich verstand die Frage nicht.
»Ich gehe immer«, sagte sie. »Hast du schon mal gesehen, wie ein Baby geboren wird?«
»Nein.«
»Aber ich, viele Male. Weißt du, was es bedeutet, wenn ein Baby Steißlage hat?«
»Nein.« Ich sagte es wie eine Entschuldigung.
Als Mutter das erste Mal bei einer Geburt half, war sie zwei Tage weg. Dann wehte sie zur Tür herein, so blass, dass sie fast durchsichtig war, und ließ sich aufs Sofa sinken, wo sie zitternd liegen blieb. »Es war furchtbar«, flüsterte sie. »Sogar Judy hat gesagt, sie hat Angst.« Mutter schloss die Augen. »Man hat es ihr aber nicht angesehen.«
Mutter ruhte sich noch einige Minuten aus, bis sie wieder etwas Farbe bekam, dann erzählte sie die Geschichte. Die Wehen waren lang und aufreibend gewesen, und als das Baby endlich kam, war die Mutter stark aufgerissen. Überall war Blut. Es blutete einfach immer weiter. Da sah Mutter, dass die Nabelschnur sich um den Hals des Babys gewickelt hatte. Der Junge war violett und so still, dass Mutter ihn für tot hielt. Während sie diese Einzelheiten erzählte, wich ihr das Blut aus dem Gesicht, bis sie fahl wie ein Ei dasaß, die Arme um den Oberkörper geschlungen.
Audrey machte Kamillentee, dann brachten wir unsere Mutter ins Bett. Als mein Vater am Abend nach Hause kam, erzählte meine Mutter es auch ihm. »Ich kann das nicht«, sagte sie. »Judy schon, aber ich nicht.« Dad legte ihr den Arm um die Schulter. »Der Herr hat dich berufen«, sagte er. »Und manchmal verlangt der Herr schwere Dinge.«
Mutter wollte keine Hebamme sein. Es war Dads Idee gewesen, einer seiner Pläne für größere Unabhängigkeit. Er hasste nichts mehr als unsere Abhängigkeit vom Staat. Dad sagte, eines Tages seien wir völlig los vom Netz. Sobald er das Geld zusammen habe, werde er eine Pipeline bauen, über die Wasser vom Berg komme, und danach werde er auf der ganzen Farm Sonnenkollektoren aufstellen. Damit hätten wir am Ende aller Tage dann Wasser und Strom, wo alle anderen dann Wasser aus Pfützen trinken und im Dunkeln leben müssten. Mutter sei Kräuterkennerin, damit sie uns pflegen könne, wenn wir krank seien, und wenn sie Hebamme würde, könnte sie die Enkel entbinden, wenn die dann kämen.
Ein paar Tage nach jener ersten Geburt kam die Hebamme Mutter besuchen. Sie brachte Maria mit, die wieder mit mir auf mein Zimmer kam. »Das war richtig Pech, dass deine Mutter bei ihrem ersten Mal eine schlimme gekriegt hat«, sagte sie und lächelte. »Die nächste wird einfacher.«
Ein paar Wochen später kam ihre Voraussage auf den Prüfstand. Es war Mitternacht. Da wir kein Telefon hatten, rief die Hebamme bei Oma-von-unten an, die daraufhin müde und widerwillig zu uns heraufging und blaffte, Mutter müsse wieder »Doktor spielen«. Sie blieb nur wenige Minuten, aber lange genug, um das ganze Haus zu wecken. »Warum ihr nicht einfach ins Krankenhaus gehen könnt wie jeder andere auch, das kapier ich nicht«, brüllte sie und knallte die Haustür hinter sich zu.
Mutter holte ihre Reisetasche und den Kasten mit den dunklen Tinkturfläschchen, dann schlich sie langsam aus dem Haus. Ich war besorgt und schlief schlecht, aber als sie am Morgen zurückkam, die Haare wirr und dunkle Ringe unter den Augen, hatte sie ein breites Lächeln im Gesicht. »Es war ein Mädchen«, sagte sie. Dann legte sie sich ins Bett und schlief den ganzen Tag.
So vergingen Monate, meine Mutter musste zu jeder Tages- und Nachtzeit aus dem Haus und kam zitternd wieder, zutiefst erleichtert, dass es vorüber war. Als die Blätter fielen, hatte sie bei einem Dutzend Geburten mitgeholfen. Am Ende des Winters bei mehreren Dutzend. Im Frühling sagte sie meinem Vater, sie habe nun genug gelernt, sie könne nun ein Baby selbst entbinden, wenn es sein müsse, wenn das Ende der Welt gekommen sei. Sie könne jetzt aufhören.
Dad machte ein langes Gesicht. Er erinnerte sie daran, dass es Gottes Wille sei, dass es unsere Familie segnen werde. »Du musst Hebamme sein«, sagte er. »Du musst selbst ein Kind entbinden können.«
Mutter schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht«, sagte sie. »Und außerdem, wer würde mich denn holen, wenn es Judy gibt?«
Sie hatte sich verhext, Gott den Fehdehandschuh hingeworfen. Bald danach erzählte mir Maria, ihr Vater habe eine neue Arbeit in Wyoming. »Mama sagt, deine Mutter soll das jetzt übernehmen«, sagte Maria. In meiner Fantasie nahm ein erregendes Bild Gestalt an, ich in Marias Rolle, die Tochter der Hebamme, selbstbewusst, kenntnisreich. Doch beim Blick auf meine Mutter, die neben mir stand, verflüchtigte sich das Bild.
In Idaho arbeiteten Hebammen außerhalb der Legalität, sie hatten weder eine offizielle Zulassung noch eine Ausbildung. Das bedeutete, dass eine Hebamme bei einer schiefgegangenen Entbindung eine Anklage wegen unerlaubter Arzttätigkeit riskierte; ging die Entbindung richtig schief, musste sie mit einer Anklage wegen Totschlags und einer Haftstrafe rechnen. Dieses Risiko gingen nur wenige Frauen ein, weswegen Hebammen rar waren: An dem Tag, als Judy nach Wyoming aufbrach, war Mutter die einzige Hebamme im Umkreis von hundertfünfzig Kilometern.
Nun kamen Frauen mit dicken Bäuchen zu uns und baten Mutter, sie zu entbinden. Mutter wurde blass bei dem Gedanken. Eine Frau saß auf der Kante unseres abgewetzten gelben Sofas, den Blick zu Boden gerichtet, und erklärte, ihr Mann sei arbeitslos und sie habe kein Geld fürs Krankenhaus. Mutter saß still da, der Blick gerade, die Lippen fest, der ganze Ausdruck einen Moment lang stabil. Dann löste sich der Ausdruck auf, und sie sagte mit ihrer kleinen Stimme: »Ich bin keine Hebamme, nur Assistentin.«
Die Frau kam noch einige Male, saß wieder und wieder auf unserem Sofa und beschrieb die unkomplizierten Geburten ihrer anderen Kinder. Oft, wenn Dad den Wagen der Frau vom Schrottplatz aus sah, kam er ins Haus, leise, durch die Hintertür, vorgeblich, um Wasser zu trinken; dann stand er in der Küche, trank langsam lautlose Schlucke, die Ohren zum Wohnzimmer hin gespitzt. Und wenn die Frau dann ging, war Dad ganz aufgeregt, sodass Mutter, sei es angesichts der Verzweiflung der Frau oder Dads Hochgefühl, schließlich nachgab.
Die Geburt lief glatt. Die Frau hatte eine Freundin, die ebenfalls schwanger war, und Mutter entband auch sie. Dann hatte diese Frau eine Freundin. Mutter nahm sich eine Assistentin, und schon bald entband sie so viele Babys, dass Audrey und ich unsere Tage damit verbrachten, mit ihr im Tal herumzufahren, wo sie Schwangerschaftsuntersuchungen vornahm und Kräuter verschrieb. Sie wurde zu unserer Lehrerin wie nie zuvor, denn zu Hause gab es nur selten Unterricht. Sie erklärte jedes Mittel, jede Schmerztherapie. War der Blutdruck zu hoch, war Weißdorn angezeigt, um das Kollagen zu stabilisieren und die Herzkranzgefäße zu erweitern. Kamen vorzeitige Wehen, war ein Ingwerbad nötig, um die Sauerstoffzufuhr im Uterus zu steigern.
Die Arbeit als Hebamme veränderte meine Mutter. Sie war eine erwachsene Frau mit sieben Kindern, nun aber war sie zum ersten Mal in ihrem Leben diejenige, die frag- und vorbehaltlos bestimmte. Manchmal entdeckte ich in den Tagen nach einer Geburt bei ihr etwas von Judys starker Präsenz, wie sie nachdrücklich den Kopf drehte und eine Augenbraue gebieterisch wölbte. Sie trug nun kein Make-up mehr, dann entschuldigte sie sich auch nicht mehr dafür.
Mutter berechnete für eine Entbindung rund fünfhundert Dollar, und auch darin veränderte ihre Arbeit als Hebamme sie: Auf einmal hatte sie Geld. Dad fand nicht, dass Frauen arbeiten sollten, aber vermutlich fand er es schon in Ordnung, dass Mutter für ihre Hebammendienste bezahlt wurde, weil das die Regierung schwächte. Zudem brauchten wir das Geld. Dad arbeitete härter als jeder, den ich kannte, aber Schrotthandel und der Bau von Scheunen und Heuschuppen brachten wenig ein, und es half, dass Mutter Lebensmittel mit den kleinen Scheinen bezahlen konnte, die sie in ihrer Geldbörse hatte. Manchmal, wenn wir den ganzen Tag im Tal herumgesaust waren, um Kräuter auszuliefern und geburtsvorbereitende Gespräche zu führen, führte sie Audrey und mich zum Essen aus. Oma-in-der-Stadt hatte mir ein Tagebuch geschenkt, pink mit einem karamellfarbenen Teddybären vorn drauf, und darin machte ich meinen ersten Eintrag, als Mutter mit uns in ein Restaurant ging, das ich als »richtig schick mit Speisekarte und allem« beschrieb. Dem Eintrag zufolge kostete meine Mahlzeit 3,30 Dollar.
Mutter gab das Geld auch für die Vertiefung ihrer Kenntnisse als Hebamme aus. Sie kaufte eine Sauerstoffflasche für den Fall, dass ein Neugeborenes nicht allein atmen konnte, und sie absolvierte einen Nähkurs, damit sie die Frauen, deren Damm riss, nähen konnte. Judy hatte Frauen, die genäht werden mussten, immer ins Krankenhaus geschickt, Mutter dagegen war entschlossen, es selbst zu machen. Autarkie war wohl der Gedanke dahinter.
Mit dem Rest des Geldes ließ Mutter eine Telefonleitung legen. Eines Tages erschien dann ein weißer Lieferwagen, und eine Handvoll Männer in dunklen Overalls kletterten auf den Strommasten am Highway herum. Dad kam durch die Hintertür gestürmt und fragte, was zum Teufel da los sei. »Ich dachte, du wolltest ein Telefon«, sagte Mutter, der Blick so voller Überraschung, dass er nichts mehr sagen konnte. Schnell redete sie weiter: »Du hast doch selbst gesagt, es könnte Ärger geben, wenn eine die Wehen bekommt und Oma nicht da ist, um den Anruf anzunehmen. Da hab ich gedacht: Er hat recht, wir brauchen ein Telefon! Wie dumm von mir! Hab ich da was missverstanden?«
Dad stand mehrere Sekunden lang mit offenem Mund da, dann sagte er, natürlich, eine Hebamme braucht ein Telefon, und ging zurück auf den Schrottplatz. Danach wurde die Sache nicht mehr erwähnt. Solange ich denken konnte, hatten wir kein Telefon gehabt, aber am nächsten Tag war es da mit seiner lindgrünen Gabel und wirkte mit seinem schimmernden Gehäuse neben den trüben Gläsern mit Frauenwurz und Helmkraut fehl am Platz.
Luke war fünfzehn, als er Mutter fragte, ob er eine Geburtsurkunde haben könne. Er wollte bei Driver’s Ed einsteigen, weil Tony, unser ältester Bruder, gutes Geld mit Lkw-Fahren verdiente; das konnte er, weil er einen Führerschein hatte. Shawn und Tyler, die nach Tony kamen, hatten schon eine Geburtsurkunde, nur die vier Jüngsten – Luke, Audrey, Richard und ich – hatten keine.
Mutter machte sich an den Papierkram. Ich weiß nicht, ob sie es vorher mit Dad besprochen hatte. Falls ja, ist mir sein Sinneswandel nicht erklärlich – dass mit einem Mal eine zehn Jahre alte Richtlinie, sich nicht bei der Regierung anzumelden, kampflos aufgegeben wurde –; es wird wohl das Telefon gewesen sein. Fast war es, als hätte mein Vater schließlich akzeptiert, dass er, wollte er sich wirklich mit der Regierung anlegen, gewisse Risiken eingehen musste. Dass Mutter Hebamme war, mochte das medizinische Establishment untergraben, aber als Hebamme brauchte sie auch ein Telefon. Vielleicht wurde diese Logik ja auf Luke ausgedehnt: Luke brauchte ein Einkommen, um eine Familie zu ernähren, um Vorräte anzulegen und sich auf das Ende aller Tage vorzubereiten, also brauchte er auch eine Geburtsurkunde. Die andere Möglichkeit ist, dass Mutter Dad gar nicht fragte. Vielleicht beschloss sie es einfach für sich, und er akzeptierte es. Vielleicht wurde sogar er – dieser charismatische Baum von einem Mann – von ihrer Gewalt zeitweise weggeweht.
Als sie mit dem Papierkram für Luke anfing, befand Mutter, dass sie dann auch gleich für uns alle Geburtsurkunden besorgen konnte. Das war schwieriger, als sie gedacht hatte. Mutter stellte das Haus auf den Kopf auf der Suche nach Dokumenten, die bewiesen, dass wir ihre Kinder waren. Sie fand nichts. In meinem Fall wusste niemand so genau, wann ich geboren worden war. Mutter hatte ein Datum in Erinnerung, Dad ein anderes, und Oma-von-unten, die im Bezirksgericht eine eidesstattliche Erklärung abgegeben hatte, dass ich ihre Enkelin bin, hatte noch ein drittes angegeben.
Mutter rief bei der Kirchenzentrale in Salt Lake City an. Dort fand man einen Taufschein von mir, als ich ein Baby war, und eine Urkunde für eine weitere Taufe, die ich wie alle Mormonenkinder mit acht bekommen hatte. Mutter bat um jeweils eine Kopie. Sie trafen einige Tage später mit der Post ein. »Ach, du liebe Güte!«, sagte Mutter, als sie den Umschlag öffnete. Auf jedem Dokument stand ein anderes Geburtsdatum, und keines war das, was Oma bei ihrer eidesstattlichen Erklärung angegeben hatte.
In der Woche telefonierte Mutter jeden Tag stundenlang. Den Hörer zwischen Hals und Schulter eingeklemmt, die Schnur quer durch die Küche gespannt, kochte sie, putzte, verarbeitete Gelbwurzel und Benediktenkraut zu Tinkturen und führte dabei immer die gleichen Gespräche.
»Natürlich hätte ich sie bei der Geburt registrieren lassen sollen, aber ich hab’s nicht getan. Jetzt haben wir den Salat.«
Am anderen Ende der Leitung murmelten Stimmen.
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt – und Ihrem Untergebenen und dessen Untergebenem und noch fünfzig weiteren diese Woche – sie hat eben weder Schul- noch medizinische Unterlagen. Nein, sie hat keine! Sie sind nicht verloren gegangen. Ich kann auch keine Kopien anfordern. Es gibt sie nicht!«
»Ihr Geburtstag? Sagen wir, der siebenundzwanzigste.«
»Nein, sicher bin ich mir da nicht.«
»Nein, ich habe keine Unterlagen.«
»Ja, ich bleibe dran.«
Immerzu setzten die Stimmen sie in die Warteschleife, wenn sie zugab, dass sie meinen Geburtstag nicht kannte, leiteten sie an ihre Vorgesetzten weiter, so als würde die Unkenntnis meines genauen Geburtsdatums der gesamten Vorstellung, ich hätte eine Identität, die Berechtigung entziehen. Ohne Geburtstag kann man kein Mensch sein, sagten sie offenbar. Warum, das verstand ich nicht. Bis Mutter beschloss, mir eine Geburtsurkunde zu beschaffen, hatte ich es nie komisch gefunden, mein Geburtsdatum nicht zu kennen. Ich wusste, dass ich irgendwann Ende September geboren wurde, und jedes Jahr wählte ich mir einfach einen Tag, Hauptsache, er fiel nicht auf einen Sonntag, weil es nicht lustig ist, den Geburtstag in der Kirche zu verbringen. Manchmal wünschte ich, Mutter würde mir den Hörer geben, damit ich es selbst erklären konnte. »Ich habe einen Geburtstag, genau wie Sie«, wollte ich den Stimmen sagen. »Er wechselt nur. Würden Sie Ihren Geburtstag nicht auch gern wechseln wollen?«
Schließlich überredete Mutter Oma-von-unten, eine neue eidesstattliche Erklärung abzugeben, ich sei am siebenundzwanzigsten geboren, auch wenn Oma weiterhin glaubte, es sei der neunundzwanzigste gewesen, worauf der Staat Idaho eine nachträgliche Geburtsurkunde ausgab. Ich weiß noch, wie sie mit der Post kam. Ich empfand es wie eine Enteignung, diesen ersten rechtlichen Beweis meines Menschseins in Händen zu halten. Bis zu dem Moment war mir nie in den Sinn gekommen, dass dafür ein Beweis erforderlich war.
Letztlich bekam ich meine Geburtsurkunde viel früher als Luke die seine. Als Mutter den Stimmen am Telefon gesagt hatte, sie glaube, ich sei in der letzten Septemberwoche geboren, waren sie verstummt. Aber als sie ihnen sagte, sie sei sich nicht ganz sicher, ob Luke im Mai oder Juni auf die Welt gekommen war, erhob sich ein regelrechtes Stimmengewirr.
In dem Herbst, als ich neun war, nahm Mutter mich zu einer Geburt mit. Ich hatte sie schon monatelang bedrängt und sie daran erinnert, dass Maria in meinem Alter schon ein Dutzend Geburten erlebt hatte. »Ich stille nicht«, sagte sie. »Es gibt keinen Grund, dich mitzunehmen. Außerdem würde es dir auch gar nicht gefallen.«
Dann wurde Mutter von einer Frau bestellt, die schon mehrere kleine Kinder hatte. Man beschloss, dass ich währenddessen auf sie aufpassen sollte.
Der Anruf kam mitten in der Nacht. Das mechanische Klingeln bohrte sich durch den Flur, und ich hielt den Atem an in der Hoffnung, dass niemand sich verwählt hatte. Gleich darauf stand Mutter an meinem Bett. »Los geht’s«, sagte sie, und zusammen rannten wir zum Auto.
Zwanzig Kilometer lang übte Mutter mit mir, was ich sagen sollte, falls der schlimmste Fall eintrat und das FBI kam. Unter keinen Umständen dürfe ich sagen, dass meine Mutter Hebamme sei. Sollten sie mich fragen, warum wir dort seien, sollte ich nichts sagen. Mutter nannte es »die Kunst des Klappehaltens«. »Du sagst einfach nur, du hast geschlafen und nichts gesehen und du weißt gar nichts und auch nicht mehr, warum wir hier sind«, sagte sie. »Gib ihnen nicht noch mehr Grund, mich dranzukriegen, als sie eh schon haben.«
Mutter verstummte. Ich musterte sie, während sie fuhr. Ihr Gesicht war von den Instrumentenlichtern erhellt und vor dem Tiefschwarz der Landstraßen gespenstisch weiß. Angst war in ihre Züge gemeißelt, in der gewölbten Stirn und den zusammengepressten Lippen. Allein nur mit mir, legte sie die Persona ab, die sie für andere bereithielt. Sie war nun wie früher, fragil, verzagt.
Ich hörte leises Flüstern und erkannte, dass es von ihr kam. Sie sagte sich vor, was alles passieren konnte. Und wenn etwas schiefging? Wenn es eine Vorerkrankung gab, die man ihr nicht gesagt hatte, eine Komplikation? Oder wenn es etwas Gewöhnliches war, eine übliche Krise, und sie in Panik geriet, erstarrte, die Blutung nicht rechtzeitig stoppen konnte? In wenigen Minuten würden wir da sein, dann würden zwei Leben in ihren kleinen, zitternden Händen liegen. Bis zu dem Augenblick war mir das Risiko, das sie da einging, überhaupt nicht klar gewesen. »Im Krankenhaus sterben auch Leute«, flüsterte sie, und ihre Finger umklammerten das Steuer wie ein Geist. »Manchmal ruft Gott sie zu sich, dann kann niemand was machen. Aber wenn das einer Hebamme passiert …« Sie drehte sich zu mir her und sagte: »Nur ein Fehler, dann kannst du mich im Gefängnis besuchen.«
Wir kamen an, und Mutter verwandelte sich. Sie gab eine Reihe von Befehlen aus, an den Vater, die Mutter und an mich. Fast vergaß ich, ihre Aufträge auszuführen, da ich sie immerzu ansehen musste. Heute wird mir klar, dass ich sie in jener Nacht zum ersten Mal sah, ihre geheime Stärke sah.
Sie bellte Befehle, und wir führten sie wortlos aus. Das Kind kam ohne Komplikationen. Es war mythisch und romantisch, unmittelbar Zeugin dieser Wendung im Kreislauf des Lebens zu sein, aber Mutter hatte recht gehabt, es gefiel mir nicht. Es war lang und erschöpfend, und es roch nach Schweiß.
Bei der nächsten Geburt bat ich nicht mehr, dabei zu sein. Mutter kam bleich und zitternd zurück. Mit bebender Stimme erzählte sie mir und meiner Schwester die Geschichte: dass die Herzfrequenz des Kindes gefährlich abgesunken sei, bis auf einen bloßen Tremor, dass sie den Krankenwagen gerufen habe, sie dann aber fand, dass sie nicht warten konnten, und sie die Mutter in ihren Wagen gepackt habe. Dass sie so schnell gefahren sei, dass sie mit einem Geleitschutz der Polizei beim Krankenhaus angekommen sei. In der Notaufnahme versuchte sie, den Ärzten zu erklären, was los war, ohne zu kenntnisreich zu wirken – sie sollten nicht auf die Idee kommen, sie könnte eine Hebamme ohne Lizenz sein.
Sie machten einen Not-Kaiserschnitt. Mutter und Kind blieben noch einige Tage im Krankenhaus, und als sie dann entlassen wurden, hatte Mutter auch aufgehört zu zittern. Sie war sogar fast in Hochstimmung und erzählte die Geschichte anders, genoss geradezu den Moment, als sie von dem Polizisten angehalten worden war, der zu seiner Überraschung auf dem Rücksitz eine stöhnende Frau sah. »Ich hab die schusselige Frau gemimt«, erzählte sie mir und Audrey und wurde dabei immer lauter. »Die Männer glauben gern, sie retten eine hirntote Frau, die sich selbst in die Bredouille gebracht hat. Ich musste bloß zur Seite treten und ihn den Helden spielen lassen!«
Der gefährlichste Moment für Mutter kam Minuten später, im Krankenhaus, nachdem sie die Frau in den OP gebracht hatten. Ein Arzt hielt Mutter an und fragte sie, warum sie überhaupt bei der Geburt dabei gewesen sei. Bei der Erinnerung daran musste sie lächeln. »Ich hab ihm die blödesten Fragen gestellt, die mir eingefallen sind.« Sie nahm eine hohe, kokette Stimme an, ganz anders als die ihre: »Oh! Das war der Kopf des Babys? Kommen die denn nicht mit den Füßen zuerst raus?« Da war der Arzt überzeugt, dass sie unmöglich eine Hebamme sein konnte.
In Wyoming fand sich keine Kräuterfrau, die so gut wie Mutter war, daher kam Judy einige Monate nach dem Vorfall im Krankenhaus zum Buck Peak, um ihren Vorrat aufzufüllen. Die beiden Frauen plauderten in der Küche, Judy auf einem Barhocker, Mutter über den Tresen gebeugt, den Kopf lässig auf die Hand gestützt. Ich nahm die Liste mit den Kräutern und lief ins Lager. Maria, ein anderes Baby auf dem Arm, folgte mir. Ich zog getrocknete Blätter und trübe Flüssigkeiten von den Borden, wobei ich unablässig über Mutters Heldentaten schwafelte und mit der Sache im Krankenhaus endete. Maria hatte auch Geschichten parat, in denen sie dem FBI aus dem Weg gingen, doch schon als sie dazu ansetzte, unterbrach ich sie.
»Judy ist sicher eine gute Hebamme«, sagte ich, und meine Brust schwoll an. »Aber bei Ärzten und Cops stellt sich keine so dumm wie meine Mutter.«
3. KapitelCremefarbene Schuhe
Meine Mutter, Faye, war die Tochter eines Postboten. Sie wuchs in der Stadt auf, in einem gelben Haus mit einem weißen Lattenzaun, der mit lila Iris gesäumt war. Ihre Mutter war Näherin, die beste im Tal, wie manche sagten, daher trug Faye als junge Frau schöne Kleider, alle perfekt geschnitten, von Samtjacken und Polyesterhosen bis zu wollenen Hosenanzügen und Gabardinekleidern. Sie ging zur Kirche und nahm an Veranstaltungen der Schule und der Gemeinde teil. Ihr Leben verströmte strenge Ordnung, Normalität und unangreifbare Respektabilität.
Diese Respektabilität war sorgfältig von ihrer Mutter ausgeheckt worden. Meine Großmutter, LaRue, war in den Fünfzigerjahren volljährig geworden, im Jahrzehnt des idealistischen Fiebers, das nach dem Zweiten Weltkrieg brannte. LaRues Vater war Alkoholiker, als die Sprache von Sucht und Empathie noch gar nicht erfunden war, als Alkoholiker noch Säufer genannt wurden. Sie stammte aus einer »falschen« Familie, war aber in einer frommen Mormonengemeinde integriert, die wie viele Gemeinden die Verbrechen der Eltern an den Kindern ahndeten. Die ehrbaren Männer der Stadt hielten sie für nicht heiratsfähig. Als sie meinen Großvater kennenlernte und heiratete – einen gutherzigen jungen Mann, der gerade von der Marine heimgekehrt war –, widmete sie sich dem Aufbau der perfekten Familie, wenigstens nach außen hin. Das, so glaubte sie, werde ihre Töchter von der gesellschaftlichen Verachtung abschirmen, die sie so verletzt hatte.
Ein Ergebnis waren der weiße Lattenzaun und der Schrank mit den selbst genähten Kleidern. Ein weiteres war, dass ihre älteste Tochter einen strengen jungen Mann mit kohlschwarzen Haaren und einem Hang zum Unkonventionellen heiratete.
Das heißt, meine Mutter reagierte trotzig auf die Ehrbarkeit, die ihr aufgebürdet wurde. Oma wollte ihrer Tochter das schenken, was sie selbst nie gehabt hatte, nämlich aus einer guten Familie zu kommen. Doch das wollte Faye nicht. Meine Mutter war keine Sozialrevolutionärin – noch auf dem Höhepunkt ihrer Rebellion bewahrte sie sich ihren mormonischen Glauben mit seiner Verehrung von Ehe und Mutterschaft –, doch die sozialen Veränderungen der Siebziger hatten immerhin eine Wirkung auf sie: Sie wollte keinen weißen Lattenzaun und auch keine Gabardinekleider.
Meine Mutter erzählte mir Dutzende Geschichten aus ihrer Kindheit, wie Oma sich um die gesellschaftliche Stellung ihrer Tochter sorgte, ob ihr Piquékleid ordentlich geschnitten war oder ihre Samthose das korrekte Blau hatte. Diese Geschichten endeten fast immer damit, dass mein Vater hereinkam und die Samthose gegen eine Jeans eintauschte. Besonders eine ist mir in Erinnerung geblieben. Ich bin sieben oder acht und mache mich in meinem Zimmer für den Kirchgang fertig. Ich wische mir gerade mit einem Waschlappen Gesicht, Hände und Füße, nur die Haut, die zu sehen sein wird. Mutter sieht mir zu, wie ich mir das Baumwollkleid über den Kopf ziehe, das ich mir wegen seiner langen Ärmel ausgesucht habe, damit ich mir nicht auch die Arme waschen muss, und da glimmt in ihren Augen Neid.
»Wenn du Omas Tochter wärst«, sagt sie, »dann wären wir schon bei Sonnenaufgang aufgestanden, um dir die Haare zu bürsten. Den weiteren Vormittag hätten wir uns damit herumgeschlagen, welche Schuhe, die weißen oder die cremefarbenen, den richtigen Eindruck machen.«
Mutters Gesicht verzerrt sich zu einem hässlichen Grinsen. Sie müht sich um einen Witz, doch die Erinnerung ist bitter. »Selbst nachdem wir uns endlich für die cremefarbenen entschieden hätten, wären wir zu spät gekommen, weil Oma in letzter Minute in Panik geraten wäre und unbedingt noch zu Cousine Donna fahren und deren cremefarbene Schuhe hätte leihen wollen, weil die einen niedrigeren Absatz hatten.«
Mutter starrt aus dem Fenster. Sie hat sich in sich zurückgezogen.
»Weiß oder Creme?«, sage ich. »Ist das nicht dieselbe Farbe?« Ich besaß nur ein Paar Kirchenschuhe, und die waren schwarz, jedenfalls waren sie schwarz gewesen, als sie noch meiner Schwester gehörten.
In meinem Kleid trete ich wieder vor den Spiegel, rasple mir die Dreckkruste vom Hals und denke, welches Glück Mutter gehabt hatte, einer Welt entflohen zu sein, in der es einen wichtigen Unterschied zwischen Weiß und Cremefarben gab, wo mit solchen Fragen ein richtig guter Vormittag draufgehen konnte, den man sonst damit hätte verbringen können, Dads Schrottplatz mit Lukes Ziege zu plündern.
Mein Vater, Gene, gehörte zu den jungen Männern, die es irgendwie schaffen, feierlich und spitzbübisch zugleich zu wirken. Seine äußere Erscheinung war auffallend – pechschwarze Haare, strenges, kantiges Gesicht, die Nase wie ein Pfeil, der auf wilde tief sitzende Augen zeigte. Seine Lippen waren häufig zu einem amüsierten Grinsen zusammengepresst, als könnte er über die ganze Welt lachen.
Obwohl ich meine Kindheit auf demselben Berg verbrachte wie mein Vater die seine, die Schweine im selben Eisentrog fütterte, weiß ich doch sehr wenig über seine Jugendzeit. Er redete nie darüber, ich hatte also immer nur Andeutungen von meiner Mutter, die mir erzählte, Opa-von-unten sei in jüngeren Jahren brutal und aufbrausend gewesen. Mutters Gebrauch des Wortes »gewesen« kam mir immer seltsam vor. Wir alle wussten, dass man Opa besser nicht reizte. Er explodierte schnell, das war einfach so, das hätte einem jeder im Tal sagen können. Er war wettergegerbt, innen wie außen, so straff und struppig wie die Pferde, die er frei auf dem Berg laufen ließ.
Dads Mutter arbeitete als Versicherungsvertreterin in der Stadt. Als Erwachsener entwickelte Dad krasse Meinungen über arbeitende Frauen, die selbst für unsere ländliche Mormonen-Gemeinde radikal waren. »Eine Frau gehört ins Haus«, sagte er jedes Mal, wenn er in der Stadt eine verheiratete Frau arbeiten sah. Heute, da ich älter bin, frage ich mich manchmal, ob Dads Eifer mehr mit seiner Mutter als der reinen Lehre zu tun hatte, ob er sich einfach nur gewünscht hatte, dass sie zu Hause gewesen wäre, damit er nicht die vielen Stunden mit Opas Wutausbrüchen allein war.
Die Arbeit auf der Farm rieb Dads Jugend auf. Ich habe Zweifel, ob er das College erwog. Ich weiß nicht einmal, ob er die Highschool abschloss.
Trotzdem, nach den Erzählungen meiner Mutter platzte Dad damals vor Energie, Gelächter und Elan. Er fuhr einen babyblauen VW Käfer, trug ausgefallene Sachen aus bunten Stoffen und lief mit einem dicken modischen Schnauzbart herum.
Sie lernten sich in der Stadt kennen. Faye kellnerte an einem Freitagabend in der Bowlingbahn, als Gene mit einer Horde seiner Vettern im Schlepp hereinstolzierte. Sie hatte ihn noch nie gesehen, also wusste sie gleich, dass er nicht aus der Stadt war und aus den Bergen um das Tal herum stammen musste. Das Leben auf der Farm hatte Gene anders als andere junge Männer gemacht: Er war ernst für sein Alter, körperlich imposanter und ein unabhängiger Geist.