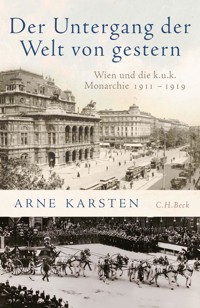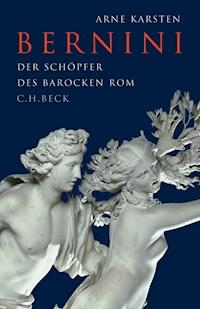
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gianlorenzo Bernini erwarb seinen Ruhm vor allem als der große Baumeister und Bildhauer des römischen Barock: als Architekt von Petersdom und Petersplatz und als Schöpfer einzigartig bewegter, dramatischer Skulpturen. In seinem langen Leben diente er nicht weniger als acht Päpsten und beeindruckte die Zeitgenossen als Universalgenie. Arne Karsten leuchtet in seiner glänzend geschriebenen Biographie neben dem vielfältigen Werk Berninis auch das soziale und politische Umfeld aus, in dem der Künstler agierte und seine Erfolge feierte. Zugleich erzählt er von den Intrigen, den Exzessen und Wutausbrüchen des Künstlers, der mit seinen hochgestellten Auftraggebern zwar meisterhaft umzugehen wusste, aber alles andere als ein farbloser Karrierist war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Arne Karsten
BERNINI
Der Schöpfer des barocken Rom
Leben und Werk
C.H.Beck
Zum Buch
Gianlorenzo Bernini (1598–1680) erwarb seinen Ruhm vor allem als der große Baumeister und Bildhauer des römischen Barock: als Architekt von Petersdom und Petersplatz und als Schöpfer einzigartig bewegter, dramatischer Skulpturen. In seinem langen Leben diente er nicht weniger als acht Päpsten und beeindruckte die Zeitgenossen als Universalgenie. Der Historiker und Kunsthistoriker Arne Karsten leuchtet in seiner glänzend geschriebenen Biographie neben dem reichen Werk Berninis auch das soziale und politische Umfeld aus, in dem der Künstler agierte und seine Erfolge feierte. Zugleich erzählt er von den Intrigen, den Exzessen und Wutausbrüchen Berninis, der mit seinen hochgestellten Auftraggebern zwar meisterhaft umzugehen wusste, aber alles andere als ein farbloser Karrierist war.
«Spätestens seit Dan Browns Bestseller Illuminati kennt alle Welt seinen Namen: Gianlorenzo Bernini. Kein anderer hat Rom so geprägt wie er. Nun der spannende Blick hinter die blendende Künstler-Fassade: Bernini als Choleriker und Lebemann, virtuoser Taktiker und Intrigant.» Stern
«Arne Karsten fesselt mit einer Karriere- und Charakterstudie des Barockstars Gianlorenzo Bernini.» Ulrike Knöfel, Der Spiegel
«Arne Karstens Bernini-Buch ist die Gesamtschau einer Epoche.» Dirk Schümer, FAZ
Über den Autor
Arne Karsten, Dr. phil. habil., ist Historiker und Kunsthistoriker und lehrt Geschichte der Neuzeit an der Bergischen Universität Wuppertal. Bei C.H.Beck sind von ihm lieferbar: Kleine Geschichte Venedigs (2008) und Geschichte Venedigs (2012).
Inhalt
Vorwort
Vorwort zur Neuauflage
Der Schöpfer des barocken Rom
Die zwei Gesichter des Gianlorenzo Bernini
Biographen und Archivare
Anfänge: Die Jahre unter Paul V. und Gregor XV. (1605–1623)
Eine glückliche Kindheit?
Rom zur Zeit Pauls V. (1605–1621)
Frühe Meisterwerke
Aeneas und Anchises
Ein Karriereknick
Der Raub der Proserpina
Ein Bildnis des Künstlers als junger Held
Zwischen den Zeiten: Das erhitzte Konklave des Jahres 1623
Im Glanz des Barberini-Hofes. Bernini und Urban VIII. (1623–1644)
Auf dem Weg nach oben
Die Familie Barberini und ihre Gefolgschaft
Apoll und Daphne
Der Baldachin von St. Peter
Feindschaften
Die Borgia-Krise
Glanzvolle Feste
Die Vierung von St. Peter und Francesco Mochi
Der «Herr der Welt»
Späte Heirat
Francesco Barberini
Castro und die Folgen
Schwierige Zeiten. Die Herrschaft Innozenz’ X. (1644–1655)
Unruhige Tage – Das Konklave des Jahres 1644
Dies irae
Die Niederlage seines Lebens
Die Rückkehr des lebenden Toten
Die heilige Teresa und der ehrgeizige Kardinal Cornaro
Auferstehung
Staatsräson im Bild
Der Papst ist tot, es lebe der Papst!
Höhe des Lebens? Die Jahre der Herrschaft Alexanders VII. (1655–1667)
Am Hof des Chigi-Papstes
Der Petersplatz
Die «Scala regia»
Christina von Schweden
Die Galleria Colonna
Sant’Andrea al Quirinale
Die Korsenaffaire
Die Frankreichreise
Die Ludwigs-Büste
Im Dienste der Familie Chigi
Posthume Siege
Der Tod des Widersachers
Dem Ende entgegen
Der Rospigliosi-Pontifikat
Der alte Mann und die Macht
Der Sanierer
«And my ending is despair»
Anhang
Anmerkungen
Italienkarte
Zeittafel
Bibliographie
Abbildungsnachweis
Personenregister
Vorwort
In die vorliegende Arbeit über Leben und Werk des Gianlorenzo Bernini sind die Ergebnisse mehrjähriger Studien zum Thema «Rom im Zeitalter des Barock» eingeflossen, und mit ihnen die Anregungen und Hinweise aus zahllosen Gesprächen mit Freunden und Kollegen, für die an dieser Stelle zu danken nur einen allzu schwachen Eindruck davon vermittelt, wie viel ich ihnen schulde.
Mein besonderer Dank gilt den Kollegen am Forschungsprojekt «REQUIEM – Die römischen Papst- und Kardinalsgrabmäler der frühen Neuzeit», Philipp Zitzlsperger und Carolin Behrmann an erster Stelle; zunächst für intensive Diskussionen über Berninis Leben und Werk sowie ihre gründliche Durchsicht des Manuskriptes und zahlreiche Anregungen und Korrekturen; nicht weniger jedoch für ihre Großzügigkeit und menschliche Aufmerksamkeit, dank derer die Arbeit am gemeinsamen Projekt in den vergangenen Jahren nicht nur viel Freude bereitet hat, sondern darüber hinaus eine prägende Lebenserfahrung geworden ist. Den Projektleitern, Horst Bredekamp und Volker Reinhardt, sei herzlich gedankt für die Verbindung von Förderung und Gewährung von Freiräumen, mit der sie die Arbeit seit Jahren begleiten, Volker Reinhardt außerdem für seine sorgfältige Lektüre des Manuskriptes und stets hilfreiche Kritik. Franziska Facile hat mich bei der Zusammenstellung der Abbildungen und den Druckvorbereitungen mehr als nur unterstützt. Peter Stephan danke ich herzlich für wertvolle Hinweise bei den Vorbereitungen der 2.Auflage.
Auch Daniel Büchel verdankt diese Bernini-Biographie vielfältige Anregungen, ebenso Ulrich Köchli, der mir zudem mit der ihm eigenen Generosität unpubliziertes Quellenmaterial aus der Arbeit an seiner Studie zum Barberini-Pontifikat zur Verfügung gestellt hat. Karin und Leo Zitzlsperger haben das Manuskript in einer frühen Fassung mit großer Aufmerksamkeit gelesen und dem Verfasser nicht allein Hinweise auf so manche argumentative Nachlässigkeit zukommen lassen, sondern ihm auch bewusst gemacht, wie viel man über die Regeln der deutschen Kommasetzung wissen kann.
Beim Verlag C.H.Beck hat sich Alexandra Schumacher mit einer Sorgfalt und einem Engagement des Manuskriptes angenommen, wie es heutzutage bei geisteswissenschaftlichen Verlagen nicht mehr selbstverständlich ist. Auch ihr sei herzlich gedankt!
Am meisten jedoch sind das Werk und sein Autor Almut Goldhahn zu Dank verpflichtet, die sich um beide mit viel Liebe gekümmert hat.
Berlin, am 31. März 2007
Vorwort zur Neuauflage
«So viel wie nötig, so wenig wie möglich» war die Maxime, der ich bei der Überarbeitung dieser Bernini-Biographie, zehn Jahre nach ihrem ersten Erscheinen, gefolgt bin. Neue Erkenntnisse der Forschung wurden verschiedentlich eingearbeitet, ohne die Erzählstruktur des Buches zu verändern, die Bibliographie um die wichtigsten Neuerscheinungen ergänzt. Stefanie Hölscher und Beate Sander vom Verlag C.H.Beck sei für die einmal mehr überaus angenehme Zusammenarbeit herzlich gedankt!
Wuppertal, am 9. November 2017
Der Schöpfer des barocken Rom
Die zwei Gesichter des Gianlorenzo Bernini
Für die einen war er «jener Drache, der unermüdlich über die Gärten der Hesperiden wachte und sicher stellte, dass kein anderer nach den Äpfeln päpstlicher Gunst greifen konnte»,[1] ein ebenso ehrgeiziger wie egozentrischer Karrierist, der neben sich keine Kollegen oder gar Konkurrenten duldete. Von anderer Seite hingegen wurde ihm bescheinigt, er sei «ein seltener Mensch, von sublimer Begabung, durch göttliches Wirken geboren, um zum Ruhme Roms Licht in dieses Jahrhundert zu tragen».[2] Keine Frage, an Gianlorenzo Bernini schieden sich die Geister. Eines jedoch steht außer Zweifel: er war das, was man gemeinhin als «Großer Mann» bezeichnet. Kein anderer Künstler hat das Stadtbild Roms in vergleichbarer Weise geprägt. Seine Produktivität lässt sich in Qualität und Vielfalt allenfalls mit derjenigen Michelangelos vergleichen, dem zeitlebens von Bernini bewunderten Vorbild. Der «Michelangelo seines Jahrhunderts» wollte er werden – und wurde von den Zeitgenossen auch tatsächlich so gesehen und genannt.[3]
Nun ist es mit «großen Männern» so eine Sache. Ihre Größe geht oftmals einher mit wenig anziehenden Charakterzügen, und wenn man fragt, ob der persönliche Umgang mit ihnen stets erfreulich sei, so sind in aller Regel einige Vorbehalte anzuführen, um es vorsichtig zu formulieren. Gianlorenzo Bernini jedenfalls, den man ohne Übertreibung als den Schöpfer des barocken Rom bezeichnen kann, vereinte in sich irritierend widersprüchliche Eigenschaften. Seit jeher gilt er als die geradezu vollkommene Verkörperung des «Hofkünstlers», der es mit Virtuosität verstand, sich auf dem glatten Parkett der höfischen Gesellschaft zu bewegen. Und soviel ist daran richtig, dass er seinen Erfolg nicht zuletzt der Fähigkeit verdankte, im Umgang mit den päpstlichen und adligen Auftraggebern stets den rechten Ton zu treffen, gemischt aus Bescheidenheit und Selbstbewusstsein. Sein Charme und seine Produktivität, sein schlagfertiger Esprit, seine unermüdliche geistige Präsenz, kurz: die Intensität seiner Persönlichkeitswirkung müssen die Zeitgenossen immer wieder aufs Neue fasziniert haben – in den Quellen finden sich zahllose Hinweise darauf.
Daneben aber stand die andere Seite, nicht unvermittelt, sondern eher als Komplementärstück, dunkel, drohend, destruktiv. Der geistreiche Witz konnte unversehens in blanke Boshaftigkeit umschlagen, oft brillant, doch bitter für das Opfer, das, willentlich oder unabsichtlich, Berninis Reizbarkeit herausgefordert hatte. Seine Produktivität war staunenerregend, nicht weniger jedoch die Egozentrik, mit der er danach strebte, die Aufmerksamkeit der Umwelt auf sich allein zu lenken. Obwohl er es als Leiter einer beständig wachsenden, glänzend organisierten Werkstatt mit Dutzenden von Mitarbeitern zu tun hatte, lag ihm nichts ferner als Teamarbeit, die auf die sensible Berücksichtigung der Interessen von Untergebenen und Angestellten achtet. Im Umgang mit den Kollegen legte er im besten Fall die kalte Toleranz der Gleichgültigkeit an den Tag; oft genug jedoch verhielt er sich rüde oder gar beleidigend. Überhaupt: die Tatsache, dass es Kollegen gab, scheint ihm entschieden unangenehm gewesen zu sein – jedenfalls, soweit sie nicht tot und damit als Konkurrenten ungefährlich waren. Der wohlstilisierten Formvollendung, mit der er sich am päpstlichen Hof zu bewegen wusste, standen Wutausbrüche von eruptiver Gewalt gegenüber, die ihn zumindest in einem Fall um ein Haar zum Mörder hätten werden lassen; es war reiner Zufall, dass es, wie man heute sagen würde, bei «versuchtem Totschlag in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung und Hausfriedensbruch» blieb. Und während der einzigen großen Reise, die er in seinem Leben unternahm, verstand er zwar auf der einen Seite Ludwig XIV., den Sonnenkönig, durch seine gewitzten Schmeicheleien glänzend zu unterhalten. Seine übrigen Gesprächspartner jedoch bekamen anderes zu hören: endlose Mäkeleien über die französische Kunst, die Lernbedürftigkeit der französischen Architekten, die Minderwertigkeit der französischen Handwerker. Verständlich, dass sich in Paris die Begeisterung über den berühmten Italiener in engen Grenzen hielt.
Wer also war Gianlorenzo Bernini? Es ist an dieser Stelle auf die grundlegende Problematik jeder «psychologisierenden Annäherung» an geschichtliche Größen hinzuweisen, die immer in der Gefahr schwebt, ihr Studienobjekt zur beliebigen Projektionsfläche zu machen. In den unzähligen Trivialbiographien mehr oder minder bedeutender Gestalten der Vergangenheit kann man das einfache Strickmuster, dem sie ihre Existenz verdanken, ohne große Mühe durchschauen: mit Hilfe von ein paar bunt kostümierten Puppen, denen man die Ideen, Wertvorstellungen und Ideale der Gegenwart in den Mund legt, wird Karl der Große unversehens zum Bannerträger der Völkerverständigung, Lorenzo de’Medici zum Vorkämpfer der Demokratie und Christina von Schweden zur Begründerin der Frauenbewegung. Kitsch, so hat Jorge Luis Borges einmal konstatiert, sei eine spanische Wand vor dem Tod. Und eine solche Art von Geschichtswahrnehmung wäre nach dieser Definition hochgradig kitschig, indem sie nämlich über die Vergänglichkeit der Menschen, die Zeitgebundenheit ihrer Wertvorstellungen und Weltwahrnehmung hinwegzutäuschen sucht.
Doch gilt es festzuhalten, dass selbst bei sorgfältig-skrupulöser wissenschaftlicher Arbeit ein gewisses Maß an Subjektivität, an unwillkürlich interpretierender Wahrnehmung der Vergangenheit unvermeidlich ist und unweigerlich zu Verzerrungen führt. Geschichte «ist» nun einmal nicht, sie wird erst durch das auswählende Auge des Historikers gemacht,[4] der selbst beim sorgsamsten Blick auf die Nachrichten aus der Vergangenheit nicht aus seiner Haut kann, und das heißt konkret: die Darstellung durch die Auswahl dessen, was ihn interessiert, prädisponiert. So bleibt alle historische Forschung zeitgebunden, vergänglich wie die Menschen, von denen sie handelt. In besonderem Maße gilt das für die Beschäftigung mit etwas so schwer zu Begreifendem wie einem individuellen Menschenschicksal. Das Fremde und Fremdgewordene verstehen zu suchen, ohne aber das grundsätzliche Anders-Sein zu übertünchen, ist vermutlich seit jeher eine Kernaufgabe historischer Forschung gewesen und zugleich die Garantie dafür, dass bei aller Freude an der Erkenntnis die Beschäftigung mit der Vergangenheit immer nur zu Ergebnissen von heiterskeptisch zu beurteilender Vorläufigkeit führt.
Allein, was bleibt uns übrig? Wenn wir nicht als Opfer der Tageseindrücke an der Oberfläche unserer eigenen Zeit umhergeworfen werden wollen, dann hilft letztlich nur der Blick in den Brunnen der Vergangenheit, im vollen Bewusstsein, dass er, ein Dichterwort zu zitieren, nicht nur tief, sondern unergründlich genannt werden sollte. Aber auch wenn alle historische Erkenntnis unvollkommen und ihrem Wesen nach zeitgebunden bleibt, so sind doch wenigstens Annäherungen an die historische Wahrheit möglich, an Rankes berühmte Forderung, zu zeigen, «wie es eigentlich gewesen». Im Falle Gianlorenzo Berninis weitgehende Annäherungen, weitergehende jedenfalls, als gegenüber den allermeisten seiner Zeitgenossen. Über kaum einen Menschen des 17. Jahrhunderts wissen wir mehr als gerade über ihn. Um zu verstehen, warum, ist ein Blick auf die Quellen nötig.
Biographen und Archivare
Die wichtigsten Zeugnisse über das Leben des Gianlorenzo Bernini stellen zwei Lebensbeschreibungen dar, die schon sehr bald nach seinem Tod im November 1680 verfasst wurden. Die erste entstammt der Feder seines jüngsten Sohnes, Domenico Bernini, der im Jahre 1657 geboren wurde. Ursprünglich hätte er in den Jesuitenorden eintreten sollen, heiratete jedoch schon in jungen Jahren und lebte dank des reichen väterlichen Erbes als Privatgelehrter seinen historischen Studien, die in einem umfangreichen und durchaus anspruchsvollen Werk über die «Geschichte der Häresien» kulminierten.[5] Enthusiastischer Bewunderer von Werk und Person des Vaters, machte er sich unmittelbar nach dessen Tod an die Arbeit, Material zu sammeln, um eine Lebensgeschichte zu verfassen, die sich nicht nur auf mündliche Nachrichten aus erster Hand, sondern auch auf eine beträchtliche Anzahl von Briefen und anderen schriftlichen Quellen stützt.
Domenico Berninis Vita erschien erst im Jahre 1713 im Druck, was dazu führte, dass lange Zeit die «Vita del Cavaliere Gianlorenzo Bernini» von Filippo Baldinucci für die früheste Lebensbeschreibung des Künstlers gehalten wurde.[6] Bei Baldinucci handelte es sich um einen mäßigen Maler und kompetenten Kunstkenner aus Florenz, dessen anerkannte Fähigkeiten als Connaisseur ihm einen ehrenvollen Platz in der kulturellen Entourage des Großherzogs Ferdinand II. der Toskana eintrugen. Im April 1681 begab sich Baldinucci nach Rom und erhielt dort von der künstlerisch überaus interessierten Königin Christina von Schweden, einer glühenden Bewunderin Berninis, den Auftrag, eine Biographie des kaum ein halbes Jahr zuvor verstorbenen Künstlers zu verfassen. Baldinucci ging sogleich mit Eifer ans Werk, und dabei kam ihm zugute, dass ihm Domenico Bernini seine eigenen Studien zur Verfügung stellte.[7] Hier und da zog Baldinucci auch andere Quellen zu Rate, aber alles in allem beruht seine Arbeit zu wesentlichen Teilen auf den Angaben des jüngeren Bernini.
Sowohl in der Vita, die Domenico Bernini verfasste, als auch beim weitgehend von ihm abhängigen Baldinucci finden sich zahlreiche Elemente von stilisierter Memoriabildung, mit der so etwas wie eine urkatholische Prädestination des Künstlers zum Dienst an Kirche und Glauben konstruiert werden soll. Die Hinweise auf die früh hervortretende Begabung des jungen Gianlorenzo entbehren gewiss nicht des wahren Kerns, erfahren aber eine Deutung, die sie in die Nähe eines Quasi-Wunders im nahezu religiösen Sinne rückt. Besonders in dieser Hinsicht sind die Angaben der beiden Autoren mit Vorsicht zu behandeln und, gerade was ihre Beschreibung der frühen Jahre Gianlorenzo Berninis angeht, mitunter nachweislich falsch. Auch sonst sind sie geflissentlich darum bemüht, ihren Helden in möglichst hellem Glanz erstrahlen zu lassen; zu den Schattenseiten des Protagonisten, den charakterlichen Schwächen oder seinem mitunter eigenwilligen Benehmen, findet sich bei ihnen nur hier und da ein vorsichtiger Hinweis, und auch der oft nur, wenn man zwischen den Zeilen zu lesen versteht.
Weniger hagiographischen Charakter als diese beiden Werke hat das unschätzbare Tagebuch, das Paul Fréart Sieur de Chantelou, ein französischer Adeliger, während des Aufenthaltes Berninis in Paris 1665 führte.[8] Chantelou fungierte in dieser Zeit als persönlicher Betreuer des berühmten Künstlers und sah ihn in dem halben Jahr, das Bernini an der Seine verbrachte, beinahe täglich. Sein Tagebuch ist ohne Zweifel geprägt von der Bewunderung und persönlichen Sympathie, die er, der gebildete aristokratische Dilettant, dem anerkannten Großmeister entgegenbrachte. Doch sorgt die fast protokollhafte Genauigkeit, mit welcher der Autor Tag für Tag die Ereignisse aufnahm, für einen ungewöhnlich direkten Blick auf das Denken und Verhalten des «Cavaliere», wie Chantelou ihn durchgängig nennt. Lange Passagen enthalten kunsttheoretische Reflexionen Berninis, die für das Verständnis seiner Kunstauffassung von grundlegender Bedeutung sind. Interessanter noch, und für eine Biographie zweifellos auch bedeutsamer, erscheinen freilich die unwillkürlichen, nicht reflektierten Äußerungen des Künstlers; und schließlich sein alltägliches Benehmen, die Lebens- und Arbeitsgewohnheiten, sein Umgang mit der Umwelt, seien es Berufskollegen (die wenig Freude an ihm hatten) oder Angehörige der glanzvollen französischen Hofgesellschaft (die auch allerlei Gelegenheit bekamen, sich über sein Verhalten zu wundern). Chantelou notierte alles, den Gemüts- und Gesundheitszustand, die täglichen Aktivitäten, Besuche beim König, bei Angehörigen des Hochadels, bei Antiquaren und die Teilnahme an Gottesdiensten, Berninis Ansichten über die bildenden Künste, über die Unterschiede zwischen Rom und Paris. Er berichtet detailliert von der praktischen Arbeit Berninis an den Entwürfen für den Louvreneubau und der Porträtbüste des Königs, von geistreichen Bonmots wie von unkontrollierten Wutausbrüchen, und gestattet uns damit einen Blick auf jenen «alltäglichen» Bernini, der in den sauber stilisierten Briefen und formelhaft verkürzten Berichten der Zeit nicht zu fassen ist.
Freilich sind auch letztere von erheblicher Bedeutung für die Rekonstruktion seines Lebens. Angesichts der außerordentlichen Produktivität Berninis und seines spätestens seit den späten zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts europaweiten Renommees, finden sich Nachrichten über ihn in vielen Archiven Italiens und Europas.[9] Interessant sind zumal die in den avvisi di Roma, Vorläufern der späteren Zeitungen, enthaltenen Informationen nicht zuletzt deshalb, weil die avvisi die Ereignisse in Rom in der Regel unkommentiert schildern und damit der tendenziösen Deutung unverdächtig sind. Auffällig oft ist in ihnen vom «Cavaliere» – Bernini trug diesen Titel seit 1621 – die Rede: Kaum ein anderes Künstlerleben der Frühen Neuzeit dürfte von den Zeitgenossen so aufmerksam beobachtet und beschrieben worden sein wie dasjenige des Gianlorenzo Bernini. Ein unmissverständliches Zeichen für den Ruhm, den er zu Lebzeiten genoss.
Und mit dem es schon sehr bald nach seinem Tode vorbei war. Bernini, dessen Werke das Bild der Ewigen Stadt in so hohem Grade prägten, geriet in einen Misskredit, an dem zunächst der Bedeutungsverlust des Papsttums im 18. Jahrhundert, dann die Antikenbegeisterung des bürgerlichen 19. Jahrhunderts die Hauptschuld trugen.[10] Besonders folgenreich wirkte sich die Ablehnung der barocken Kunstsprache durch Jacob Burckhardt aus. Dem Basler Protestanten verschlossen sich die geistigen Grundlagen des römischen Barock und die ihm zugrunde liegende Weltsicht der katholischen Universalkirche; zumindest waren sie ihm zutiefst suspekt. Seine Verdikte über die Arbeiten Berninis zeitigten Folgen, zumal beim deutschen protestantischen Bildungsbürgertum, womöglich bis in die Gegenwart. Zwar nicht in den Kreisen der Kunsthistoriker, die Bernini schon seit längerem wiederentdeckt und seinem Werk eine wahre Flut von Studien gewidmet haben. Doch außerhalb der Fachgelehrten-Zunft hat sich Skepsis gehalten: Kann Kunst in einer so überschwenglich-suggestiven, sinnlichen Form, wie sie uns in der «Apoll-und-Daphne-Gruppe» oder in der «Heiligen Teresa» in Santa Maria della Vittoria entgegentritt, gute Kunst sein, ja, handelt es sich überhaupt noch um Kunst, und nicht vielmehr um eine Art «Edelkitsch»?
Um diese Frage zu beantworten, wird man versuchen müssen, die Zeitumstände zu rekonstruieren, in der diese Kunst entstanden ist, nicht nur das Leben ihres Schöpfers, sondern auch die physische, psychische und geistige Umwelt, in der sich sein Dasein abspielte. Vollständigkeit im Sinne einer Werkmonographie ist dabei in keiner Weise angestrebt. Viele, mitunter auch bedeutende Werke Berninis werden nicht einmal angesprochen werden, in einigen Passagen wird vom Künstler und seinen Arbeiten kaum oder gar nicht die Rede sein. Ausblicke auf politische, gesellschaftliche, religiöse oder kulturelle Kontexte sollen, dies ist zumindest meine Hoffnung, dazu beitragen, das Verständnis für die Umwelt, in der und für (oder auch gegen) die Bernini agierte, zu vertiefen. Denn darum wird es im Folgenden gehen: um das Nachzeichnen eines Lebensweges, doch nicht in selbstzweckhafter Weise, sondern um mit ihm zugleich Einblick in eine Epoche zu gewinnen, jene Epoche des römischen Barock, in der die entscheidenden künstlerischen Impulse für ganz Europa zum letzten Mal aus Italien kamen.
Anfänge: Die Jahre unter Paul V. und Gregor XV. (1605–1623)
Eine glückliche Kindheit?
Gianlorenzo Bernini wurde am 7. Dezember 1598 in Neapel geboren. Wenige Jahre später, im Herbst 1606, zog die Familie nach Rom, wo der Vater, Pietro Bernini, ein tüchtiger, aber keineswegs herausragender Bildhauer, im Dienste Papst Pauls V. Borghese (1605–1621) Arbeit gefunden hatte. Schon bald konnte er sich in der Ewigen Stadt nicht nur über wohlgefüllte Auftragsbücher freuen, sondern ebenso über die früh ans Licht tretende, herausragende Begabung seines Sohnes. Der Vater förderte sie mit Eifer und Geschick. Die Konstellation im Hause Bernini glich derjenigen in der Musikerfamilie Mozart anderthalb Jahrhunderte später, und wie der junge Wolfgang Amadeus erhielt auch Gianlorenzo schon als Kind Gelegenheit, seine frühreife Begabung vor dem Papst zu demonstrieren. Paul V., neugierig geworden auf den kleinen Nachwuchskünstler, empfing ihn im Vatikan und fragte ihn, ob er ein Gesicht zeichnen könne. Statt einer Antwort bekam er die selbstbewusste Gegenfrage gestellt, was für ein Gesicht er denn wünsche? Worauf der Pontifex meinte, wenn es so sei, dann könne er wohl alle beliebigen Köpfe machen, und ihm befahl, einen Kopf des Heiligen Paulus zu zeichnen. Das Ergebnis, mit raschen, sicheren Strichen zu Papier gebracht, setzte den Papst und seinen Hofstaat in Erstaunen.
«Se non è vero, è ben trovato» – «wenn es nicht wahr ist, dann gut erfunden», so ließe sich die von Berninis Sohn und erstem Biographen Domenico überlieferte Anekdote kommentieren.[1] Natürlich rückt sie den Künstler in ein strahlendes Licht, woran Bernini Zeit seines Lebens Gefallen fand. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass die Geschichte eine spätere Erfindung sein muss. Denn die Familie Bernini war in diesen Jahren im Dienste der Borghese tätig, und der kleine Gianlorenzo wurde schon sehr früh an den Arbeiten in der Werkstatt des Vaters beteiligt. Unter diesen Umständen erscheint es nicht unplausibel, dass die kulturell aufgeschlossene Hofgesellschaft den Pontifex darauf hingewiesen hat, hier sei ein ungewöhnliches, frühreifes Talent zu bestaunen.
Entscheidend aber ist, dass der junge Gianlorenzo Bernini sehr bald durch besondere Begabung auffiel,[2] nicht nur aufgrund seiner schon im kindlichen Alter stupenden Fähigkeiten im Umgang mit Marmor und Zeichenstift, sondern ebenso aufgrund des Eifers, mit der er an der Entwicklung dieser Fähigkeiten arbeitete. Tag für Tag begab sich der Junge vom väterlichen Wohnhaus bei Santa Maria Maggiore quer durch das gesamte damals besiedelte römische Stadtgebiet zum Vatikan, um dort die berühmte Antikensammlung zu studieren, das heißt zu zeichnen, so lange es das Tageslicht zuließ. Dort blieb er dann Stunde um Stunde, oft bis in den späten Abend, so dass ihn der Vater mitunter tagelang nicht zu Gesicht bekam. Doch nicht nur die antiken Statuen faszinierten ihn, sein Interesse galt ebenso der jüngeren und jüngsten Malerei, den Arbeiten Raffaels und Michelangelos, der Carracci-Brüder und Guido Renis. Und stets hielt er mit dem Zeichenstift fest, was er sah. Domenico Bernini berichtet, die in diesen Kindheitsjahren entstandenen Studienzeichnungen hätten sich erhalten, sie lägen ihm vor, «und ich kann bestätigen, dass kaum ein Menschenleben genügt, all diese Dinge auch nur mit den Augen zu sehen, die er damals im Zeitraum von gerade einmal drei Jahren zeichnete.»[3]
Es stellt sich die Frage nach den Ursachen des jugendlichen Schaffensfurors: welcher Genius führte, oder, anders gedeutet, welcher Dämon trieb den jungen Gianlorenzo, wenn er unermüdlich weiterarbeitete, dieweil seine Brüder und die Mitarbeiter des Vaters sich längst den behaglichen Freuden des Feierabends hingaben? Ohne Zweifel spielte eine wichtige Rolle, dass er hohe «Anerkennungsprämien» für seine Lernbegierde durch den stolzen Vater bekam. Auch hier ist der Vergleich mit dem jungen Mozart hilfreich, dessen Kindheit und Jugend Norbert Elias eine anregende Untersuchung gewidmet hat,[4] in der die früh entwickelten außerordentlichen Fähigkeiten des Kindes als Ergebnis des Zusammenspiels von «Begabung», so schwer zu fassen dieser Begriff auch ist, technisch-handwerklicher Förderung und geschickter emotionaler Steuerung durch den Vater gedeutet werden. Pietro Bernini bewies eine glückliche Hand im Umgang mit seinem hochbegabten Kind. Dazu gehörte nicht zuletzt, dass er genug Größe besaß, sich mit der eigenen Mittelmäßigkeit abzufinden. Als der kunstsinnige Kardinal Maffeo Barberini eines Tages beim Anblick einiger früher Skulpturen des jungen Gianlorenzo dem Vater unverblümt ins Gesicht sagte, er werde wohl von den Arbeiten seines Sohnes bei weitem in den Schatten gestellt werden, replizierte Pietro Bernini gelassen: «Wer in diesem Spiel verliert, gewinnt.»[5] Eine weise Antwort, und eine glaubwürdige zudem. Denn die Begabung des jungen Gianlorenzo hätte sich wohl kaum so glänzend entwickeln können, wenn nicht der Vater fordernd und fördernd, zugleich aber ohne Neidgefühle das ungewöhnliche Talent des Kindes wahrgenommen hätte.
Doch die Sensibilität und das Engagement des Vaters reichen als Erklärung für die staunenerregende Behendigkeit kaum aus, mit welcher der Sohn sich Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignete, wie sie für sein Alter außergewöhnlich waren. Es ist kaum anzunehmen, dass seine Brüder (Gianlorenzo besaß deren fünf) anders behandelt wurden, oder jedenfalls anders behandelt worden wären, hätten sie ein vergleichbares Talent und eine ähnliche Lernbereitschaft gezeigt. Die rasche Auffassungsgabe, eine bemerkenswerte Fähigkeit zur konzentrierten Anspannung seines Geistes, mit der es ihm gelang, sich neue Eindrücke binnen kürzester Zeit in ihrer wesentlichen Substanz anzueignen und ins Produktive umzusetzen, sollte Bernini Zeit seines Lebens bewahren; wir werden noch des Öfteren auf Beispiele dafür stoßen. Jedenfalls entwickelte er sich schon bald nicht nur zum Vorzeigekünstler am Papsthof, sondern auch zu einem unverzichtbaren Mitarbeiter in der Werkstatt seines Vaters.
Rom zur Zeit Pauls V. (1605–1621)
Damit wird es höchste Zeit, für einen Moment die Blickrichtung zu wechseln und die Aufmerksamkeit der betriebsamen Bildhauerwerkstatt Pietro Berninis zuzuwenden: den Kunstwerken, die dort entstanden, den Mitarbeitern, die sie schufen, vor allem aber dem kulturellen und gesellschaftlichen, kurz, dem historischen Ambiente, das sie prägte.
Es ist das Rom zur Zeit Papst Pauls V. Borghese (1605–1621), eine Stadt von etwas mehr als 100.000 Einwohnern. Groß mithin nach den Maßstäben der Zeit, wenn auch bei weitem nicht die größte Stadt Italiens: Palermo etwa und Neapel, ebenso Venedig und Mailand zählten wesentlich mehr Menschen in ihren Mauern. Dennoch übertraf Rom an künstlerischem Glanz alle Metropolen dieser Epoche, nicht nur die italienischen. Das lag an den Päpsten und ihrer eigentümlichen Doppelrolle als Souveräne des Kirchenstaates und Oberhäupter der katholischen Christenheit. Das Papsttum stellte in den Jahren zu Beginn des 17. Jahrhunderts wenn auch keine europäische Großmacht mehr, so doch unzweifelhaft eine Macht von europäischer Bedeutung dar. Alle größeren katholischen Staaten unterhielten diplomatische Vertretungen am Tiber, am aufwendigsten die Erzrivalen Spanien und Frankreich, im säkularen Kampf um die Vorherrschaft in Europa ineinander verbissen und darum bemüht, ihren Einfluss an der Kurie zu verteidigen und nach Möglichkeit auszubauen. Doch auch die Staaten Mittel- und Oberitaliens, etwa die Republiken Genua und Venedig oder das Großherzogtum Toskana (s. Italienkarte S. 251), achteten sorgsam auf eine angemessene Präsenz am Papsthof, der dementsprechend von zeitgenössischen Beobachtern als «Theater der europäischen Politik» bezeichnet wurde.[6] Dieses Bild war nicht schlecht gewählt. Auf der Bühne am Tiber agierten schließlich nicht nur die diplomatischen Gesandten, sondern, in Abstimmung mit ihnen, freilich oftmals auch in Konkurrenz, Angehörige des geistlichen Standes. Zumal die Kardinäle, jene im «Heiligen Senat» der Kirche vereinten bis zu 70 Spitzenkleriker, die in dieser Epoche zumeist ausgebildete Juristen und versierte Politiker, nur selten jedoch Berufs-Theologen waren.[7] Dementsprechend erwies sich das Konklave, die Wahl eines neuen Papstes, stets von Neuem als ein Politikum ersten Ranges. Hinter den Kulissen kämpften die verschiedenen Faktionen erbittert um die Durchsetzung von Favoriten und Verhinderung von Feinden. So zogen sich die Verhandlungen oft über Wochen oder gar Monate hin.
War die Wahl entschieden, vollzog sich jedes Mal aufs Neue das gleiche Spiel: der frisch gekürte Pontifex besetzte die Schlüsselpositionen in Politik und Verwaltung mit seinen Gefolgsleuten, und das hieß in einer Epoche, die politische Parteien im modernen Sinne nicht kannte, mit Verwandten und Freunden – wobei letzterer Begriff in einem funktionalen Sinn zu verstehen ist.[8] Auf diese Weise erlangte alle paar Jahre eine neue Familie mit einem Schlag den Status eines europäischen Herrscherhauses, denn als Souverän des Kirchenstaates war der Papst ein Fürst unter Fürsten. Für die meist aus der gehobenen Mittelschicht stammenden Angehörigen des neuen Nachfolgers Petri bedeutete das einen sozialen Quantensprung, doch handelte es sich um eine Herrlichkeit auf Zeit, die mit dem Tod des Familienpontifex unvermeidlich ihr Ende fand. Denn die nächste Generation von Nepoten (Neffen) folgte sogleich und verdrängte die Vorgänger mehr oder minder rücksichtslos aus ihren einflussreichen und lukrativen Positionen. Daraus resultierte ein ausgeprägtes Wettbewerbsklima in der römischen «guten Gesellschaft», eine Art sozialer Hyperkonkurrenz: die Verhältnisse wandelten sich mit oftmals atemberaubender Geschwindigkeit und zudem in kaum vorhersehbarer Weise. Zu dem Zeitpunkt etwa, da die Familie Bernini von Neapel nach Rom zog, war das Drei-Päpste-Jahr 1605 noch in lebhafter Erinnerung. Nach dem Tod Clemens’ VIII. Aldobrandini hatte am 1. April jenes Jahres Leo XI. de’Medici den Stuhl Petri bestiegen, zum Jubel der Franzosen, denen er seit langem verbunden war, und ebenso der Florentiner, denn er entstammte einer Seitenlinie des berühmten Florentiner Herrscherhauses. Doch auf den Jubel folgte schon bald Entsetzen, als nämlich der neue Pontifex nach vier Wochen starb. Mit der Wahl Camillo Borgheses als Paul V. ergaben sich ganz neue gesellschaftliche und politische Konstellationen – diesmal triumphierten die Spanier sowie in besonderem Maße die Angehörigen und Freunde einer Juristenfamilie aus Siena, die erst seit einer Generation in Rom ansässig war. Was der römische Volksmund boshaft, aber nicht unzutreffend kommentierte:
Nach den Carafa, den Medici, Farnese
Bereichert sich von nun an – das Haus Borghese.[9]
Freilich nur bis zum Ende des Pontifikats. Mit anderen Worten: Erfolg und Misserfolg, Aufstieg und Abstieg wechselten rasch, und dieser Sachverhalt war im Wesentlichen verantwortlich für das unvergleichlich angeregte kulturelle und künstlerische Klima im Rom dieser Jahre.
Denn all die vergleichsweise traditionsarmen Aufsteigerfamilien, diejenigen der Päpste besonders (aber auch unter den Kardinälen und ihren Angehörigen gab es eine Vielzahl von Emporkömmlingen), sahen sich gehalten, die womöglich kurze Zeit im Glanz der Gnadensonne des Pontifex dazu zu nutzen, Kapital zu akkumulieren, und zwar nicht nur wirtschaftliches, sondern ebenso soziales und kulturelles. Wachsende Einnahmen gestatteten die Knüpfung von prestigeträchtigen Eheverbindungen, und man tat gut daran, beides, Einnahmen wie Eheverbindungen, mit künstlerischer Pracht zu veredeln, welche die bedrohliche Traditionsarmut und das daraus resultierende Legitimationsdefizit werbewirksam übertünchte. Mehr noch: mit jedem neuen Papst wechselte nicht nur das politische, sondern auch das künstlerische Establishment, denn in dem Bemühen, sich von den verfeindeten Vorgängern abzusetzen, sahen sich die papstverwandten Parvenüs gehalten, ihre Kultiviertheit durch die «Entdeckung» neuer Künstler unter Beweis zu stellen. Abgesehen davon gab es, wenn eine Papstfamilie nicht aus Rom stammte, und das war die Regel, landsmannschaftliche Bindungen zu beachten; wir werden Beispiele dafür noch in Fülle finden.
Große Auftragsvolumen und Zwang zur Innovation: kein Wunder, dass die künstlerische Produktivität in Quantität wie Qualität alle übrigen Städte Europas in diesen Jahren in den Schatten stellte und überall, sogar über die Konfessionsgrenzen hinweg, eifrig rezipiert wurde. Zu den Nutznießern dieser Situation gehörte Pietro Bernini, der, wie fast alle in Rom tätigen Künstler, nicht in der Ewigen Stadt geboren worden war, sondern in Sesto Fiorentino, einem nahe Florenz gelegenen Provinznest. Der einst so strahlende kulturelle Glanz der Stadt am Arno war schon seit längerem im Verblassen begriffen, und so begab sich Pietro Bernini gleich vielen seiner Kollegen in die Ewige Stadt, nahm zwischenzeitlich einige Aufträge im zum spanischen Weltreich gehörenden Neapel an und zog schließlich 1606 erneut nach Rom, wo er sich in der Nähe von Santa Maria Maggiore ein zweistöckiges Haus mit großem Atelier errichtete.
Offensichtlich beabsichtigte der Bildhauer, sich dauerhaft am Tiber niederzulassen; Arbeit würde es auf absehbare Zeit genug geben. Tatsächlich entstand in der Berninis neuem Haus gegenüberliegenden Patriarchalkirche Santa Maria Maggiore just in diesen Jahren eine Grabkapelle, wie sie selbst das Grablegen-Eldorado Rom noch nicht gesehen hatte: Paul V. trug frühzeitig Sorge für ein angemessenes Gedenken an seine Person und seine Herrschaft und ließ in der Cappella Paolina ein Ensemble errichten, das nicht nur sein eigenes Erinnerungsmonument, sondern auch noch dasjenige für seinen Vorgänger Clemens VIII. (1592–1605) umfasste. Auf Kosten der Apostolischen Kammer gönnte sich der Pontifex ein Grabmal der Superlative, das durch seine schiere Größe, vor allem aber die Verwendung edelster Materialien am Ende fast das Vierfache der gegenüberliegenden Kapelle Sixtus’ V. kostete, und insgesamt so viel wie Fassade und Langhaus von St. Peter zusammen.[10] Neben den monumentalen Skulpturen der hier verewigten Päpste erzählten großflächige Reliefs von deren bedeutendsten Taten, vor allem von gewonnenen Schlachten gegen die Ungläubigen und von aufwendigen Baumaßnahmen. Einige dieser Reliefs wurden Pietro Bernini zur Ausführung übertragen, und dieser, seit jeher alles andere als ein Spezialist für lebenswirkliche Porträts, mochte froh sein, dass ihm hier zum ersten Mal bei einem großen Auftrag sein hochbegabter Sohn zur Hand ging und das Gesicht Clemens’ VIII. schuf. Wenig später folgten Gianlorenzos erste eigenständig geschaffene Skulpturen, die bereits ahnen ließen, dass eine Revolution der römischen Bildhauerei bevorstand.
Frühe Meisterwerke
Angesichts der gängigen Arbeitspraxis in Bildhauerwerkstätten, verschiedene Künstler an einem Werk zu beschäftigen, ist es nicht immer ganz einfach zu sagen, wer für einzelne Skulpturen in der Hauptsache verantwortlich war. Eine der ersten Figuren, bei denen an der Autorschaft Gianlorenzo Berninis kein Zweifel besteht, ist der Hl. Lorenzo (Abb.1). Es handelt sich um den Namenspatron des Künstlers, und Bernini soll diese Statue aus persönlicher Frömmigkeit und Verehrung für den frühchristlichen Märtyrer geschaffen haben. Das mag stimmen; dass Bernini ein gläubiger Katholik war, ist vielfach belegt. Später verkaufte er die Skulptur an den Grafen Leone Strozzi, der sie in seiner römischen Villa aufstellte und somit auch als Auftraggeber in Frage käme. Vielleicht handelte es sich dabei aber auch um den Kardinal Maffeo Barberini,[11] auf den noch zurückzukommen sein wird.
Die Statue, die im Laufe des Jahres 1617 entstand, muss auf die Betrachter atemberaubend gewirkt haben, zunächst schon allein aufgrund der technischen Virtuosität, mit der sie gestaltet worden war. Denn die Darstellung des Martyriums, das der Heilige Lorenzo im Zuge der Christenverfolgungen unter Kaiser Valerian im Jahre 258 n. Chr. erlitten haben soll, stellte ungewöhnliche Anforderungen an die Fähigkeiten eines Bildhauers. Er wurde nämlich auf einem Rost im wahrsten Sinne des Wortes gegrillt – was im Übrigen dem Heiligen den Humor nicht verschlagen haben soll: nach einiger Zeit forderte er die Folterknechte auf, ihn zu wenden, auf der unteren Seite sei er jetzt gar.[12] Eine gern und oft erzählte Anekdote im nachtridentinischen Rom, wo angesichts der existenzbedrohenden Kritik der Protestanten am Heiligenkult die Verehrung gerade der frühchristlichen Märtyrer mit ihrer traditions- und damit legitimationsstiftenden Wirkung eine wahre Blütezeit erlebte.[13] Zumal in Rom entwickelte sich in diesen Jahrzehnten der Besuch der Katakomben nachgerade zu einer Mode, und das kam nicht zuletzt dem Heiligen Laurentius zugute, seit jeher einer der Schutzpatrone der Römer. Nur eben, wie gesagt, für einen Bildhauer ein dankbares, aber alles andere als einfaches Sujet aufgrund der Hinrichtungsweise. Wie sollte ausgerechnet im Medium des statischen Marmors die zerstörerische Wirkung der züngelnden Flammen gestaltet werden?
Dass der gerade einmal achtzehnjährige Künstler vor dieser Aufgabe nicht zurückschreckte, spricht für sein Selbstbewusstsein. Die Lösung, die er fand, ist noch nicht von der Vollkommenheit, die er wenige Jahre später bei der Apoll-und-Daphne-Gruppe erreichte, doch überzeugend allemal. Durch hell-dunkel-Effekte wird die unruhige Lichtwirkung des Feuers angedeutet; einige Flammenzungen lecken am Körper des Heiligen, dessen expressives Pathos in Gestik und Mimik jedoch dafür sorgt, dass die Aufmerksamkeit des Betrachters ihm gewiss ist. Bernini stellte ihn in dem Moment dar, da der Tod eintritt, die Augen brechen, die Muskeln des gequälten Körpers sich entspannen, besonders deutlich zu erkennen an den Fingern der linken Hand. Die Darstellung einer Handlung auf ihrem Höhe- und Umschlagpunkt ist neu, geradezu revolutionär, und sollte in der Folgezeit prägend für die römische Barockskulptur werden.
Abb. 1 Skulptur des Hl. Lorenzo, Sammlung Conti Bonacossi, Florenz (1617)
Einen vorbildlicheren, ästhetisch ansprechenderen und zugleich in seiner religiösen Glaubensstärke überzeugenderen Heiligen konnte man sich wahrlich nicht wünschen! Die Kreise der gebildeten römischen Oberschicht, zumal ihre kulturell besonders interessierten Vertreter, waren begeistert. Vor allem Kardinal Maffeo Barberini, in diesen Jahren Präfekt der Segnatura di Giustizia, dem wichtigsten gerichtlichen Appellationstribunal des Kirchenstaates, zeigte sich enthusiastisch. Barberini, geboren 1568, stammte wie Pietro Bernini aus Florenz und war im Alter von 20 Jahren nach Rom gekommen. In der Folgezeit hatte er an der Kurie eine Bilderbuchkarriere absolviert, deren wichtigste Stationen die Nuntiatur am französischen Königshof von 1604 bis 1607 und wenig später die Tätigkeit als päpstlicher Legat, also oberster Verwaltungschef, im zum Kirchenstaat gehörenden Bologna darstellten. Selbstbewusst, energisch und überaus eitel, bewegte sich Barberini mit diplomatischem Geschick und politischem Talent am Hof des Papstes. Sein Ruf als «kommender Mann» profitierte zudem in hohem Maße von seinen kulturellen Neigungen. Selbst ein nicht unbegabter Schriftsteller, der einige Bücher mit lateinischen Gedichten veröffentlicht hatte, zeigte er Interesse an künstlerischen Neuerungen aller Art. Sein waches Auge fiel rasch auf den vielversprechenden jungen Bildhauer, der dem Kardinal eine Skulptur des Heiligen Sebastian schuf, auch sie gleichermaßen bemerkenswert im Hinblick auf die Virtuosität der Meißelhandhabung wie die Expressivität der Formensprache (Abb. 2). Diese Arbeit markiert den Beginn einer lebenslangen Verbindung.
Abb. 2 Hl. Sebastian, Sammlung Thyssen-Bornemisza, Lugano (1617)
Man wäre versucht, von Freundschaft zu sprechen, würde dieser Begriff nicht die sozialen Abstände zwischen dem Künstler und dem Kirchenfürsten in missverständlicher Weise verwischen. Lassen wir es also dabei, von einer geradezu idealtypischen Beziehung zwischen gebildetem Mäzen und geistreichem Künstler zu sprechen, von der beide auf ihre Weise profitieren sollten.
Aeneas und Anchises
Die frühen Arbeiten Gianlorenzo Berninis waren erstaunlich genug. Der Durchbruch jedoch, mit dem er auf einen Schlag zum umjubelten Nachwuchsstar unter den römischen Bildhauern wurde, gelang ihm mit der Aeneas-und-Anchises-Gruppe (Abb. 3), die er 1618, im Alter von noch nicht 20 Jahren, für Kardinal Scipione Borghese, den Neffen des regierenden Papstes, geschaffen hatte. Dieser hatte sich vor den Toren der Stadt für die gewaltige Summe von mehr als 200.000 scudi (zum Vergleich: Ein Handwerker verdiente im 17. Jahrhundert etwa 70–80 scudi im Jahr) eine prächtige Villa errichten lassen, noch heute ein Anziehungspunkt für Römer und Romtouristen gleichermaßen. Die Villa diente der repräsentativen Selbstdarstellung des Kardinalnepoten, und in diesen Kontext passte die Skulptur hervorragend; schon aufgrund des gewählten Themas. Es ist die in Vergils Aeneis erzählte Geschichte des Trojaners Aeneas, dem es gelingt, aus der von den Griechen eroberten brennenden Vaterstadt zu fliehen, um nach göttlichem Willen und langen Irrfahrten schließlich in Latium zu landen und dort nach Kämpfen mit den einheimischen Herrschern zum Stammvater der Römer zu werden. Die römische Weltherrschaft, so glaubte man in der Antike, fand ihren Ursprung und ihre Rechtfertigung in der Verheißung, die dem Aeneas von Seiten der Götter zuteil wurde: «Idem venturos tollemus in astra nepotes»,[14] «dereinst werden wir die Nachfahren zu den Sternen erheben», so heißt es in der Aeneis.