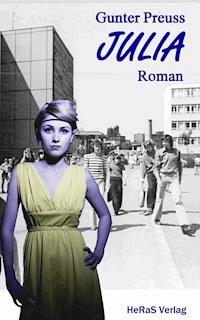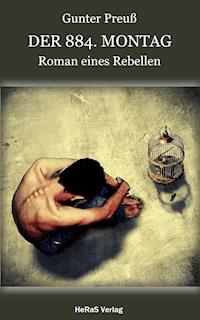Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit den hier vorliegenden Geschichten aus dem vollen Menschenleben, die Preuß "Berührungen" titelt, trifft er mitten in eines der Hauptprobleme gegenwärtiger und (wie zu befürchten ist) kommender Generationen: die zunehmende Berührungslosigkeit. Die Prosastücke spielen in deutscher Vergangenheit (1973 – 2006), die uns wie alles Gewesene, ob es uns genehm ist oder nicht, im Gegenwärtigen anhängt und im Kommenden begleiten wird. In dieser Anthologie finden sich bereits veröffentlichte Kurzgeschichten, Erzählungen und Auszüge aus Romanen, die vom Autor für diese Ausgabe noch einmal überarbeitet wurden. (Wobei am Inhalt der Geschichten nichts verändert wurde.) Lassen Sie sich also berühren vom Erleben des im Nachkrieg heranwachsenden Bernhard und der anderen männlichen und weiblichen Akteure. Sie alle sind mehr oder weniger begabte Lebenskünstler im beengten und doch unendlichen Zirkus Mensch. Wer, wenn nicht das selbst ernannte Ebenbild Gottes, brauchte zu seiner Selbstdarstellung nicht den gesamten Raum und die Zeit und vor allem sein Publikum ...?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gunter Preuß
Berührungen
Ausgewählte Kurzprosa
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Brunnenkinder (Und wenn ich sterben sollte, 2004)
Eine Reise zurück (Verbotene Türen, 1985)
Charlys Paradies (Verbotene Türen, 1985)
Liebgott (Aus der eigenen Haut, 2000)
Das Radio (Verbotene Türen, 1985)
Begegnung mit Hamlet (Verbotene Türen, 1985)
Der Tausch (Verbotene Türen, 1985)
Im Kino (Verbotene Türen, 1985)
Der Zauberstein (Aus der eigenen Haut, 2000)
Der Frosch (Tschomolungma, 1981)
Manja (Eine Handvoll Sehnsucht, 1999)
Margitta (Und wenn ich sterben sollte, 2004)
An einem Tag (Die Grasnelke, 1973)
Die Grasnelke (Die Grasnelke, 1973)
Spiegelscherben (Spiegelscherben, 1986)
Die Blonde (Spiegelscherben, 1986)
Mittwochs in der Stadt (Die Grasnelke, 1973)
Zwischen Abend und Morgen (Die großen bunten Wiesen, 1976)
Aufstehen und Gehen (Verbotene Türen, 1985)
Tanzstunden (Verbotene Türen, 1985)
Der Güterboden (Verbotene Türen, 1985)
Im Haus des Todes (Verbotene Türen, 1985)
Der Klang (Im Bauch der Stadt, 2000)
Joker (Zwei im Spinnennetz, 2006))
Das Weib (Und wenn ich sterben sollte, 2004)
Marina (Und wenn ich sterben sollte, 2004)
Die Geliebte (Und wenn ich sterben sollte, 2004)
Inmitten der Nacht (Der 884. Montag, 1999)
Sechserpasch (Briefe an die Geliebte, 1989)
Der Hang (Spiegelscherben, 1986)
Abschied (Spiegelscherben, 1986)
Impressum neobooks
Brunnenkinder (Und wenn ich sterben sollte, 2004)
Impressum
©HeRaS Verlag, Rainer Schulz, Berlin 2020
www.herasverlag.de
Layout Buchdeckel Rainer Schulz
Bernhard rannte aus dem Gehöft der Großeltern und den Hügel hinunter, bis die Apfelbäume ihn vor der Großmutter versteckten. Er aß den Käse von der dicken Scheibe Brot, die er aus der Küche stibitzt hatte, dann kaute er Stück um Stück die krustige Rinde. Das Brotinnere befeuchtete er mit Speichel und knetete es, brach dann die Masse auseinander, rollte sie zu Kügelchen, die er sich in den Mund schob und auf der Zunge zergehen ließ.
Mittlerweile hatte er das Dorfinnere erreicht. Vorm »Ross«, der bis auf das Dach mit wildem Efeu umrankten Dorfkneipe, lehnten Fahrräder, deren Felgen mit Stricken oder Hartgummireifen umspannt waren. Im Schatten einer Pappel saßen Jessner-Franz, Karla und noch ein paar Jungen und Mädchen, die von der Feldarbeit ausruhten und mit Löffeln ihre Kochgeschirre auskratzten.
Bernhard blieb bei ihnen stehen. Er löste mit den Fingerspitzen Krumen aus seinem Knetbrot und steckte sie genüsslich in den Mund.
Das Kochgeschirrgeklapper wurde leiser und verstummte. Die Kinder sahen auf das Stück Brot in Bernhards Händen. Jessner-Franz, ein lang aufgeschossener Junge mit kahl geschorenem Kopf und geröteten Händen und Füßen, einer von den Zugewanderten »aus Hinterpommern«, wie Großvater verächtlich sagte, schluckte mehrmals, hustete und spie vor Bernhards Füße. Im vergangenen Winter war er mit seiner Mutter und seiner zweijährigen Schwester ins Dorf gekommen. Er hatte auf den Tod gelegen, aber die uralte Jelanka hatte ihm das Fieber weggehext und ihm einen alten Uniformmantel geschenkt.
Jessner-Franz zog aus einer der Manteltaschen einen kleinen Spiegel, ließ die Sonne aufs Glas scheinen und lenkte den blitzenden Lichtstrahl auf Bernhards Augen. Die Jungen und Mädchen rutschten sitzend auf dem staubigen Boden heran. Sie bildeten einen Kreis um Bernhard und Jessner-Franz.
Bernhard versuchte, durch Drehen des Kopfes dem blendenden Lichtstrahl auszuweichen. Er hatte sich schon mit Jessner-Franz und anderen Jungen geprügelt, weil sie ihm die Faust entgegenstreckten und ihn »Städter« und »Weißkäse« riefen und die Großeltern als »Leuteschinder« und »Halsabschneider« beschimpften und in Richtung des Mainbachschen Hügels spuckten.
Heute wollte Bernhard einer Prügelei nicht aus dem Weg gehen. Nicht hauptsächlich den Schmerz fürchtete er, es war der Hass, der ihm aus den Augen seiner Gegner entgegenschlug.
Die böseste Prügelei hatte er mit Jessner-Franz gehabt, der vor Schmerz aufgeschrien hatte, wenn Bernhard ihn im Gesicht traf, und in rasende Wut geriet. Bernhard hatte nur fliehen können, wofür er sich nicht einmal geschämt hatte.
Bernhard sah verstohlen zu Karla, der er immer wieder einmal im Dorf oder auf den Feldern begegnet war. Sie lehnte an dem verrosteten Eisengitter vor der Schenke. Das Mädchen war wie die anderen barfuß. Ihre Füße waren braun gebrannt und von der Feldarbeit zerkratzt. Das Frauenkleid, das sie trug, hatte sie mit Bindfaden bis zu den Knien hochgerafft. Ihr Gesicht war rund und glatt wie ein Pfirsich. Sie hatte schwere hellbraune Zöpfe, in denen Lichtpunkte hin und her hüpften. Bernhard versuchte vergeblich, einen Blick von ihr zu erhaschen. Doch sie sah wie gebannt zur halb offenstehenden Schenkentür.
Ihm fehlte mit einmal der Mut zu einer Prügelei. Er überlegte, wie er den Kreis der Dorfkinder verlassen könnte, ohne als Feigling zu gelten.
Aus der Kneipe waren Stimmen zu hören, das Aufschlagen von Fäusten und Biergläsern auf Tischplatten. Jemand schrie: »Schnaps will – will ich! Noch, noch ’nen Schnaps, du – du Spiri – Spirituspanscher!«
Karla senkte den Kopf, löste hastig ihre Zöpfe auf und zog sich die helle Flut von Haaren über die Ohren.
Jessner-Franz stand langsam auf, er überragte Bernhard fast um Kopfeslänge. Verlangend stierte er auf den kleinen Brotklumpen in Bernhards Hand und ließ das gespiegelte Licht darauf fallen.
»Teile!«, forderte er.
Bernhard sagte widerwillig, aber bestimmt: »Der Sieger gewinnt Brot und Spiegel.«
Jessner-Franz blickte auf seine zerschundenen Hände, knackte mit den Fingern, drehte die Handgelenke hin und her. Er sagte dumpf: »Okay.«
Der Kreis der Jungen und Mädchen schloss sich enger um die beiden Widersacher. Hoch über ihnen, in den dichten Blättern der Pappel zeterten Sperlinge.
Bernhard steckte den Rest des Brotes in die Hosentasche und ballte die Hände. Er bemühte sich, langsam zu atmen, überlegte, wo er mit seinen Fäusten den Feind treffen musste, um ihn womöglich gleich kampfunfähig zu machen.
Ein untersetzter hakennasiger Mann trat aus der Kneipe. Er zog Pawlik mit sich, einen riesigen bartstoppeligen Invaliden, der Mühe hatte, mit seinem einen Bein und der Krücke die Balance zu halten.
Die beiden Männer mühten sich die Stufen zur Straße hinunter und blieben bei den Fahrrädern stehen, wobei der eine versuchte sich am anderen festzuhalten. Der Hakennasige sagte: »Pa – Pawlik, du – du bist doch mein Freund – ach, was sa – sage ich, mein Bruder bist du. Es ist so, als wärst du ich – geht das in deinen Schädel?«
Pawlik ließ den schweren Kopf vor seiner Brust pendeln. »Ich bin Invalide«, sagte er. »Sieh doch nur her, oder bist du denn blind?« Er starrte auf das mit Sicherheitsnadeln im Bereich des Oberschenkels fixierte leere Hosenbein.
Der Hakennasige sagte beschwörend: »Du bist – mein Freund, Pawlik – das bist du doch! Fünf Jahre hat meine Frau auf mich – gewartet hat sie. Fünf Jahre! Und nun ist mit mir – wie soll ich sagen – nischt mehr los. Das – das ist so und nicht anders.«
Der Hakennasige sprach weiter, seine Stimme wurde leiser. Bernhard hatte Mühe, ihn zu verstehen. »Ein Granatsplitter, Pawlik ...« Der Hakennasige griff sich zwischen die Oberschenkel. »Mann, Pawlik – ich will sie nicht verlieren, sie ist doch meine Frau – versteh doch. Also würdest du – was soll ich sagen – würdest du mir, wo du doch mein Freund bist – würdest du uns aushelfen?«
Schritt für Schritt und leicht schwankend entfernten sich die beiden. Die Hände des Hakennasigen waren im Ärmel von Pawliks Joppe verkrampft.
»Was ist denn nun? Komm schon, Städter!« Jessner-Franz fuchtelte bedrohlich mit seinen knochigen roten Fäusten vor Bernhard herum.
Bernhard sah zu Karla, die den beiden Männern ein paar Schritte hinterhergelaufen war und nun vor einer Hausmauer kauerte und ihre schmutzigen Hände aufs Gesicht drückte. Er durchbrach den Kreis der überraschten Dorfkinder und rannte zu ihr. Die Jungen und Mädchen sprangen sogleich auf, pfiffen und klapperten mit den Kochgeschirren. Karla drückte den Kopf auf ihren Schoß, ihre Schultern zuckten. Bernhard schob verlegen die Hände in die Hosentaschen. Er fragte: »Der mit der Vogelnase – das ist doch dein Vater?«
Karla schob sich, den Rücken an der Hausmauer, langsam hoch und rieb mit dem Saum des Kleides die Tränen aus ihrem Gesicht. Sie schluchzte auf und sagte: »Abends – da bringt er manchmal Männer mit nach Hause. Mich – schickt er ins Bett ... Ich kann aber nicht schlafen. Er – er läuft in der Küche auf und ab, oder er schärft auf dem Hof die Sense ... Und Mutter – sie lacht dann so laut, nein – sie schreit ...«
Karla drehte sich von ihm weg, blieb aber stehen.
Bernhard ging zu den Jungen und Mädchen zurück. Er sah Jessner in die Augen und wusste, dass er ihm wieder unterliegen würde.
»Tauschen wir«, sagte Bernhard. »Mein Brot gegen deinen Spiegel.«
Die Jungen und Mädchen riefen wild durcheinander. Jessner musterte Bernhard, dann sah er kurz auf seine wunden Hände und sagte: »Okay. Tauschen wir.«
Unter dem Geschrei der Kinder wechselten Brot und Spiegel den Besitzer. Bernhard lief zurück zu Karla, die ihn verunsichert, aber neugierig ansah. In einigem Abstand blieb er vor ihr stehen, streckte den Arm aus und reichte ihr wortlos den Spiegel.
Sie nahm ihn zögernd, sah hinein und zupfte mit flinken Fingern an ihren Haaren, spuckte sich auf den Handrücken und wischte damit über Stirn und Wangen.
Bernhard lachte leise auf. Eine sanfte warme Welle ging ihm durch Kopf und Brust. Er griff unwillkürlich nach ihren Händen, zuckte aber zurück, bevor er sie berührt hatte.
Aus einem Gehöft schoss mit aufheulendem Motor ein Jeep heraus. Drei amerikanische Soldaten saßen darin. Vor ihrer Brust hingen Maschinenpistolen. Ein vierter Soldat, dunkel wie die Nacht, saß lässig am Steuer des Wagens und rief ihnen lauthals lachend, die Kinder nachahmend zu: »Give me chocolate! Give me chewing gum!«
Der schwarze Ami lenkte den Jeep gewagt von einer Straßenseite zur anderen. Er hupte dabei anhaltend, dass ein schriller Ton alle anderen Geräusche übertönte. Staub wirbelte hoch auf. Die anderen Soldaten lehnten sich weit aus dem offenen Wagen heraus. Die Maschinenpistolen schlugen gegen das Blech des Autos. Ein Soldat warf in hohem Bogen eine Tafel Fliegerschokolade in die Straßenmitte. Der Jeep hielt an mit kreischenden Bremsen. Die Soldaten lehnten sich in den Sitzen zurück und warteten gespannt ab, welches der Dorfkinder wohl die Prügelei um die begehrte Schokolade gewinnen würde. Bernhard erreichte die Tafel Schokolade noch vor Jessner-Franz. Er presste sie an seine Brust und rannte wie um sein Leben durch die winkeligen Gassen des Dorfs und den Hügel hinauf zum Gehöft der Großeltern.
Eine Reise zurück (Verbotene Türen, 1985)
Bernhard war angespannt und ohne Hoffnungen in das Dorf der drei Hügel zurückgekommen. Der Bauernhof der Großeltern, die Kirche und der Friedhof überragten weiterhin die kleinen buckeligen Häuser, die sich zu beiden Seiten der kopfsteingepflasterten engen Straße aneinanderdrängten. Nichts hatte sich verändert, und doch erschien ihm alles fremd. Die Wirklichkeit zerstörte manchen Zauber der Erinnerung, und er machte die Entdeckung, dass zurückgeholte Vergangenheit schmerzliche Enttäuschung mit sich brachte. Das Gefühl der Fremdheit kam für ihn nicht vom Äußeren der Menschen und Dinge, sondern aus ihrem Inneren. Auf dem Friedhofshügel sang wie damals der Wind in den gewaltigen uralten Bäumen, aber seine Melodie war eine andere; das Wasser des Baches hatte noch die gleiche Kälte und Beredsamkeit, aber Bernhard verstand seine Worte nicht mehr; die Sonne erkannte er nicht mehr als die ihm Glück verheißende goldene Murmel, derentwegen er in die Wipfel der Bäume gestiegen war, sie war ein fremdes Gestirn, von dem Bruder Werner ihm gesagt hatte, dass seine mittlere Entfernung von der Erde einhundertneunundvierzig Komma sechs Millionen Kilometer betrüge. Die Menschen hier erschienen ihm wie verwandelt. Darüber erschrak er.
Es war Sommer, aber die Kinder waren nicht auf den Feldern. Auf dem Friedhofshügel belauerten zwei Jungen, hinter schief stehenden Grabsteinen versteckt, einander. Beim Umherirren fand er heraus, dass die älteren Jungen und Mädchen Mitglieder im neu gegründeten Ruderverein »Aufbau Jöseritz« waren. Sie ruderten auf dem Fluss oder arbeiteten in einem Schuppen mit Laubsäge, Sperrholz und Leinen an einem Bootskörper. Am Flussufer standen geflickte Zelte, in denen die Jungen und Mädchen übernachteten. Wer nicht bei den Ruderern war, trainierte auf dem Fußballplatz im Nachbardorf. Die Mädchen besuchten einen Zirkel für Volkstanz. Jeden Sonnabend gab es im ehemaligen Vereinszimmer vom Gasthof »Zum Ross« eine Filmvorführung oder Tanzveranstaltung. Die Jungen und Mädchen sprangen dann an den Fenstern hoch, um neugierige Blicke nach drinnen zu werfen. Die Kleinen spielten Verstecken und Haschen, bis sie von den Eltern oder Geschwistern nach Hause gerufen wurden.
Bernhard traf bei den Bootsleuten auf alte Bekannte. Sofort hatte er Jessner-Franz im Blick. Der Junge war noch länger geworden, die Narbe zwischen seinen Augen schien sich vertieft zu haben, seine Hände waren blaurot, das Haar war kurz geschnitten und sturzelte ihm in Büscheln in die Stirn. Der Stimme des ehemaligen Tagelöhnersohnes war anzuhören, dass er bei den Bootsleuten etwas galt. Er rannte von einem zum anderen, packte dort und da mit zu und hatte ständig was zu rufen und zu fluchen. Er hielt sich oft bei Karla auf, die gewachsen war und statt der Zöpfe die Haare kurz trug, aber sonst so aussah, wie er sie in Erinnerung hatte. Bernhard bemerkte schnell, dass Jessner-Franz sie nie anschrie und oft ihren Blick suchte.
Da kam Jessner-Franz zu den Weidensträuchern gerannt, hinter denen Bernhard sich verbarg.
»He! Was hast du hier zu suchen?«, rief er. »Kannst du nicht lesen? Betreten verboten!«
Bernhard trat aus dem Schatten der Büsche.
»Was willst du? Ich kenne dich nicht. Du bist nicht von hier. Also hau ab, bevor ich dir Beine mache!«
Bernhard sah den Jungen nur böse an und rührte sich nicht vom Fleck. Die Jungen und Mädchen hatten ihre Arbeit unterbrochen und schauten herüber. Karla schrie kurz auf, ließ den Pinsel fallen, lief ein paar Schritte auf Bernhard zu und blieb dann stehen.
»Ist was?« Jessner-Franz sah fragend zu ihr. »Kennst du den?« Er drehte sich wieder Bernhard zu und sagte in alter Feindseligkeit: »Du bist der Mainbach, na klar. Der Bernhard Mainbach bist du.«
»Ich bin kein Mainbach«, entgegnete Bernhard diesem Jungen, der wohl immer sein Feind sein würde. Zu Karla gewandt sagte er bestimmt: »Ich bin Bernhard Teichmann.«
Die Jungen und Mädchen flüsterten miteinander, lachten und wanden sich wieder ihrer Arbeit zu.
»Aber ihr kennt mich doch«, rief Bernhard erschrocken. »Ihr müsst mich kennen! Als die Amis im Dorf waren, haben wir für Kaugummi und Schokolade gegeneinander geboxt! Und als die Russen kamen, haben wir uns ein Erdloch gegraben, weil es hieß, sie bringen die Kinder nach Sibirien! Später dann sind wir auf diesem Schinder, den sie Karascho nannten, geritten!«
Bernhard wartete, doch das Schweigen der anderen erschien ihm undurchdringlich. Er wandte sich ab, wartete noch ein paar Augenblicke und ging dann weg. Zurück am Ort seiner Kindheit war er ein Fremder unter Fremden. Warum nur war der Zug nicht weitergefahren, viel weiter, hin zu diesem Land am Ende der Welt, von dem die Märchen erzählten, das hinter siebenmal sieben Bergen und siebenmal sieben Flüssen lagen, wo die Menschen einander lieben und miteinander spielen konnten. Aber keiner kannte den Weg dorthin, vielleicht nur Charly, aber der Bruder hütete seine Kenntnis, als fürchtete er, ein anderer könnte dorthin gelangen und den Zauber zerstören.
Bernhard lief in die Wiesen zu den Mähern und arbeitete mit ihnen, um zu vergessen. Spätabends kehrte er müde und zerschlagen auf den Mainbachschen Hügel zurück, schlang das Essen hinunter, legte sich ins Bett, sprang wieder auf, lief durchs Haus, hörte das Knacken des Holzes, Großmutters Gebete, Großvaters röchelndes Schnarchen, Tante Marthes aufbegehrendes Stöhnen aus sommerschweren Träumen, Schwester Ritas lustvolles Kichern und Onkel Arnos schwer aufsetzende ruhelose Schritte.
Bernhard schlich aus dem Haus. Er kletterte über die Gehöftmauer und legte sich auf das üppige Gras des Hügels. Er sah in die treibenden Wolken, fand einen kleinen Stern, dem er sich anvertraute und der ihn in den Schlaf führte.
Bernhard lebte in diesen Sommerwochen auf dem Hügel in der Nähe des Todes, ohne dass er sich von ihm auch nur gestreift fühlte. Er erkannte seine Herrschaft über Haus und Hof. Bernhard versuchte, mit seiner älteren Schwester über das Gehöft der Großeltern und seine Bewohner zu sprechen. Rita hörte kaum hin und lachte herausfordernd, es war Abend, unten im Dorf spielte eine Kapelle zum Tanz. Sie wiegte sich geschmeidig, den Kopf in den Nacken geworfen und die Arme in die Hüften gestemmt, vor einem alten Wandspiegel. Ihr buntes Kleid umspielte ihren schlanken, aber lockend weiblichen Körper wie eine Welle. Ihr Gesicht und die nackten Arme und Beine waren leicht gebräunt und straff. Eine Flut blonden Haare umspielte ihre Schultern. Bernhard wünschte, sie würde aufhören zu lachen, es klang ihm wie das Gewieher der Stute, wenn sie durch die Stallmauern hindurch den Hengst spürte, der auf dem Hof mit den Hufen scharrt und am Zügel riss.
Bernhard wollte das Zimmer verlassen, aber er stand wie festgehalten. Er dachte daran, dass sich von Rita zu der Reise nicht hätte überreden lassen sollen. Überraschend zog sie ihn an sich, schloss ihn fest in ihre Arme, bedeckte seine Stirn mit Küssen und schluchzte heftig. Er hielt still, überwältigt und gedemütigt. Als sie ihn dann von sich stieß – sie standen sich taumelig gegenüber – fragte sie leise: »Hast du deine große Schwester ein wenig lieb, Bernd? Hast du mich lieb?«
Vor seinen Augen flimmerte es, seine Hände verkrampften sich, er brachte es nicht fertig wegzulaufen. Rita sagte beschwörend: »Du musst mich liebhaben, hörst du. Wir müssen uns liebhaben!«
Sie packte ihn derb an den Schultern, schüttelte ihn und schrie: »Hast du deine Schwester lieb? Sag es! Dass du mich liebhast!«
Bernhard brachte kein Wort heraus, er war nahe daran loszuheulen.
»Sieh mich an«, forderte Rita unnachgiebig. »Du siehst mich jetzt an und sagst, ob du deine Schwester liebhast.«
Bernhard versuchte den Kopf zu heben, aber es ging nicht. Er fühlte seinen Körper so hart und unbeweglich, dass er nie wieder zu einer Bewegung fähig sein würde. Er war also zu Stein geworden, noch nie hatte er sich so sicher gefühlt.
Da hörte Bernhard sich von weit her schließlich doch »Ja« sagen.
Rita ließ ihn los, lachte ausgelassen und rief: »Du dummer Junge, du! Warum musst du deine Schwester so erschrecken! Tu so was nie wieder, hörst du! Versprich es mir!«
»Ich tu´s nie wieder, Rita.«
Einen Augenblick später rannte Rita aus dem Haus. Bernhard stand noch immer steif in Ritas Zimmer. Durch das Fenster sah er die Schwester mit ausgebreiteten Armen den Hügel hinunterrennen.
Charlys Paradies (Verbotene Türen, 1985)
Bernhard spürte: Er musste etwas tun. Aber vorher wollte er sich darüber klar werden, was zu tun war. Er vermutete Ungeheures und wusste von nichts. Er befragte die Menschen; aber auch sie waren ahnungslos. So kam er zu Charly, einst ein Gott, jetzt ein Zauberer.
Charly hatte es in der Dachkammer zwischen verfallenen Häusern und Fabrikschornsteinen nicht lange ausgehalten. Er wohnte jetzt in einem Villenviertel im Süden der Stadt. Bernhard fuhr gern mit dem Rad dorthin. Die Villen lagen versteckt hinter Tannen und Obstbäumen. Der Himmel wirkte hier größer und blauer. Hunde schlugen an und ließen sich mit Worten beruhigen. Bienen flogen im Blütentaumel. Bernhard fühlte sich für Augenblicke befreit von den hohen Häusern der Stadt, die ihn wie riesige Schraubstöcke festhielten. Also hatte Charly für sich einen Weg aus der Enge gefunden.
Am Stadtrand, in einem prächtigen Haus, keine dreißig Meter von einem Kastanien- und Platanenwald entfernt, wohnte der Bruder. Am verrosteten Gartentor war ein blank geputztes Messingschild angeschraubt, auf dem in kunstvoll verschnörkelter Schrift eingraviert war: Henriette Rausch. Opernsängerin. Am Briefkasten hing schief, mehrmals abgerissen und wieder angeklebt, ein Papptäfelchen, auf dem mit farbigen Druckbuchstaben geschrieben stand: Charly Teichmann. Mensch.
Der Garten war riesig und verwildert. Rosen rankten sich an Stämmen krumm gewachsener Kiefern und schlanker Birken empor. Gräser und Unkraut standen fast mannshoch. Und überall wucherten Blumen. Mitten aus der farbenfrohen Fülle erhob sich die arg heruntergekommene Villa. Sie war fast gänzlich von wildem Efeu umschlossen. Das Terrassendach wurde von zwei Baumstämmen gestützt. Die Fenster und die Eingangstür standen weit offen. In einem der vielen Zimmer oder irgendwo im Garten musste der Bruder zu finden sein. Charly war in seinem Paradies Herr über Pflanze und Getier, über Licht und Schatten, Stille und Lärm.
Des Bruders Clownsgesicht grinste froh, wenn Bernhard ihn besuchen kam. Bei der Begrüßung hob er segnend die Arme über alles: Sieh nur, Kleiner, so lässt es sich doch leben!
»Mein Gott, setz dich!«, rief Charly. »Nimm mir um Himmels willen nicht die Ruhe. Hau dich ins Gras, mein Alter, steig auf die Bäume, ich glaube, die ersten Äpfel werden reif.«
»Rausch!«, brüllte Charly durch den Garten. »Wir haben Besuch! Hörst du nicht, mein kleiner Bruder ist gekommen, bemüh dich also hoch, Räuscherl«
»Lass sie doch«, wehrte Bernhard ab. Er sah den Bruder nicht gern mit dieser Frau zusammen.
Charlys Hände strichen unruhig über den Berg ungestüm beschriebener Seiten, der sich vor ihm im Gras türmte. Er sah gereizt zum Haus und schrie: »Nun bewege dich aber, Herzchen, wälz dich vom Kanapee, ich will euch etwas vorlesen, mein Gott noch mal, nun komm doch!«
Bernhard setzte sich Charly gegenüber ins Gras. Aus dem Haus war ein Grunzen zu hören, danach ein Ächzen, gleich darauf eine hohe feine Stimme: »Ich fliege schon, Charly, mein Herz. Gleich bin ich bei dir. Hast du etwas Neues geschrieben?«
»Ja, verdammt noch mal, ja!« Mit zittrigen Fingern zog Charly eine Seite aus dem Papierberg hervor, las lautlos mit sich schnell bewegenden Lippen.
»Bist du noch immer krankgeschrieben?«, fragte Bernhard.
»Was denkst du denn, Kleiner«, antwortete Charly eifrig. »Die Journaille muss so lange ohne Charly auskommen, bis der Roman fertig ist. Schluss mit den Aufbaugedichten und Planerfüllungsgeschichtchen, jetzt macht dein Bruder Kunst, verstehst du, jetzt will ich΄s wissen. Ich werde der Welt einen Roman hinlegen und sagen: Seht ihr, so ist das Leben, so und nicht anders, ihr kleinen Idioten, es ist ein Walzer, der getanzt werden will, Wein, den man trinken muss. He, Bruder, warum soll es mir nicht gelingen, mit einem gelungenen Lassowurf den Himmel auf die Erde zu holen, warum nicht, frage ich?«
Henriette Rausch kam mit kleinen schwankenden Schritten auf sie zu. Es sah aus, als würde sie jeden Augenblick stolpern, so aus dem Gleichgewicht erschien die ein Meter und achtzig hohe massige Frau. Sie trug einen Morgenmantel aus buntem Brokat, der ihre plumpen Beine bis zu den Knien und den Ansatz ihrer großen schweißigen Brüste sehen ließ. Über Henriette Rauschs rundem Gesicht türmten sich die nach Art einer Geisha gesteckten blauschwarzen Haare, die sichtlich gefärbt war. Ihr Blick war offen und freundlich, doch um den üppigen kirschrot geschminkten Mund fand sich ein arrogant-abweisender Zug. Trotz ihrer glatten Haut war sie gepudert, und auf Charlys ausdrücklichen Wunsch hatte sie Finger- und Zehennägel hellgrün lackiert. Sie duftete stets, dass Bernhard nie genug davon bekommen konnte, und wenn er für einen Moment die Augen schloss, kam ihm ein betörend schönes Mädchen vor Augen, dem er in Wirklichkeit noch nie begegnet war.
Bernhard wusste nicht viel über Henriette Rausch. Bolz, sein neuer Vater, behauptete, ihren Namen zu kennen, sie hätte in den Vorkriegsjahren die großen Sopranpartien an deutschen Opernhäusern gesungen. Nicht einmal Charly ahnte, wie alt sein Räuscherl war. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie wohl mit An- und Verkauf von Schmuck. Sie war eine Kennerin schöner Dinge und wusste Preise zu machen, die ihre Kunden und auch sie selbst zufriedenstellte. Dazu besaß sie einen winzigen Tabak- und Spirituosenladen, an dessen Tür meistens ein Schild hing: Komme gleich zurück.
Aus den Büchern und durch seine Fantasien bestätigt, wusste Bernhard von den magischen Kräften der Frauen, die Männer hilflos und blöd, zu Schwächlingen und Verrätern, ja, Mördern machen konnten. Aber er verzieh es Charly insgeheim nicht, dass er sich in übergewichtige ältere Frauen verliebte, als sei er blind, als gäbe es diese zarten feenhaften Geschöpfe nicht, denen Bernhard in seinen Träumen so oft begegnete. Charly aber unterwarf diese Mütter-Frauen und ließ von ihnen Gebete und Hilferufe an sich richten. Er machte Puppen, die größer als er selbst waren, aus ihnen; sie reagierten auf seine Handbewegung, und wenn er es verlangte, umarmten, speisten und tränkten sie ihn.
Henriette Rausch kniete vor Charly nieder, streichelte seinen Kopf, den er tief einatmend zwischen ihren Brüsten barg. »Da bist du ja endlich«, sagte Charly zufrieden und erregt. »Meine Schöne, mein Schweinchen, komm, lass dich anfassen, du!« Er griff mit beiden Händen derb an ihre Brüste, an ihre ausladenden Hüften, ihre prallen Schenkel. Henriette Rausch grunzte und quiekte, sie bekam einen Lachanfall, der ihr den Atem nahm.
»Genug!«, rief sie lachend. »Genug, Charly, du Wilder, du, genug!«
Bernhard war aufgesprungen und suchte die Gartentür. Mein Gott!, dachte er, voller Vorwurf gegen sich selbst: Ich ertrage das nicht mehr!
Charly holte ihn ein, riss ihn herum, und Bernhard sah in des Bruders Clownsgesicht, aus dem alle Farbe und Schläue verschwunden war.
»Komm zurück, Kleiner«, bat Charly. »Lauf bloß nicht weg, hörst du, tu das nicht. Ich habe sie ins Haus geschickt, mein Gott, ja, sie ist weg, wir sind allein, wir reden miteinander, über alles reden wir, darum bist du doch gekommen, Kleiner. Es kommt manchmal so über mich, weißt du, es ist die Verdammnis des Fleisches, die uns den Verstand nimmt.«
Bernhard ließ sich von Charly zurück in den Garten ziehen, bereit, zu vergessen und erneut zu glauben. Viel, so viel hatte er den Bruder zu fragen.
Charly setzte sich wieder ins Gras, sah unruhig zum Haus, wo an einem Fenster für einen Augenblick der nackte Oberkörper Henriette Rauschs zu sehen war. Eine mädchenhaft reine Stimme sang das Lied von den beiden Königskindern, die zusammen nicht kommen können.
»Singt sie nicht wunderbar?« Charly nickte, nahm sich die letzten Seiten seines Manuskripts und begann mit Predigerstimme vorzulesen, eines Künders frohe Botschaft. Dabei vergaß er alles um sich herum, er war im Gespräch mit sich selbst, erstaunt und beglückt über die gefundenen Worte.
Wenn Charly ihm vorlas, fühlte Bernhard sich wie von zwei unterschiedlichen Händen berührt. Die eine war grob und rüttelte ihn. Die andere war ohne Schwere und streichelte ihn; ihr gab er nach. Es war die Geschichte ihrer Familie, die der Bruder erzählte, sie hörte sich gut an, lebendig und spannend wie ein Abenteuer. Über manches musste Bernhard lachen, wo er, als er es erlebte, geweint hatte. Charlys Buch erschien ihm wie ein großes Märchen, es wiegte den Zuhörer in Sicherheit, man wusste, das Gute siegte über das Böse, das Schöne über das Hässliche. In Charlys Buch war Rita noch ein langzöpfiges verträumtes Mädchen. Bolz und der tote Vater war dieselbe Person. Die Großeltern waren ein altes gütiges Königspaar. Werner und Charly waren unzertrennliche Zwillingsbrüder. Maria, die Mutter, lebte ohne Angst, immer zu kleinen liebevollen Neckereien aufgelegt und jederzeit zum Verzeihen bereit. Und in Jinnis, der Jüngsten, Augen schaukelte der Schalk.
Charly hatte seine Lesung beendet. Er warf die Blätter ins Gras, saß mit gekreuzten Beinen und auf die knochige Brust geneigtem Kopf. Nach ein paar Sekunden fuhr er hoch, blickte Bernhard böse an und rief: »He, Kleiner, was sitzt du hier herum und kriegst den Mund nicht auf, was soll das heißen, was? Sag schon, was dir nicht gefallen hat, vernichte mich, ja, Himmel, worauf wartest du noch, nun rede schon, sag, dass dir’s nicht passt, was und wie ich’s sage! Hast du überhaupt zugehört, du Blödel, du?«
»Ja – doch«, sagte Bernhard verlegen. »Mir gefällt’s. Es ist gut – schön, ja. Wie du das alles so sagst.«
Charly sprang auf, hampelte durch den Garten, trat gegen Baumstämme und schrie: »Mir gefällt’s! Schön und gut! Verflucht noch mal! Gottverflucht noch mal!«
»Mir gefällt es«, versicherte Bernhard, eingeschüchtert von dem verrückten Gehabe des Bruders. Charly kam zu ihm zurückgesprungen und ließ sich neben ihm aufstöhnend ins Gras fallen. Bernhard sagte: »Wirklich, Charly, ich weiß nur nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es gefällt mir. Das kannst du mir glauben.«
Charly zog Bernhard in seine Arme, drückte ihn mit all seiner schwächlichen Kraft. Seine Stimme war dankbar bewegt. »Ich danke dir, Kleiner, Bruder, mein Gott, bin ich froh, ich weiß, dass du nicht lügst, nicht mehrstimmig zwitscherst wie all die verfluchten Vögel um mich herum. Gefällt’s dir also wirklich, ich hab’s geahnt, nein, ich hab’s gewusst, das wird ein großes Buch, aus den Händen werden’s sich die Leute reißen, das werden sie.«
Charly sah welk aus wie eine Blume, in deren Blüte der Regen geraten war. Er blickte nun immer öfter zum Haus, als suche er Hilfe.
Bernhard verabschiedete sich eilig. Charly nahm ihm das Versprechen ab, bald wiederzukommen, damit würden sie über alles reden, über die ganze verdammte Sippschaft, das verspreche er, jetzt müsse er arbeiten, das nächste Mal aber ...
Bernhards Weggehen aus Charlys Paradies glich einer Flucht. Auf der Straße trat er in die Pedale, wagte nicht, sich umzusehen. Er wusste, Henriette Rausch kam sogleich aus dem Haus getrippelt. Charly barg seinen Kopf in ihrem Schoß und weinte wie ein kleines Kind. Bernhard schämte sich, für den Bruder, für sich, für alle. Er bezichtigte sich der Feigheit, des Verrates an der Wahrheit. Aber er brachte es nicht fertig, dem Bruder zu sagen, dass er mit seinem Schreiben log, dass er ihnen nicht nur andere Namen und ein anderes Aussehen gegeben hatte, sondern dass er sie leben ließ, wie sie nie gelebt hatten. Oh, Charlys Zauber war falsch. Seine Blumen waren aus Papier, die Sterne aus Flitter, die Herzen aus Stoff. Bernhard erschien es, als lebte der Bruder auf einem anderen Stern, von seinem Lichtjahre entfernt. Charly spielte nur Theater, und doch hätte Bernhard in seinem Stück liebend gern eine Rolle übernommen, vielleicht dass es ihm gelänge, Tränen und Lachen echt werden zu lassen.
Liebgott (Aus der eigenen Haut, 2000)
Die Flucht aus Schlesien war den Teichmanns endlos erschienen. Nun war der Krieg zu Ende, und sie hatten in Leipzig eine Wohnung gefunden. Dem Haus war von einer Bombe das Dach weggerissen worden. Sie wohnten zu fünft in einer nasskalten Erdgeschosswohnung. Im Haus und im dunklen Hinterhof roch es nach Fäulnis und Urin.
Bernhard war dreizehn Jahre alt geworden. Er verliebte sich in irgendwelche Frauen, denen er hier und da begegnete oder die aus Zeitungskiosken von bunten Illustrierten seinen Blick auf sich zogen. Es waren blonde, blauäugige Frauen mit Engelsgesichtern und üppigen Körperformen.
Aus tiefstem Herzen hasste er seinen Klassenlehrer. Herr Lohmers wurde von den Schülern Liebgott gerufen. Er war etwa fünfzig Jahre alt, groß gewachsen, hatte einen kleinen Buckel und ein faltiges Gesicht. Auf der entzündeten Nase saß eine Brille mit starken Gläsern, hinter der sich wachsame Frettchenaugen versteckten.
In Bernhards Klasse gab es nur Jungen, die ständig in Prügeleien verwickelt waren. Sie lagen auf der Lauer, um einen Apfel oder ein Stück Brot zu erbeuten. Nach einer wilden Pausenschlägerei stand plötzlich Liebgott im Klassenzimmer.
»Aber, aber. Was geht denn hier vor, meine Lieben?«, erkundigte der Lehrer sich mit milder Stimme. »Das sieht ja so aus, als wäret ihr ungehorsam.«
Die Jungen rannten zu ihren Plätzen und standen soldatisch stramm. Nur Bernhard war nach Luft ringend stehen geblieben. Sein Kopf schmerzte, das Hemd war zerrissen, und sein Hunger war nicht gestillt.
Liebgotts Gesicht verzog sich angewidert. Mit zwei Fingern fasste er Bernhards Hemd, ließ gleich wieder los, als hätte er sich verbrannt.
»Pfui, du blutest ja.« Der Lehrer hielt ihm einen Taschenspiegel vor Augen.
Bernhard sah in ein Jungengesicht, das anscheinend seins war. Der Lehrer fragte mit öliger Stimme: »Erkennst du dich?« Der Junge nickte widerwillig.
Liebgott fragte mit öliger Stimme: »Bereust du dein tierisches Verhalten?«
Bernhard schüttelte trotzig den Kopf.
Liebgott zog ein Lineal aus seinem Jackenärmel. Bernhard streckt automatisch die Hände vor und schloss die Augen. Siebenmal spürte er einen brennenden Schmerz auf den Handflächen.
Dann befahl Liebgott: »Stell dich mit dem Gesicht zur Wand. Und bis morgen schreibst du hundertmal in Schönschrift und ohne Fehler: Bernhard Teichmann ist seinem Lehrer ungehorsam. Nun bedanke dich bei mir, mein Junge, weil ich dir helfe, den rechten Weg zu finden.«
Die Jungen begegneten einander und anderen Lehrern ungezügelt und unbarmherzig. Aber bei Liebgott waren sie wie hölzerne Puppen. Nur auf seinen Fadenzug standen sie vom Platz auf und setzten sich wieder. Sie sprachen nur, wenn sie vom Lehrer gefragt wurden.
Liebgott war gehasst und gefürchtet von Schülern und Eltern. Wenn der Entscheid über die Versetzung in die nächsthöhere Klasse bevorstand, gaben die Eltern ihren Kindern Päckchen mit. In ihnen befanden sich ein paar Kaffeebohnen, ein viertel Stück Butter oder eine selbst gemachte Wurst. Die Jungen legten ihre Päckchen, auf denen ihr Name stand, vor der Mittagspause hinter die Tafel. Wenn sie vom Hofgang zurückkamen, waren die Päckchen verschwunden.
Liebgott verkündete dann mit Predigerstimme: »Gutes soll nicht unbelohnt bleiben, meine Söhne. Jakob, Wehrmann, Richter, Gruner - ihr bekommt in Fleiß und Rechnen eine Zwei. Ihr gebt euch viel Mühe. Das verdient Anerkennung.«
Der Lehrer zog aus seiner Aktentasche einen Stoß Heiligenbilder und überreichte jedem der Belobigten eins. Die Heiligenbilder waren von allen Schülern sehr begehrt. Sie waren bunt und aus Glanzpapier, und manchmal zeigten sie Abbildungen schöner Frauen.
Am begehrtesten waren die von der Jungfrau Maria. Die Heilige stand an eine Mauer gelehnt, den keuschen Blick auf ihre über der Brust zum Gebet gefalteten Hände gerichtet. Die Jungen radierten so lange am Kleid der Jungfrau Maria herum, bis sie nackt zu sehen war. Mit ein paar Bleistiftstrichen gaben sie ihr, was der Maler aus frommer Überlegung mit dem Kleid verhüllt hatte.
Als Liebgott davon erfuhr, verteilt er nur noch Bilder des Kampfes zwischen David und Goliath. Aber die Schüler malten ihnen pralle Brüste und Hinterteile, so dass die Streitenden als nackte Weiber ihren Kampf fortsetzten.
Auch Maria, Bernhards Mutter, hatte mehrmals versucht, ihrem Sohn ein Päckchen mit vom Munde abgesparten Lebensmitteln mitzugeben. Bernhard spürte, dass der Lehrer auch von ihm diesen Tribut verlangte. Aber gerade darum weigerte er sich, so ein Päckchen mit in die Schule zu nehmen.
Von Liebgott bekam Bernhard immer schlechtere Zensuren. Wegen Nichtigkeiten ließ er ihn sich stundenlang mit dem Gesicht zur Wand stellen. Bernhards Handflächen waren von den vielen Schlägen mit einer Hornhautschicht überzogen.
Bernhards Mitschüler beobachteten gespannt, wie der ungleiche Kampf zwischen Lehrer und Schüler ausgehen würde. Sie schlossen eifrig Wetten ab. Nur die Stärksten von ihnen gaben Bernhard eine Chance.
Zum Schuljahresende spitzte sich die Auseinandersetzung zu. Liebgotts mahnende Briefe an Bernhards Mutter häuften sich. Er teilte ihr mit, dass Bernhard versetzungsgefährdet sei. Sein Fleiß und vor allem seine Disziplin ließen doch sehr zu wünschen übrig. Überhaupt wisse er nicht, was aus dem Jungen werden solle, wenn er nicht recht bald Einsehen zeigen würde.
Bernhard dachte ernsthaft daran, Liebgott umzubringen. Er schloss die Augen und sah sich einen Pfeil abschießen, der dem Lehrer in die Brust drang und ihn zu Boden sinken ließ. Oder er reichte ihm ein Bonbon, das Liebgott schmatzend lutschte, bis dann das Gift wirkte: Zuerst wurde ihm übel – dann traten seine Augen heraus – er begann zu röcheln, kippte auf die knarrenden Dielen des Klassenzimmers und flehte um Hilfe.
»Das Bonbon war vergiftet«, sagte Bernhard lächelnd. »Es gibt keine Rettung mehr. Nun weiß ich wirklich nicht, was aus Ihnen werden soll.«
Aber Tagträume halfen dem Jungen nicht, das Problem zu lösen. Ihm musste etwas einfallen, wenn er dem Lehrer nicht unterliegen wollte.
In die Mädchenklasse Gleichaltriger war eine Neue gekommen: Margitta Krüger. Vergessen waren die blonden Frauen mit den Engelsgesichtern und die heiligen Weiber mit den Riesenbrüsten. Margitta war klein und zierlich. Sie hatte schwarze Haare, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden trug. Ihre Brüste waren nur zu ahnen. Ihre Haut war tief gebräunt. In ihrer Nähe roch es aufregend nach Schweiß. Und sie war von einem Geheimnis umgeben, das Bernhard um jeden Preis der Welt lösen wollte. Manchmal, so glaubte er, lächelte sie ihm beim Hofgang verstohlen zu.
Bernhard musste also in die nächste Klassenstufe versetzt werden, wenn Margitta Krüger ihn nicht als Sitzenbleiberverachten sollte. So entschloss er sich, seiner Liebe zu ihr seinen Hass auf Liebgott zu opfern. Er legte das Päckchen wie die anderen Schüler in der Mittagspause hinter die Tafel. Und Bernhard wurde versetzt. Der Mutter fiel ein Stein vom Herzen, als sie auf seinem Zeugnis las, dass ihr Sohn es verstände, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen.
Noch am selben Tag fand Bernhard in seinem Schulranzen einen Brief. Er war von Margitta Krüger, und in ihm standen Worte der Verachtung, dass er dem verhassten Liebgott nun doch nachgegeben hatte.
Bernhard zerriss sein Zeugnis und führte seine Bleisoldaten in eine entsetzliche Schlacht. Keiner durfte überleben. Sie lagen verstreut auf dem Fußboden, und er ließ seine bunten Glaskugeln über sie hinwegrollen.
Das Radio (Verbotene Türen, 1985)
Die Mutter hatte ständig neue Einfälle, um Bernhard vom Sporttreiben abzubringen. Jede Sportart, über die sie alles, was sie beunruhigen konnte, in Erfahrung gebracht hatte, war für sie eine Art Kampf, bei dem sie Tote nicht ausschloss. Sicherheit für sich und für die Ihren sah sie nur in ihrer häuslichen Welt. Den Unfall, der hier hätte passieren können, dass jemand auf den blank gebohnerten Dielen ausrutschte, wollte sie verhüten, indem sie aus alten Teppichen zugeschnittene Läufer auf die Wege, die durch die Zimmer zu gehen waren, gelegt hatte.
»Herrgott noch mal!« Sie stöhnte auf, als Bernhard nach dem Judotraining hinkend und mit schiefem Hals nach Hause kam. »Jetzt ist es aber genug, Junge! Willst du dich umbringen lassen?«
Bernhard gab weder ihren Bitten noch Drohungen, den Sport aufzugeben, nach. Pünktlich eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn verließ er die Wohnung im Trainingsanzug, den Campingbeutel mit den Sportsachen über die Schulter geworfen. Zum Abschied küsste er die Mutter, sprang die Treppe hinunter und rannte aus dem Haus.
Als Maria erkannte, dass Bernhard so nicht in der Wohnung zu halten war, wandte sie eine andere Taktik an. Jeden Nachmittag, wenn er aus der Schule nach Hause kam, wartete eine Überraschung auf ihn: ein ausgeliehenes Buch, selbst gebrannte Malzbonbons, ein Kanarienvogel, der nicht singen wollte.
»Was soll denn das?«, wehrte Bernhard beunruhigt ab. »Ich habe alles. Ich brauche nichts.«
»Nun rede schon«, bat Maria. »Wenn du einen Wunsch hast - ich tue, was ich kann. Wir sind arme Leute, ja, aber so arm sind wir nicht, dass ich dir nicht einen Wunsch erfüllen kann.«
»Ich habe keinen Wunsch, Mama.«
»Man hört, die Jungen sind jetzt alle verrückt auf ein Radio. Willst du – soll ich dir ein Radio kaufen? Dann brauchst du nicht mehr weglaufen. Aus so einem Radio kann man alles hören. Die Welt kannst du dir in dein Zimmer holen, die ganze Welt, wenn du nur willst.«
»Ich will kein Radio.« Bevor Bernhard zum Sport kam, war für ihn ein Radio die Erfüllung eines Traumes gewesen, vor allem so ein Gerät, das man mit sich herumtragen konnte. Abends trafen sich Jungen und Mädchen an den Straßenecken und in den Ruinen, und mancher von ihnen hielt ein Radio im Arm. Aus dem Lautsprecher waren klirrende Musik und quäkende englische Stimmen zu hören. Bernhard hatte nie gewagt, seinen Wunsch laut werden zu lassen. Die Mutter hätte ihn dann angesehen, als hätte er sich eines Verbrechens schuldig gemacht.
»Ich kann kein Radio gebrauchen«, sagte Bernhard, und er drohte: »Oder ich stelle mich damit zu den anderen an die Straßenecke.«
»Wer so ein ordentliches Zuhause hat wie du, der braucht nicht an schmutzigen Ecken herumzulungern. Warum quälst du deine arme Mutter?«
»Ich – ich will dich nicht quälen«, sagte Bernhard bitter, wich Marias Blick aus, ließ die Hände in den Hosentaschen verschwinden.
»Und doch tust du΄s.« Die Mutter ließ ihn nicht aus dem Blick, wartete auf das geringste Anzeichen von Schwäche, um ihn in ihre Arme zu schließen.
»Womit habe ich das verdient?« Maria schluchzte, Tränen in den wachsamen Augen. »Ist das nun der Lohn dafür, dass ich euch immer eine gute Mutter war? Ja, geh nur, geh, verlass nur deine Mutter!«, rief sie ihm nach, als er aus der Wohnung rannte, um nicht doch noch schwach zu werden.
Bald darauf, eines Abends, fand Bernhard ein Kofferradio in seinem Zimmer. Er ging misstrauisch an das Gerät heran, sah zu Maria, die an der Zimmertür stand und mit dem Staubtuch über den Kachelofen wischte. Als Bernhard nicht reagierte, hielt sie in ihrer Arbeit inne und fragte beleidigt: »Freust du dich denn gar nicht?«
»Doch - doch, ja.«
»Was denkst du, was das gekostet hat. Wenn der Apparat auch gebraucht ist, er war nicht billig, bei Gott nicht. Dein Bruder hat das Radio einem Lehrling abgekauft. Der hat es sich gespart durch Buntmetallsammeln. Sieh mal an. Es ist nicht so, dass alle Mütter ihren Söhnen ein Radio kaufen. So ist das nicht. Und du freust dich gar nicht.«
»Aber doch, ja, Mutter, ja doch.« Langsam gewann er Interesse an dem kleinen Kasten. Er hörte gern Musik, wie die meisten jungen Leute englische Titel, die die Welt offener und zugänglicher erscheinen ließen. Am liebsten waren ihm Hörspiele, wo er zu den Stimmen Landschaften, Straßen, Häuser, Sonne, Regen, Himmel und Erde hinzuerfinden musste.
»Dort, links, diesen Knopf musst du nach rechts drehen«, erklärte Maria. »Damit wird das Radio eingeschaltet. Es hat mehrere Wellen oder wie das heißt. Nun schalte es doch ein, Junge.«
Bernhard folgte der Aufforderung, die Skalenbeleuchtung glomm gelb auf, eine Männerstimme sprach in breitem sächsischem Dialekt enthusiastisch von bevorstehenden Ernteerfolgen.
»Hörst du – es spielt!« Maria lachte erleichtert.
»Ja, es spielt!«, rief Bernhard überrascht. Auch er lachte.
»Dreh mal weiter«, sagte Maria und trat näher heran. »Vielleicht findest du noch einen anderen Sender. Ja – dort rechts an dem Knopf.«
Walzerklänge ertönten, Vogelgezwitscher, ein Biologe erklärte das Paarungsverhalten der Spinnen. Eine schnarrend reißerische Stimme kündigte auf Englisch irgendetwas an. Radio Moskau sendete: Du mein stilles Tal, grrruß dich tausend Mal ...
Sie standen über das Gerät gebeugt eng beieinander und hörten zu, als würden sie zum ersten Mal Stimmen und Musik aus einem Radio hören, als stände nicht im Wohnzimmer ein altes großes Gerät, das alle Abende eingeschaltet war. »Hörst du«, sagte Maria. Sie lächelte zufrieden. »Ist das nicht schön. Hier findest du alles, was du brauchst, ohne dass du dir dabei den Arm oder womöglich das Genick brichst. Mache es dir nur gemütlich heute Abend. Ich habe Streuselkuchen gebacken. Und Kakao habe ich auch gekocht. Ich bin ja so froh, mein Junge.«
Bernhard blieb an diesem Abend zu Hause, auch an den drei folgenden Abenden. Er meinte, Maria das schuldig zu sein. Das Radio übte eine ihm bisher unbekannte Faszination auf ihn aus. Sein Zimmer bekam Wärme, die Bilder an den Wänden bekamen Glanz, und es gelang ihm wie durch Zauberei, in Bruchteilen von Sekunden jeden beliebigen Teil der Welt in sein Zimmer zu holen. Gern lag er auf dem Bett, wenn die Dämmerung vom Bahngelände her in sein Zimmer kam. Das Radio stand auf seiner Brust. Die erleuchtete Skala mit den klingenden Namen der Weltstädte lockte ihn, den grünen Zeiger wandern zu lassen. Er hörte die verschiedenen Sprachen Europas. Manchmal meinte er, die Laute eines anderen Kontinents zu empfangen, und dann war es ihm, als hätte er in diesem Augenblick einen Teil der Welt entdeckt. Bis tief in die Nächte hinein hörte er zu: er bewegte sich im schleppenden Rhythmus der Karawane durch die Wüste; er war auf Großwildjagd im afrikanischen Busch; er experimentierte, von der Umwelt verlacht, in einem winzigen Labor an einer Erfindung, die den Menschen das ewige Leben geben sollte; er tanzte mit schönen Frauen in den prächtigen Sälen eines Schlosses; er war dabei, wenn geboren und gestorben wurde; er hörte Stimmen von Menschen, die in Not waren und um Hilfe riefen, hörte Gebete und Freudenschreie, und da waren auch wieder die Stimmen der Tiere, deren Sprache er einmal gesprochen, aber vergessen hatte.
Aber dann kam die Stunde, in welcher der Zauber erlosch. Er suchte mit all den Stimmen, die er da hörte, das Gespräch. Aber seine Stimme wurde nicht gehört. Er fühlte sich ausgeschlossen, wenn andere auszogen, das Glück zu finden, er war zum Zuhören und Nichtstun verdammt. Er durchschaute die Mutter und war sich böse, dass er ihr geglaubt hatte. Das Radiohören war wie Marias Essen, das sie gekocht und ihm serviert hatte: Er brauchte es nur in den Mund zu bringen. Es war wie das Bett, das Maria ihm zurechtmachte: Er brauchte sich nur hineinlegen.
»Wohin willst du?«, erkundigte sich Maria besorgt, als Bernhard im Trainingsanzug, den Campingbeutel geschultert, aus der Wohnung wollte. »Heute Abend bringen sie die Fortsetzung von diesem Hörspiel, in dem der Eisenbahner umgebracht worden ist. Mein Gott, bin ich neugierig, ob sein Freund der Täter ist. Was meinst du? Es kommen natürlich noch andere infrage, seine Frau zum Beispiel und dieser Heimkehrer, der da herumlungert.«
»Ich muss zum Training.«
»Wohin musst du?« Maria hielt Bernhard am Jackenärmel fest. Ihre Stimme hatte einen warnenden und zur Klage neigenden Tonfall. »Ich denke, damit ist endgültig Schluss. Habe ich nicht genug Kummer mit meinen Kindern? Rita arbeitet Tag und Nacht. Werner steckt in Uniform irgendwo an der Grenze in Thüringen. Charly treibt sich was weiß ich wo herum. Und Jinni, die Kleine, hat Fieber. Gestern Abend fast vierzig Grad. Du bleibst im Haus, Bernd!«
»Ich gehe. Ich muss gehen.«
»Du musst gar nichts«, erklärte Maria beruhigend. »Diese Sportsleute haben dich längst vergessen. Die Ärztin sagt, ich soll mich nicht aufregen. Das scheint dich nicht zu stören.«
»Aber ich will dich nicht aufregen! Du regst dich selber auf! Ich muss gehen! Das musst du einsehen: Ich kann nicht bleiben!«
»Sieh mal an. Sieh mal einer an.« Maria atmete schwer. »Du kannst nicht. Du musst. Sieh mal an. Und was wird mit dem Radio? Du hast es nicht bezahlen müssen. Das teure Gerät. Vier Abende hat es den feinen Herrn vergnügt. Vier Abende! Und nun muss er weg! Soll das Gerät nun nur herumstehen? Du gibst das Radio zurück! Du verdienst es nicht, dass ich dir ein so teures Gerät schenke!«
Die Mutter fasste ihn an den Handgelenken. Er riss sich los und ging. An der Wohnungstür blieb er stehen und sagte, ohne sich umzusehen: »Aber das Radio gehört mir. Du hast es mir geschenkt.«
»Du verdienst es nicht!« Die Stimme der Mutter überschlug sich. Er hörte deutlich ihre herrische Angst heraus. »Du gibst mir sofort das Radio zurück!«
Er sprang die Treppe hinunter, dann aber wieder hinauf und schrie ins Dunkel des Flurs: »Nein! Das Radio bekommst du nicht. Es gehört mir! Mir!«
Bernhard lauschte, er biss sich auf die Lippen, ballte die Hände, hustete, fragte schließlich: »Bist du – bist du noch da? Ist – ist was mit dir, Mutter …?«
Nun war ihr unterdrücktes schnelles Atmen zu hören, eine ungeduldige Bewegung ihrer Füße auf ihn zu, gleich darauf ihre verlangende Stimme: »Hast du es dir überlegt, mein Junge? Bleibst du …?«
»Nein!«
Er warf die Tür hinter sich zu und rannte davon. Spät in der Nacht kam er nach Hause. Nach dem Training war er in eine Kellerkneipe eingekehrt, hatte mit drei Kohlenträgern Siebzehn und vier gespielt und mit ihnen über ihre derben Witze gelacht. Wie immer stand die Tür von Marias Schlafzimmer spaltbreit offen. Er hörte, dass die Mutter sich im Bett aufsetzte und dass das kleine Radio Musik spielte. Er ging in sein Zimmer, warf sich aufs Bett und dachte an Afrika, dieses wilde heiße Land, das auf ihn wartete wie eine Geliebte. Unter einer heißen Sonne träumte er sich in den Schlaf.
Begegnung mit Hamlet (Verbotene Türen, 1985)
Eines Abends, als Bernhard vergebens versucht hatte, sich in den Straßen müde zu laufen, stand er vor dem Städtischen Theater am Rand der Innenstadt. Es war diese unnachgiebige Hand, von der er nachts manchmal geweckt wurde, die ihn hierhergeführt hatte. Da rief ihn eine Stimme aus dem weitläufigen Haus, an dessen Außenmauern Baugerüste aufgestellt waren. Sie verhieß ihm ein unbekanntes Abenteuer, und er folgte ihr ohne zu zögern. Es war ein dünnes, wippendes Seil, auf dem er in das Theater gehen musste, Schritt für Schritt, balancierend, die Arme etwas gehoben, als könnten ihm in der Not Flügel wachsen.
Er kam aus der einen und ging in eine andere Welt. Alle Fremdheit verschwand wie ein Schatten, er gewann an Sicherheit, wusste, es war gewollt, dass er nun hier im Halbdunkel die Stuhlreihen entlanglief. Er setzte sich in eine hintere Stuhlreihe an den Rand und sah begierig hinauf zur Bühne.
Zurückversetzt in ferne Zeit, in ein dänisches Schloss am Meer, fand er sich in ein grausames und verwirrendes Spiel verwickelt. Von Anbeginn fühlte er sich diesem Prinzen zugeneigt, Hamlet, von dem er bereits gehört hatte, aber nichts wusste. Bernhard litt mit dem jungen Mann, der an sich zweifelte, alles infrage stellte, sich ruhelos befragte und bis zum Grund aufwühlte. Dieser Hamlet konnte sich selbst und den anderen, die ihm nahestanden, keinen Frieden geben, weil sie ihm keinen Frieden gaben. Bernhard wuchs förmlich in den Verzweifelten hinein, er atmete, dachte und sprach mit ihm aus, was da war und nicht war. So vieles verstand er nicht, aber er wusste, es war wahr. Er war sich sicher, was kommen würde und fürchtete sich nicht - sie starben gemeinsam an dem Gift, das im Schloss wie ein Gespenst umging und dem keiner entgehen konnte. Nach all dem erfahrenen Leid und den durchlittenen Ängsten empfand der Junge den Tod wie eine Erlösung.
Bernhard brauchte Zeit, bis er aus dem Spiel auf der Bühne herausfand. Der Vorhang war geschlossen, der Saal hatte sich geleert. Verwirrt sprang er auf und tastete sich im Dunkel aus dem Zuschauerraum.
Im Haus war es still. Er geriet in ein Labyrinth von schmalen Gängen, hörte verstecktes Lachen, Seufzen und Klagen, tastete an Abgründen vorbei, geriet ins Scheinwerferlicht, roch Veilchenduft und beißenden Schweiß, sah unter Engelsflügeln verzerrte Teufelsmasken, an Fäden schwangen wie im Tanz prächtige Kleider. Ein kalter Wind ging ihm unter die Haut, er rannte ein Stück, ihm wurde nicht wärmer. Hier und da stieß er an, spürte keinen Schmerz, er hatte nur den Wunsch anzukommen.
Er suchte nach der Hand, die ihn hergeführt, lauschte nach der Stimme, die ihn gerufen hatte. Niemand berührte ihn. Niemand rief nach ihm. Er versuchte, sich des Vaters und der Mutter zu erinnern. Zwischen all den Dingen sah er einen Schlosserkittel und eine weiße Schürze aufeinander zu schwingen und sich voneinander entfernen im ermüdenden Rhythmus des Perpendikels eines Regulators. Und da schwang auch er, ohne Gesicht und Körper, nur eine abgetragene dunkle Jacke. Wie blind tastete er sich weiter, er würde nie aufhören zu suchen.
Eine Tür stand offen. Er sah einen Mann vor einem großen Spiegel sitzen – es war Hamlet. Er sah in den Spiegel, sein und Hamlets Gesicht, das Gesicht eines Mannes mit kühn blickenden Augen und schmalem Mund, wortlos allen Schmerz verspottend.
Hamlet rührte sich nicht, er saß da wie durch seinen eigenen Anblick erstarrt.
Bernhard wollte es ihm zurufen, das erlösende Wort, das ihm im Traum erschien, an das er sich aber erwacht nicht erinnern konnte.
Im Spiegel sah er, dass Hamlet nun entschlossen beide Hände hob und sich die wie pures Gold glänzenden Haare vom Kopf zog – und es kamen andere Haare ans Licht, schütter, farb- und glanzlos, an den Schläfen grau. Die Hände griffen sich vom Tischchen ein Tuch und rieben derb damit übers Gesicht, und es war, als zöge es die Haut ab, von der Stirn zur Brust hinunter. Die Stirn hatte in ihrer Mitte eine narbenähnliche Kerbe, die den Eindruck erweckte, als sei sie gespalten. Aus den Augen verlor sich alles Aufbegehren in Müdigkeit. Die edle Nase drückte sich zwischen krankhaft geröteten Wangen in die Breite. Und der Mund – der zu sagen gewagt hatte, wovon sonst niemand sprach – dieser Mund hatte blasse Lippen, die einander schlaff berührten.
Bernhard schwankte, wie ein gepeitschter Kreisel schien er sich um sich selbst zu drehen, er wünschte sich, dass das aufhörte, dass er stürzte und dunkel würde. Aber er blieb auf den Beinen und sah in ein Krämergesicht, das ihm, seit er sich erinnern konnte, so oder so täglich begegnet war und fortan begegnen würde. Dem Mann waren die Augen zugefallen, er war wohl eingeschlafen.
Bernhard schlich sich aus der Garderobe. Er fand schnell den Ausgang des Theaters. Es war eine sternenklare kalte Nacht, er knöpfte sich die Jacke bis oben hin zu und stelle den Kragen hoch. Die Straße war breit und leer, er lief mitten auf ihr, und er war sich gewiss, dass er von nun an auf diesem dünnen Seil, auf dem er ins Haus gelangt war, balancieren müsste.
Der Tausch (Verbotene Türen, 1985)
Nun war dieser Mann in ihre Familie geraten. Bolz war aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft gekommen und hatte der Mutter den letzten Brief ihres Mannes und die Nachricht von seinem Tod gebracht. Eines Tages war der Rückkehrer wieder zu ihnen gekommen; dann kam er in immer kürzeren Abständen und schließlich jeden Tag. Die Familie hatte sich schnell an Bolz gewöhnt: an seinen Mut, Herausforderungen zu begegnen; an seine wohlklingende Tenorstimme, wenn er ihnen Lieder und Arien vorsang; an die kleinen Geschenke, mit denen er sie verwöhnte. Er warb um Maria mit unaufdringlicher Ausdauer. Er sagte zu ihr: »Lass uns tauschen, Maria. Du brauchst einen Mann und für deine Kinder einen Vater. Ich brauche eine Frau und Kinder. Du gibst dich mir. Ich gebe mich dir. Das ist doch ein Angebot.«
Die Kinder nickten zu seinen Worten.
Maria begann das Abendbrot abzuräumen und sagte: »Ich brauche nichts. Was ich verloren habe, lässt sich nicht wiederfinden.«
»Schon gut«, sagte Bolz. »Ich lass dir Zeit. Aber glaub mir, wir leben und wir brauchen einander.«
Es war die Zeit des Tauschens. Wer etwas besaß, handelte damit. Gold wurde gegen einen Laib Brot getauscht, silberner Schmuck gegen einen Sack Kartoffeln oder Mehl. Der Hunger ließ den Schwarzhandel wuchern. Und in Bolz΄ Adern floss Händlerblut. Er schien sein Leben auf den Märkten der Welt verbracht zu haben, ein herumziehender aus Königs Gnaden entlassener Narr, der den Leuten sein Lachen und ein Lied anbot. Er tauschte Stück um Stück, bis er bekam, was er wollte: Parfümierte Seife für Maria, für Rita ein Paar seidene Strümpfe, einen Filzhut für Charly, einen Rechenschieber für Werner, für Jinni eine Puppenstube und für Bernhard Teile zu einem Fahrrad, das er ihm zusammenbaute. Für sich selbst brauchte Bolz wenig. Manchmal versackte er in einer Kneipe. Die Leute bezahlten ihm gern ein paar Bier und Schnaps, wenn er ihnen nur sagte: »Das Leben geht weiter, Männer. Wer sich nicht das Unkraut von unten ansieht, der muss sein Feld bestellen.« Und er schmetterte ihnen den Filmschlager »Ein Lied geht um die Welt …«, der schon Joseph Schmidt, dessen Stimme er pries, berühmt gemacht hatte.
Die Familie bewunderte Geschäftssinn von Bolz, der ihnen völlig abging. Sie bestaunten sein Weggehen mit einem Stein und sein Wiederkommen mit einem Klumpen Butter. Es kam vor, da schloss Bernhard sich Bolz an. Er vermutete hinter dem Tun von Bolz eine Art Zauber. Denn er verstand nicht, was da passierte zwischen treppauf und treppab, vor und hinter Wohnungstüren: geflüsterte, ihm unverständliche Worte, gebende und nehmende Hände, die sich schnell wieder unter Mänteln verbargen. Selten ging Bolz auf den Schwarzmarkt. Er suchte seine Kunden in den Häusern der Stadt. Schnüffelnd wie ein Hund lief er durch die Straßen, und er fand fast immer den Ort, wo es etwas zu holen gab.
Eines Abends hatte Bolz im Eifer des Handelns Bernhard in einer Wohnung zurückgelassen. Das Haus befand sich im östlichen Teil der Stadt, in dem von jeher die Ärmsten gelebt hatten: Tagelöhner, Fabrikarbeiter, Waschfrauen, kleine Ganoven und billige Huren. Die Wohnung sah aus wie ein kleines Museum, ein Lager für kostbare Möbel, bunte Teppiche, reich verzierte Vasen, handgearbeitete Wandbehänge, Gemälde und kleine Skulpturen. Die gesamte Wohnungseinrichtung passte nicht in diese Gegend.
Es war zur Zeit der allabendlichen Stromsperre, nur eine Petroleumlampe erhellte den Raum. Bernhard bewegte sich lautlos. Er spürte federnde Teppiche unter den durchgelaufenen Schuhsohlen, atmete eine warme, erregende Luft, strich vorsichtig über altes Holz und Porzellan. Sesam hatte sich für ihn geöffnet, und er durfte die verborgenen Schätze anschauen.
Er hielt eine schlanke Vase in den Händen, auf die ein Jüngling und ein schönes Mädchen aufgemalt waren, beide nackt, in einer Umarmung, als würden ihre Körper zusammenschmelzen.
»Die Vase gefällt dir, ja?«
Bernhard schrak zusammen, als er aus dem Dunkel des hinteren Raumes die Frauenstimme hörte. Nicht einmal zu nicken wagte er. Seine Hände zitterten, als er die Vase abstellte. Bolz hatte den Handel mit einem weißhaarigen alten Mann, der eine Brille mit grünen Gläsern trug und eine klagende Stimme hatte, geführt. Eine Frau hatte Bernhard nicht bemerkt.
»Komm. Komm zu mir.«
Bernhard tappte in den Dämmer hinein. Auf einem hochlehnigen Stuhl saß die Frau. Sie trug ein altertümliches Kleid. Es war eine junge Frau mit dichten schwarzen Haaren, schmalen Augen, blassem Gesicht und Armen und Händen wie aus weißem Porzellan. Etwa zwei Schritt von ihr entfernt blieb er stehen.
Sie sagte leise, mit klingender Stimme: »Du bist neugierig, mein Prinz. Wie weit hast du denn gehen müssen, um mich zu finden? Setz dich zu mir.«
Bernhard setzte sich auf eine Fußbank, die neben ihrem Stuhl stand. Er fühlte eine kühle Hand auf seinem Gesicht und hörte ihre feine Stimme. »Du bist schön, mein Prinz. Was für eine reine Haut du hast. Ist der Krieg nun zu Ende? Sage es mir doch. Wann wird denn das Licht wieder da sein? Oh, ich habe lange nicht mehr getanzt. Wie überall hast du mich suchen müssen, mein Prinz?«
Bernhard kam sich alt vor, voller Weisheit und Verstehen, und er war froh, dass er hier sitzen konnte. Er sagte: »Lange habe ich dich gesucht. Um die ganze Welt bin ich gelaufen.«
Die Frau beugte sich etwas vor. »Ich bekomme ein Kind«, flüsterte sie ihm zu. »Pscht! Das weiß niemand. Niemand darf es mir wegnehmen. Ich bin ja so froh, dass du da bist, mein Prinz. Hier - fühle doch. Spürst du es?«
Sie zog seine Hand auf ihren Bauch. Er fühlte eine Wölbung – Stoff, ein Kissen. Er sagte: »Ich spüre es. Ja.«
Die Frau lachte leise. Bernhard sah in ihre Augen. Die Pupillen waren zwei starre dunkle Punkte.
Inzwischen war der Strom wieder da und tauchte den Raum in ein fahles Gelb. Der weißhaarige alte Mann kam ins Zimmer. Wortlos fasste er Bernhard am Arm und führte ihn nach draußen.
Die Straße war spiegelglatt. Ein kalter Wind stemmte sich Bernhard entgegen.
»Da bist du ja endlich«, rief ihm Bolz entgegen. »Wo warst du denn bloß, Junge? Ich bin die verdammte Straße ein paar Mal auf und ab gelaufen. Hier ist der letzte Hund verreckt. Aber der Tausch hat sich gelohnt.«
Sie rannten einer anfahrenden Straßenbahn hinterher, sprangen auf den hinteren Perron des letzten Wagens. Der Schaffner half Bolz, der ein Paket umklammerte, aufzusteigen. Er verlangte eine Strafe für das Aufspringen während der Fahrt. Bolz verhandelte, schließlich lachten beide, und der Schaffner ließ eine Zigarre in seiner Geldtasche verschwinden.
Bernhard lehnte in der offenen Tür und hielt seinen Kopf in den eisigen Fahrtwind. Die Straßenbahn fuhr quietschend und schüttelnd von Haltestelle zu Haltestelle. Die Straßen waren menschenleer. Hinter den Fenstern der Häuser brannte mattes Licht. Aus den Essen stiegen schmale Rauchsäulen.
»Die Frau - die junge Frau«, sagte Bernhard zu Bolz. »Wie heißt sie? Wer ist sie?«
»Welche junge Frau?«, fragte Bolz. »Wo denn? Ich habe keine gesehen.«
In der Nacht wälzte Bernhard sich hin und her. Kaum eingeschlafen, erwachte er wieder, er fühlte sich von zwei Händen berührt, von zwei Augen angesehen. Am nächsten Vormittag verließ er in einer Unterrichtspause die Schule. Er lief durch die Stadt, irrte durch das Labyrinth der Straßen. Er versuchte sich zu erinnern, ging in Häuser, klopfte an Wohnungstüren, Türfenster wurden spaltbreit geöffnet, fremde Augen musterten ihn misstrauisch, fremde Stimmen wiesen ihn ab. Am Abend kehrte er nach Hause zurück, warf sich aufs Bett und sagte sich, dass es diese junge Frau nicht gab, dass die Begegnung mit ihr nicht stattgefunden hatte. In der Nacht erzählte er Charly von seinem Erlebnis. Der Bruder war soeben von einem seiner nächtlichen Ausflüge zurückgekehrt. Er sah aus wie ein zerraufter Kater, sein Gesicht war wie geschrumpft und faltig. Charly wankte durch das kleine Zimmer, als müsste er eine schwere Last tragen. Als er sprach, wurden seine Schritte leichter, seine Hände beredt.