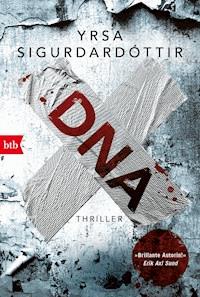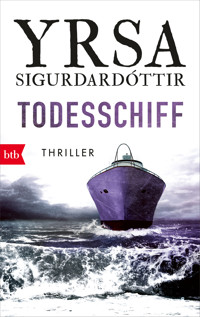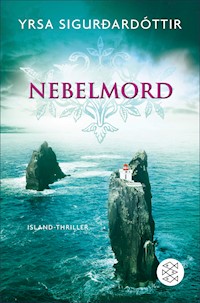14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eisige Stimmung auf einem Fischtrawler vor Islands Küste ― und eine Aushilfsköchin, die um ihr Leben fürchtet.
Ein Fisch-Trawler vor der Küste Islands: Hier wurde die Köchin Gunndís kurzfristig als Aushilfe angeheuert. Doch von Anfang an bemerkt die junge Frau eine feindselige Stimmung an Bord. Kann es an ihrem Vater liegen, der vor vielen Jahren als Schiffskoch für einen verhängnisvollen Brand verantwortlich gemacht wurde? Mehrere Mitglieder der jetzigen Crew haben damals ihre Väter verloren, Gunndís ebenso. Will sich die Besatzung jetzt an ihr rächen? Doch dann entdeckt sie im Schiff geheime Unterlagen, die darauf hindeuten, dass ihr Vater damals gar nicht der wahre Schuldige war, sondern der Brand eine ganz andere Ursache hatte ...
Dramatisch, bildkräftig, mit eisiger Atmosphäre und genialen Verwicklungen ― der neue Besteller von Islands Thriller-Königin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Ein Fischtrawler vor der Küste Islands: Hier wurde die Köchin Gunndís kurzfristig als Aushilfe angeheuert. Doch von Anfang an bemerkt die junge Frau eine feindselige Stimmung an Bord. Kann es an ihrem Vater liegen, der vor vielen Jahren als Schiffskoch für einen verhängnisvollen Brand verantwortlich gemacht wurde? Mehrere Mitglieder der jetzigen Crew haben damals ihre Väter verloren, Gunndís ebenso. Will sich die Besatzung jetzt an ihr rächen? Doch dann entdeckt sie im Schiff geheime Unterlagen, die darauf hindeuten, dass ihr Vater damals gar nicht der wahre Schuldige war, sondern der Brand eine ganz andere Ursache hatte …
Dramatisch, bildkräftig, mit eisiger Atmosphäre und genialen Verwicklungen – der neue Besteller von Islands Thriller-Königin.
Zur Autorin
Yrsa Sigurdardóttir, geboren 1963, ist eine vielfach ausgezeichnete isländische Bestsellerautorin, deren Romane in über 30 Ländern erscheinen. Die Ikone zählt zu den »besten Thrillerautorinnen der Welt« (The Times). Ihre faszinierenden Thriller, in denen sie die unbarmherzige Natur Islands meisterhaft beschreibt, werden von Presse und Leser*innen gleichermaßen geliebt. Ihre Thriller SCHNEE, NACHT und RAUCH waren immer wochenlang in den Top Ten der SPIEGEL-Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Reykjavík.
Yrsa Sigurdardóttir
BLUT
Thriller
Aus dem Isländischen von Anika Wolff
Die isländische Originalausgabe erschien unter dem Titel Frýs í æðum blóð, bei Veröld, Reykjavík
Es ist der Autorin bewusst, dass von Grindavík aus keine Loddenfischerei betrieben wird. Die Reederei, die Schiffe und alle Figuren in diesem Roman sind frei erfunden.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © Yrsa Sigurdardóttir 2023
Published by agreement with Salomonsson Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © shutterstock / RonnyKratif
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößnec
ISBN 978-3-641-32098-0V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Dieses Buch ist meinem Enkel Reginn Freyr Mánason gewidmet.
Prolog
Die meisten waren einfach zu blöd. Zu diesem Ergebnis kam Einar, nachdem man beim Recyclingunternehmen Sorpa, bei dem er arbeitete, das neue Mülltrennungssystem eingeführt hatte. Es war nicht auf seinem Mist gewachsen, er traf hier keine wichtigen Entscheidungen und war auch nicht für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er arbeitete an der Basis, kontrollierte stichprobenartig den Abfall und erfasste, was die Leute richtig und was falsch sortiert hatten. Und leider ließ das traurige Ergebnis seiner Proben keinen anderen Schluss zu, als dass die meisten eben zu blöd waren.
Dabei war es wirklich kein Hexenwerk: Papier, Plastik, Essensreste und allgemeiner Haushaltsmüll. Für jede der vier Kategorien gab es eine eigene Mülltonne. Alle anderen, spezielleren Abfälle konnte man an den zahlreichen Wertstoffhöfen in der Hauptstadtregion abgeben. Es hatte eine umfangreiche Informationskampagne dazu gegeben, alles Wichtige dazu stand im Netz, und jeder Haushalt hatte entsprechende Broschüren erhalten. Aber gebracht hatte es nichts. Aludosen steckten mit Essensresten in Papiertüten, Essensreste landeten in der Plastiktonne und Gartenabfälle im Restmüll. Am schlimmsten war es mit dem Sondermüll, Elektrogeräte und Batterien wurden immer noch regelmäßig über die normalen Mülltonnen entsorgt. Natürlich gab es auch Leute, die ihren Müll gewissenhaft trennten, aber nur ein Bruchteil der Stichproben bestand die Prüfung.
Zu allem Übel hatte Einar den Eindruck, dass es einen Abwärtstrend gab. Die Motivation, die sie bei Einführung des neuen Systems erzeugt hatten, war wirklich schnell verflogen.
Einar ging durch die Sortierhalle. Auf beiden Seiten eines Fließbands standen Frauen und pulten Glasscherben, Plastiksplitter, Metallteile und andere nicht organische Partikel aus Lebensmittelresten, die zur Methangasgewinnung genutzt wurden. Er nickte ihnen im Vorbeigehen zu, doch niemand erwiderte seinen stillen Gruß. Die Aufmerksamkeit der Frauen richtete sich ganz auf den Müll, der wie ein Höllenfluss an ihnen vorbeiströmte.
Einar hatte keine Probleme mit Übelkeit. Nicht mehr. Vor Einführung des neuen Trennsystems hatte er bei der jährlichen Untersuchung des Haushaltsmülls mitgemacht und Tonnen von gemischtem Abfall aus der Hauptstadtregion untersucht. Zum Beispiel hatte er Windeln herausfischen müssen, aber es gab noch deutlich Unangenehmeres. In einem Jahr fand er eine tote Katze, im nächsten eine Ratte, im dritten einen vergammelten, undefinierbaren Riesenfisch. Oder diese Papierstreifen, die zur Haarentfernung verwendet wurden und wie kleine Teppiche aussahen. Ganz zu schweigen von den zahllosen Spritzennadeln und benutzten Kondomen.
In der ersten Arbeitswoche hatte er sich immer wieder gesagt, dass man sich an alles gewöhnte. Wenn Chirurgen lernen konnten, Menschen den Bauch aufzuschneiden, ohne dass ihnen schlecht wurde, dann sollte das hier auch möglich sein. Und tatsächlich. Inzwischen riefen merkwürdige Funde im Abfall keine Übelkeit mehr bei ihm hervor, sondern weckten vielmehr sein Interesse. Und da gab es einiges Interessantes: ein einsames Puzzleteil, nach dem die Besitzer sicher die ganze Wohnung abgesucht hatten, ein Ehering, der absichtlich im Müll gelandet war – so zumindest seine Theorie. Denn es war einfach viel spannender, sich vorzustellen, dass ein gewisser Guðmundur seine Partnerin übel betrogen hatte, als dass der Ring, in den sein Name eingraviert war, versehentlich beim Müllrausbringen vom Finger gerutscht war. Eine Flaschenpost in einer Tüte Strandmüll, mit einem Brief von einem isländischen Mädchen, das sicher hoffte, die Flasche würde irgendwo in der Welt an einen Strand gespült. Er hatte den Brief fotografiert und sich vorgenommen, ihr von seiner nächsten Auslandsreise unter einem fremdländischen Pseudonym eine Postkarte zu schicken.
Am meisten setzte ihm eine Tüte mit unbenutzter Babykleidung zu. In diesem Fall war die Geschichte dahinter ziemlich eindeutig.
Dennoch blieb interessanter Müll die Ausnahme. Der heutige Tag würde aller Voraussicht nach genau wie der gestrige werden, und so weiter und so fort.
Einar blieb stehen und wandte sich an seinen Mitarbeiter, der ihm gefolgt war. Er zeigte auf einen großen Haufen transparenter Müllsäcke. »Gartenabfall? Zu dieser Jahreszeit?« Über den Winter wurde so gut wie kein Grünschnitt abgegeben, im Gegensatz zu Frühling, Sommer und Herbst. Die Grünabfälle bedeckten dann als oberste Schicht anderen Müll auf der Deponie. Im Winter hatte das keinen Zweck, da wurde eine solche Deckschicht sofort weggeweht.
Der junge Mann zuckte mit den Achseln. »Vielleicht, weil es warm ist. Die sind im Herbst nicht fertig geworden und haben jetzt die Chance genutzt.«
»Warum ist das alles noch in Säcken? Die müssen doch in den Container geleert werden.« Einar hatte nur laut gedacht. Er rechnete nicht damit, dass der Neue seine Frage beantworten konnte.
»Möglich, dass ein oder zwei Säcke im Container lagen und der Nächste dachte, das gehört so?«
Ein guter Gedanke, das musste Einar zugeben. »Kann sein. Trotzdem hätten die Mitarbeiter es bemerken und eingreifen müssen.«
Sie betrachteten den Haufen. Laut Vorschrift mussten von allen Müllsorten Stichproben genommen werden, auch von den Abfällen, die an den Sammelstellen abgegeben wurden. Bei der Auswertung des neuen Trennsystems kam es auf das Gesamtbild an. Sollte sich herausstellen, dass an den Sammelstellen viel Müll auftauchte, der eigentlich zu Hause hätte sortiert werden müssen, könnte sich daraus ein Handlungsbedarf ergeben. Eine neue Kampagne vielleicht, wenn es mit der Motivation zum Mülltrennen weiter so bergab ging.
Einar zeigte auf einen der Säcke. »Diesen da.«
Der junge Mann streifte sich Handschuhe über und zerrte den Sack aus dem Haufen. Er hängte ihn an die Kofferwaage; Einar notierte das Gewicht. Dann setzten sie Masken auf und schütteten den Inhalt auf den Boden. Kahle Äste, halb verrottetes Laub, Erde und Grasnarbe. Alles gemäß der Trennvorschrift. Dennoch hatte dieser emsige Gartenbesitzer nicht alles richtig gemacht. Zwischen den Gartenabfällen fanden sich auch Plastiktöpfe mit vertrockneten Sommerblumen, einige Steine, ein völlig verdrecktes Handtuch von unbestimmbarer Farbe, zerschlissene Stofffetzen und einige neuere Werbeprospekte.
Der Neue begann, die falsch sortierten Dinge zu wiegen; Einar notierte die Ergebnisse. Bei den Sommerblumen zögerte er. »Ist der Blumentopf samt Inhalt falsch einsortiert oder nur der Topf?«
»Nur der Topf. Der Inhalt ist Gartenabfall.«
»Und die Steine?«
Der Mann hatte gerade erst bei Sorpa angefangen, konnte also noch nicht alles wissen. Und immerhin war er um einiges schlauer als die Person, die die Säcke befüllt hatte und offenbar glaubte, dass Handtücher zu organischem Abfall zählten. »Steine sind kein Gartenabfall. Die sind nicht organisch.«
»Oh. Okay.« Er beugte sich runter und nahm einen der Äste in die Hand. »Und das hier?«
Möglicherweise hatte Einar den Intellekt des Mannes doch überschätzt. »Versuch mal, dir einen Garten vorzustellen. Alles darin, was grün ist und aus der Erde wächst, zählt zum Gartenabfall. Auch die Erde. Bäume und Äste gehören auch in diese Kategorie, oder?«
»Das ist aber kein Ast. Glaube ich zumindest.« Der Mann besah sich das Ding, das eindeutig nach Ast aussah, von allen Seiten. »Ich glaube, das ist ein Knochen.«
»Ein Knochen?« Einar ging hin und sah es sich selbst an. Im Hausmüll kamen Knochen nicht selten vor, Lammkeule und -rücken, Hähnchenknochen, und im Sommer die Knochen von gegrilltem Schweinefleisch. Wenn dieser Ast tatsächlich ein Knochen sein sollte, stammte er nicht von den genannten Tieren. Dafür war er viel zu groß.
Der Mann gab Einar das Ding – das tatsächlich ein Knochen war. Er war nicht weiß, wie die Knochen, die man sonst sah, sondern braun und ziemlich schmutzig. Einar war kein Experte für Knochen, doch er schätzte, dass er von einer Kuh oder einem Pferd stammte. Aber wer grillte schon eine Rinder- oder Pferdekeule? Ging das überhaupt? Ein Beinknochen war es in jedem Fall, der runde Hüftkopf ließ daran keinen Zweifel. Aber die Länge des Knochens passte zu keinem Tier, das hierzulande auf dem Speiseplan stand. Von einem Haustier konnte der Knochen auch nicht sein. Zumindest würde er persönlich keinen so großen Hund haben wollen. Geschweige denn eine Katze.
Pferd oder Kuh? Oder das einzige Tier auf Island, das ansonsten noch infrage kam: der Mensch. Einar wurde blass, und obwohl er einiges gewohnt war und Handschuhe trug, hätte er das Teil am liebsten fallen lassen.
»Hier sind noch mehr davon.«
Einar riss sich zusammen und legte den Beinknochen vorsichtig auf den Boden. Er holte tief Luft, und dann machten sie sich daran, die übrigen Knochen aus den Ästen herauszusuchen. Es waren eine ganze Menge. Nacheinander leerten sie die Säcke auf den Boden, denn obwohl sie vermutlich nicht alle von derselben Person stammten, sahen sie von außen gleich aus. Mithilfe von Skelettbildern aus dem Internet sortierten sie die Knochen, und als alle ungefähr an ihrem Platz lagen, traten sie zurück und betrachteten das Ergebnis.
Auf dem Boden lag tatsächlich das bräunliche Skelett eines Menschen. Hier und da fehlte zwar ein Knochen, vor allem der Schädel und einige Finger- und Zehenknochen, aber die meisten größeren Knochen waren da. Während sie sprachlos auf das schaurige Ergebnis ihrer Puzzlearbeit starrten, schoss Einar der Gedanke durch den Kopf, dass er sich vermutlich einen neuen Mitarbeiter suchen musste. Der jetzige würde seinen Job wohl kündigen, sobald er die Sprache wiederfand.
1. Kapitel — Nacht zum Samstag
Wie erwartet war am Hafenbecken nicht viel los. Es war kalt, aber nicht windig, der Mond schien, und es herrschte fast absolute Stille. Nur das leise, träge Plätschern der Wellen war zu hören, neben dem Knarzen der Fischtrawler, die sich an den Reifen am Kai rieben. Diese Geräusche strahlten eine solche Ruhe aus, als gäbe es keinen Grund zur Eile. Alles ganz entspannt. Bis zur Morgendämmerung musste sich niemand stressen.
Doch Gunndís hatte es eilig. Sie holte die Sporttasche aus dem Kofferraum ihres kleinen Wagens und versuchte, nicht weiter darüber nachzugrübeln, ob sie irgendetwas vergessen hatte. Es war eine kurzfristige Anfrage gewesen, wie immer. Sie hatte noch keine feste Anstellung und musste sich mit den Fahrten begnügen, bei denen sie einspringen konnte, weil der Schiffskoch aus irgendeinem Grund ganz kurzfristig ausfiel. Aber über die Hektik, die das mit sich brachte, regte sie sich schon lange nicht mehr auf, sondern freute sich über jede Gelegenheit, die sie bekam. Seit sie denken konnte, war das hier ihr Traumjob, und ihr war bewusst, dass sie einen steinigen Weg vor sich hatte. Sie musste sich Schritt für Schritt vorankämpfen, einen guten Job machen, zeigen, dass man sich auf sie verlassen konnte, und darauf hoffen, dass sich das herumsprach.
Sie hatte keine Schwierigkeiten, das Schiff zu finden. Es war das einzige, das beleuchtet war, ein Teil der Mannschaft war schon an Bord. Niemand wollte sich diese Tour entgehen lassen, die Lodde war kurz vor dem Laichen, es war die letzte Chance, den Fisch in diesem wertvollsten Stadium zu fangen. In den Abendnachrichten war über den Fischfang berichtet worden, und es hieß, der Rogen sei voll ausgereift und der Zeitpunkt perfekt. Auch der Anteil der Rogner, der weiblichen Tiere in den Schwärmen, sei westlich von Island zurzeit optimal. Der Trawler fasste zweitausend Tonnen. Wenn sie mit vollen Laderäumen zurückkehrten, würde sie in diesen paar Tagen mehr verdienen als in drei Monaten Schulmensa. Ihre feste Stelle als Schulköchin war weder ihr Traumjob noch besonders gut bezahlt, aber sie hatte aushandeln können, dass sie in Situationen wie diesen spontan freibekam. Damit hatte sie sich unter den Kollegen zwar nicht gerade beliebt gemacht, aber egal. Die anderen schafften das auch ohne sie, es war kein Weltuntergang, wenn sie ab und zu fehlte. Zumal das ja wirklich auch nicht häufig passierte, so selten, wie sie die Chance bekam, mit rauszufahren. Und krank wurde sie fast nie. Daher fehlte sie so unterm Strich viel seltener, als wenn sie alle ihre Krankheitstage in Anspruch nehmen würde.
Gunndís blieb vor dem Schiff stehen und holte ihr Handy heraus. Sie wollte zwei Nachrichten schreiben, bevor sie an Bord ging, damit sie es später nicht vergaß. Die erste war eine Mitteilung an die Schule, dass sie zu Beginn der nächsten Woche fehlen würde; die zweite ging an ihren Exmann Gauti. Sie hatten sich vor gut einem Jahr getrennt, aber blieben durch ihren zweijährigen Sohn Daði dennoch untrennbar miteinander verbunden. Gerade war Papa-Wochenende, daher war Daði bei seinem Vater, aber Montagfrüh würde Gauti ihn zur Kita bringen und normalerweise müsste sie ihn dort nachmittags abholen. Nicht, dass der arme Junge vergeblich auf seine Mama wartete. Sie hörte Gauti schon stöhnen, wenn er erfuhr, dass Daði länger bei ihm bleiben sollte, aber er meinte es nicht so. Er hatte sich für sie nicht als der Partner erwiesen, den sie sich erhofft hatte, aber er war ein wunderbarer Vater, der gerne Zeit mit seinem Sohn verbrachte. Und die Loddenfahrten waren kurz. Wenn alles wie geplant lief, war sie Montagabend oder spätestens Dienstag früh zurück. Zwei Extratage würden ihn nicht umbringen. Und sollte er deswegen Stress machen, würde sie ihm anbieten, dafür das nächste Papa-Wochenende zu übernehmen. Sie musste dafür nicht mal in den Kalender schauen, denn es war klar, dass Gauti dieses Angebot nicht annahm. Außerdem wusste sie ganz sicher, dass sie am nächsten Papa-Wochenende nichts vorhatte. Genauso wenig wie an allen anderen Wochenenden. Sie war von Natur aus introvertiert. Im Gegensatz zu Gauti. Auch das hatte zu ihrer Trennung beigetragen. Neben anderen Dingen, an die sie gerade nicht denken wollte.
Gunndís erspähte eine Person auf der Brücke, vermutlich Kapitän Hróbjartur, der sie heute früh geweckt und ihr den Job angeboten hatte. In dem kurzen Telefonat hatte er ihr mitgeteilt, dass sie eine dreizehnköpfige Crew seien, sechs Matrosen, drei Maschinisten, drei Steuermänner und er selbst. Mit ihr also vierzehn. Sie würden in Richtung Breiðafjörður fahren, wo sich die Lodden derzeit aufhielten. Er hatte nachgefragt, ob sie über ein gültiges STCW-Zertifikat verfüge, was sie bejahen konnte. Dann wollte er wissen, ob sie in einer Stunde an Bord sein könne. Auch das hatte sie bejaht, wenn auch etwas zögerlicher. Mehr hatte Hróbjartur nicht wissen wollen, und nachdem er ihr erklärt hatte, wo genau der Trawler auslief, war sie aus dem Bett gesprungen, hatte ein paar Dinge eingepackt und war losgerast. Die Fahrt von Breiðholt nach Grindavík dauerte vierzig Minuten, daher waren ihr fürs Packen und Fertigmachen nur zehn Minuten geblieben. Ganz sicher hatte sie irgendetwas vergessen, aber das Wichtigste hatte sie dabei: Zahnbürste, Wechselsachen und ihr Messerset.
Gunndís steckte das Handy wieder ein und stieg über die Reling an Deck. Mit der schweren Sporttasche an ihrer Schulter verlor sie kurz das Gleichgewicht. Um ein Haar wäre sie in den Spalt zwischen Schiff und Kaimauer gestürzt. Die Lücke war nicht so breit, dass sie im Wasser gelandet wäre, aber sie hätte sich verletzen können, wäre vielleicht mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus gelandet. So etwas sprach sich schnell herum, und dann würde sie lange auf eine neue Anfrage warten – und den Traum von einem festen Job auf See konnte sie sich dann ganz abschminken. Glücklicherweise hatte keiner ihre ungeschickte Kletterpartie beobachtet, es war kein Mensch an Deck. Leer war es trotzdem nicht. Ihren Weg musste sie sich durch ein Labyrinth aus Spulen, Ketten, Kränen, Winden, Masten und aller möglicher Ausrüstung bahnen.
Als sie im Inneren des Schiffes war, hörte sie vom Ende des Gangs Stimmen und folgte ihnen in der Hoffnung, jemanden zu finden, der sie zu ihrer Kajüte bringen und ihr den Weg zur Brücke zeigen konnte.
Vier Männer saßen in einem Raum, dem Trockenraum, wie ein Schild an der Tür verriet. Dort hingen Arbeitskleidung und Helme, gleichzeitig war es wohl ein Aufbewahrungsraum für diverses Kleinzeug, aber auch Pausenraum und Raucherzimmer. Die Männer blickten auf, als Gunndís hineinschaute, wirkten aber nicht sonderlich erstaunt über das Erscheinen eines weiblichen Crewmitglieds. Sie stellten sich zwar nicht mit Namen vor, begrüßten sie aber freundlich an Bord und sahen sie erwartungsvoll an. Als Gunndís fragte, ob jemand wisse, in welcher Kajüte sie untergebracht sei, sprang der jüngste der Männer auf und bot an, sie hinzubringen.
Gunndís war zum ersten Mal auf diesem Schiff, und obwohl ihr vieles vertraut vorkam, war nichts genauso, wie sie es von anderen Schiffen kannte. Doch eine Gemeinsamkeit gab es. Leider. Kaum an Bord, befiel sie dieses klaustrophobische Gefühl, das ihr den Atem raubte, wenn sie es nicht im Keim erstickte. Energisch schob sie alle Bilder von sich, auf denen die Gänge geflutet wurden, sich das Schiff auf die Seite legte oder Feuer an Bord ausbrach. Allein der Gedanke daran brachte ihren Puls zum Rasen. Sie wollte nicht vor dem jungen Matrosen kollabieren, also musste sie sich zusammenreißen. Meist half es, wenn sie sich bewusst machte, dass es noch viel schlimmere Situationen gab. Das hier war zumindest kein U-Boot oder Raumschiff.
Es würde schon alles gutgehen. Natürlich würde alles gutgehen. Solche Schiffsunglücke, wie sie es sich ausmalte, gehörten in isländischen Gewässern quasi der Geschichte an. Gunndís atmete tief ein und langsam wieder aus. Sie spürte, wie ihr Körper sich entspannte und auch ihr Herz wieder ruhiger schlug. Ein wunderbares Gefühl.
Damit die Panik nicht von den Toten auferstand, konzentrierte sie sich ganz auf die Umgebung. An der Wand neben dem Ausgang zum zweiten Deck hing ein Trockengestell für die Arbeitshandschuhe der Mannschaft. Über jeden Halter war ein steifer, wasserdichter Handschuh gestülpt. Die vielen dicken Finger, die in den Gang ragten, wirkten fast wie ein Kunstwerk. Hoffentlich fand sie ein Paar in einer kleineren Größe, wenn sie morgen wie jedes andere Crewmitglied Handschuhe überziehen würde. Denn der Koch fuhr nicht nur zum Kochen mit. Damit die Crew genug zu essen bekam, würde sie zwar als Letzte an Deck gehen und als Erste wieder in die Kombüse, aber sobald das Netz ausgelegt wurde, musste auch sie mit anpacken.
Eine enge, steile Treppe mit Geländern an beiden Seiten führte nach unten. Bei starkem Wellengang hätten selbst Zirkusartisten Schwierigkeiten, dort hinunterzuklettern, ohne sich festzuhalten. Unten befanden sich die Kajüten, und vor einer Tür ungefähr in der Mitte des Gangs blieb der junge Mann stehen. Gunndís atmete auf, denn sie hatte schon befürchtet, ganz hinten zu landen, wo der Maschinenlärm am lautesten war. Aus bitterer Erfahrung wusste sie, dass die Angst leichtes Spiel mit ihr hatte, wenn sie in der dunklen Kajüte unter dem Meeresspiegel wach lag. Dass sie ihren Seefahrertraum nicht schon längst begraben hatte, war wirklich erstaunlich. In der Schulkantine, wo sie Gemüse für Kinder schnippelte, die viel lieber Pizza essen wollten, hatte sie noch nie eine Panikattacke bekommen.
Der junge Mann öffnete die Tür, ging hinein und machte Licht. »Das ist die Kajüte des Kochs. Von dem Koch, der sonst mitfährt, meine ich. Seine Sachen stören dich hoffentlich nicht.« Er zeigte auf die untere Koje. »Das Bett ist frisch bezogen. Und im Bad sind saubere Handtücher.«
Gunndís nickte und lächelte freundlich. »Super. Danke.« Ihr Blick schweifte durch die Kajüte. Es lag nicht viel herum; ein paar Bücher, ein Laptop, eine Spielekonsole. An der Wand hing ein kleiner Fernseher. Auf dem Schreibtisch ein paar Zettel, die sie in eine der Schubladen legen würde, falls etwas Privates darauf stand. Außerdem war da noch eine Plastiktüte von einem Supermarkt, die hoffentlich nur Limo und Knabbereien enthielt und nichts, was verderben konnte. Oder schon verdorben war. Ansonsten war die Kajüte ordentlich, es lagen keine schmutzigen Socken herum oder anderer Kram des verhinderten Kochs. Sie stellte ihre Tasche neben das Bett. »Würdest du mich auf die Brücke bringen? Ich muss dem Kapitän Bescheid geben, dass ich da bin.«
»Das weiß er sicher schon. Aber klar, dann los.«
Als Gunndís die Tür hinter sich zuzog, fiel ihr auf, dass sie keinen Schlüssel bekommen hatte. Die Tür war auch nicht abgeschlossen gewesen. »Hast du den Schlüssel, oder wo kriege ich den her?«
»Oh. Ich glaube, es gibt keine Schlüssel. Die Kajüten sind immer offen.« Er senkte verlegen den Blick. »Hier passiert nichts.«
»Nein, natürlich nicht. Kein Problem.« Gunndís wünschte, sie hätte nicht gefragt. Oder sich an den Kapitän gewandt. Der verbrachte die meiste Zeit auf der Kommandobrücke und redete nicht viel mit den anderen. Jetzt sprach es sich bestimmt herum, dass sie Sorge hatte, jemand könnte zu ihr in die Koje kriechen.
Der junge Mann lächelte. »Ich heiße übrigens Logi. Habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Matrose.«
Sie lächelte zurück und streckte die Hand aus. »Gunndís.« Sie hatte sich mal wieder umsonst gesorgt. Logi wirkte aufrichtig und nett, überhaupt nicht wie jemand, der Geschichten über andere verbreitete.
Nachdem sie sich die Hand gegeben hatten, standen sie einen Moment unschlüssig voreinander, dann lief Logi los und sie folgte ihm. Im Vorbeigehen zeigte er ihr Kombüse und Messe, und sie prägte sich den Weg ein. Das Schiff war nicht besonders groß, aber die schmalen Gänge und unzähligen Türen verwirrten sie. Wenn die erste Mahlzeit anstand, wollte sie die Küche sofort finden und nicht orientierungslos durchs Schiff irren.
Auf der Brücke war von Enge nichts zu spüren. Der großzügig geschnittene Raum hatte Fenster zu allen Seiten, durch die in der Dunkelheit und wegen der Salzkruste allerdings nicht viel zu sehen war. Neben zwei Steuersesseln und dem massiven Steuerpult gab es eine Sofaecke, zwei Schreibtische und einen Ablagetisch mit zahlreichen Schubladen. Wo man auch hinblickte, waren Bildschirme, die dabei halfen, das Schiff sicher zu navigieren und Fischschwärme aufzuspüren.
Der Kapitän saß mit dem Rücken zu ihnen an einem der Schreibtische und war in die Anzeige auf einem Bildschirm vertieft. Logi räusperte sich und sagte dann: »Die Vertretungsköchin ist eingetroffen. Sie möchte sich kurz vorstellen.«
So formell, wie Logi sie ankündigte, klang es, als würde sie untertänigst vor einen Monarchen treten. Dabei wollte sie lediglich kurz Bescheid geben, dass sie an Bord war, falls der Kapitän auf sie gewartet hatte. Als er sich umdrehte, brachte sie dennoch ein Lächeln zustande und ließ sich ihre Irritation nicht anmerken.
»Willkommen. Entschuldige die Eile und vielen Dank, dass du alles stehen und liegen gelassen hast und hergekommen bist.« Er drückte fest ihre Hand. »Ich bin Hróbjartur. Wir haben vorhin telefoniert.«
Nachdem sie ein paar freundliche Worte gewechselt hatten, sagte Hróbjartur, dass sie bald auslaufen und gegen Mittag die Fanggründe erreichen würden, wenn alles nach Plan laufe. Ab acht solle das Frühstück bereitstehen, und das Mittagessen am besten, noch bevor sie das Netz auslegten. Falls das überhaupt möglich sei. Das Wetter werde eher schlechter, und es sei fraglich, ob sie dann wirklich loslegen könnten. Im Zweifel erst am Sonntagmorgen, aber essen müssten sie natürlich trotzdem. Er wisse nicht, was der Koch bestellt habe, aber Kühlschrank und Vorratskammer dürften gut gefüllt sein. Damit sollte sie etwas anfangen können.
Bis zum Frühstück waren es noch einige Stunden, da konnte sie sich noch mal kurz aufs Ohr hauen. Doch vorher wollte sie sich die Vorräte ansehen, um beim Einschlafen über den Speiseplan nachzudenken, anstatt sich auszumalen, welche Katastrophen an Bord passieren konnten.
Logi begleitete sie zur Kombüse, obwohl sie dem Matrosen erklärt hatte, dass sie den Weg schon finden würde. Offenbar hatte er sich zum Empfangschef erkoren und nahm seinen Job sehr ernst. Während sie die Regale inspizierte, fragte er ihr Löcher in den Bauch. Woher sie komme, mit welchen Schiffen sie schon gefahren sei und ob sie diesen oder jenen Koch kenne, mit denen er offenbar gearbeitet hatte. Als ihm die allgemeinen Fragen ausgingen, wurde er persönlich. War sie verheiratet? Hatte sie Kinder? Wie alt war sie?
Sie beantwortete gewissenhaft alle Fragen: Sie kannte nur wenige der Leute, die er nannte, aber konnte mehrere Schiffe aufzählen, auf denen sie gearbeitet hatte. Sie war alleinerziehende Mutter und gerade achtundzwanzig geworden. Dann kam eine Frage, auf die sie keine eindeutige Antwort hatte. Sie überlegte, ob sie ihm einfach irgendetwas erzählen sollte, als er von ihr wissen wollte, wie sie darauf gekommen war, Schiffsköchin zu werden. Sie befürchtete, dass die Wahrheit noch mehr Fragen nach sich ziehen würde, doch sie riskierte es und antwortete: »Mein Vater war Koch. Schiffskoch. Ich wollte immer in seine Fußstapfen treten.«
Tatsächlich horchte der Matrose auf, als witterte er ein gutes Gesprächsthema. »Kenne ich ihn vielleicht? Wie heißt er?«
»Nein. Sicher nicht. Er ist tot. Schon lange.« Gunndís verzog den Mund zu einem Lächeln, das sofort erstarrte. Sie wollte nicht über den Tod ihres Vaters reden. »Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Speiseplan?«
Auch Logi schien froh über den Themenwechsel. Niemand wollte mit Fremden über Tod und Trauer sprechen. »Ja. Kann sein.« Er zeigte auf eine Schublade, in der der Koch verschiedene Unterlagen aufbewahrte. Gunndís öffnete die Schublade und durchsuchte sie, doch sie fand nur Notizen und Broschüren von diversen Lieferanten.
»Ich glaube, er hat ein gutes Kochbuch da unten im Schrank, falls das hilft.« Er holte das Buch heraus. »Diese Rezepte kommen hier jedenfalls immer gut an.«
Gunndís nahm das Buch. Sie starrte auf den vertrauten Umschlag und spürte, wie sich in ihr alles verkrampfte. Vor achtzehn Jahren, als Zehnjährige, hatte sie ihrem Vater dieses Buch zu Weihnachten geschenkt. Damit er leckeres Essen für seine Seeleute kochen konnte. Kochen für viele – Festessen für Hungrige. Sie hatte das Buch selbst ausgesucht und eingepackt, und ihre Vorfreude war so groß gewesen, dass sie ihm schon beim Auspacken alles verriet.
Dieses Buch war das letzte Weihnachtsgeschenk für ihren Vater gewesen. Einen Monat später war er tot. Am liebsten hätte Gunndís die Augen geschlossen und das Buch fest an sich gedrückt. Das tat sie natürlich nicht, wollte nicht mit Logi darüber sprechen, so nett er auch wirkte. Außerdem war es reiner Zufall, dass ihr das Buch hier in die Hände fiel; dieses Exemplar war natürlich nicht das ihres Vaters. Genauso wenig wie die Winston-Zigaretten, die hier offenbar geraucht wurden und die sie ebenfalls an ihren Vater erinnerten.
»Unser Lieblingsessen aus dem Buch ist Wiener Schnitzel. Mit Röstzwiebeln.« Logi lächelte.
Gunndís war dankbar für den Hinweis. Er holte sie zurück in die Gegenwart. »Wiener Schnitzel kriege ich hin. Ich hatte mich schon über das Kalbfleisch in der Kühltruhe gewundert. Jetzt ist mir alles klar.« Sie schlug das Kochbuch auf, um das Rezept herauszusuchen – und erstarrte, als ihr Blick auf die Titelseite fiel.
Dort stand handgeschrieben:
Für Papa,
jetzt kannst du leckeres Essen für deine Seeleute kochen.
Deine Gunndís
Ihr wurde schwindlig, sie fühlte sich wie in einem Traum. Ihr Vater hatte das Buch, ihr Weihnachtsgeschenk, auf seine letzte Fahrt mitgenommen. Und das Schiff war mit Mann und Maus untergegangen.
2. Kapitel — Donnerstag
»Ihr da!«, schallte es aus dem Büro von Erla, der Chefin ihres Ermittlungsteams. Týr ließ den Blick durch das Großraumbüro wandern, aber da war niemand außer ihm und Karó, die am Nachbartisch saß. Erst jetzt drehte er sich zu Erla um, die ungeduldig im Türspalt stand und mit dem Finger auf sie zeigte. Mit ihr da waren unmissverständlich Karó und er gemeint.
Niemand würde sich Erla als Chefin wünschen. Aber leider war sie die Chefin, also mussten sie sich mit ihr abfinden. Besser ärgerte man sich über Dinge, die sich ändern ließen, und nicht über Personalentscheidungen, die mehrere Hierarchieebenen über ihnen getroffen wurden. Und obwohl Erla barsch und eine absolute Katastrophe im zwischenmenschlichen Umgang war, hatte sie ihre Vorzüge.
»Wie heißt ihr noch mal?« Erla ließ sie in ihr Büro und setzte sich. Týr und Karó nannten ihr zum hundertsten Mal ihre Namen, die sie sofort wieder vergessen würde, sobald sie den Raum verließen. So ging es den meisten Kolleginnen und Kollegen, die nicht besonders hoch in Erlas Gunst standen. Daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern. Denn um ein Problem in den Griff zu bekommen, musste man sich erst einmal bewusst sein, dass es ein Problem gab. Den Vorschlag eines Kollegen, dass alle im Team Namensschilder tragen, hatte Erla sofort vom Tisch gewischt. Sie sah nicht, wozu das gut sein sollte, und begriff auch nicht, dass es vor allem als Hilfe für sie gedacht war.
Erla musterte Karó und Týr, der sich schon auf eine Standpauke gefasst machte. Er hatte nicht den geringsten Schimmer, was sie angestellt haben könnten. Soweit er wusste, war nichts vorgefallen; überhaupt war es in den letzten Wochen ungewohnt ruhig zugegangen. Der einzige große Fall – wenn man ihn überhaupt so nennen konnte – war der Fund von menschlichen Knochen auf einem Sorpa-Recyclinghof vor knapp zwei Wochen. Aber damit waren nicht Karó und er befasst, sondern Leute, die Erla mit Namen kannte.
»Kennt ihr irgendeine Tagesmutter? Tante, Onkel, Freundin, Nachbarn oder was weiß ich?«
Die Frage kam überraschend, und andererseits auch wieder nicht. Selbst Týr war nicht von ihren ewigen Klagen über den Mangel an Kinderbetreuungsplätzen im Hauptstadtgebiet verschont geblieben. Erla hatte ein Kind, und es schien ein großes Problem zu sein, einen verlässlichen Platz zu finden.
»Nein. Leider«, antwortete Týr.
Auch Karó wusste keinen Rat. »Ich kenne leider auch niemanden.«
Erla presste die Lippen zusammen und starrte sie stumm an, wie eine Schuldirektorin zwei freche Schüler, die man dabei erwischt hatte, wie sie die Toiletten mit Klopapier verstopften. Sie hatte tiefe Ringe unter den Augen, die fast wie kleine Hängematten aussahen, in denen die Augäpfel lagen. Offenbar raubte das Betreuungsproblem ihr den Schlaf.
»Hätte ja sein können.« Erla seufzte, dann entspannten sich ihre Gesichtszüge ein wenig. »Egal. Die Kollegen aus Grindavík brauchen unsere Unterstützung. Irgendein unwichtiger Quatsch, aber wir müssen reagieren. Nachbarschaftsstreitigkeiten.«
Karó kam Týr zuvor. »Wozu brauchen sie Unterstützung aus Reykjavík? Warum kann sich die Polizei Suðurnes nicht darum kümmern? Hat Grindavík keine Polizeiwache?« Schnell fügte sie hinzu: »Ist natürlich kein Problem vorbeizuschauen. Ich frage mich nur …«
»Diese bescheuerten Nachbarn haben bereits die meisten Kollegen der örtlichen Polizei angezeigt. Auch Kollegen der Bezirkspolizei haben sie schon Diskriminierung, Bestechlichkeit und wer weiß was vorgeworfen. Alles Schwachsinn, diese Leute sind einfach nur Querulanten. Sie haben auch die örtlichen Behörden verklagt. Und die Nachbarn natürlich. Das geht immer hin und her. Wenn das eine Ehepaar klagt, zeigt das andere sie wegen derselben Sache an. Kinderkram, aber verständlicherweise hat keiner der Kollegen da unten mehr Lust, sich weiter mit denen abzugeben. Zumindest nicht solange die Klagen laufen. Jede Folgeklage verzögert den gesamten Prozess.«
»Also fahren wir hin und handeln uns wahrscheinlich auch eine Klage ein?« Týr war ja nicht blöd.
Erla machte ein Pokerface und dachte kurz nach. »Ja. Vermutlich wird es so laufen.«
»Super.« Auch Karó war nicht scharf auf diesen Job.
»Keine Sorge. Ich nehme allen Ärger auf mich. Dafür bin ich da. Ich gehe davon aus, dass ihr keine Verbindung nach Grindavík habt? Sodass man euch nicht vorwerfen kann, dass ihr für eine Seite Partei ergreift?«
Beide nickten.
Týr hatte keine Lust, ihr zu erklären, dass sich die Klagen dieser Leute sicher nicht so leicht aus der Welt schaffen ließen. Sonst müssten sie ja nicht nach Grindavík fahren, sondern die Polizei vor Ort könnte sich um die Sache kümmern. Bei Strafanzeigen gegen Beamte gab es klare Regeln, daran änderte auch ein Anruf von Erla nichts. Sie hätten das gesamte Prozedere an der Backe, auch wenn völlig klar war, dass die Anzeige aus der Luft gegriffen war. So funktionierte das System, und auch sie waren Teil dieses Systems. Dass er jetzt keine Welle machte, lag nicht daran, dass er befürchtete, damit bei Erla auf taube Ohren zu stoßen – was definitiv der Fall wäre –, sondern dass es ihm schlicht egal war. Er war sich nicht sicher, ob er weiter hier arbeiten würde, wusste noch nicht einmal, ob er im Land bleiben wollte.
Dass er sich in Island so unwohl fühlte, war nicht der Arbeit geschuldet, sondern generell seinem verkorksten Leben. Er war einsam, seit er Schweden verlassen hatte, ohne darüber nachzudenken, dass er in Island keine Freunde hatte. Es gab da zwar einige Verwandte, aber die konnten seine sozialen Bedürfnisse natürlich nicht befriedigen. Er hatte sich bei einer Dating-App registriert und einige Frauen getroffen, aber es war beiden Seiten immer schnell klar gewesen, dass sie nicht zusammenpassten. Im Moment steckte er in einer hoffnungslosen Beziehung und musste dringend den Mut aufbringen, sie zu beenden. Je eher er diesen Schritt machte, umso besser war es für sie beide. Seine geheime Hoffnung, dass sie ihm zuvorkam, würde sich ziemlich sicher nicht mehr erfüllen. Leider. Es war nicht schön, verlassen zu werden, aber immer noch hundertmal angenehmer, als dem anderen den Laufpass zu geben.
Das Beziehungsschlamassel war nicht das Einzige, was ihn bedrückte. Er war in dem Glauben aufgewachsen, dass Tante und Onkel ihn als Kleinkind adoptiert hatten. Dass seine Mutter an Krebs gestorben war und sein Vater ihn nicht zu sich nehmen wollte. Er hatte nie einen Grund gehabt, daran zu zweifeln, war beim Tod seiner Mutter noch so jung gewesen, dass er über keinerlei Erinnerungen verfügte. Doch nach seiner Rückkehr nach Island war die Wahrheit ans Licht gekommen und er wünschte, er hätte sie nie erfahren. Sein leiblicher Vater hatte seine Mutter ermordet und sich anschließend im Gefängnis das Leben genommen. Das war ein schwerer Schlag für Týr gewesen. Und als er sich gerade wieder einigermaßen gefangen hatte, hatte ihm Rechtsmedizinerin Iðunn gesteckt, dass der Tathergang nicht zu den Beweisen passte und sein Vater nicht der Täter sein konnte. Es war zwar eine Erleichterung gewesen, nicht von einem Mörder abzustammen, doch dieses Gefühl wurde schnell von dem überwältigenden Verlangen überlagert, die Wahrheit herauszufinden.
Doch daraus würde nichts werden. Sein Vater hatte sich erhängt, seine Mutter war tot, und niemand konnte mehr berichten, was wirklich geschehen war. Für die Polizei war der Fall abgeschlossen, und Týr würde sich auch nicht für eine Wiederaufnahme der Ermittlungen einsetzen. Er hatte einfach keine Kraft dafür. Zumal die Polizei unterbesetzt war und niemand Lust hatte, die begrenzten Kapazitäten auf einen alten Fall zu verwenden. Eine solche Anfrage würde man mit Sicherheit jahrelang im System dümpeln lassen in der Hoffnung, dass er es irgendwann aufgab. Außerdem wollte er die Kollegen auch nicht auf seine Vergangenheit aufmerksam machen. Wenn der Fall tatsächlich wieder aufgerollt würde, musste er damit rechnen, dass der Kollege am Nachbartisch in den Geheimnissen seiner Eltern herumwühlte, sich Bilder von den Leichen seiner Eltern ansah und las, was der Kinderpsychologe damals über ihn geschrieben hatte. Das würde ihn endgültig fertigmachen.
Aber vielleicht wäre es doch erträglicher als diese nagende Sehnsucht nach der Wahrheit?
Er hatte es aufgegeben, darauf zu warten, dass sie nachließ; die Sehnsucht war noch genauso intensiv wie in dem Moment, als er davon erfahren hatte. Und es half auch nicht, dass ihm beim Blick in den Spiegel jedes Mal die Narbe auf seiner Stirn ins Auge sprang, die er von dem tödlichen Angriff auf seine Mutter davongetragen hatte. Man hatte ihm immer erzählt, dass sie von einem Dreiradunfall herrührte – nicht von einem Axtangriff. Wer bitte fällt mit einer Axt über ein Kleinkind her? Nachdem er Fotos von den furchtbaren Verletzungen seiner Mutter gesehen hatte, fragte er sich, warum der Mörder ihm nur einen einzigen, verhältnismäßig leichten Schlag verpasst hatte. Es war ziemlich offensichtlich, dass der Täter es ganz gezielt auf Týrs Mutter abgesehen hatte, denn bei einem zufälligen Angriff eines Psychopathen wäre es mit Sicherheit nicht bei einem Todesopfer geblieben. Dafür sprach auch, dass es in den darauffolgenden drei Jahrzehnten keinen weiteren Angriff dieser Art mehr gegeben hatte. Wobei es natürlich sein konnte, dass der Täter selbst verstorben war, dass er sich in einer psychiatrischen Anstalt befand oder wegen anderer Vergehen im Gefängnis saß.
Auch darauf würde Týr nie Antworten erhalten, und trotzdem grübelte er laufend darüber nach. Nicht umsonst hatte er Kriminologie studiert. Je weniger bei der Arbeit zu tun war, umso mehr Raum blieb für diese Grübeleien. Fast schien es, als hielten die Kriminellen des Landes die Füße still, bis der Winter endlich vorbei war.
Karó nahm einen Stapel Dokumente entgegen, die Erla ausgedruckt hatte, damit sie sich während der Fahrt nach Grindavík in den Nachbarschaftsstreit einarbeiten konnten. Alles Fälle, in die diese furchtbaren Nachbarn verwickelt waren. Als sie gerade das Büro verlassen wollten, rief Erla: »Eine Sache noch. Du. Karen.«
»Karó.«
»Ja. Genau. Karó.«
Auch Týr war stehen geblieben und wusste nicht, ob er weitergehen oder ebenfalls warten sollte. Während er noch überlegte, legte Erla schon los.
»Ähm, bist du eigentlich zufrieden? Willst du über irgendetwas sprechen, was die Kollegen angeht oder so?«
Karó guckte irritiert. »Doch, doch. Alles gut. Der Kaffee könnte besser sein, aber ansonsten …«
»Eigentlich meinte ich etwas anderes. Du weißt schon … Ob dir gegenüber mal irgendwer … ähm, na ja, du weißt schon …«
Karós Blick verhärtete sich. »Nein. Ich weiß nicht.«
Erla fuchtelte mit einer Hand in der Luft herum. »Ich meine Rassismus. Hast du hier jemals Rassismus erlebt? Wenn ja, will ich das wissen. So etwas gibt es verdammt noch mal nicht in meinem Team.«
Týrs Selbstmitleid wurde von Mitgefühl für Karó überlagert. Sie war so isländisch wie Skyr, hier geboren und aufgewachsen, guckte den ESC, begrüßte das neue Jahr mit Raketen, schimpfte über die Politik und das Wetter, kraxelte bei jeder Gelegenheit in den Bergen herum und snackte Fladenbrot, geräuchertes Lammfleisch und Nocco. So gesehen war sie noch viel isländischer als er selbst. Aber im Gegensatz zu ihm war sie schwarz und wurde daher oft für eine Immigrantin oder Touristin gehalten. Die isländische Gesellschaft war einfach viele hundert Jahre lang so homogen wie zur Landnahmezeit geblieben. Dass sich das inzwischen geändert hatte, war noch nicht bei allen angekommen. Bei Einsätzen führte das manchmal zu Situationen, die in erster Linie peinlich waren. Knallharten Rassismus gegenüber Karó hatte Týr aber noch nicht erlebt, was natürlich auch daran lag, dass sie nur während der Arbeit miteinander zu tun hatten und niemand so dumm war, sich vor der Polizei als Rassist zu outen. Aber frei davon war Island genauso wenig wie andere Länder, daher war Erlas Sorge durchaus berechtigt.
»Ich hätte mich beschwert, wenn etwas vorgefallen wäre.«
Týr hörte die Gereiztheit in Karós Stimme, die Erla vermutlich nicht wahrnahm. Karó und er saßen im Büro nebeneinander und kannten sich inzwischen ziemlich gut.
»Ja. Super. Wenn, dann meldest du dich.« Der Anflug eines Lächelns huschte über Erlas Gesicht, die sichtlich zufrieden wirkte. Sie nahm einen Stift in die Hand, und Týr dachte schon, sie wollte auf einem der Formulare, über die sie immer stöhnte, ein Häkchen hinter den Punkt »Maßnahmen gegen Rassismus« setzen. Doch sie kratzte sich bloß hinter dem Ohr. »Jetzt aber schnell nach Grindavík. Bevor diese Nachbarn sich noch gegenseitig umbringen.«
Erst als sie die Aluminiumfabrik hinter sich ließen, hatte Karó sich wieder einigermaßen gefangen. Sie hatten zwar ein paar Worte gewechselt, aber sie wirkte total niedergeschlagen und zeigte so deutlich, dass ihr nach Schweigen zumute war, dass Týr das Radio einschaltete. Auch wenn er ein Gespräch über das Thema scheute, konnte er sich vorstellen, wie nervig es sein musste, wenn ständig die Hautfarbe zum Thema gemacht wurde. Selbst wenn Erla es nur gut meinte. Týr atmete auf, als Karó von den Dokumenten aufblickte, das Radio leiser drehte und wieder ganz die Alte war.
»Da können wir uns auf was gefasst machen.« Sie sah aus dem Fenster, auf die endlosen Lavafelder, die von Moos bedeckt waren, das im grauen Wintergewand ganz matt wirkte. »Das ist schon heftiger als der übliche Streit unter Nachbarn. Fast schon ein Krieg. Wenn es stimmt, was hier steht, hat das richtig üble Ausmaße angenommen.«
Týr hatte keine Erfahrung mit solchen Konflikten. Die Wohnung, in der er lebte, gehörte seinen Adoptiveltern in Schweden, die sie bislang immer während ihrer Islandaufenthalte genutzt hatten. Sie befand sich in der mittleren Etage eines Dreiparteienhauses, und die Nachbarn oben und unten waren so ruhig und friedlich wie Schmetterlinge. Was den Garten oder die Hausfarbe anging, war Týr leidenschaftslos, und alle Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen akzeptierte er ohne Protest. Er konnte sich beim besten Willen keine Situation vorstellen, die einen Krieg im Haus auslösen würde. Alle wollten ihren Frieden.
Leider war das nicht überall so. Während seines Studiums hatte er ein bisschen was über Psychologie gelernt, genug, um einigermaßen zu verstehen, wie der Mensch tickte und was ihn aus dem Gleichgewicht bringen konnte. Dazu brauchte es noch nicht einmal die besondere Nähe zwischen Nachbarn. Wenn es schlecht lief, konnten die Menschen über alles Denkbare streiten. »Steht da auch, wie alles angefangen hat?«
»Nein, nicht wirklich. Das wirkt fast wie ein buntes Buffet, an dem sie sich bedienen. Es geht um die Grundstücksgrenzen, einen Wohnwagen, der die Aussicht verdeckt, Lärm, Löwenzahn, lästige Pflichten, stinkenden Kompost, einen frei laufenden Hund. Zu grelle Weihnachtsbeleuchtung am Dachfirst – im Ernst jetzt?«
»Das klingt doch alles total harmlos, damit muss sich doch die Polizei nicht befassen.«
»Stimmt. Das Auffallende ist hier aber auch nicht der jeweilige Anlass des Streits, sondern die Reaktion darauf. Die wirkt völlig übertrieben.«
»Zum Beispiel?«
»Wenn das wirklich stimmt, haben die Leute Reifen aufgeschlitzt, am Wohnwagen randaliert, Mülltonnen in den Nachbargarten entleert, Trampolinverankerungen gelöst, Haustiere vergiftet, Fenster mit Steinen eingeschlagen, Zucker in einen Benzintank gefüllt, einen Rasen mit Salz zerstört, einen anderen mit heißem Wasser, Überwachungskameras demoliert, anonyme Briefe mit allen möglichen Diffamierungen über das benachbarte Ehepaar in der Nachbarschaft verteilt, Bestellungen aus dem Internet abgefangen und Essen zertreten, das der Lieferant vor die Tür gestellt hat. Das ganze Programm.«
»Beide Ehepaare?«
»Ja. Ich habe den Eindruck, dass keine Partei unschuldig ist. Sie streiten natürlich alles ab und niemand weiß, was wahr und was gelogen ist.« Karó zuckte mit den Schultern. »Vielleicht ist eine Partei ja doch unschuldig, und die anderen sind auf ihrem eigenen Essen herumgesprungen und haben ihr Eigentum selbst beschädigt, um es so aussehen zu lassen, als wären sie angegriffen worden. Wer weiß. Alle vier wirken gestört genug für so etwas.«
»Was machen diese Leute sonst so? Arbeiten sie oder ist dieser Nachbarschaftskrieg ein Vollzeitjob?«
»Einer der Männer fährt für eine Reederei auf See. Seine Frau arbeitet für die örtliche Gewerkschaft. Die andere Frau ist Reiseleiterin, und ihr Mann ist bei einer Autovermietung auf dem Flughafen Keflavík angestellt.« Karó sah ihn mit fragendem Blick an. »Wäre interessant zu wissen, ob sie bei der Arbeit auch Probleme haben oder ob sie nur im Privatleben so durchdrehen.«
Eines war jedenfalls klar: Sie mussten sich auf was gefasst machen …
Als sie in die Straße bogen, in der der Nachbarschaftskrieg tobte, konnte man den Eindruck gewinnen, dass hier ganz normale Familien wohnten. Typisch isländische Einfamilienhäuser, mittelgroß, solide Bauweise, meist zweigeschossig, triste Farben. Nur ein Haus stach heraus. Es befand sich im hinteren Teil der Straße und war ganz offensichtlich bei einem Brand zerstört worden. Die Hauswand rund um die zugenagelten Fenster im Obergeschoss war rußschwarz. Das Dach erinnerte an ein Sieb; ein Großteil der Eindeckung fehlte, und durch die Löcher waren die verkohlten Dachbalken zu sehen. Týr ahnte, dass sich das Feuer im Dachstuhl ausgebreitet und die Feuerwehr die Dacheindeckung heruntergerissen hatte, um besser an den Brandherd heranzukommen.
Er starrte auf das Haus. »Wie kann es sein, dass das Haus so stehen bleibt? Warum wurde es nicht längst abgerissen?«
»Frag nicht mich.« Karó wandte den Blick ab und schüttelte sich. »Aber ich glaube, ich weiß, welches Haus das ist. Vor ungefähr einem Jahr wurde in den Nachrichten über einen Hausbrand in Grindavík berichtet. Zwei Kinder und ihr Vater sind in den Flammen ums Leben gekommen. Die Ehefrau hat überlebt. Furchtbar. Das muss das Haus sein.«
»Ja, stimmt. Shit.« Von diesem Hausbrand hatte auch Týr gehört, obwohl ihn die isländischen Nachrichten nicht sonderlich interessierten. Aber manche waren so furchtbar und erschütternd, dass er doch mehr als nur die Schlagzeile las. Der tragische Brand fiel in diese Kategorie. Angesichts der Brandruine kamen ihm die Nachbarschaftsstreitigkeiten einfach nur lächerlich vor.
Er wandte sich von dem Haus ab und sah in die Sackgasse hinein. Dort standen drei Häuser, ebenfalls zweigeschossig. Er hielt vor dem mittleren Haus, und das Navi bestätigte, dass sie ihr Ziel erreicht hatten.
Eine völlig überflüssige Mitteilung, denn was sie vor sich sahen, räumte jeden Zweifel aus. Das Schlachtfeld lag genau vor ihnen.
3. Kapitel — Donnerstag
Das verbrannte Haus war schlagartig vergessen, und Týr nahm ein seltenes Gefühl wahr: eine Art Unbeschwertheit. Und das lag nicht an der frischen Luft in Grindavík, sondern an dem Anblick, der sich ihnen bot. Er war geradezu fasziniert davon. Karó schien es ähnlich zu gehen. Seine eigenen Probleme hatten sich natürlich nicht in Luft aufgelöst, aber es tat gut zu sehen, dass andere noch viel schlimmer dran waren. Er schlug sich zwar mit schwierigen Fragen zu Vergangenheit und Gegenwart herum, aber wenigstens brüllte ihn dabei niemand an. Und er wurde auch nicht mit Dingen beworfen, während er überlegte, ob er das Land verlassen sollte. Ihm war es vergönnt, sich in aller Ruhe mit seinen Problemen zu befassen.
Das traf auf die benachbarten Ehepaare vor ihnen nicht zu. Von Gesprächen zur Konfliktlösung hatten sie sich längst verabschiedet, stattdessen rechneten sie wie Höhlenmenschen miteinander ab. Diese Leute steckten wirklich tief in der Scheiße.
Sie mussten vorsichtig sein. Wenn sie aufpassten und ein bisschen Glück hatten, bestand die Chance, dass sie ohne Klage am Hals von diesem Einsatz zurückkehrten. Eine winzige Chance. Es würde sich zeigen, ob das Glück ihnen hold war. Týr schaltete die Bodycam ein und sah, dass auch Karó dies tat. Aufs Glück allein durften sie sich nicht verlassen. Nicht, dass sich die Erzfeinde noch gegen die Polizei verbrüderten.
»Bereit?« Karó wirkte nicht ganz so motiviert wie er. Sie zog ihren Reißverschluss zu und murmelte etwas Unverständliches.
Týr nickte aufmunternd und hoffte, dass sie ihm die leise Vorfreude nicht anmerkte. Sein letzter Einsatz im Streifendienst war verdammt lange her. Damals war er froh darüber gewesen, sich hinter den Schreibtisch zu setzen und sich nicht mehr mit Menschen im Ausnahmezustand und mit Einbrüchen herumschlagen zu müssen, die nie aufgeklärt werden würden. Aber aus der Ferne wirkten alle Berge blau – und auf einmal hatten solche Einsätze wieder einen Reiz.
Keine der Kriegsparteien hatte bemerkt, dass sie in die Straße eingebogen waren. Und niemand merkte, dass sie aus dem Wagen stiegen.
Karó baute sich vor den Streitenden auf. »Was ist hier los?«
Erst jetzt verstummte das Geschrei, und die Leute drehten sich wie perfekt aufeinander abgestimmte Synchronschwimmerinnen zu Karó und Týr um. Auf den tiefroten, wutverzerrten Gesichtern machte sich Erstaunen breit. Die Leute standen rechts und links einer Hecke, die offenbar Schlimmeres verhindert hatte. Dennoch hatten beide Männer Verletzungen im Gesicht, der eine Blutspuren unter der Nase und am Kinn, der andere eine zerkratzte Wange.
Von den leichten Blessuren der Familienväter abgesehen, wirkten die beiden Paare wie ganz normale Eheleute, die gewissenhaft ihre kontinuierlich steigenden Kreditraten zahlten, regelmäßig zum Friseur gingen, im Januar Urlaub auf Teneriffa machten und darauf achteten, dass sie rechtzeitig zum Þorrablót-Fest ihres Sportvereins zurück waren.
Eine der Frauen ergriff das Wort. »Was?!«, fuhr sie Karó und Týr an, als ob die beiden in den Streit verwickelt wären. Die anderen drei stimmten mit ein.
»Was mischt ihr euch hier ein?«
»Habt ihr nichts Besseres zu tun?«
»Wer hat euch verdammt noch mal gerufen?«
Karó und Týr ließen sich davon nicht irritieren, sie hatten sich auf Schlimmeres gefasst gemacht. Rassistische Kommentare zum Beispiel. Týr entspannte sich, erleichtert darüber, dass er nicht für seine Kollegin Partei ergreifen musste, Bodycam hin oder her. Vermutlich hätte er sich damit nicht nur Ärger von den Pöblern hier, sondern auch von Karó eingehandelt, die solche Situationen immer selbst klären wollte.
Schließlich erklärte Týr ruhig: »Uns wurden Lärmbelästigung und eine Schlägerei in der Straße gemeldet.« Dann wiederholte er Karós Frage: »Was also ist hier los?«
Im ersten Moment wollte niemand etwas sagen, standen alle nur da und starrten Karó und Týr wütend an. Bis ihnen klar wurde, dass es vermutlich am klügsten war, die eigene Sicht der Dinge zügig darzulegen und so die Richtung vorzugeben, in die das Ganze hier sich entwickeln würde. Der Mann mit dem blutigen Gesicht war am schnellsten. »Er hat mich angegriffen.« Er zeigte auf seinen Nachbarn und schob zum Beweis sein Kinn vor. Er war das Opfer, nicht der Täter. »Vorhin. Einfach so. Hier auf dem Gehweg.«
»Scheißlügner! Du hast mich angegriffen.« Mit der einen Hand zeigte er auf die Kratzer in seinem Gesicht, mit der anderen auf seinen Nachbarn. »Der hat mir wie eine Hexe das Gesicht zerkratzt.«
Daraufhin wollten auch die Frauen ihren Senf dazugeben, und die Männer gerieten wieder in Streit. Karó hielt eine Hand hoch. »Stopp. Einer nach dem anderen. Fangen wir mit Namen und Adresse an.« Sie zeigte auf eine der Frauen. »Sie zuerst.«
Einer nach dem anderen nannte seinen Namen, und Týr schrieb gewissenhaft mit. Guðrún war mit Jón verheiratet, Sigríður mit Þórður. Den Adressen nach zu urteilen standen alle Beteiligten jeweils auf ihrem eigenen Grundstück. Die winterlichen Vorgärten auf beiden Seiten der Hecke sahen chaotisch aus, nachdem die Leute sich gegenseitig mit allem beworfen hatten, was in Reichweite gewesen war: abgerissene Äste von der Hecke, ein alter, platter Fußball, eine Pepsi-Dose, eine kleine Plastikschaufel und zwei Blumentöpfe aus Ton. Keines dieser Dinge flog wirklich gut, daher hatten die Leute leicht ausweichen können. Anders sah es mit den Steinen aus, die überall herumlagen. Gott sei Dank waren die Beteiligten offenbar nicht besonders treffsicher.
»Worum geht es bei Ihrem Streit?«, fragte Karó, nachdem der letzte Name notiert war.
Darauf redeten alle wild durcheinander und wetteiferten darum, dem jeweils anderen Ehepaar die Schuld in die Schuhe zu schieben, bis Karó und Týr genug hatten und das Gekeife unterbrachen. »So geht das nicht, wir müssen einzeln mit Ihnen reden.«
Die Leute verstummten und blickten sie wütend an. Einer der Männer runzelte die Brauen und fragte: »Moment mal, ihr seid gar nicht von hier, oder? Wer seid ihr eigentlich?«
»Wir kommen aus Reykjavík. Die Kollegen vor Ort hatten keine Zeit.« Eine kleine weiße Lüge war schon in Ordnung. Dass sie von der Polizei waren, stellte wohl keiner infrage, schon allein der Uniformen und des Einsatzwagens wegen.
»Seid ihr überhaupt weisungsberechtigt? Bewegt ihr euch nicht außerhalb eures Hoheitsgebiets oder wie auch immer das heißt?« Der Mann verschränkte voller Selbstzufriedenheit die Arme vor der Brust. Doch sein Triumph währte nicht lange, denn die Leute jenseits der Hecke schnauzten ihn an, er solle sein verdammtes Maul halten und die Polizei ihren Job machen lassen. Karó rief über das Gezanke hinweg, das unverzüglich ausbrach, sie seien rechtmäßig und offiziell hier, da müsse sich niemand Sorgen machen. Dann wählten sie willkürlich die erste Person aus und baten sie, ihnen in den Wagen zu folgen. Die anderen sollten warten, bis sie an der Reihe waren. Und zwar in ihren Häusern, fügte Týr hinzu, denn er hatte keinen Nerv, ständig aus dem Auto zu springen und den Streitschlichter zu spielen.
Zum Glück machten die Leute, was sie tun sollten, und die Haustüren öffneten sich nur, wenn die nächste Person an der Reihe war. Doch schlauer wurden sie aus diesen Befragungen nicht. Die Berichte der jeweiligen Ehepartner deckten sich bis ins Detail, doch links und rechts der Hecke gab es keinerlei Übereinstimmungen. Þórður und Sigríður erzählten, der aktuelle Streit habe begonnen, nachdem die Nachbarn ihr Auto zerkratzt hätten. Der Lack war tatsächlich beschädigt. Auf der einen Seite des Wagens hatte jemand kreuz und quer Linien hineingeritzt, stellenweise bis in den Stahl. Da hatte jemand richtig Kraft und Zeit aufgewendet. Spontan fand Týr es wahrscheinlicher, dass es ein Mann gewesen war, aber sicher war das nicht. Hass konnte ungeahnte körperliche Kräfte freisetzen. Möglicherweise hatte sich hier auch eine durchgedrehte Frau abreagiert.
Jón und Guðrún, denen der Schaden zugeschrieben wurde, stritten das vehement ab. Sie seien nicht einmal in die Nähe des Wagens gekommen. Womöglich hätten die Nachbarn ihr Auto selbst zerkratzt, um es ihnen vorwerfen zu können. An ihren Gesichtern ließ sich kaum etwas ablesen, beim Parkplatz gab es keine Überwachungskamera und Zeugen vermutlich auch nicht. Und selbst wenn, wäre diese Person sicher nicht erpicht darauf, in den Krieg am Ende der Sackgasse hineingezogen zu werden. Daher stand Aussage gegen Aussage.
Die Leute erzählten noch mehr, nutzten die Gelegenheit und packten alles aus, was man ihnen angetan hatte. Das meiste davon hatte Týr bereits auf der Fahrt von Karó erfahren. Wenn das alles tatsächlich stimmte, waren diese Nachbarn in einem verrückten Pingpong-Krieg gefangen. Auf jede Provokation folgte sofort eine Retourkutsche. Darauf reagierten dann wieder die Nachbarn, und so ging das immer weiter. Alles erwachsene Menschen, aber keinem kam in den Sinn, kurz innezuhalten und darüber nachzudenken, ob es nicht langsam mal gut war. Geschweige denn, ob es nicht einen Versuch wert wäre, die Wogen zu glätten.
Es war unmöglich auszumachen, wer diesen ewigen Kampf begonnen hatte. Þórður und Sigríður erklärten, ursprünglich sei es um die Grundstücksgrenze gegangen. Die Hecke zwischen den Häusern rage auf ihr Grundstück. Die Besitzer der grünen Abgrenzung hingegen behaupteten, die Hecke sei schon beim Kauf des Hauses vorhanden gewesen, daher seien sie nicht dafür verantwortlich. Außerdem hielten sich Pflanzen nicht an die Grenzen der Menschen, sondern wüchsen wie es ihnen gefalle. Das könne man ihnen kaum zum Vorwurf machen.
Gleichzeitig beteuerten Jón und Guðrún, der Auslöser des Streits sei nicht die Hecke, sondern der Hund der Nachbarn gewesen. Auch er habe sich nicht um die Grundstücksgrenzen geschert und sei ständig durch ihren Garten gestromert. Und habe dort Löcher gebuddelt und Rasen und Beete ruiniert. Darüber hätten sie sich immer wieder beschwert – aber vergiftet hätten sie das Tier natürlich nicht. Diese Behauptung ihrer Nachbarn sei völlig absurd; es müsse doch möglich sein, ihre Unschuld zu beweisen. Zum Beispiel, indem man den Hund exhumiere, wie Guðrún allen Ernstes forderte. Týr und Karó erstickten diese Diskussion geschickt im Keim, ohne zu erklären, dass niemand die Kosten für die Exhumierung eines Hundes übernehmen würde. Die Notwendigkeit einer Obduktion des Hundes war übrigens der einzige Punkt, in dem sich beide Parteien einig waren: Auch Sigríður und Þórður wollten, dass ihr Hund obduziert würde. Þórður behauptete, aus verlässlicher Quelle zu wissen, dass die Nachbarn das Tier vergiftet hatten. Eine Obduktion könne das beweisen. Doch seine verlässliche Quelle offenlegen wollte er nicht. Auch er erhielt dieselbe Antwort wie Guðrún: Eine Obduktion war ausgeschlossen.
Karó atmete auf, als die letzte Person in ihr Haus verschwand. »So ein Chaos. Was geht bloß in den Köpfen dieser Menschen vor?«
Týr versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie unterhaltsam er das Ganze fand. »Manche Leute sind einfach durchgeknallt. Das war schon immer so.«
»Und jetzt? Zurück in die Stadt?«
Das war nun wirklich das Letzte, worauf Týr Lust hatte. »Sollten wir nicht noch etwas weiterforschen? In der Nachbarschaft anklopfen und nachfragen, ob jemand beobachtet hat, wie das Auto zerkratzt wurde? Das ist Sachbeschädigung. Vielleicht kommen die Leute ja zur Vernunft, wenn eine Anzeige ins Haus flattert.«
Karó schenkte ihm ein Lächeln, das ihn wie einen Idioten dastehen ließ. »Wie süß. Du glaubst wirklich noch daran, dass Menschen sich ändern können.« Das Lächeln verschwand. »Na gut. Dann los.«
Wie erwartet hatten diejenigen, die sie zu Hause antrafen, nichts mitbekommen. Ebenso wenig verwunderlich war es, dass niemand ein gutes Wort für die streitenden Nachbarn übrighatte. Ganz im Gegenteil. Offenbar hatten beide Parteien mit einigem Nachdruck versucht, die Nachbarschaft auf ihre Seite zu ziehen. Ständig hätten sie angeklopft und ihre Sicht der Dinge geschildert, obwohl sich niemand in diesen Krieg hineinziehen lassen wollte. Für gewöhnlich war der Mensch friedfertig und hatte keine Lust, sich in seiner wertvollen Freizeit anzuhören, wie Nachbarn sich gegenseitig durch den Dreck zogen.
Auch wenn sich niemand die Aufnahmen ansehen würde, ließen Týr und Karó während der Gespräche mit den Anwohnern ihre Bodycams laufen. Im Grunde reichte es, sich eine der Befragungen anzusehen, denn die Leute wiederholten mehr oder weniger dasselbe. Bis auf zwei Nachbarn, die noch einiges andere zu sagen hatten.
Ein Mann um die sechzig, der Bewohner des dritten Hauses in der Sackgasse, hatte die Konflikte von Anfang an aus nächster Nähe mitbekommen. Kein Wunder, dass er die Schnauze voll hatte. Er hieß Fannar, war Witwer, lebte allein und entpuppte sich als der Anwohner, der bei der Polizei angerufen und die Schlägerei gemeldet hatte. Im ersten Moment freute er sich sehr über den Besuch der Polizei, doch als Týr und Karó klarstellten, dass sie nicht anordnen konnten, dass die verfeindeten Familien ihre Häuser oder gar die Gemeinde verließen, verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht. Er konnte seine Enttäuschung kaum verbergen und fragte, was denn noch passieren müsse, damit die Behörden diese Menschen endlich voneinander trennten. Das sei schließlich für alle das Beste, dann werde in der Straße endlich wieder Ruhe einkehren.
Obwohl sein Anliegen durchaus nachvollziehbar war, konnten die beiden nicht viel dazu sagen. Karó erwähnte, dass es sich um Einfamilienhäuser handele; wenn die Parteien in einem Mehrfamilienhaus wohnen würden, wäre es vielleicht einfacher, etwas zu unternehmen. Der Mann stöhnte und erklärte trotzig, wenn die Männer das nächste Mal aneinandergerieten, würde er nichts mehr unternehmen. Dann würde er zusehen, wie die beiden sich gegenseitig umbrächten, denn die Polizei tue ja auch nichts.
Die andere Ausnahme war eine Frau namens Messíana, die ein paar Häuser weiter wohnte. Sie schlug in dieselbe Kerbe wie Fannar und forderte noch vehementer von Týr und Karó, dass sie die Streithähne aus der Straße entfernten – und das musste etwas heißen, denn sie wohnte ein ganzes Stück von den Kriegsparteien entfernt und bekam von den Auseinandersetzungen sicher längst nicht so viel mit wie der direkte Nachbar Fannar. Doch es war nicht aus ihr herauszubekommen, warum sie die Bewohner der Sackgasse so dringend loswerden wollte. Sie sagte lediglich, diese Leute seien Abschaum und würden über Leichen gehen. Bei jedem starken Erdbeben hoffe sie, das Haus von Jón und Guðrún würde mitten in der Nacht über ihnen einstürzen. Wenn Týr sich recht entsann, waren das die Leute mit der frechen Hecke, die den Nachbarshund vergiftet haben sollten. Als er vorsichtig nachfragte, ob da nicht auch Kinder betroffen wären, entgegnete sie: »Doch, sie haben eine Tochter. Aber das würde mir keine schlaflose Nacht bereiten.«
Týr und Karó schwiegen sprachlos. Und damit war die Geduld der Frau zu Ende. Sie sagte, sie müsse sich um ihre Tochter kümmern, verabschiedete sich und schloss die Tür.
In den drei letzten Häusern erreichten sie niemanden. In dem Wissen, dass sie aus vielen Fenstern von neugierigen und gleichzeitig frustrierten Augen beobachtet wurden, kehrten sie zu ihrem Wagen zurück. Auch Týr fand es deprimierend, dass sie im Grunde nichts tun konnten. In einem Fenster im Obergeschoss des Hauses der ehemaligen Hundebesitzer nahm Týr im Vorbeigehen ein Gesicht wahr, aus dem tiefe Enttäuschung sprach. Es war kein Erwachsener, sondern höchstens ein Jugendlicher. Als er bemerkte, dass Týr zu ihm hinaufsah, verschwand er schnell.
Sie setzten sich in den Wagen, schalteten die Bodycams aus, und Týr startete den Motor. Als er losfuhr, drehte Karó sich um und blickte zu den drei Häusern in der Sackgasse zurück. Dann wandte sie sich wieder nach vorne, starrte durch die Windschutzscheibe und sagte: »Das wird noch böse enden. Richtig böse.«
Týr wusste, dass sie damit die Auseinandersetzungen zwischen den Nachbarn meinte, und sofort befiel ihn das unangenehme Gefühl, dass Karós Worte auch auf seine persönliche Situation zutreffen könnten. Die konnte auch böse ausgehen. Richtig böse. Als Erstes musste er sich schleunigst aus seiner Beziehung lösen. Das wäre zumindest schon mal ein guter Anfang.