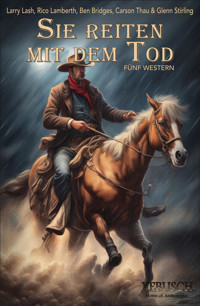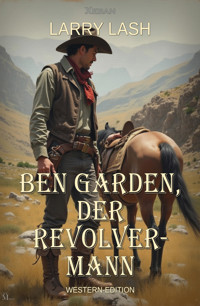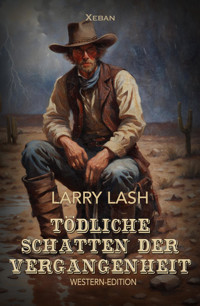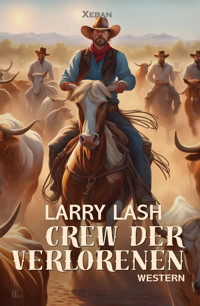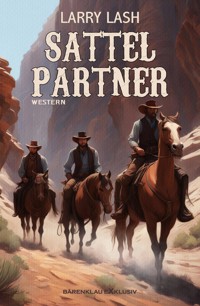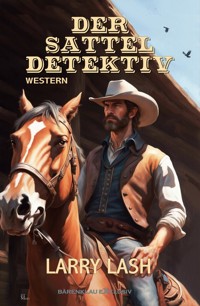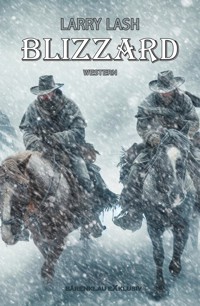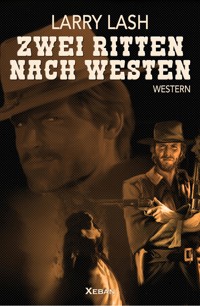3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bisher konnten Schafzüchter und Pferderancher in Utah friedlich nebeneinander existieren mit ihren Tieren. Die Verträge gewährten den Pferden ihren Platz im Sint Creek Valley, während die Schafe außerhalb des Tals ihre Weidegründe hatten. Doch jemand hetzt die Pferderancher gegen die Schafzüchter auf, deren Tiere das Tal kahlfressen und mit ihrem Dung die Weiden auf Jahre hinaus unbrauchbar machen. Sheriff Prescott kommt ein Weidekrieg sehr gelegen, denn damit hat er urbaren Boden gewonnen, den er für viel Geld hoffnungsfrohen Siedlern zugesichert hat, die sich in Utah eine neue Existenz aufbauen wollen. Prescotts Bande ruchloser Schießer zieht brandschatzend und mordend durch das Tal, damit der blutige Weidekrieg genügend Opfer fordert. Jim Dunhill, der dem Tal vor Jahren den Rücken gekehrt hat, schnallt den Colt wieder um und kehrt zurück, um dem Treiben ein Ende zu bereiten, denn unter den Toten sind die Menschen, die ihn einst wie einen eigenen Sohn aufnahmen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Larry Lash
Blutiger Weidekrieg in Utah
Western-Edition
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: XEBAN-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang;
[email protected] / www.xebanverlag.de
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by XEBAN-Verlag mit einem Motiv von Steve Mayer und eedebee (KI), 2025
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Blutiger Weidekrieg in Utah
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Bisher konnten Schafzüchter und Pferderancher in Utah friedlich nebeneinander existieren mit ihren Tieren. Die Verträge gewährten den Pferden ihren Platz im Sint Creek Valley, während die Schafe außerhalb des Tals ihre Weidegründe hatten. Doch jemand hetzt die Pferderancher gegen die Schafzüchter auf, deren Tiere das Tal kahlfressen und mit ihrem Dung die Weiden auf Jahre hinaus unbrauchbar machen. Sheriff Prescott kommt ein Weidekrieg sehr gelegen, denn damit hat er urbaren Boden gewonnen, den er für viel Geld hoffnungsfrohen Siedlern zugesichert hat, die sich in Utah eine neue Existenz aufbauen wollen. Prescotts Bande ruchloser Schießer zieht brandschatzend und mordend durch das Tal, damit der blutige Weidekrieg genügend Opfer fordert. Jim Dunhill, der dem Tal vor Jahren den Rücken gekehrt hat, schnallt den Colt wieder um und kehrt zurück, um dem Treiben ein Ende zu bereiten, denn unter den Toten sind die Menschen, die ihn einst wie einen eigenen Sohn aufnahmen…
***
Blutiger Weidekrieg in Utah
Western von Larry Lash
1. Kapitel
Das wilde Bergland der Uinta zeigte in diesem Frühling 1876 seine ganze urwüchsige Schönheit. Die kahlen Schroffen der Berggipfel reckten sich hoch in den azurblauen Himmel. Schafherden kamen aus ihren Winterquartieren in den tiefgelegenen Tälern, sich Kopf an Kopf drängend, der wiedergefundenen Freiheit freuend. Das Geläut der Leittierglocken mischte sich mit dem scharfen Gekläff halbwilder Schäferhunde, dem Stampfen von Pferdehufen und dem Räderknarren der Küchenwagen.
Der würzige Geruch des Frühlings erfüllte die Luft. Der Geruch des frischen Grases, der aufbrechenden Knospen von Salbei und Wermut, war mit dem feuchten Hauch jener unzähligen Seen verbunden, die ihren Dornröschenschlaf inmitten der Wälder und Berge schliefen. Seen, die äußerst fischreich waren, und an deren Ufern es Wild in Fülle gab: Damhirsche, Elen, langgehörnte Schafe, Wölfe und Bären. Ein Paradies für Jäger und Trapper.
Jim Dunhill sah zu den Bergen hin, deren Kuppen vom ewigen Eis und Schnee bedeckt, in der Sonne gleißten und blitzten, deren weite Hänge in vielen Farbtönen prangend sanft-grüne Matten und Almen zeigten. Der Anblick war ihm nicht neu, und doch genoss er ihn immer wieder mit der tiefen Ruhe eines Mannes, dessen offener Sinn für alles Schöne stets empfänglich blieb.
Nach dem langen, harten Winter war es endlich wieder Frühling geworden. Der Mensch und die Natur lebten auf.
Die Wasser des Sint Creeks rauschten um Jim Dunhills Birkenrindenkanu, trugen es in flotter Fahrt dahin. Mal an glatten Ufern vorbei, mal überschäumende Stromschnellen hinweg ging die Fahrt immer weiter nach Süden. Weidendickichte, in vollem Blütenschmuck prangend, tauchten auf und versanken wieder. Schafherden, die von Hirten und Hunden begleitet waren, kamen in Jims Sichtfeld, um dann wenig später in der gigantischen Landschaft der Berge zu verschwinden.
Die Wellen trugen das Kanu mühelos vorwärts. Jim hatte nichts weiter zu tun, als das kurze Paddel hin und wieder einzutauchen, um den Kurs zu halten, oder einem Felsbrocken auszuweichen, der das Strombett teilte.
Die niedergehenden Wasser des Frühlings hatten dem Sint Creek das Bett erweitert, hatten es Jim ermöglicht, ihn mit einem Kanu zu befahren. Seine Ausrüstung im Bug des Kanus war sorgfältig mit einer Büffelhaut verpackt. Nur die Winchester lag schussbereit zwischen seinen Beinen. Ein Zeichen, dass er sich nicht von der weittragenden Waffe trennen wollte, dass er sie zur Unterstützung eines tiefgeschnallten Colts in Bereitschaft hielt. Ein bitteres Zeichen, das klarstellte, dass die würdige Ruhe, die Stille ringsum, der süße Frieden über dem Lande für Jim eine Illusion war, wie der Rauch aus Blütenstaub, den der Wind aus den Dickichten hob und verflüchtigte.
Vielleicht dachte Jim Dunhill, dass dort, woher er kam, der Frieden wirklich echt gewesen war, im Gegensatz zu dem Lande, in das er jetzt sanft hineingetragen wurde.
Vielleicht dachte er an den verflossenen Winter, den er in einer primitiven Blockhütte hoch in den Bergen hinter sich gebracht hatte, allein mit der allmächtigen, erhabenen Natur, allein mit den Geschöpfen der Wildnis, wo jeder Tag ein neues Geschenk war, jeder Tag Neues brachte.
Sein schmales, braungegerbtes, von Sonne, Wind und Wetter gezeichnetes, wie aus einem Granitblock gemeißeltes Gesicht, verzog sich nachdenklich. Seine dunklen Augen, die an mitternächtliche Seen erinnerten, schienen nach innen gewandt zu träumen.
Vielleicht träumte er noch von dem Leben als Einsiedler, das er oben in den Bergen, an einem der kleinen, wunderbaren Seen gelebt hatte, träumte von den Fellen der Nutrias, Bären und Wölfe, die er dort angestapelt und liegen gelassen hatte, die er später holen wollte.
Welch ein Wort… später! Würde es überhaupt ein Später für ihn geben?
Seine schmalen Lippen pressten sich fest aufeinander, und in seinen Augen kam plötzlich ein helles, gleißendes Licht auf. Seine Nasenflügel blähten sich auf wie bei einem witternden Tier, das irgendeine Gefahr wahrgenommen hatte, aber es war nichts, was ihn hätte erschrecken können. Die Ufer lagen niedrig, und die Gegend, durch die ihn der Sint Creek trug, war weithin übersichtlich.
Nein, das war es nicht, was ihn beunruhigte. Es waren die eigenen Gedanken, die ihn erschreckten, die an ihm nagten und zerrten, ihm keine Ruhe ließen. Gedanken, die zurückglitten zur Blockhütte in den Bergen. Dorthin, wo sich gleich neben dem See ein Grabhügel aufwölbte … der Grabhügel Ralph Kennedys!
Ohne Ralph kehrte er nun zurück.
Vor drei Tagen war Ralph bei ihm in der selbstgewählten Einsiedelei eingetroffen. Nur, um eine Nachricht abzugeben und um zu sterben.
Ralph war den Strapazen des beschwerlichen Rittes nicht gewachsen gewesen, hatte wohl auch zu viel mit gemacht und war geschwächt durch das Blei, das ihm jene Schurken gaben, die auch Tom Kennedy auf dem Gewissen hatten. Jene hartgesottenen Schufte, die Tom Kennedy zum Pferdedieb gestempelt hatten.
Hart knirschten Jims Zähne aufeinander. Nein, Tom Kennedy war kein Pferdedieb. Geradesogut hätte man das dem Präsidenten der Staaten in die Stiefel schieben können. Tom Kennedy vergriff sich nicht an fremdem Eigentum. Was wäre er, Jim, ohne Tom Kennedy gewesen? Tom, der ihm Vater- und Mutterstelle vertreten, der ihn als Jungen aufgenommen und wie seine eigenen Söhne Ralph und Jude erzogen hatte.
Ohne Tom Kennedy wäre der elternlose Jim sicherlich irgendwo untergegangen, vom Strom erfasst und ins Meer des Vergessens getragen worden gleich seinen Eltern. In das Meer, das voller Tränen ist und niemanden, den es aus dem Leben nimmt, wieder hergibt.
Yeah, Tom war ihm ein guter Vater gewesen und seine Söhne Ralph und Jude wie wirkliche Brüder. Sie alle hatten wie Pech und Schwefel zusammengehalten.
Bis sich Jim vor zwei Jahren entschlossen hatte, sich selbstständig zu machen, sein Glück auf eigene Faust zu versuchen. Nur die Kennedys wussten, wo er sich niederließ, was er trieb. Die Kennedys waren es, die seine Ausbeute an Fellen weiterverkauften. Die letzten vor einem Jahr.
Er hatte sie ihnen bei Nacht und Nebel herunter ins Tal gebracht. War dann gleich wieder mit seinen Mulis abgeritten, zu seiner Einsiedelei zurück, ohne sich in der Stadt von der Plackerei des Alltags bei Whisky und Tanzhallenmädchen zu vergnügen. Der Ruf der Wildnis war stärker als die Lust, sich zu entspannen, sich gehen zu lassen, wie Cowboys nach Erhalt des Wochenlohns.
Jim konnte dem wilden, zügellosen Treiben in der Stadt keinen Geschmack abgewinnen. Es stieß ihn ab, trieb ihn eilig wieder in den Sattel, und den Erlös, den die Felle einbrachten, zahlte Old Tom für ihn auf der Bank in Reseda ein. Jim verfügte inzwischen über ein ansehnliches Bankkonto. Es sollte der Grundstein für seine zukünftige Ranch sein. Keine Schafranch, wie sie hier in den Uintas überall zu finden waren, nein, Jim mochte Schafe nicht. Ihr Geruch war ihm widerwärtig, ihre Art zu weiden ein Dorn im Auge, denn wo Schafe waren, wühlten sie den Boden auf, machten ihn unbrauchbar für Rinder, beschmutzten ihn mit Kot. Jim wollte sich auf die Pferdezucht verlegen, wie Tom Kennedy und andere Züchter in der Nähe Resedas.
Ah, noch vor drei Tagen schien das Ziel in greifbarer Nähe zu liegen. Jetzt aber …
Jetzt lag es weiter denn je! Ralph war in seinen Armen gestorben, und er hatte ihm dort ein Grab geschaufelt, droben am Silbersee, wie er den See, dessen Spiegel Jim Dunhills Schatten als den des ersten Menschen an seinen Ufern widerspiegelte, getauft hatte.
Ralph hatte vor seinem Tode noch sprechen können, hatte Dinge berichtet, die Jims Ruhe zerbrachen.
Von einem gewissen Al Prescott hatte Ralph gesprochen, einem Mann, der sich selbst zum Sheriff gemacht hatte und der mitverantwortlich für Tom Kennedys Tod sei. Ralph hatte von Einwanderern erzählt, von Siedlern und Farmern, die dieser Sheriff ins Land holte, die mithelfen sollten, das Land urbar zu machen.
Urbar …? Herr im Himmel! Es gab nur wenig Land, das sich dafür eignete. Was also bezweckte der Sheriff? Gehörte er zu jenen Landhaien, die Land verkauften, um sich zu mästen, denen es gleichgültig war, wie viele Menschen sie zum Ruin trieben? Warum musste Tom sterben? Warum stellte man ihn als Pferdedieb hin? Ralph war mitten im Bericht gestorben, ohne ihm die Zusammenhänge noch aufdecken zu können.
Bitter quoll es in Jim auf. Ausgerechnet Tom sollte ein Pferdedieb sein? Tom, der selbst Pferde züchtete, der friedliebend und ehrlich seinen Trail ritt. Nein, das konnte Jim nicht schlucken.
Tom und Ralph waren nun tot. Zwei gute Männer, die viele Freunde hatten. Ihr Tod würde Staub aufwirbeln. Jim ahnte Kampf und Verdruss voraus, aber sein Platz war an der Seite der Kennedys.
Darum hatte Jim auch nicht gezögert, war sofort aufgebrochen, um nach dem Rechten zu sehen. Die Hüttentür droben in den Bergen hatte er vernagelt, die Mulis in ein Tal getrieben, in dem sie bis zum Herbst hin genügend Futter finden würden und sicher aufgehoben waren. Ralph Kennedy hatte er auf einer Anhöhe begraben, die einen freien Ausblick über die glitzernde Fläche des Silbersees gestattete.
Den schönsten Platz hatte ihm Jim gegeben. Den Platz, den er selbst immer aufgesucht hatte, wenn die Sonne aufging, wenn die gefiederten Scharen der Wasservögel rege wurden, der Fischadler durch die Lüfte strich, Reiher, Gänse, Enten und Kraniche ihr Geschrei erschallen ließen, wenn die Blesshühner zu ihren Gelegen fegten und die Rohrdommel im Röhricht rief.
Ralph hatte die Natur geliebt. Sein Grab würde unvergessen sein, sein Andenken in den Herzen der Männer lebendig bleiben, die ihn gekannt hatten.
Fester umschlossen die sehnigen Hände das Paddel. Jims Kinn schob sich vor, und seine Augen richteten sich zum Knick des Creeks hin. Gleich hinter dem Knick, den der Creek zwischen den Ausläufern gewaltiger Felsen machte, würde die Sicht frei auf die Stadt Reseda werden.
Jim dachte nicht daran, mit seinem Kanu bis in die Stadt zu fahren. Er lenkte ohne zu zögern mehr zum Ufer hin, wo die Strömung nicht mehr so reißend war und die Fahrt abschwächte. Doch am Knick wurde Jim wieder mit unwiderstehlicher Gewalt in die Strömung hineingerissen. Bergwände zwängten den Creek ein. Gischtend schoss das Wasser durch die Enge, riss das leichte Birkenrindenkanu mit sich, dass es fast zu kentern drohte. Gischt überschüttete Jim, tosende, weiße Gischt. Für eine Sekunde hob sich das Kanu wie von einer riesigen Hand gehoben, schleuderte dann durch die gläsern wirkende Gischtwand eines Wasserfalls hindurch. Plötzlich wichen die Wassernebel, verebbte die Gischt. Die Ufer weiteten sich. Frei war die Sicht in eine weite Ebene, die angefüllt war vom Sonnendunst des Vormittags: das Sint Creek Valley!
Weit vorn zeigten sich die Umrisse der Stadt Reseda. Links und rechts im Tal lagen Weidegebiete, durchsetzt mit Birkenwaldungen, die hell in der Sonne leuchteten.
Leicht glitt das Kanu zum rechten Ufer hin in ruhiges Wasser hinein. Der Creek war weit über seine Ufer getreten. Jim paddelte an einer Buschinsel vorbei, die halb unter Wasser stand, und trieb dann mit kräftigen Stößen das Kanu an Land, so dass es sich knirschend weit auf das Ufer heraufhob.
Jim sprang ans Ufer und zog das leichte Kanu aufs Trockene. Wie einen Schlitten schob er es dann weiter in eine Dornenhecke hinein, entnahm ihm seine Winchester und den Büffelhautpacken, zog dann die Dornen über das Kanu, so dass es unsichtbar wurde, verwischte sorgfältig die Spuren zum Ufer hin, schulterte die Winchester und nahm den Packen auf.
Er war zufrieden mit seinem Werk, zog die Brauen hoch, nickte vor sich hin.
»Mögen die Schurken die Pässe besetzt halten«, murmelte er bitter, »an die Möglichkeit, dass ein Mann mit einem Kanu in das Valley kommen kann, daran haben sie sicherlich nicht gedacht.«
Yeah, auch davon hatte Ralph gesprochen, dass die Pässe besetzt waren, die jeden Einwanderer hereinließen, aber keinen Pferdezüchter hinaus. Das hatte Jim auf die Idee gebracht, es auf dem Wasserweg zu versuchen. Die Schneeschmelze in den Bergen hatte ja den Creek stark anschwellen lassen. Er war ins Valley eingedrungen, ohne große Mühe, ohne von Wachtposten aufgehalten zu werden, ohne misstrauische Fragen beantworten zu müssen. Er war mitten ins Zentrum gestoßen und bereit zum Kampfe.
Dieses große Valley, das sieben Pferderanches barg und über zwanzig Schafzüchtern Lebensraum bot, war in Wirklichkeit nichts anderes als ein riesengroßer Talkessel, durch den der Sint Creek hindurchfloss. Das Tal war umgeben von den Hügeln und Steilwänden der Uintas, die nur an drei Stellen passierbar waren, sonst aber jedem Versuch, sie zu ersteigen, ein schroffes Halt entgegensetzten.
Yeah, niemand konnte diese Bergriesen außerhalb der Pässe bezwingen. Die glatten Wände, die steilen Schroffen boten den Geiern und Adlern Horst und Nistgelegenheiten. Sie schützten den Habicht, den Bussard, aber sie waren den Menschen feindlich, und nicht einmal das Bighorn fühlte sich dort in den Klüften wohl.
Mit dem weich federnden Gang eines Mannes, der lange Zeit in der Wildnis verbracht und gelebt hatte, nahm Jim den Marsch in der Richtung zur Stadt auf. Durch Birkenwälder marschierte er, deren jungfräuliches Grün den Augen wohltat, an den Hügelsohlen entlang, immer in Deckung von Bäumen und Sträuchern. Er war bemüht, einen Bogen zu schlagen und seine Spur so gut es ging zu verwischen, indem er moosbewachsene Stellen bevorzugte, es vermied, deutliche Trittsiegel im weichen Boden zu hinterlassen. Man sollte nicht gleich entdecken, dass er vom Creek herkam, wie ein Schatten aus einem anderen Reich.
Später, wenn er weit genug vom Ufer fort war, brauchte er nicht mehr so sorgfältig auf alles zu achten. Seine Spur würde mit anderen Trittsiegeln verschmelzen oder in einem Schaftrail untergehen, oder aber auf einem von Wagenfurchen zerrissenen Boden jede Bedeutung verlieren.
Ab und zu blieb Jim stehen. Seine dunklen Augen tasteten das Gelände ab. Er wunderte sich, als er Schafdung entdeckte, und fragte sich, ob der alte Vertrag, den die Pferdezüchter mit den Schafzüchtern abgeschlossen hatten, gebrochen worden war.
Schafdung im Valley! Das war hässlich. Das gute Land hier im Valley war laut Vertrag den Pferdezüchtern überschrieben worden. Schafherden mussten außerhalb des Valleys in den Bergen weiden und wurden nur im Winter hereingebracht.
Den Schafen machte es nichts aus, über die Pässe zu wandern, mit den Hirten in unwirtliche Gegenden zu ziehen, solange es Frühling, Sommer und Herbst war. Im kalten Winter schützten dann die Corrals und die Heufütterung im warmen Valley die Tiere. So war es immer schon gewesen. Schafzüchter und Pferdezüchter kamen gut miteinander aus. Sie brauchten sich, um leben zu können.
Darum hatten die Dungspuren, die Jim sah, keine gute Bedeutung. Die Schafstrails zu den Pässen lagen viel weiter südlich, einige Meilen von hier entfernt. Der Dung jedoch war frisch, noch nicht verhärtet, wie Jim feststellte. Das bedeutete also, dass die Herde, die aus dem Winterquartier von Reseda auf den Marsch gebracht worden war, nicht, wie durch den Vertrag vereinbart, über einen der Pässe, sondern mitten ins Valley getrieben worden war.
Mitten ins Valley? By Gosh, sollten jene schuftigen Kerle, die die Pässe bewachten, nicht nur den Pferdezüchtern, sondern auch den Schafzüchtern alle Rechte der Überquerung genommen haben?
Die Auswirkung dessen würde hier die Hölle entfachen. Schafe im Valley, das würde sich kein Pferdezüchter gefallen lassen! Würde bedeuten, dass ein Krieg in der Luft lag.
»Mir scheint, dass ich in einen Hexenkessel hereingerasselt bin«, murmelte Jim heiser. »Wer auch immer diesen Tanz hier in die Wege leitet, er muss ein Teufel in Menschengestalt sein, der größte Schuft unter der Sonne. Vielleicht will dieser Schuft, dass Schafzüchter und Pferdezüchter sich gegenseitig an die Kehlen fahren, um für seine eigenen Pläne freie Bahn zu haben. Eine trübe Geschichte, von der nur der Himmel weiß, wie sie ausgehen wird.«
Falten kerbten seine Stirn. Seine Besorgnis wuchs mit jedem Schritt. Ah, Ralph hatte vieles nur angedeutet, die Wahrheit war weitaus schlimmer. Jetzt sah es Jim mit eigenen Augen, und wieder dachte er an Ralph, den man beim Verlassen des Valleys übel angeschossen hatte, als Ralph sich den Weg über einen der Pässe öffnen wollte, um zu ihm gelangen zu können.
Die Kehle wurde Jim eng. By Jove, Ralphs Bild hatte sich in seinem Herzen festgefressen, wich nicht aus seinem Gedächtnis, blieb mit einer beständigen Hartnäckigkeit haften. Immer das gleiche Bild, wie Ralph plötzlich vor seiner Hütte auftauchte, hin und her schwankend im Sattel. Das jungenhafte, fahle Gesicht mit den Bartstoppeln vom Tode gezeichnet.
»Jim …!« Mehr hatte Ralph nicht mehr über die Lippen gebracht, als Jim aus der Blockhütte trat und zu Ralphs Pferd stürzte, gerade noch zurechtkam, um den Fallenden aufzufangen. Ein Seufzer folgte. Ralphs Augen schlossen sich vor Schmerzen, als ihn Jim in die Hütte trug.
Ralph stöhnte und klagte nicht. Er war ein Mann, ein echter Kennedy, und selbst das Wissen, dass er sterben müsse, brachte ihn nicht aus dem Gleichgewicht.
»Wir müssen alle gehen, der eine früh, der andere spät«, quälte es sich von seinen Lippen, als Jim ihm die Wunden verband. »Gib dir keine Mühe mehr, es ist zu spät.«
»Niemals!«, hatte ihn Jim unterbrochen. Interessiert schaute ihn Ralph an, so als sähe er ihn zum ersten Mal.
»Dad hatte recht«, sagte er dann fast feierlich. »Du bist härter als wir Kennedys.«
»Ralph …!«
»Halte mich jetzt nicht auf. Dad hatte schon immer so eine Ahnung, dass er plötzlich sterben müsse, und er bestimmte, dass nach seinem Tode einer von uns Brüdern dich holen sollte.«
»Tom …?«
»Ist tot!«, stieß der Sterbende bitter hervor. »Man schob ihm einen Pferdediebstahl in die Stiefel. Al Prescott, der Mann, der sich selbst zum Sheriff machte, nahm das als gegeben hin.«
Ralph fuhr mit seinem Bericht weiter fort. Jim aber war nicht fähig, ihn zu unterbrechen, nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Ungeheuerlichkeit der Botschaft drückte ihn schier zu Boden. Vergeblich versuchte er alles, um Ralph am Leben zu erhalten. Vergebens, Ralph starb noch in der Nacht seiner Ankunft, und er nahm ein abgeklärtes Lächeln mit in die andere Welt, als wollte er zeigen, dass er endlich die Ruhe, den Frieden gefunden hatte, den es auf dieser Welt nicht gibt.
Yeah, noch einmal ging Jim alles durch den Kopf, noch einmal überdachte er die Lage. Gewiss hatte sich vieles im Sint Valley geändert und nicht zum Guten. Was wurde nun aber wirklich gespielt?
Wer war Al Prescott? Der Mann war Jim unbekannt. In den zwei Jahren seines Fortseins mochten viele unbekannte Gesichter das Valley beleben.
In zwei Jahren aber war aus einem Knaben ein Mann geworden. Sicherlich würde kaum noch jemand Jim Dunhill erkennen, und das passte so recht zu der Rolle, die er sich ausgesucht hatte.
»Keinen Schritt weiter!«, platzte die dunkle Stimme eines Mannes vom Weggestrüpp her zu Jim hin. Das Schnauben eines Pferdes verriet den Standort des Bedrohers.
Trotz der Gefahr hechtete Jim blitzschnell zur Seite. Ein Flammenstrahl wischte in beißender Schärfe dicht an seiner Wange vorbei, die brüllende Detonation des Schusses wütete hinterher. Eine zweite Flammenzunge bleckte dorthin, wohin Jim mit heftigem Schwung sein Bündel geworfen hatte, teils, um sich mehr Bewegungsfreiheit zu verschaffen, teils aber, um den Kerl im Hinterhalt abzulenken. Die Winchester glitt ihm von der Schulter, schlug gegen ausgetrocknete Äste. Der dritte Schuss brüllte auf. Im nächsten Sprung aber war Jim um das Gebüsch herum und riss den Colt aus dem Holster.
Wenn er aber geglaubt hatte, der andere hätte sich bluffen lassen, so sah Jim sich getäuscht. Jäh prallte er zurück, und nur der Himmel oder die Hölle mochten wissen, weshalb beide Gegner ihre Waffen in Anschlag hielten, ohne zu schießen.
War es das plötzliche Gegenübertreten, das sie davon abhielt, das Blei hinauszujagen, oder war es das Weiße im Auge des Gegners, die gegenseitige Erkenntnis der höllischen Gefährlichkeit, die beiden Männern aufgeprägt war?
Jedenfalls starrte der schwarzhaarige, schlanke Mann im Sattel des nervös tänzelnden Fuchswallachs über seine rauchende Waffe hinweg zu Jim hin und verzog sein Gesicht zur Grimasse.
Beide hielten die Eisen gezogen, waren schussbereit, und doch zögerten sie.
»Hallo, Freund, das ändert alles! Ich habe nicht vor, einen Mann auf einer heißen Fährte zu stören!«
»Sondern …?«, rasselte Jim ihm zu. Das Grinsen des anderen wurde breiter.
»Ich hatte geglaubt, einen Cowboy von den Pferderanches vor mir zu haben«, erklärte der Reiter, nahm den rauchenden Colt hoch und blies in die Mündung. »Jetzt weiß ich es aber anders. Du bist hier fremd, bist wohl ein Langreiter?«
Jim war nicht gewillt, sich zu verraten, nicht gewillt, auf die betont sorglose Geste des anderen einzugehen. Er blieb wachsam, geduckt stehen.
Das schien dem Reiter noch mehr zu gefallen. Er steckte seinen Revolver in das Holster zurück, beugte sich im Sattel vor und klatschte die flache Hand beruhigend auf den Hals seines nervösen Tieres. »Du kannst mich nicht täuschen. Wenn ich es mir auch nicht erklären kann, wie du ins Valley gekommen bist, so steht doch eines fest, ein Cowboy bist du nicht. Das Innenleder deiner Hose ist zu glatt. Du trägst dein Eisen tiefer als ein Broncobuster, mit dem Kolben nach vorn. Diese Zeichen trügen nicht. Wir gehören zur gleichen Sippe, Freund. Stecke deine Waffe ein!«, forderte der schwarzhaarige Mann fast freundlich.
Auch das konnte eine Täuschung sein, oder aber der Kerl hielt Jim wirklich für einen Revolverschwinger, für einen Geächteten.
Der Reiter sprach weiter auf Jim ein: »Zuerst, als ich dich vom Hügelkamm beobachtete, hielt ich dich für einen Schafhirten, doch als du näherkamst, sah ich, dass deine Kleidung zu gut dafür war. Aber zum Teufel auch, ein Mann zu Fuß muss Verdacht erregen, denn nur die lumpigsten Hirten besitzen kein Pferd.« Er nahm seinen Tabaksbeutel aus der Hemdtasche, schüttete Tabak auf ein Zigarettenpapierblättchen und reichte dann seinen Beutel Jim hin. Der nahm ihn gelassen mit der linken Hand entgegen, während die rechte den Colt sanft in das Holster zurückschob und dann über dem Kolben schweben blieb.
Die Augen des Schwarzhaarigen leuchteten auf. »Ich sehe, dass ich mich nicht irre«, lachte er freundlich. »Joe McDaniel ist mein Name. Ich denke, wir könnten Freunde werden.«
Ein wahrhaft überraschendes Angebot, dachte Jim hellhörig, wobei er sich merklich entspannte. Geschickt rollte er sich nun mit der linken Hand einen Glimmstängel, gab dem anderen und sich Feuer, wobei er ebenfalls nur die linke Hand benutzte, was wiederum McDaniel die Augen aufleuchten ließ. »Yeah, Freund«, drängte er. »Das würde bedeuten, dass du lästigen Fragen aus dem Wege gehst.«
»Mir haben derartige Fragen nie geschadet!«, schnappte Jim ein.
McDaniel lachte rau vor sich hin.
»Möglich, mein Freund, hier aber könnte es der Fall sein. Es bleibt dir aber auch nichts anders übrig, und auch ohne meine Hilfe würdest du zu uns stoßen. Das liegt wohl, glaube ich, an der besonderen Nase eines Revolvermannes, der verdienen will.« Wieder lachte er, als hätte er einen besonders feinen Witz gerissen. »Wer wirklich verdienen will, muss eine schnelle Hand, ein kluges Köpfchen und eine gute Auffassungsgabe haben. Alle diese Eigenschaften scheinst du mitzubringen. Das sagt mir die Art, wie du mich abzulenken versuchtest und zum Kampf zwingen wolltest. Glaube mir, dein Packen hat ein Loch, und deiner Winchester fehlt ein wenig Holz.«
Es war erstaunlich, wie schnell die Augen des Kerls alles in sich aufgesogen hatten. Ganz in Schwarz gekleidet, hockte er im Sattel. »Männer deiner Art sind uns immer willkommen«, grinste er leutselig herunter.
»Uns?«, dehnte Jim misstrauisch, seiner ihm zugedachten Rolle gemäß. Scharf musterte er den Reiter. Der Kerl hatte ein hübsches Gesicht, doch die Augen standen etwas zu eng beieinander. Seine Nase war leicht gekrümmt, und in seinen Mundwinkeln war ein spöttischer, leichtsinniger Zug zu erkennen.
Sein Stetson, ebenso schwarz und neu wie seine Kleidung, war durch eine dicke Goldkordel verziert. Über Kreuz geschnallte Patronengurte und zwei Eisen verrieten den Zweihandschützen. In seinem schmalen Gesicht standen grüne, lodernde Augen, die voller Spott leuchteten.
Yeah, der Revolvermann musterte Jim ebenso schnell und prüfend, wie dieser ihn. Das war so üblich in diesem rauen Lande, gehörte zu der Art, wie Männer sich einstuften.
Jim war bald mit seinem Urteil fertig. Es war ihm klar, sein Gegenüber gehörte zu den schnellen Eisen, zu den wandelnden Pulverfässern, wie man so sagt, die jeden Moment explodieren konnten. Sein leichtsinniges Lächeln täuschte. Gewiss war sich der Bursche noch nicht ganz sicher, ob Jim wirklich seinesgleichen war.
»Yeah, uns«, betonte er gedämpft. »Damit meine ich die Männer, die dieses Valley in die Tasche stecken, es bald unter sich aufteilen werden, so dass jeder reich wird.« Obwohl er die Waffen unberührt ließ, schwebten seine Hände seltsam wachsam über den Kolben, gleich Klapperschlangen, zum Zustoß bereit.
»Meine Taschen sind leer«, dehnte Jim.
Der andere nickte, grinste stärker. By Gosh, yeah, das sah man doch gleich. Jim Dunhill war einfach gekleidet. Ein verwaschenes Hemd unbestimmbarer Farbe legte sich prall auf die Haut, so dass seine Muskeln sichtbar wurden. Halstuch, Stetson und Hose waren von Wind und Sonne unansehnlich geworden. Er trug Mokassins an den Füßen, im Gegensatz zu McDaniel, der hochschaftige Stiefel mit großen Radsporen trug, wie sie hier von Texas her eingeführt worden waren. Irgendwie erinnerte Daniels lässige Erscheinung an Billy the Kid.
Yeah, der Eindruck blieb für Jim bestehen. Billy the Kid hatte ähnlich ausgesehen. Sonderbar, dass gerade Billy the Kids Bild, das er einmal in einer Zeitung gesehen hatte, sich ihm aufzwang, dass er daran denken musste, dass sich eine kleine Gruppe von Männern immer irgendwie glich, als wären alle Zwillingsbrüder. Jetzt wusste Jim auch, warum ihm der Mann so bekannt vorkam.
Vor zwei Jahren gab es solche Art von Kerlen noch nicht im Valley. Vieles schien sich hier grundlegend geändert zu haben. Tolle Zustände mochten hier herrschen, wenn das Valley noch mehreren solcher Kerle zum Aufenthalt diente.
Nur einen Fehler machte der Kerl. Er lud seine leeren Patronenkammern nicht auf. Das war verteufelt leichtsinnig von ihm. Einen Leichtsinn, den Jim nicht verstand, denn er hatte in der Wildnis lernen müssen, dass eine Waffe immer sofort mit neuem Futter versorgt werden musste.
»Yeah, meine Taschen sind leer, Freund«, wiederholte Jim. »Ich glaube aber, dass in einem Valley, das hermetisch abgeriegelt ist, sich Colts verkaufen lassen.«
McDaniel lächelte noch stärker.
»Das habe ich mir doch gleich gedacht, Freund.« Er blickte zum Fluss hin, dann zu den Bergen, die weit in der Runde standen, zuckte die Schultern. »Mir ist es gleich, ob du wie eine Gämse oder wie ein Fisch hierhergekommen bist. Ich würde es selbst schlucken, wenn du ganz einfach vom Himmel gefallen wärst, solange du nur auf unserer Seite bist.«
Das war deutlich, eine klare Warnung. »Sicher, es gibt genug Männer hier, die das Geld dazu haben, um Revolverlöhne zu bezahlen«, grinste McDaniel Jim zu. »Einige Schafzüchter und Broncobuster haben versucht, außerhalb des Valleys schnelle Kanonen anzuwerben. Leider ist es schiefgegangen. Die Kerle haben sich entschlossen, lieber für uns zu arbeiten.«
Für uns? Da war es wieder, dieser Hinweis auf eine raue Horde! Jim beglückwünschte sich innerlich, dass ihm der Zufall oder das Schicksal in Gestalt von McDaniel in den Weg getreten war. Auf diese Weise brauchte er nicht lange zu suchen.
Der Schwarzgekleidete war der richtige Mann, um ihn mitten ins feindliche Lager zu bringen, sozusagen in die Höhle des Löwen.
McDaniel stieg leichtfüßig von seinem Fuchswallach, half dem neuen Freund, den Packen und die Winchester aufzuheben, sagte dabei befriedigt: »Wie ich dir gesagt habe, hier ist ein Loch im Packen, und dort an der Winchester fehlt ein Stück Holz.«
»Eine glatte Arbeit«, grinste ihn Jim an.
»Ich treffe aus zwanzig Yards drei Walnüsse in der Luft«, brüstete sich McDaniel. »Aber das ist noch gar nichts, wenn man dagegen Prescotts Colts in Tätigkeit sieht.«
»Prescott …?«
»Du hast noch nichts von ihm gehört, Freund? Oh, dann musst du dir den Namen besonders gut merken. Er schützt dich vor Überraschungen, das heißt, wenn meine Empfehlung bei ihm ankommt.«
»Bisher haben mich Empfehlungen immer über den Berg gehalten, McDaniel.«