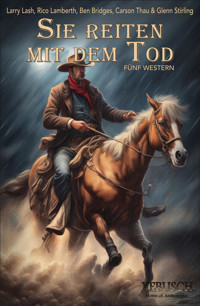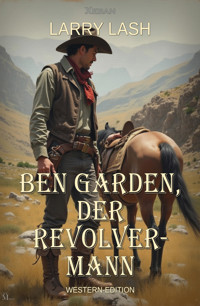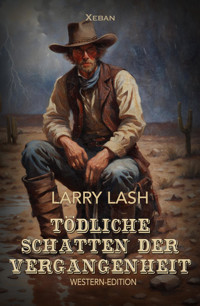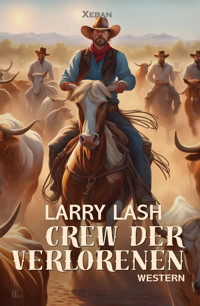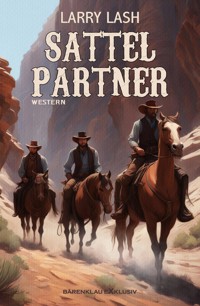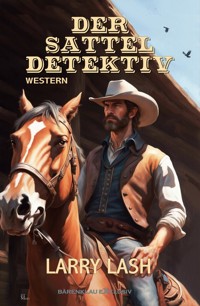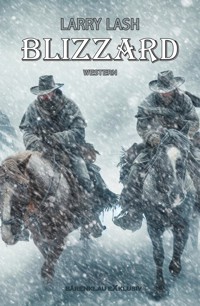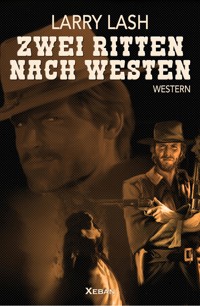3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Durch das verschneite Land ziehen Söldnertruppen, Banditenhorden und Indianer. Sie rauben, brandschatzen und morden, alles unter dem Deckmantel des Krieges.
Zwei Männer versuchen, zur Armee von Washington durchzubrechen. Sie werden verfolgt und gehetzt. Fast unüberwindliche Hindernisse stellen sich ihnen in den Weg. Erschöpft, am Ende ihrer Kraft, schleppen sie sich voran. Sie müssen zum Wisconsin River, sonst sind sie rettungslos verloren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Larry Lash
Verfolgt und gehetzt
Western-Edition
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Steve Mayer, nach Motiven, 2026
Korrektorat: Claudia Müller
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Verfolgt und gehetzt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Durch das verschneite Land ziehen Söldnertruppen, Banditenhorden und Indianer. Sie rauben, brandschatzen und morden, alles unter dem Deckmantel des Krieges.
Zwei Männer versuchen, zur Armee von Washington durchzubrechen. Sie werden verfolgt und gehetzt. Fast unüberwindliche Hindernisse stellen sich ihnen in den Weg. Erschöpft, am Ende ihrer Kraft, schleppen sie sich voran. Sie müssen zum Wisconsin River, sonst sind sie rettungslos verloren.
***
Verfolgt und gehetzt
Western von Larry Lash
1. Kapitel
»Aus!«
Nur dieses eine Wort kam abgerissen von den Lippen des Mannes, der sein rammsnasiges, drahthaariges Pony mit einem Ruck zum Halt brachte. Das schmale Gesicht des Mannes verzerrte sich in ohnmächtiger Wut. Wie erstarrt saß er im Sattel.
Der scharfe Winterwind wehte Schneeflocken in Dan Farrs Gesicht. Der Himmel war grau, düster und drohend, doch diese Drohung zählte im Augenblick nicht für den Reiter. Eine stärkere Drohung war dort, wohin Dan Farr blickte.
Vierzig Reiter hatten sein Haus umstellt, das am Rand der kleinen Stadt lag. Vierzig uniformierte, wilde, schnauzbärtige Burschen, deren zerschlissene Uniformen den Zustand zeigten, in dem sich die Soldaten der glorreichen englischen Armee befanden.
By Gosh, England duldete keine Selbständigkeit. Jeder freiheitsliebende Mann wurde als Ketzer angesehen, schlimmer noch, als ein Verbrecher. Dan Farr hielt man für einen der Schlimmsten. Jetzt war sein Haus umstellt, und es gab keine Heimkehr zu seiner Familie. Verzweiflung und Bitternis überfielen Dan Farr, der ohnmächtig zusehen musste und das Schicksal seiner Familie nicht mehr ändern konnte. Gegen vierzig Reguläre konnte ein Mann allein nicht anreiten.
»Gegen Rebellen ist alles erlaubt.«
Das waren die Worte, die König Georg III. von England gesagt hatte.
Dan Farr galt als Rebell. Sein Name stand auf der schwarzen Liste. Dan sah jetzt mit eigenen Augen, wie groß die Macht der Rotröcke noch war, wie genau sie den Befehl ihres Königs nahmen. Mit aufgepflanzten Bajonetten saßen sie ab und traten zum Sturm auf das Haus an.
Eine weiße Fahne wurde aus einem der Fenster herausgeschoben.
»Gott schütze meine Eltern, meine Geschwister und meinen Onkel!«, murmelte Farr und riss sein Pferd herum. Ein längeres Verweilen würde ihm mit Sicherheit den Tod bringen. Jeden Augenblick konnte er entdeckt werden, und das würde genügen, um gnadenlos Jagd auf ihn zu machen. Auf seinem abgetriebenen Pferd würde er nicht weit kommen. Er musste fliehen, musste im Schutz der Hecken zurückreiten und versuchen, in den dunklen Wäldern unterzutauchen. Vorerst durfte er sich nirgends sehen lassen. Er war zu bekannt, und es gab genug Menschen, die ihn für eine Handvoll Patronen oder für etwas Proviant verraten würden.
Dan Farrs Herz schlug wie rasend. Ungewollt kam ein Stöhnen über seine Lippen. Er sah sich nicht um, sondern richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf den Weg, den sein Pony zu gehen hatte.
Wie vom Blitz getroffen zuckte Dan Farr zusammen, als er hinter sich eine Schusssalve hörte, dem eine weitere folgte.
»Sie sind tot!«, kam es über seine Lippen. »Keiner kam mit dem Leben davon, keiner!«
Dan schrie die Worte anklagend heraus. Deutlich konnte er vor seinem geistigen Auge das Gesicht des Anführers sehen. Es hatte sich für alle Zeiten in seinem Gedächtnis eingeprägt. Er kannte den Namen des Offiziers, der keine Gnade walten lassen wollte und dabei war, ein Exempel zu statuieren. Es gab wohl keinen Zweifel daran, dass er alle Familienmitglieder hatte erschießen lassen.
»Red Warren!« Den Namen stieß Dan Farr hervor.
Dan Farr wusste nicht, dass dieser hartgesichtige Offizier der englischen Krone zu jenen Männern gehörte, die einen traurigen Ruhm in der Geschichte des amerikanischen Westens erlangten.
Der Tod ging im Lande um. Die Truppen König Georgs III. kämpften nicht allein. Indianische Völker hatten sich ihnen angeschlossen, die ihre weißen Freunde an Grausamkeit und Zerstörungswut noch weit übertrafen. Überall patrouillierten ihre Helfer, die sich für Fallensteller, Jäger und Farmer ausgaben.
Dieser Winter war besonders hart. Dan Farr zog seinen Schal fester, sodass das Innenfutter seiner Kapuze dichter an den Ohren anlag. Mit seinem mageren Pony war er rasch aus der Gefahrenzone heraus. Als er das Flachland verließ, machten ihm starke Schneeverwehungen zu schaffen. Der Wind wehte stärker, und die Kälte wurde schärfer.
Dan Farr ritt, als wäre die Pest hinter ihm ausgebrochen. Als es zu dämmern begann, hatte er die Blockhütte eines Waldläufers vor sich. Als er auf sie zuritt, schlug ein großer, grauer Hund an, stürmte aus seiner Hütte und zerrte an seiner Leine.
»Du bist weit genug geritten, Fremder!«, dröhnte die Bassstimme eines Mannes. »Hier ist nichts zu holen!«
Das Misstrauen war verständlich in dieser Zeit, in der man auf der Hut sein musste und jeden Fremden als Feind betrachtete.
»Mein Vieh haben des Königs Soldaten, und mein Korn wurde von Banditen geholt. Meine Familie hat kaum noch etwas zu beißen. Ich habe nicht einmal ein Pferd, um in die nächste Stadt zu reiten. – Genügt dir das, Fremder? Reite weiter!«
»Aber du hast sicherlich Patronen?«
»Eine Menge! Genug, um einem Dutzend Hartgesottener tagelang Widerstand zu leisten.«
»Ich brauche Munition, und ich zahle dafür.«
»Mit blankem Gold?«, fragte der Mann. »Das wäre etwas anderes. Für Gold verkaufe ich dir Munition und noch einiges dazu. Komm heran, Fremder. Willst du noch weit reiten?«
»Ja, sehr weit«, bestätigte Dan Farr.
Er musste es tun, um den Mann nicht noch misstrauischer werden zu lassen. Er musste zugeben, dass er ein Gehetzter war. Das konnte verheerende Folgen haben, denn die Wahrheit konnte sich gegen ihn wenden.
»Dachte es mir doch«, sagte der Mann. »Wer hierherkommt hat Grund, in den Wäldern unterzutauchen. Ich will deinen Namen nicht wissen. Je weniger ich über dich weiß, desto besser für mich. Dann und wann kommen Patrouillenreiter des Königs, um mich auszufragen. Ich muss es mir gefallen lassen, wenn ich das Dach über dem Kopf behalten will. Außerdem lasse ich mir ein gutes Geschäft nicht entgehen.«
Die Stimme klang jetzt freundlicher, und der Mann tauchte an der Tür auf. Der Lauf seiner Rifle zeigte zu Boden. Der Mann hatte wild wucherndes Haar, das bis auf die breiten Schultern herabfiel. Von seinem Gesicht war in dem dichten Gestrüpp kaum etwas zu erkennen. Schräggestellte Augen richteten sich fest auf Dan Farr, der sein Pferd entschlossen näher trieb.
Die untersetzte und zerlumpte Gestalt sah nicht vertrauenerweckend aus. Die buschigen Augenbrauen und die gezackte, rotgeflammte Narbe auf der Stirn des Mannes veranlassen Dan Farr, diesen Mann vorsichtig zu behandeln.
Dan Farr hatte in seiner verzweifelten Lage keine andere Wahl. Er musste mit allem vorliebnehmen, auch mit zwielichtigen Gesellen. Dieser Mann, das war Dan Farr klar, würde keinen Augenblick zögern, des Königs Getreuen einen Wink zu geben. Wahrscheinlich bedeutete das für ihn eine weitere Einnahmequelle.
Aber Dan brauchte Munition und noch einiges mehr, um in der Wildnis überleben zu können. Es wäre zwecklos gewesen, dem alten Fuchs einzureden, dass er aus purem Zufall hierhergeritten war. Dan musste wachsam sein, denn er merkte deutlich den gierigen, abschätzenden Blick, mit dem der Mann Dans Pony betrachtete. Nicht jeder Mann, der in der Wildnis lebte, besaß ein Reittier. Pferde waren knapp geworden, seitdem die Soldaten des englischen Königs sie beschlagnahmten. Man erzählte sich, dass es Banditen gab, die gefallenen Rotröcken die Uniformen auszogen, um als Soldaten getarnt leicht Beute machen zu können.
Der bärtige Waldläufer musterte Dans Pistolen und die gute Rifle, dann erst Dan selbst. Er schien nun doch etwas Achtung zu bekommen, denn sein Grinsen löschte jäh aus.
»Also gut, machen wir das Geschäft, und dann verschwinde schnell, bevor es Mitternacht wird. Ich erwarte Besucher, die dir wenig angenehm sein dürften«, sagte der Mann laut. Dabei dachte er: Die eigene Sicherheit hängt davon ab, ob man Männer richtig einschätzt. Dieser hier ist mit besonderer Vorsicht zu genießen. Er ist eiskalt, schnell und bärenstark. Seine Augen können durch einen hindurchsehen. Er erinnert mich an einen grauen Wolf, der einsam durch das Land streift und alle Gefahren kennt. Wenn einer eine Chance zum Überleben in den Wäldern hat, dann ist er es. Aber wird ihn der Winter und die Einsamkeit nicht mürbe machen? Ich werde sein Pferd nicht ohne Kampf bekommen, er hat mich durchschaut. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich mir seinen Namen hätte nennen lassen. Nun, ich werde ihn mir genau ansehen, sodass ich ihn beschreiben kann. Es wird sich bald herausstellen, ob etwas für die Beschreibung abfällt. Verdienen werde ich so oder so. Jeder muss heute zusehen, wie er überlebt. Meinen eigenen Bruder habe ich den Königstreuen ausgeliefert. Der Sack Mehl, den ich dafür bekam, hat meine Familie vor dem Verhungern bewahrt. Wenn dieser Fremde Gold hat, kann es mir nur recht sein, denn für Gold kann man alles bekommen.
Dan Farr ließ sein Pferd mit verhängten Zügeln draußen stehen. Sein Gastgeber hieß ihn eintreten, doch Dan bot dem Mann nicht den Rücken.
Die Hütte hatte nur einen Raum. Die Wände bestanden aus Stämmen, die mit Lehm abgedichtet worden waren. Es gab nur ein kleines, glasloses Fenster, durch das der Kaminrauch abzog. In der Hütte roch es, als sei jahrelang nicht gelüftet worden. Ein halbes Dutzend Kinder balgte sich auf einem Felllager, und eine magere Frau hantierte an der offenen Feuerstelle. Sie beschäftigte sich mit einem riesigen Topf, der an einer Kette über der Feuerstelle aufgehängt war. Weder die Kinder noch die Frau kümmerten sich um den Fremden. Nur eines der Kinder hockte still in einer Ecke. Dan sah an dem Blick des etwa sechzehn Jahre alten Mädchens, dass es die Umgebung nicht wahrnahm.
»Das ist Linda. Banditen haben sie im Herbst beim Beerensuchen überfallen und verschleppt. Als Soldaten das Banditennest aushoben, fanden sie unsere Tochter. Es muss eine Gnade für sie sein, dass sie sich an nichts mehr erinnern kann. Sie muss Furchtbares erlebt haben. Es wäre wohl besser für sie und uns alle gewesen, wenn sie gestorben wäre.«
So hart und rau dachten die Menschen hier, die in einem erbarmungslosen Lebenskampf standen. Der Mann war nicht zart besaitet, doch zum Glück begriff das Mädchen den Sinn seiner Worte nicht.
Der Mann hob ein Wapitifell vom Boden auf. Die losen Bretter darunter schob er zur Seite. Ein Loch wurde sichtbar.
»Hier liegen meine Schätze«, sagte der Mann zu Dan. »Sieh selbst, es ist genug Munition vorhanden, um eine ganze Bande zu versorgen.«
»Daddy, wenn das Red Warren zu Ohren kommt, dann …«
Der älteste Junge hatte die beiden Männer heimlich beobachtet.
Jetzt sprach er den Namen aus, der in Dan Farrs Gedächtnis eingebrannt war. Unwillkürlich zuckte Dan zusammen, doch niemand bemerkte es. Das Mädchen, das bisher teilnahmslos vor sich hin gestiert hatte, stieß einen schrillen Schrei aus. Sie fuhr in die Höhe, und ihre Hände schlugen nach einem unsichtbaren Gegner. Stöhnend fiel sie zu Boden. Die Mutter lief zu ihr hin und fuhr dabei den Jungen an:
»Du weißt doch, dass du den Namen nicht aussprechen sollst! Immer wenn der Name genannt wird, bekommt sie diese Anfälle. – Hilf mir, John!«
John Smith murmelte etwas, was Dan Farr dennoch verstand. Er konnte heraushören, dass immer etwas dazwischenkomme, wenn er Geschäfte machen wollte.
Die beiden Eltern beruhigten das Mädchen. Wenig später konnte Dan das erstehen, was er für seinen Ritt brauchte, vor allem Munition, ein Brennglas, Feuersteine und anderes mehr. Er bezahlte mit Goldnuggets, die John Smith grinsend einstrich. Wie nebenbei fragte Dan:
»Was erschreckt das Mädchen an dem Namen, der vorhin genannt wurde?«
Der Bärtige zuckte die Schultern.
»Das geht niemanden etwas an, auch dich nicht, Fremder. Es ist unsere Sache, wie wir hier zurechtkommen, Linda muss den Namen irgendwo gehört haben und bringt ihn mit einer schlechten Sache in Verbindung. Nur so kann ich mir ihr Verhalten erklären. – Kennst du den Namen, Fremder?«
John Smith sah Dan Farr mit schief geneigtem Kopf aufmerksam von der Seite an.
Dan verneinte, und das schien den Mann zu erleichtern. Es zeigte ihm, dass John Smith etwas zu verbergen hatte.
»Du solltest deine Zeit nicht vertrödeln, Fremder. Es wird eine kalte Nacht werden. Reite los, bevor es aufhört zu schneien. Der Schnee verwischt deine Spuren, und ich glaube, dass es für dich wichtig sein kann.«
Dan spürte, dass Smith ihn schnell los sein wollte. Er schien auf etwas zu warten. Auch die Frau ging mehrmals zu dem kleinen Fenster und blickte in eine bestimmte Richtung.
Dan Farr warf noch einen raschen Blick auf das bildschöne junge Mädchen. Was mochte sie erlebt haben, was brachte sie mit dem Namen des gefürchteten Offiziers in Verbindung? Ob die Eltern es wussten und für sich behalten wollten? Diese Fragen drängten sich Dan auf. Doch er musste weiter. Er fühlte auch, wie die kalten Augen des Gastgebers ihn ständig beobachteten und wie unruhig der Mann wurde.
Auch beim Hinaustreten achtete Dan darauf, dem Mann nicht den Rücken zu zeigen.
»Du bist sehr vorsichtig, Fremder«, knurrte John Smith. »Du traust wohl niemandem über den Weg?«
»Nein, keinem Menschen«, gab Dan zu.
»Und du kennst den Mann wirklich nicht, der sich Red Warren nennt?«, erkundigte sich John Smith.
»Kennst du ihn?«, fragte Dan zurück.
»Ich glaube, wir reden aneinander vorbei«, erwiderte John Smith. »Nun gut, Red Warren ist ein Offizier des Königs. Meine Frau braucht es nicht zu wissen. Es würde ihren Hass auf die Leute verstärken, mit denen ich zu tun habe.«
»Auf deine Tochter Linda scheint der Name eine besonders schlimme Wirkung zu haben.«
»Ich weiß«, murmelte John Smith. »Aber was soll ich tun? Ich will mit meiner Familie überleben. Ich kann keine Erkundigungen darüber einziehen, warum dieser Name so schrecklich auf sie wirkt. Tue ich es, bin ich mit meiner Familie bald ausgelöscht. Zwar tut meine Frau so, als sei es ihr gleichgültig, aber ich kenne sie besser. Sie nimmt an, dass ich mich davor drücke. Aber wer bin ich denn schon? Wer aufmuckt, wird abserviert, und genau das habe ich meiner Frau klargemacht. Sie will mich scheinbar nicht begreifen. Kannst du mich verstehen, Fremder?«
»Nein!«, sagte Dan rau. »Aber das ist schließlich deine Sache, du musst damit fertigwerden. Wenn du mit den Leuten sympathisierst, die deine Tochter auf dem Gewissen haben, wirst du es selbst eines Tages verantworten müssen.«
»Du wirst den Himmel eher nötig haben als ich. Du reitest nämlich geradewegs in die Hölle hinein«, knurrte Smith.
»Und du trägst die Hölle in dir. Du machst mit Kerlen, die deiner Tochter das Schlimmste antaten, die sie um ihren Verstand brachten, noch Geschäfte. Du erwartest diese Männer und gibst ihnen Informationen, du beobachtest für sie die Verlorenen, die in die Wälder zu flüchten versuchen. Du bist es, der die Skalpjäger hinter diesen Menschen herschickt. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Eines Tages wirst du verlassen sein. Deine Familie wird sich von dir wenden, niemand wird mehr etwas mit dir zu schaffen haben wollen.«
»Nicht, solange der König noch die Macht hat!«, schrie Smith mit heiserer Stimme. »Niemand kann gegen ihn an, auch du nicht! Auch du hast seine Macht gespürt und versuchst zu fliehen. Die Angst sitzt dir im Nacken. Du bist noch schlimmer dran als ich. Ich möchte mit dir nicht tauschen. Du wirst untergehen, noch bevor eine Woche um ist. Reite nur, du kannst nicht schnell genug und nicht weit genug reiten!«
Er verstummte einen Moment. Er sah die rauchgrauen Augen Dan Farrs auf sich gerichtet und konnte diesen Blick nicht länger ertragen.
»Du bist ein toter Mann!«, fuhr er keuchend fort. »Du kennst die Wälder nicht. Du unterschätzt die Gefahren, die darin lauern. Es ist nicht nur das Raubwild, Pumas, Bären und Wölfe, es sind auch die Indianer, die die Wälder nach Leuten, wie du es bist, durchkämmen. Keiner kann ihnen entrinnen, auch du nicht.«
»Lass das meine Sorge sein.«
»Nur zu!«, höhnte Smith. »Du hättest mir alles Gold lassen können, ausgeben kannst du es ja doch nicht mehr. Bald wird es dir einer abnehmen!«
Dan Farr schwang sich in den Sattel. Er trieb das Pony so, dass es rückwärtsgehen musste. So konnte Dan John Smith im Auge behalten. Diesem Mann durfte er nicht den Rücken zeigen.
Erst als er außer Schussweite war, nahm er das Tier herum und trieb es vorwärts, dass der Schnee unter seinen Hufen aufstäubte.
Der Schnee fiel jetzt in dicken Flocken. Der eiskalte Wind hatte sich gelegt. Für Dan war das gut. Je mehr es schneite, desto schneller war die Fährte verwischt. Denn schon bald würden die Häscher Informationen bekommen, daran zweifelte er nicht mehr. John Smith würde eine genaue Beschreibung von ihm geben und sich dafür bezahlen lassen.
Dan Farr wechselte mehrmals die Richtung, bis die dunklen Wälder erneut vor ihm auftauchten. Diese Wälder schienen endlos zu sein. Sie waren unter Eis und Schnee erstarrt, alles Leben schien ausgelöscht zu sein. Doch Dan wusste, dass auch in Eis und Schnee das tierische Leben weiterging.
Unentwegt stampfte der rammsnasige Wallach vorwärts. Um Mitternacht hielt Dan Farr an, um zu rasten und sich zu stärken. Er wagte es nicht, ein Feuer anzuzünden, obwohl es trockenes Holz in Mengen gab. Er war noch zu nahe an menschlichen Siedlungen. Trotz des Schneefalls konnte der Rauchgeruch gewissen Leuten zum Wegweiser werden. Ungebetene Besucher aber, ganz gleich ob roter oder weißer Hautfarbe, waren äußerst gefährlich. Im Augenblick sehnte sich Dan nicht nach Menschen, aber er spürte jetzt schon, wie sehr sie ihm fehlen würden, wie schwer es sein würde, allein auszukommen.
Dan Farr hatte noch nicht begriffen, was es heißen würde, die Gefahren der Wildnis zu bestehen und ihre Einsamkeit zu ertragen. Noch wusste er nicht, dass die Einsamkeit einen Menschen um den Verstand bringen konnte. Sein Innerstes war noch zum Bersten gefüllt mit dem Schrecklichen, was sich ereignet hatte. Es würden Monate vergehen, bis er sein inneres Gleichgewicht wiedergefunden hatte.
Dan war kein Mann, der sich vor irgendetwas fürchtete. Dennoch war ihm ziemlich beklommen zumute. Er verließ sich ganz auf seinen Instinkt, der ihn bisher immer rechtzeitig vor Gefahren gewarnt hatte.
Nach kurzer Rast drängte es Dan Farr zum Weiterritt. Die Kälte machte ihm schwer zu schaffen, und das Reiten wurde immer unerträglicher. Als der Morgen graute, hatte er drei kalte Camps hinter sich und war so zerschlagen, dass er sich kaum noch im Sattel halten konnte. Auch sein Pferd bewegte sich nur noch langsam vorwärts.
Dan glaubte zu träumen, als er an einem Hügelhang zwischen verschneitem Brombeergesträuch das schräge Dach einer fast unter Schnee vergrabenen Hütte zu sehen bekam. Er ritt darauf zu und stellte fest, dass er sich nicht geirrt hatte. Die Hütte war auf zwei Pfählen errichtet, und das Dach war an der Felswand befestigt. Die Hütte war so groß, dass er sein Pferd mit hineinnehmen konnte. An der Felswand war Reisig für ein Lager aufgeschichtet. Nichts deutete darauf hin, dass die Hütte bewohnt war. Die alte Bratpfanne, die Dan entdeckte, war so durchgerostet, dass nur noch der Rand und der Stiel heil waren. Der danebenliegende Kochtopf hatte große Rostlöcher. Die Feuerstelle verriet deutlich, dass hier seit langer Zeit kein Feuer mehr angezündet worden war.
»Einige Tage werde ich mich hier festsetzen«, murmelte Dan. Er band seinem Pferd den Futtersack um und lud dann die Lasten vom Rücken des Tieres. Danach nahm er die Axt und nur eine Pistole, um nach Holz zu suchen. Nach einer Viertelstunde kam er beladen wieder zurück. Er zündete ein Feuer an und hing seinen Teekessel darüber.
Der heiße Tee tat gut. Als Dan Farr nach draußen ging, sah er, dass der Tag grau und öde war. Es fiel weiterer Schnee. Nachdem er noch mehr trockenes Holz gesammelt hatte, verstellte er den Eingang der Hütte mit Gestrüpp und konnte bald sehen, wie er regelrecht zuschneite.
Inzwischen hatte sich der Raum erwärmt. Jetzt erst bereitete sich Dan das sehnlichst erwartete warme Essen. Wohlige Müdigkeit rann nach der Mahlzeit durch seinen Körper. Die Natur forderte ihr Recht. Er legte sich auf das Reisiglager, wickelte sich in seine Decke und war bald eingeschlafen.
Als Dan Farr erwachte, umgab ihn Dunkelheit. Der Schnee lastete dick auf dem Buschwerk am Hütteneingang. Das Feuer glomm nur noch schwach. Dan erhob sich, um Holz nachzulegen. Plötzlich vernahm er ein dumpfes Geräusch und dann ein Poltern. Er schnellte in die Höhe und ergriff eine seiner Pistolen. Sein Pferd schnaubte erschrocken und stellte die Ohren auf.
Dans Herz schlug wie rasend. Er spürte eine sonderbare Angst, die ihn lähmen wollte, doch er schüttelte sie entschlossen von sich. Vorsichtig näherte er sich dem Hütteneingang und schob das Buschwerk ein wenig zur Seite. Im nächsten Augenblick erspähte er eine riesige, dunkle Gestalt, und scharfer Wildgeruch schlug ihm entgegen. Unwillkürlich schrie er auf. Der riesige Bär vor der Hütte warf sich herum, um sich dann in erstaunlich schneller Gangart in Sicherheit zu bringen.
»Nur ein Bär!«, murmelte Dan Farr aufatmend. »Ich habe Gesellschaft bekommen, aber eine, die mir verteufelt wenig gefällt. Um diese Zeit müssten die Bären doch im Winterschlaf liegen. Bären, die jetzt auf den Tatzen sind, sollen besonders gefährlich sein. Einer wird das Feld räumen müssen, entweder er oder ich.«