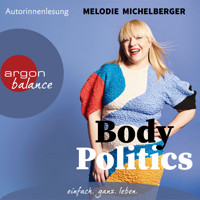14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Frauen sollen dem Schönheitsideal entsprechen, aber nicht zu individuell sein. Wer dem Ideal nicht entspricht, soll sich wenigstens selbst lieben. Der Druck auf Frauen ist so hoch wie nie, und wie seit Jahrhunderten bestimmt der männliche Blick, welche Frauenkörper attraktiv sind. Haben wir verlernt, unsere Körper zu akzeptieren und dankbar für das zu sein, was sie täglich leisten? Melodie Michelberger fragt, wem es nützt, dass sich Millionen Frauen nicht hübsch genug fühlen. Sie weiß, wie Feminismus uns hilft, gegen das traditionelle Schönheitsideal zu rebellieren – denn es ist Zeit für ein diverses Bild von Schönheit und die Akzeptanz verschiedener Körperformen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Melodie Michelberger
Body Politics
Über dieses Buch
Frauen sollen dem Schönheitsideal entsprechen, aber nicht zu individuell sein. Wer dem Ideal nicht entspricht, soll sich wenigstens selbst lieben. Der Druck auf Frauen ist so hoch wie nie, und wie seit Jahrhunderten bestimmt der männliche Blick, welche Frauenkörper attraktiv sind. Haben wir verlernt, unsere Körper zu akzeptieren und dankbar für das zu sein, was sie täglich leisten? Melodie Michelberger fragt, wem es nützt, dass sich Millionen Frauen nicht hübsch genug fühlen. Sie weiß, wie Feminismus uns hilft, gegen das traditionelle Schönheitsideal zu rebellieren – denn es ist Zeit für ein diverses Bild von Schönheit und die Akzeptanz verschiedener Körperformen.
Vita
Melodie Michelberger, geb. 1976, hat viele Jahre als Redakteurin für Gala und Brigitte und als PR-Expertin für verschiedene Modelabels gearbeitet. Sie engagiert sich auf vielfältige Weise gegen Ungerechtigkeit und für Vielfalt, u.a. auf Instagram (@melodie_michelberger) – mit einem überwältigend positiven Feedback. Sie lebt mit ihrem Sohn in Hamburg.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
nach einem Entwurf von Eva Dietrich
Coverabbildung Julia Marie Werner
ISBN 978-3-644-00680-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Dich. Und für mich.
Du kannst deinen Körper nicht in eine Form hassen, die du lieben wirst.
Ijeoma Oluo
IIEine Geschichte meines Körpers
Bitte vergiss nicht: Ich bin mein Körper. Wenn mein Körper kleiner wird, bin es immer noch ich. Wenn mein Körper größer wird, bin es immer noch ich. Es gibt in mir keine dünne Frau, die auf Freilegung wartet. Ich bin eins.
Lindy West (Shrill)
«Etwas Übergewicht» notierte der Kinderarzt im Januar 1977, ein paar Monate nach meiner Geburt, in mein gelbes Untersuchungsheft direkt neben «Gesamteindruck und Entwicklungsstand». Ich habe das Heft noch, es war Teil eines Pakets mit Memorabilia, das mir meine Mutter zum dreißigsten Geburtstag schenkte. Das Diagramm auf der Rückseite des Heftes stellt meine körperliche Entwicklung graphisch dar. Die Kreuze, die mein Körpergewicht markieren, sind alle in dem Bereich, neben dem «auffällig schwer» steht. Von den Fotos in meinem Babyalbum strahlt mich meine Miniversion in einem ärmellosen Strampler aus orangenem Frottee mit großen blauen Augen an. «Du warst gut im Futter», erzählte meine Tante, und mein Opa sagte wohl gern: «Die Melanie, die sperrt immer den Schnabel auf.» Ob ich tatsächlich oft Hunger hatte oder aus anderen Gründen den Mund aufmachte, ist nicht überliefert.
Später wurde ich beim Dorfarzt vermessen und gewogen. In seiner Praxis stand eine von diesen wuchtigen Standwaagen. Die Anzeigetafel war beinahe auf Höhe meines Gesichts, so las ich die Zahl sogar vor der Arzthelferin laut ab. Darauf war ich auch ein bisschen stolz, denn Zahlen konnte ich schon früh verstehen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommt es mir komisch vor, dass ich mich an diese Waage und die Zahlen darauf so gut erinnern kann. Wieso prägte sich mir das derart ein? Ich erinnere, dass ich mich sogar regelrecht darauf freute, dort zu erfahren, wie groß und schwer ich war. Nach der Untersuchung neben meiner Mutter zu sitzen, während die mit dem Arzt über meinen Körper sprach, war mir aber furchtbar unangenehm. «Starkes Hohlkreuz, kugeliger Bauch, Fehlstellung.» An diese Worte erinnere ich mich noch genauso wie an die Zahlen. «Streck doch deinen Bauch nicht so raus», mahnte meine Mutter mich oft. Also zog ich meinen Bauch ein und kontrollierte im Spiegel, bei welcher Körperhaltung er sich am wenigsten nach vorne wölbte.
Eine der frühesten Erinnerungen daran, wie sehr ich mich für meinen Bauch schämte, steht heute auf meinem Schreibtisch: Es ist ein Foto mit original Kodak-Farbbild-Stempel von 1982. Ich war fünf Jahre alt, fast sechs, als die Erzieherinnen im Kindergarten uns zu Beginn des Vorschuljahres fotografierten. Eigentlich habe ich die gleiche Frisur wie heute, mein Pony ist etwas schiefer, weil mir meine Mutter die Haare schnitt. Mit einer weißen Unterhose bekleidet, sitze ich auf einer Holzstufe im Garten. Mein Lächeln wirkt eher zaghaft und zeigt eine große Zahnlücke. Die Beine sind überkreuzt, dabei halte ich das rechte aber einige Zentimeter über dem Knie, entspannt sieht das nicht aus. Ich weiß, warum ich das tat – ich wollte mit dieser umständlichen Aktion meinen Bauch verdecken, der sollte auf dem Foto nicht sichtbar sein. «Babyspeck» nannte mein Vater meine rundliche Körpermitte.
Die Grundschulzeit machte mir überhaupt keinen Spaß. Auf dem Weg zur Schule vergaß ich vor lauter Tagträumen oft die Zeit und erschien viel zu spät zum Unterricht, was jeweils einen Eintrag ins rote Klassenbuch gab. Ich hatte große Mühe, mich an die Regeln und Vorschriften zu halten. Im Unterricht langweilte ich mich und begann lieber Gespräche mit meinen Sitznachbar:innen. Ich hatte viele Fragen und Interessen, allerdings hatten die meistens nichts mit dem Thema zu tun. Schnell bekam ich den Ruf der «Unruhestifterin», musste zur Strafe oft in einer staubigen Ecke des Klassenzimmers stehen oder wurde vor die Tür geschickt. «Melanies Stimmungen schwanken» steht in meinem Zeugnis der ersten Klasse. Ich verbrachte viele, sehr einsame Stunden auf dem Flur meiner Dorfschule. Einmal wollte ich nicht mehr vor der geschlossenen Tür warten und vor lauter Langeweile die Blätter der Grünlilie auf dem Fensterbrett gegenüber zählen und lief kurzentschlossen durchs ganze Dorf nach Hause. Natürlich bekam ich mächtig Ärger, als der Schulleiter Stunden später bei uns klingelte und meiner Mutter mit mahnenden Worten von meinem Verschwinden berichtete. Ich hörte ihn, weil mein Zimmer über unserer Haustür lag und ich mich dort im Schrank versteckte.
Ich weiß, dass ich mich damals vor allem danach sehnte dazuzugehören. Ich benahm mich deshalb oft auffällig und wollte «mein eigenes Ding» machen. Nach dem Motto «Schaut mal, was ich alles kann, und wisst ihr eigentlich, warum Marienkäfer Punkte haben?». Vielleicht wollte ich deswegen unbedingt diesen kunterbunten Rüschenrock in der Schule anziehen. Ich wollte gesehen werden und mit meinen schönen Kleidern auffallen. Manchmal erfand ich Geschichten, um mich spannender zu machen.
Die Sommerferien verbrachte ich bei meiner «kleinen Oma» – so nannte sie jeder in meiner Familie – in Gamshurst, einem badischen Dorf an der französischen Grenze. Auf ihrem alten Bauernhof fühlte ich mich frei, weil ich von morgens bis abends tun und lassen konnte, was ich wollte. Meine Cousine und ich waren den ganzen Tag unbeaufsichtigt zwischen Hasenställen, Kartoffeläckern und Brombeersträuchern unterwegs. Am liebsten kletterten wir in der Scheune auf die Balken und sprangen unter lautem Gekreische ins trockene Heu.
Meine kleine Oma hatte eine geräumige Vorratskammer, in der immer selbstgebackenes Brot und frischer Kuchen auf einer Anrichte standen. Dahin gelangt man durch die Küche oder direkt aus der Scheune, deshalb bekam niemand mit, wenn wir nach dem Toben heimlich Apfelkuchen oder dick geschnittene Butterbrote mampften und uns Apfelsaft aus Fässern in Flaschen umfüllten. Omas Vorratskammer war unser Schlaraffenland, Ärger bekamen wir nie. Meine Mutter schimpfte jedes Mal mit meiner Oma, wenn sie mich dort am Ende der Sommerferien abholte: «Um Himmels willen! Warum ist Melanie so dick geworden? Du darfst sie nicht einfach alles essen lassen, was sie will!» Ich fühlte mich sofort schuldig, obwohl meine kleine Oma verschmitzt lächelte. «Lass das Mädele essen», sagte sie und wühlte in den Taschen ihrer Schürze nach einem Bonbon als Trost für mich. Im Vergleich zu meiner Mutter mochte sie dicke Bäuche und runde Gesichter.
Ich muss sieben oder acht gewesen sein, als meine Mutter und Tante mit dem Weight Watchers-Programm begannen. Ich war neidisch darauf, dass sie jede Woche zusammen in die nächstgrößere Stadt fuhren, um zu einem Geheimtreffen mit anderen Frauen zu gehen. Sie redeten ohnehin ständig von Diäten und vom Abnehmen, und jetzt waren sie Teil einer Gemeinschaft, in der alle das gleiche Ziel hatten! Das fand ich höchst spannend. Von jedem dieser Ausflüge brachten sie schicke Rezeptkärtchen und jede Menge Tratsch über die anderen Teilnehmer:innen zurück. Ich sog ihre Geschichten auf wie ein Schwamm und wollte alles über dieses einfache Punktesystem, in das sich jedes Lebensmittel einordnen ließ, erfahren. Stundenlang studierte ich die Rezepte und Tabellen und lernte die Zahlen auswendig. So begann ich, Lebensmittel in gut (wenig Punkte) und schlecht (viele Punkte) einzuteilen. Ganz selbstverständlich aß ich die gleichen Dinge wie meine Mutter, das Knäckebrot lag ohnehin im Regal, und der körnige Frischkäse stand im Kühlschrank. Wenn ich mich an die Punkte hielt, machte ich alles richtig. Oder?
Irgendwann fuhr ich in den Sommerferien nicht mehr zu meiner kleinen Oma. Laut meinem Tagebuch gab es Wichtigeres als Springturniere im Heuschober und Apfelkuchen aus der Vorratskammer: Jungs! Neben dem neu entfachten Interesse an meinen Mitschülern brachte die Pubertät vor allem mehr Unsicherheiten gegenüber meinem Körper mit sich. Ich schoss in die Höhe, in der fünften Klasse war ich sogar eines der größten Mädchen in der Klasse. Danach wuchs ich allerdings nicht mehr viel in der Länge, aber mein Körper veränderte sich weiter. Als ich das erste Mal entdeckte, dass ich Brüste bekomme, war ich so schockiert, dass ich weinte. Die Dehnungsstreifen an meinen Oberschenkeln machten mich fassungslos. Auch meine Periode verheimlichte ich über Jahre und kaufte mir Tampons und Binden von meinem Taschengeld oder klaute sie meiner Mutter. Mir waren all diese Entwicklungen sehr peinlich, und zwar gleich doppelt, weil ich nicht wusste, wie ich sie aufhalten sollte. Das Gefühl, dass sich mein Körper ohne meine Zustimmung verändert, war schrecklich. Mein Misstrauen wuchs, also kontrollierte ich mich unentwegt und fürchtete jede weitere Veränderung. Ich begann, meinen Körper wie eine Außenstehende zu betrachten. Als würde er mir nicht mehr gehören. Als sei er ein bedrohlicher Gegenspieler.
Es half nicht, dass meine Familie mehr und mehr kommentierte. Meine Mutter wies andere darauf hin, «dass die Melanie jetzt bald einen BH braucht». Als ob ich nicht anwesend sei. «Sie ist jetzt schon fast eine Frau», bemerkte eine Tante. Ich wollte aber keine Frau sein. Ganz beiläufig wurde beim Kaffeetrinken darüber gesprochen, dass «Melanie einen runden Hintern bekam». Als müsste man das diskutieren. Ich wollte, dass niemand mehr etwas über meinen Körper sagte. Sie sprachen über meinen Körper wie über eine Sache. Ich schämte mich in Grund und Boden, mehr noch als damals beim Dorfarzt.
Nicht nur über meinen Körper wurde gesprochen, sondern vor allem über andere Frauen. «Also die Meier-Ursula hat die Schwangerschaftskilos ja nie wegbekommen» oder «Habt ihr die Armbruster-Sonja gesehen? Die war vor der Hochzeit richtig schön schlank, und jetzt hat die einen Arsch wie ein Brauereigaul». So und so ähnlich plauderten sie bei frisch aufgebrühtem Filterkaffee und Blechkuchen («Aber bitte nur ein kleines Stückchen, sonst muss ich morgen FDH machen!») über die Körper von Nachbar:innen, Verwandten, Freund:innen und Frauen in Magazinen. Einfach nebenbei, als ginge es um den Haushalt oder neue Schuhe. Eine Flut von Körperkritik. Mit jeder neuen Welle wuchsen meine Selbstzweifel. Jeder negative Kommentar, jede Bemerkung über «ein paar Kilo zu viel», jedes Urteil über vermeintliche Makel hallten in mir doppelt und dreifach nach. Und ich konnte nicht anders, als das Gesagte auf mich zu beziehen. Wenn meine Familie schon so redete, was würden erst andere sagen? Das war der Nährboden für meinen Selbsthass.
In den Zeitschriften, die meine Tante mitbrachte, fand sich – zum Glück! – die Lösung: Diäten! Die «Super Schlanksuppe», das «Alles essen – trotzdem abnehmen»-Programm oder «Die wirklich neue Kartoffel-Quark-Diät»! Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter oder Tante je die Wirkung in Frage stellten oder mich sonst in irgendeiner Art davor warnten. Ihre Körper mussten verbessert werden, also gingen sie auf Diät. Liebenswürdige Worte für sich selbst gab es nicht, Abwertungen dagegen zuhauf.