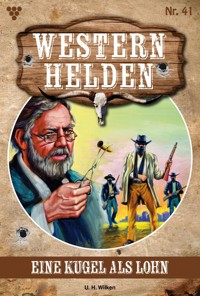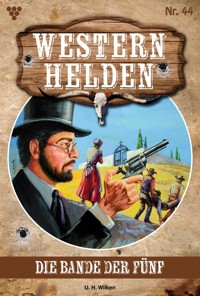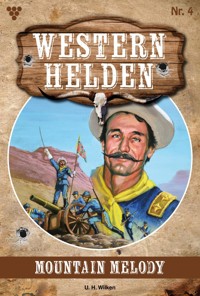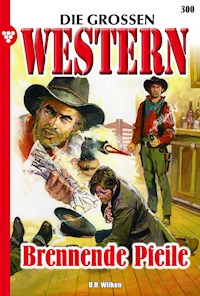
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Feuer regnete vom Himmel. Brennende Pfeile schnellten durch die Dämmerung und bohrten sich klatschend in Stall und Haus. Dumpf schlug ein glühender Pfeil in die Brust des Mannes, der gerade aus dem Stall kam. Markerschütterndes Geschrei gellte über John Wards Farm hinweg. Jetzt fielen die ersten Schüsse. Stichflammen blitzten im Dunkel auf. Kugeln fauchten über den Platz zwischen Stall und Haus, zertrümmerten die Fenster. Gurgelnd brach einer der Farmhelfer zusammen, rollte von der hölzernen Terrasse. »Wo ist der Junge?« schrie ein Mann im Haus mit wilder, heiserer Stimme. »Mein Gott, wo steckt der Junge, Frau?« Heulend hetzten Pinal-Apachen am Haus vorbei und feuerten durch die Fenster. Die bleigraue Dämmerung verwischte die Konturen, schützte die Apachen. Die Männer im Haus konnten die Apachen nur schemenhaft erkennen. Immer wieder flammten Mündungsfeuer auf. Die Stimme des Farmers tönte aus dem Haus, erstickte vor Sorge und Verzweiflung. Dann war die Stimme der Farmersfrau zu hören. »Ich weiß es nicht, John! Er muß noch im Stall sein! John, um Gottes willen, der Junge darf nicht…«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 300 –Brennende Pfeile
U.H. Wilken
Feuer regnete vom Himmel. Brennende Pfeile schnellten durch die Dämmerung und bohrten sich klatschend in Stall und Haus. Dumpf schlug ein glühender Pfeil in die Brust des Mannes, der gerade aus dem Stall kam. Er machte zwei Schritte und brach zusammen…
Markerschütterndes Geschrei gellte über John Wards Farm hinweg. Jetzt fielen die ersten Schüsse. Stichflammen blitzten im Dunkel auf. Kugeln fauchten über den Platz zwischen Stall und Haus, zertrümmerten die Fenster. Gurgelnd brach einer der Farmhelfer zusammen, rollte von der hölzernen Terrasse.
»Wo ist der Junge?« schrie ein Mann im Haus mit wilder, heiserer Stimme. »Mein Gott, wo steckt der Junge, Frau?«
Heulend hetzten Pinal-Apachen am Haus vorbei und feuerten durch die Fenster. Die bleigraue Dämmerung verwischte die Konturen, schützte die Apachen. Die Männer im Haus konnten die Apachen nur schemenhaft erkennen. Immer wieder flammten Mündungsfeuer auf.
Die Stimme des Farmers tönte aus dem Haus, erstickte vor Sorge und Verzweiflung.
Dann war die Stimme der Farmersfrau zu hören.
»Ich weiß es nicht, John! Er muß noch im Stall sein! John, um Gottes willen, der Junge darf nicht…«
Schüsse übertönten die Stimme der Mexikanerin. Brennende Pfeile bohrten sich ins Holz der Tür. Feuer leckte am Stall hoch.
Der Tod war auf die Farm gekommen…
John Ward lebte schon jahrelang im Gebiet des Gadsden Purchase. Seine Hände waren von schwerer Arbeit aufgerissen. Er hielt das Gewehr wie einen Knüppel und feuerte hinaus. Die Angst um den Sohn machte ihn fast verrückt. Hinter ihm schrie und schluchzte seine Frau, betete verzweifelt und wollte plötzlich zur Tür. Männer packten sie, hielten sie fest.
»Sie treiben das Vieh weg!« schrie John Ward. Heftiges Gewehrfeuer löschte seine Stimme. Er schoß hinaus und sah, wie die Flammen immer höher am Stall hochschlugen.
Einer seiner Männer riß auf einmal die Tür auf und rannte hinaus. Todesmutig rannte er zum Stall. Kugeln und Pfeile umfauchten ihn, zerfetzten seine Kleidung. Pinal-Apachen tauchten auf und schnellten heran. Sie trugen die Farben des Krieges im Gesicht. Die schwarz und rot bemalten Gesichter erschienen im Dunst wie teuflische Fratzen.
Verzweifelt warf sich der Mann gegen das Stalltor, zerrte es auf. Flammen leckten hoch, setzten die Kleidung in Brand, aber der Mann kam in den Stall, sah den Jungen am Boden kauern und husten, riß ihn hoch und lief mit ihm hinaus.
Da traf ihn die Kugel.
Er schlug lang hin, lag still – und seine Kleidung brannte. Der Junge schrie gellend und lief weiter.
Diese Nacht war furchtbar.
Auf den schnellen Beinen eines wiehernden Pferdes kam ein Apache herangejagt, beugte sich weit vom Pferd weg, packte den Jungen am Nacken und riß ihn aufs Pferd. Wie ein Spuk verschwand er mit dem Farmersjungen in der Dunkelheit. Die Stimme des Jungen gellte durch die Nacht und verlor sich weitab der Farm. Heulend trieben die Apachen das wenige Vieh davon. Noch fielen Schüsse, peitschten über den Platz. Der Stall brach zusammen, Funken tanzten durch die Dunkelheit.
In dieser Nacht starb so mancher Mann…
*
Räder rollten durch Staub und Sand. Zaumzeug rasselte hell. Keuchend rannten sechs Pferde vor der Postkutsche. Hart riß der Fahrer an den Zügelenden. Staub schlug über die Kutsche hinweg. Mit einer schlenkernden Bewegung blieb die Kutsche stehen, noch stampften die Pferde vor dem Wagen und zerrten am Geschirr.
Tom Jeffords neigte den Oberkörper und horchte. Das harte, knochige Gesicht verriet höchste Anspannung. Selbst im Mondlicht schimmerte sein Bart rot wie Feuer. Die Augen blickten klar und forschend über das weite Land hinweg.
Einer der Reisenden beugte sich aus dem offenen Fenster der Kutsche.
»He, warum fahren wir nicht weiter? Was ist los?«
Jeffords antwortete nicht sofort. Er starrte voraus und lauschte den dumpfen Lauten. Der Wind brachte den Knall der Gewehrschüsse heran.
»Überfall«, sagte Tom heiser. »Ich hoffe, daß ihr alle schießen und treffen könnt!«
Er wartete ihre Antwort erst gar nicht ab, fauchend fuhr die lange Peitsche durch die Luft und klatschte laut. Die Pferde warfen sich ins Geschirr und rasten los. Wieder rollten die Räder im wahnsinnigen Tempo durchs staubige Land. Wie ein König saß Tom Jeffords auf seiner Kutsche und lenkte die Pferde. Die Räder schleuderten den Sand hoch und knallten über kahles Gestein hinweg. In der Kutsche riefen die Fahrgäste, aber Tom Jeffords hörte nicht auf sie. Der Fahrtwind stieß ihm ins Gesicht, hart hatte er den Mund verkniffen. Er hielt das Bündel Zügelenden sicher in den Händen und brachte die Kutsche geschickt um alle Hindernisse.
Jäh breitete sich das Tal vor ihm aus. Er sah die Farm, das hochschlagende Feuer und die berittenen Apachen, wie sie um die Farm jagten.
Furchtlos trieb er die Pferde ins Tal. Unterwegs schlang er die Zügelenden um die Bremse und hob das Gewehr hoch. Schon schoß er auf die Apachen. Zwei fielen vom Pferd. Die anderen jagten mit schrillem Geschrei davon.
Rasselnd hielt die Kutsche vor dem Haus. Der Funkenflug gefährdete die Pferde, und Tom fuhr die Kutsche hinters Haus. Mit einem Sprung war er neben der Kutsche und riß das Gewehr hoch.
Er fürchtete nichts auf dieser Welt. Sein Leben war wie ein Tanz am Abgrund. Jahrelang raste er nun schon mit seiner Kutsche durch den Westen, und jedesmal hatte er seine Fahrgäste sicher ans Ziel gebracht. Er hatte blutige Überfälle erlebt, hatte Naturkatastrophen durchstanden und war mehr als einmal verwundet worden. Er war selber ein Stück Wildnis geworden – und er roch nach Lagerfeuern, Wild und Einöde.
In dieser Nacht aber hörte er Worte, die ihn tief erschütterten. Er sah die weinende Frau und den Farmer, wie er über den Platz hastete und in der Dunkelheit verschwand. Und er blickte in die Gesichter der Farmershelfer und sah die Toten vor dem Haus.
Die Apachen waren verschwunden.
Hell leuchtete das Feuer durch die Nacht.
Die Frau sank erschöpft zu Boden. Zwei Männer hoben sie hoch, stützten sie. Sie wimmerte leise und flüsterte immer wieder den Namen ihres Jungen.
Die Fahrgäste kamen vorsichtig und zögernd heran.
»Mein Junge«, schluchzte die Frau. »Sie haben meinen Jungen mitgenommen!«
Die Männer hielten sie fest. Sie versuchte, sich loszureißen, wollte davonlaufen, aber die Männer gaben nicht nach. Ihre Worte konnten sie nicht trösten.
Langsam kam John Ward zurück. Mit festen Schritten näherte er sich dem Haus und blieb vor seiner Frau stehen. Sein Gesicht war aschgrau.
»Sie sind weg«, flüsterte er mit zerrissener Stimme. »Der Junge ist nirgendwo. Sie nahmen ihn mit.«
Ohnmächtig sackte die Frau zusammen. Die Männer brachten sie sanft ins Haus und legten sie aufs Bett.
Tom Jeffords stand draußen und horchte. Längst war das Geheul der Apachen verstummt, das Land schien in tiefem Frieden unter dem Sternenhimmel zu liegen. Aus der Ferne kam das klagende Heulen der Wölfe herüber.
Dort begann die Wildnis, dort war das Land der Indianer.
Er hörte John Ward und drehte sich um. Der Farmer kam mit schleppenden Schritten aus dem Haus.
»Zu spät«, flüsterte er.
Tom sah zum Korral hinüber. Vieh und Pferde waren geraubt worden.
»Ich hol Hilfe vom Fort«, murmelte Tom. »Ich sag ihnen, daß sie ein paar Pferde mitbringen sollen.«
Ward nickte geistesabwesend und ging wieder ins Haus. Seine Männer standen herum und starrten in die Nacht. Schließlich ging einer von ihnen zu den Toten und sagte, daß sie beerdigt werden müßten.
Mit steifen Schritten ging Tom zur Kutsche zurück und kletterte hinauf.
»Einsteigen!« rief er heiser. »Wir fahren weiter!«
Die Fahrgäste stiegen in die Kutsche. Schon trieb Tom die Pferde an. Schnell rollte die Kutsche über den Platz und dann in die Dunkelheit hinein.
*
Tom stand im Schatten der Palisaden und rauchte seine Pfeife. Das Tor war weit geöffnet. Draußen zogen die grauen Schleier der Dämmerung übers Land. Die Abteilung kam im klirrenden Trab zurückgeritten und hielt im Fort.
Langsam klopfte Tom die Pfeife aus und zertrat die Glut. Sein Gesicht war völlig ausdruckslos. Ruhig blickte er Captain Bascom entgegen.
»Nichts«, sagte Bascom heiser. »Kein Apache zu sehen. Sie haben die Spuren gelöscht und sich davongemacht. Ich habe noch in den Bergen nach dem Jungen gesucht, aber es war zwecklos. Wen diese Teufel in den Klauen haben, den geben sie nicht mehr frei.«
Tom nickte und schob die Pfeife in die Tasche seiner langen Lederjacke.
»Ich will heute nacht weiter.«
»Tun Sie das nicht, Jeffords. Die Gegend wimmelt nur so von Apachen, aber die Kerle lassen sich nicht sehen. Sie würden das Leben Ihrer Fahrgäste aufs Spiel setzen.«
»Bis zur nächsten Station könnte ich es schaffen.«
»Warten Sie lieber. Ich weiß, Sie haben bisher alles geschafft, aber fordern Sie nicht den Tod heraus!«
Nachdenklich sah Tom durchs Tor und hinaus auf das nächtliche Land. Zwei Tage war er nun schon im Fort. Hier waren die Reisenden sicher vor den Apachen, aber dort draußen lauerte der Tod.
»Werden Sie weitersuchen, Captain?«
»Ja – und ich werde versuchen, Cochise ins Fort zu holen. Er ist bisher immer gekommen.« Der Captain verzog das schweißglänzende Gesicht und preßte den Mund zusammen. Nach einem tiefen Atemzug sagte er: »Wenn der Junge nicht lebend zu seinen Eltern kommt, dann werde ich mit Cochise abrechnen, Jeffords – und das wird für die Apachen verdammt hart werden!«
Ernst blickte Tom ihn an. Bascom war hart, aber vielleicht nicht klug genug. Cochise war gerissen und schlau, mutig und wild – und er kannte das ganze Land, das seine Heimat war.
»Beginnen Sie nicht den großen Krieg, Captain«, murmelte Tom. »Cochise schlägt sofort zurück. Ich kenne keinen anderen Indianer, der so klug ist.«
»Die Armee wird mit ihm fertig werden.« Bascom lächelte kühl, nickte Tom zu und ging mit großen raumgreifenden Schritten zur Kommandantenbaracke.
Tom ging in den Stall und holte die Pferde heraus.
Wenig später rollte die Kutsche mit den Fahrgästen aus dem Fort und aufs weite Land.
Wochenlang sollte Tom unterwegs sein. Mit tollkühnem Mut brachte er die Kutsche durchs Indianerland.
Eines Tages war er wieder unterwegs, zurück zum Fort.
Diesmal ging nichts gut…
*
Mit sicherer Hand lenkte Tom die schwankende Kutsche dicht an den Abgründen vorbei und zum Paß empor. Steine platzten unter den Rädern, jedesmal gab es einen scharfen trockenen Knall, der in den gähnenden Tiefen der Canyons ein Echo fand.
Einer der Fahrgäste fluchte. Die einzige Frau, die mitfuhr, beugte sich aus dem Türfenster und verschwand sofort wieder, als sie die Abgründe erblickte.
Tom lächelte vor sich hin und kniff die Augen zusammen. Die Luft zitterte vor Hitze über dem Paß der roten Felsen. Keuchend zogen die Pferde die Kutsche bergan.
Viele Male war Tom diesen Weg gefahren. Er wußte, daß dort oben die Felsen eng zusammentraten und die Kutsche gerade hindurchpaßte. Schon jetzt machte er sich bereit, um das Gefährt sicher hindurchzukriegen.
Er sah nicht die Reiter, die zwischen den Felsklippen verhielten und ihre Revolver gezogen hatten. Seit langer Zeit warteten sie schon auf die Kutsche. Jetzt gaben sie sich Zeichen, grinsten bösartig und jagten los…
Kaum hatte Tom den trommelnden Hufschlag gehört, da packte er schon seine Volcanic und lud durch – aber es war zu spät. Die Banditen richteten die Waffen auf ihn. Sekundenlang war Toms Leben keinen Cent mehr wert. Er ließ das Gewehr fallen und hob die Hände hoch. Die Pferde gingen weiter, und die Kutsche knallte gegen eine hervorspringende Felswand, saß fest.
Die Banditen umringten die Kutsche. Tom sah in bärtige schweißglänzende Gesichter. Das rastlose Leben rauchiger Ritte hatte die Gesichter gezeichnet. Tom erkannte sofort, daß diese Banditen rücksichtslos schießen würden. Steif saß er auf dem Bock und rührte sich nicht.
Niemals würde er diese Gesichter vergessen. Selbst nach vielen Jahren würde er sie wiedererkennen.
»Komm runter!« schrie einer der fünf Männer und legte auf Tom an. »Wenn du verrückt werden solltest, dann knall ich dich ab wie einen Hund.«
Der Bandit mit dem Narbengesicht starrte ihn kalt und mit funkelnden Augen an. Er schien zu überlegen, ob er Tom erschießen sollte. Mordlust flackerte in den Augen, und zynisches Lächeln verriet seine Gedanken.
»Ich weiß, du würdest uns am liebsten zerreißen«, dehnte er lauernd. »Du erstickst noch an deiner Wut, Rotkopf. Laß die Hände oben, sonst drück ich ab.«
Toms Gesicht war wie aus Stein. Nichts in diesem Gesicht bewegte sich, selbst die Augen blickten starr und ausdruckslos. Nur eiserne Beherrschung konnte ihn retten…
Er sah, wie die Banditen die Wagentüren aufrissen und die Fahrgäste herauszerrten. Ein Bandit kletterte auf die Kutsche, stieg übers Wagendach hinweg und warf das Gepäck herunter. Ein anderer durchsuchte das Innere des Wagens. Rücksichtslos wurden die Fahrgäste ausgeplündert.
Zitternd griff die Frau sich an den Hals und bedeckte mit den Händen die wertvolle goldene Kette. Einer der Banditen kam grinsend heran, riß ihr die Hände weg und faßte hinter die Kette, mit einem einzigen harten Ruck riß er die Kette herunter und hielt sie grinsend in der Rechten.
Neben der Frau stand ihr Mann. Tom sah, wie er bleich wurde, die Hände zusammenballte und sich nicht mehr beherrschen konnte. Als der Bandit seine Frau auch noch verächtlich und roh gegen die Felswand stieß, konnte er nicht länger stillhalten. Mit einem dumpfen Aufschrei warf er sich gegen den Banditen. Beide prallten gegen die Felswand. In wildem Zorn holte der Mann aus. Die Verzweiflung hatte ihn blind gemacht. Er schlug zu und schrie dabei. Plötzlich fiel ein Schuß. Er erstarrte mitten in der Bewegung, stand steif vor dem Banditen. Das Gesicht wurde grau, die Züge erschlafften. Schwankend wich er einen Schritt zurück. Erst jetzt war der Colt in der Hand des Banditen zu sehen. Taumelnd stürzte der Mann gegen die Kutsche, preßte die Hände gegen den Körper und fiel schwer zu Boden.
Aufschreiend warf sich die Frau neben ihm hin und umfaßte sein Gesicht.
Ungerührt standen die Banditen neben den anderen Fahrgästen. Der Narbengesichtige stieß ein leises Lachen aus.
»Macht weiter!«
Sie rissen die Kisten und Koffer auf und warfen alles, was sie nicht gebrauchen konnten, achtlos weg. Schmuck, Taschenuhren und Geld rafften sie an sich.
»Mörder!« schrie die Frau auf. »Ihr gemeinen Mörder! Mein Mann ist tot! Gemeine Halunken!«
Schluchzend brach sie über ihrem Mann zusammen…
Tom spürte die Kälte, die durch seinen Körper kroch. Sein Gesicht war auf einmal voller kleiner Falten, und in den Augen war es grau wie Rauch. Er hatte einmal erlebt, wie Banditen im Blutrausch mehrere harmlose Leute auf der Straße einfach niedergeschossen hatten.
Wenn jetzt noch einer der Fahrgäste durchdrehte, dann konnte es zu einem Blutbad kommen. Er konnte den Fahrgästen nicht helfen.
Die Frau weinte herzzerreißend. Kalt tönte die Stimme des Anführers über den Paß hinweg:
»Spannt die Gäule aus! Wir nehmen sie mit.«
Schon lösten zwei Banditen das Geschirr und zogen die Pferde nach vorn. Lässig stieg der Narbengesichtige auf sein Pferd und starrte Tom Jeffords an.
»Ich sollte dich erschießen«, flüsterte er heiser. »Du gehörst zu den Narren, die zuviel an Gerechtigkeit denken. Yeah, ich sollte dich fertigmachen, aber das wäre zu schnell. Wenn du sterben willst, dann such uns…«
Höhnisches Gelächter folgte seinen Worten. Er riß das Pferd herum und trieb es hart an.
Tom rührte sich nicht. Noch immer hatte er die Hände erhoben. Er beobachtete die Banditen, wie sie die Wagenpferde hinter sich her zerrten. Die beiden Banditen hinter der Kutsche ritten vom Weg und zwischen die Felsen. Wenig später tauchten sie vorn bei den anderen auf. Gemeinsam jagten sie davon. Eine große Staubwolke zeichnete lange Zeit ihren Weg nach.
Erst jetzt ließ Tom die Hände fallen. Er stieg über die Kutsche hinweg und beugte sich über die weinende Frau. Sanft berührte er sie an den Schultern.
Sie zuckte heftig zusammen und hob das Gesicht zu ihm auf.
»Sie haben ihn umgebracht!« flüsterte sie mit klangloser Stimme. »Er wollte mich schützen. Dafür haben sie ihn erschossen…«
»Kommen Sie, Ma’am«, murmelte er weich. »Wir werden ihn am Paß begraben. Sie dürfen sich nicht selber fertigmachen.«
»Er war ein guter Mensch, Mr. Jeffords«, hauchte sie. »Jetzt wird er für immer hier oben am Paß liegen. Mein Gott, ich werde das nie vergessen können!«
Tom faßte unter ihre Arme und zog sie hoch. Schweigend nickte er den anderen Fahrgästen zu. Sie alle gingen zurück, suchten sich einen Weg durch die Felsen und erreichten vor der Kutsche den Weg. Dann ging Tom allein zurück, hob den Mann hoch und trug ihn zwischen die Felsen. Dort schaufelte er ein tiefes Grab aus und beerdigte ihn.
Sie durften keine Zeit verlieren. Erbarmungslos brannte die Sonne hernieder. Sie hatten nur wenig Proviant und Wasser, und vor ihnen lag ein weiter Weg.
Er ging zur Kutsche zurück, nahm sein Gewehr, holte den Proviant hervor und stapfte dann zu den anderen.
»Gehen wir«, sagte er mit rauher Stimme. »Uns hilft niemand. Wir müssen uns selber helfen.«
Mit keinem Wort verfluchte er die Banditen. Dazu war er viel zu beherrscht. Aber ihre Gesichter hatten sich in sein Gedächtnis hineingefressen.
Er ging den Leuten voraus. Die Frau mußte gestützt werden. Immer wieder verharrte sie und wollte zurück zum Grab ihres Mannes. Als sie sich losriß und zurücklief, herrschte er die Männer an.
»Haltet sie fest! Ihr werdet doch wohl noch mit einer Frau fertig werden! Wenn sie noch ein paarmal zurückrennt, ist sie nach zwei Meilen fertig. Dann könnt ihr sie tragen, verdammt noch mal.«
Zwei Männer liefen ihr nach, holten sie ein und beruhigten sie. Weinend ließ sie sich von den Männern heranführen.
Tom verzog das Gesicht und ging weiter. Er machte große Schritte und zwang die Fahrgäste zu schnellem Gang. Nur manchmal drehte er sich halb um und sah zurück.
Nach zwei Meilen blieben die Fahrgäste immer mehr zurück. Tom verharrte und wartete, bis sie bei ihm waren.