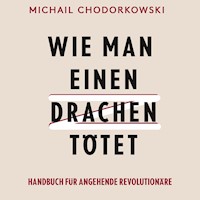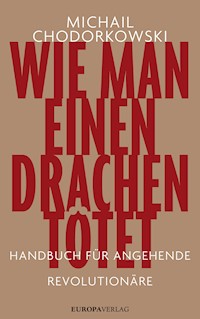4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der einst berühmteste Häftling Russlands schreibt über sein Leben
Wer ist Michail Chodorkowski, dämonisiert von den einen, verklärt von den anderen? Kommunist und Kapitalist, Gewinner der Perestroika und berühmtester Häftling Russlands. Im Oktober 2003 wurde der Oligarch und Jukos-Chef verhaftet und in einem kafkaesken Prozess zu 14 Jahren Haft verurteilt. Dies ist sein erstes Buch.
Im Oktober 2003 war sein letzter Tag in Freiheit. Man sagte ihm, Präsident Putin habe beschlossen, er solle »die Schleimsuppe« der Gefängnisse »löffeln«. Am 20. Dezember 2013 wurde er entlassen.
Michail Chodorkowskis erstes Buch versammelt Briefe und Aufsätze des Unternehmers, des Politikers, aber auch des privaten Michail Chodorkowski. Sie zeichnen eine Entwicklung nach: vom erfolgsbewussten Mann, der »sich im Grunde nie um Ideologie gekümmert hat« zu einem Helden unserer Tage, der sagt: »Das Recht auf eine Chance ist das Wichtigste für alle Kinder Russlands. Für dieses Ideal würde ich mein Leben geben.«
Chodorkowski schreibt eindrucksvoll und leidenschaftlich über seine Hoffnung, Russland werde doch noch ein modernes Land mit einer entwickelten Zivilgesellschaft frei von Beamtenwillkür, Korruption und Gesetzlosigkeit. Er spricht darüber, welche Klarheit die Haft in sein Leben brachte, und was es bedeutet, dass der Kreml ihn jahrelang von Frau, Kindern und jeglichem aktiven Leben isolierte und physisch zu zerstören versuchte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
»An Chodorkowskis Händen klebt Blut […] der Dieb gehört hinter Gitter. «
W. Putin, November 2010.
»Ich bin keineswegs ein idealer Mensch, aber ich bin ein Mensch der Ideen. Wie jedem wird es mir schwer, im Gefängnis zu leben, und ich will nicht darin sterben. Aber wenn es sein muss, werde ich nicht schwanken. Meine Überzeugung ist mir mein Leben wert. «
M. Chodorkowski, 2. November 2010.
»Unsere Justiz ist unabhängig, sagen Putin und Medwedew, von Gesetzen und dem gesunden Menschenverstand, sage ich. «
M. Chodorkowski, 24. Januar 2011
An die Eltern
» … ich wünsche Euch das Beste. Macht Euch keine Sorgen. Stellt Euch einfach vor, ich sei auf einer langen Geschäftsreise, genauer: ich diente in der Armee eines demokratischen Russland. Das finde ich übrigens wirklich. Es ist sehr ähnlich.
Ich liebe und küsse Euch.
Euer Sohn. «
»Meine gute, liebe Mamulja!
Ich gratuliere Dir zum Geburtstag! … Achte auf Deine Gesundheit! … Du musst nicht nur aushalten, bis ich zurückkomme, sondern mir dabei helfen, das, was in diesen Jahren zerstört worden ist, wieder aufzubauen. Ich hoffe sehr auf Dich.
Ich liebe und küsse Dich.
Dein Sohn.«
Warum ich dieses Buch geschrieben habe
In diesem Buch sind einige meiner Essays und Briefe aus dem Gefängnis versammelt. Ein Teil entstand in Moskau, ein anderer in Tschita, einem Ort an der Grenze zu China, wo ich ein paar Jahre meiner Haft absaß, ein dritter wiederum in Moskau, während des zweiten Strafprozesses.
Auf die Veröffentlichung meiner Texte reagierten die Machthaber manchmal gelassen, manchmal aber auch nervös, weshalb ich dann in Isolationshaft gesteckt wurde.
Ich werde immer wieder gefragt, warum ich schreibe, warum ich die Regierung weiter provoziere, ob ich denn nicht freikommen wolle.
Ich kann dazu nur sagen: Natürlich will ich die Freiheit. Ich habe vier Kinder, eine Enkelin1, die ich nie gesehen habe, eine Frau, Eltern, die nicht mehr jung sind. Gleichzeitig kann ich mich nicht damit abfinden, dass die Regierung an mir ein Exempel statuiert, um ihren Gegnern zu zeigen, dass sie einen Menschen brechen oder vernichten kann. Ein modernes europäisches Land, das als demokratischer Rechtsstaat gelten will, kann sich das nicht leisten.
Solange ich im Gefängnis bin, solange ich irgend kann, werde ich kämpfen und schreiben.
Ich bin ein ganz normaler Mensch, nur ist mein Schicksal vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich komme aus einer ganz normalen sowjetischen Ingenieursfamilie, habe eine ganz normale sowjetische Schule besucht, habe studiert, war im kommunistischen Jugendverband und bin nur durch Zufall mitten in die revolutionären Umwälzungen der neunziger Jahre geraten und zu einem Mitgestalter des neuen russischen Staates geworden.
Als Berater der ersten russischen Regierung stand ich Boris Jelzin nahe, zusammen mit seinen Leuten habe ich 1991 das Weiße Haus verteidigt, mich 1993 für die neue Regierung stark gemacht und 1996, während der schwierigen Wahlen, gehörte ich wieder zu Jelzins Mannschaft. Wir versuchten, einen neuen demokratischen Staat aufzubauen, die Gesellschaft zu erneuern, und wir haben uns im Laufe dieses Kampfes auch selbst verändert.
Ich habe erst allmählich gelernt, was Demokratie wirklich heißt, was eine moderne Wirtschaft ausmacht, wie man als Bürger seine Verantwortung wahrnehmen und sich auch für soziale Belange einsetzen muss. Mit großer Dankbarkeit denke ich in diesem Zusammenhang an die Mitglieder des Konzernvorstandes von Jukos – Sarah Carey, Bernard Lozé, Jacques Kosciusko, Michel Soublin, an meine Kollegen Bruce Misamore, Joe Mach, Frank Rieger und zahlreiche andere. Sie haben mir weit mehr vermittelt als ein Verständnis für globale Wirtschaft, internationales Finanzwesen und gutes korporatives Management. Ich habe mich meinerseits bemüht, diese neuen Erkenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben.
Die Projekte »Offenes Russland«,»Neue Zivilisation«, »Föderation Internet-Bildung« (»FIO«), meine Beteiligung an den »Schulen öffentlicher Politik«2 und die öffentliche Unterstützung bestimmter politischer Parteien sind mein Beitrag zu den Veränderungen, die mein Land braucht.
Besonders wichtig für ein grundsätzliches Umdenken war meine Bekanntschaft mit dem berühmten amerikanischen Kongressabgeordneten Tom Lantos, einem Holocaust-Überlebenden. Tom machte mir anschaulich klar, worin die Vorzüge des modernen Parlamentarismus liegen und wie er funktioniert.
Der eingeschlagene Weg in Richtung europäische Demokratie, verbal durchaus unterstützt von der derzeitigen Regierung, hat bei bestimmten einflussreichen Kreisen unseres Landes große Unzufriedenheit ausgelöst. Diese Unzufriedenheit entlud sich am 19. Februar 2003 während einer öffentlichen Konferenz bei Präsident Putin, bei der es vor allem um das Thema Korruption ging. Im Auftrag des Russischen Unternehmer- und Industriellenverbands (RSPP) hielt ich eine sehr polemische, ehrliche Rede und stieß damit auf Unverständnis. Schon im März begann die Strafverfolgung, ich wurde zu Vernehmungen vorgeladen und im Juni zum ersten Mal festgenommen. Man drängte mich förmlich dazu, das Land zu verlassen, doch ich lehnte eine Ausreise öffentlich ab.
Meine Verhaftung und die darauf folgenden Strapazen haben viel verändert, sowohl in mir selbst als auch an dem Bild, das sich der gebildete Teil der russischen Gesellschaft von mir gemacht hatte.
Vorher, noch in Freiheit, musste ich mich nur selten publizistisch äußern, und ich betrachte dies auch nicht als mein Metier. Aber durch meine Inhaftierung und die öffentlichen Strafprozesse haben die Machthaber mich und meine Kollegen zu einem Symbol des Kampfes gegen autoritäre bürokratische Willkür gemacht und mir quasi das Recht gegeben, mich direkt an die Menschen zu wenden.
Seitdem ich begriffen habe, dass ich auf absehbare Zeit nicht freikommen werde, ist die Angst von mir abgefallen, und ich sage, was ich denke. Zu meiner Überraschung stießen meine Gedanken bei den russischen Intellektuellen auf Anklang. Und so wurden die Gefängnismauern auf einmal zu einem gewaltigen Resonanzraum. 80 bis 85 Prozent der Hörer von »Echo Moskwy«,3 des einzigen liberalen Rundfunksenders in unserem Land, stimmen mit mir überein.
Sie werden in diesem Buch einen Menschen vorfinden, der sich selbst sehr verändert hat und in einem Land lebt, das ebenfalls im Wandel begriffen ist. Und Sie werden erfahren, wie ein großer Teil der gebildeten Bürger Russlands die Wirklichkeit erlebt.
Ich möchte der deutschen Öffentlichkeit von ganzem Herzen danken für die Anteilnahme und Unterstützung, die sie mir und meinen Kollegen entgegenbringt. Wir haben ein gemeinsames Ziel – ein europäisches, friedliches, demokratisches und modernes Russland.
Schlussplädoyer vom 2. November 2010
Verehrtes Gericht!
Wenn ich zurückschaue, erinnere ich mich an den Oktober 2003. Meinen letzten Tag in Freiheit. Ein paar Monate nach der Verhaftung sagte man mir, Präsident Putin habe beschlossen, ich solle acht Jahre lang »die Schleimsuppe« der Gefängnisse »löffeln«. Damals fiel es schwer, das zu glauben.
Seitdem sind sieben Jahre vergangen. Sieben Jahre sind eine sehr lange Zeit, besonders im Gefängnis. Wir alle hatten viel Zeit, das ein oder andere neu zu bewerten oder zu interpretieren.
Das Auftreten der Staatsanwälte nach dem Motto »Brummen Sie ihnen 14 Jahre auf« und »Pfeifen Sie auf die früheren Gerichtsurteile«, bedeutet wohl: Man hat in diesen Jahren noch mehr Angst vor mir bekommen und achtet das Gesetz noch weniger.
Beim ersten Mal haben sie wenigstens versucht, hinderliche juristische Verordnungen vorher aufzuheben. Diesmal geht es auch so, zumal nicht nur zwei, sondern mehr als sechzig Verordnungen aufgehoben werden müssten.
Ich möchte jetzt nicht auf die juristische Seite des Falls zurückkommen. Alle, die etwas davon verstehen wollten, haben längst alles verstanden. Keiner erwartet ernstlich ein Schuldeingeständnis von mir. Es würde heute kaum einer glauben, wenn ich sagte, das ganze Öl, das mein Konzern gefördert hat, sei von mir geraubt worden.
Aber genauso wenig glaubt jemand, dass ein Moskauer Gericht im Fall Jukos auf Freispruch erkennen könnte.
Trotzdem möchte ich meiner Hoffnung darauf Ausdruck geben. Hoffnung ist das Wichtigste im Leben.
Ich erinnere mich an die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Ich war damals 25. Unser Land lebte in der Hoffnung auf Freiheit und Glück für uns und unsere Kinder.
Zum Teil erfüllten sich die Hoffnungen, zum Teil nicht. Dafür dass sie sich nicht dauerhaft und nicht für alle erfüllten, trägt wohl unsere Generation die Verantwortung, darunter auch ich.
Ich erinnere mich auch an das Ende des vorigen Jahrzehnts. Ich war damals 35. Wir bauten den besten Ölkonzern Russlands auf. Wir errichteten Sport- und Kulturzentren, leisteten Pionierarbeit, erschlossen Dutzende neuer Fördermöglichkeiten, nahmen die Ausbeutung der ostsibirischen Reserven in Angriff und führten neue Technologien ein. Taten eigentlich all das, wessen sich Rosneft, der Konzern, der Jukos übernahm, heute rühmt.
Dank der auch durch unter Verdienst beträchtlich gestiegenen Ölförderung konnte unser Land die günstige Konjunktur für Öl ausnutzen. Wir hatten Hoffnung, dass die Zeit der Erschütterungen und Wirren endlich vorbei sei, dass wir in stabilen Verhältnissen, die enorme Anstrengungen und Opfer gekostet hatten, in Ruhe ein neues Leben und eine große Zukunft für unser Land würden aufbauen können.
Leider hat sich auch diese Hoffnung bisher nicht erfüllt. Die Stabilität wich zusehends der Stagnation. Die Gesellschaft erstarrte. Obwohl die Hoffnung noch lebendig ist. Selbst hier im Saal des Chamownitscheski-Gerichts ist sie lebendig, jetzt, wo ich schon beinahe fünfzig bin.
Mit dem Regierungsantritt des neuen Präsidenten, und das ist schon mehr als zwei Jahre her, schöpften viele meiner Mitbürger wieder Hoffnung. Hoffnung, Russland werde doch noch ein modernes Land mit einer entwickelten Zivilgesellschaft. Frei von Beamtenwillkür, Korruption, Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit.
Klar, dass das nicht von selbst und von einem Tag auf den anderen geschehen konnte. Aber so zu tun, als ob wir vorankämen, während wir in Wirklichkeit auf der Stelle treten und sogar zurückfallen, das ist, auch wenn es sich den Anschein eines edlen Konservativismus gibt, inzwischen unmöglich und schlicht gefährlich für unser Land.
Man kann unmöglich hinnehmen, dass Menschen, die sich Patrioten nennen, sich derart vehement gegen jede Änderung sperren, die ihre Futtertröge und Privilegien begrenzen würde. Ich erinnere nur an Paragraf 108 der Strafprozessordnung der Russischen Föderation, in dem es um die Festnahme von Unternehmern oder die Einkommenserklärung von Staatsdienern geht. Die Verhinderung von Reformen beraubt unser Land der Perspektiven. Das ist kein Patriotismus, sondern Heuchelei.
Ich schäme mich zu sehen, wie einige in der Vergangenheit von mir geachtete Leute versuchen, bürokratische Willkür und Gesetzlosigkeit zu rechtfertigen. Sie geben ihren guten Ruf im Tausch gegen ein ruhiges, privilegiertes Leben im Rahmen des herrschenden Systems.
Zum Glück sind nicht alle so, und die anderen sind in der Mehrheit.
Ich bin stolz darauf, dass es unter den tausend Mitarbeitern von Jukos während der sieben Jahre dauernden Verfolgungen keinen einzigen gegeben hat, der bereit gewesen wäre, durch eine Falschaussage seine Seele und sein Gewissen zu verkaufen.
Dutzende wurden bedroht, von ihren Angehörigen und Freunden getrennt und ins Gefängnis geworfen. Einige wurden gefoltert. Aber obwohl sie ihre Gesundheit und Jahre ihres Lebens opferten, bewahrten sich die Menschen das, was sie für die Hauptsache hielten: ihre Menschenwürde.
Diejenigen, die diesen schändlichen Fall angezettelt haben – Birjukow, Karimow und andere –, haben uns verächtlich »Händler« (»kommersanty«) genannt, uns als Gesindel bezeichnet, das zu allem bereit ist, um seinen Wohlstand zu retten und nicht ins Gefängnis zu kommen.
Inzwischen sind Jahre vergangen. Und wer hat sich wie Gesindel verhalten? Wer hat für Geld und aus Feigheit vor der Obrigkeit gelogen, gefoltert, Geiseln genommen?
Und das haben sie eine »Staatsangelegenheit« genannt!
Ich schäme mich. Ich schäme mich für mein Land.
Ich glaube, eines ist uns allen sehr wohl klar: Die Bedeutung dieses Prozesses geht weit über das Schicksal von Platon (Lebedew) und mir hinaus, ja sogar weit über die Schicksale all derer, die im Zuge der großen Abrechnung mit Jukos unschuldig gelitten haben, derer, die ich nicht habe schützen können, die ich aber nicht vergesse und an die ich jeden Tag denke.
Fragen wir uns doch: Was denkt denn heute ein Unternehmer, eine Führungskraft in der Industrie, schlicht ein gut ausgebildeter, kreativer Mensch, wenn er unseren Prozess beobachtet und dessen absolut vorhersehbaren Ausgang sieht?
Die klare Schlussfolgerung jedes denkenden Menschen ist schrecklich einfach: Die Polizei-Bürokratie ist allmächtig. Ein Recht auf Privateigentum gibt es nicht. Die Menschenrechte haben bei einem Konflikt mit dem »System« grundsätzlich keine Geltung.
Obwohl sogar im Gesetz verankert, werden die Rechte nicht vom Gericht verteidigt. Entweder weil das Gericht ebenfalls Angst hat oder weil es Teil des »Systems« ist. Wen überrascht es, wenn niemand danach strebt, Verantwortung zu übernehmen?
Wer soll die Wirtschaft modernisieren? Die Staatsanwälte? Die Milizionäre? Die Geheimpolizisten? Eine solche Modernisierung hat man schon einmal versucht, es hat nicht geklappt. Die Wasserstoffbombe und Raketen konnten sie bauen, aber einen eigenen guten, modernen Fernseher, ein eigenes billiges, konkurrenzfähiges modernes Auto, ein eigenes modernes Handy und jede Menge anderer moderner Produkte, das kriegen wir bis heute nicht hin.
Dafür hat man sich mit bei uns hergestellten, veralteten ausländischen Modellen geschmückt, und die wenigen Entwicklungen russischer Erfinder finden, wenn überhaupt, nur im Ausland Anwendung.
Was ist aus den im vorigen Jahr unternommenen Initiativen des Präsidenten zur Industriepolitik geworden? Sind sie ad acta gelegt? Dabei waren sie durchaus eine reale Chance, von der Rohstoffabhängigkeit wegzukommen.
Warum sind sie begraben? Weil es zu ihrer Realisierung nicht nur eines Koroljows und eines Sacharows unter den Fittichen des allmächtigen Berija4 und seines Millionenheers bedurft hätte, sondern Hunderttausender von Koroljows und Sacharows, beschützt von gerechten, verständlichen Gesetzen und unabhängigen Gerichten, die diesen Gesetzen Leben einhauchen und ihnen nicht einen Platz im verstaubten Regal zuweisen würden wie es einst mit der Verfassung des Jahres 1937 geschah.
Wo sind diese Koroljows und Sacharows heute? Emigriert? Auf dem Sprung in die Emigration? In der inneren Emigration? Haben sie sich unter die grauen Bürokraten gemischt, um nicht wieder unter die Dampfwalze des »Systems« zu geraten?
Wir, die Bürger Russlands und Patrioten des ganzen Landes, können und müssen das ändern.
Wie soll Moskau zu einem Finanzzentrum Eurasiens werden können, wenn unsere Staatsanwälte in einem öffentlichen Prozess unumwunden und unmissverständlich wie vor zwanzig und fünfzig Jahren dazu aufrufen, das Streben nach Vergrößerung der Produktion und Kapitalisierung eines Privatunternehmens als verbrecherisches Ziel anzuerkennen, das mit 14 Jahren Gefängnis zu ahnden ist?
Wenn der Konzern laut dem einen Urteil Steuern hinterzogen haben soll, obwohl er nach Gasprom der größte Steuerzahler im Land ist, es sich laut dem anderen Urteil aber gar nicht um einen besteuerungsfähigen Gegenstand gehandelt hat, sondern um gestohlenes Gut!
Ein Land, das sich damit abfindet, dass die Polizeibürokratie im eigenen und keineswegs im Interesse des Landes Zehn-, wenn nicht Hunderttausende talentierter Unternehmer, Führungskräfte und einfacher Bürger statt und zusammen mit Verbrechern in Gefängnissen hält, ist ein krankes Land.
Ein Staat, der seine besten Konzerne zerschlägt, die auf dem Weg sind, in die Weltklasse aufzusteigen, ein Staat, der seine Bürger verachtet, der nur der Bürokratie und den Geheimdiensten vertraut, ist ein kranker Staat.
Die Hoffnung ist der Hauptantrieb für große Reformen und Änderungen, die Gewähr für deren Erfolg. Wenn sie erlischt, wenn sie von dumpfer Enttäuschung abgelöst wird, wer und was wird dann unser Russland aus einer neuen Stagnation herausführen können?
Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Millionen Augen in unserem Land und auf der ganzen Welt verfolgen den Ausgang dieses Prozesses. Sie verfolgen ihn in der Hoffnung, dass Russland doch noch zu einem Land der Freiheit und des Gesetzes wird, in dem das Recht höher steht als ein Beamter.
In dem die Unterstützung oppositioneller Parteien aufhört, ein Anlass für Repressionen zu sein.
In dem die Sicherheitsdienste Volk und Gesetz schützen, nicht die Bürokratie vor Volk und Gesetz.
In dem die Menschenrechte nicht mehr von der Laune des Zaren abhängig sind. Sei es nun ein guter oder ein böser.
In dem im Gegenteil die Regierung wirklich von den Bürgern und das Gericht nur von Recht und Gott abhängig sein werden. Wenn Sie wollen, nennen Sie das Gewissen.
Ich glaube, dass das kommen wird.
Ich bin keineswegs ein idealer Mensch, aber ich bin ein Mensch der Ideen. Wie jedem fällt es mir schwer, im Gefängnis zu leben, und ich will nicht darin sterben.
Aber wenn es sein muss, werde ich nicht schwanken. Meine Überzeugung ist mir mein Leben wert. Ich meine, das bewiesen zu haben.
Und die Ihre, meine Herren Opponenten? An was glauben Sie? An das Recht der Obrigkeit? An das Geld? Daran, dass das »System« straflos ausgeht?
Euer Ehren!
In Ihren Händen liegt sehr viel mehr als nur zwei Schicksale. Hier und jetzt wird über das Schicksal eines jeden Bürgers unseres Landes entschieden. Über das Schicksal derjenigen in Moskau und Tschita, Petersburg und Tomsk und in anderen Städten und Dörfern, die darauf zählen, nicht ein Opfer der Gesetzlosigkeit der Miliz zu werden, derjenigen, die ein eigenes Geschäft gegründet, ein Haus gebaut, Erfolg gehabt haben und möchten, dass dies ihren Kindern und nicht Plünderern in Uniform zugutekommt, und schließlich derjenigen, die ehrlich für ein gerechtes Gehalt ihre Pflicht tun wollen, ohne jede Minute befürchten zu müssen, unter einem beliebigen Vorwand von einer korrumpierten Obrigkeit entlassen zu werden.
Es geht nicht um Lebedew und mich, jedenfalls nicht nur. Es geht um die Hoffnung vieler unserer Mitbürger. Um die Hoffnung, dass das Gericht morgen ihre Rechte wird verteidigen können, sollte es irgendwelchen Bürokraten wieder in den Sinn kommen, diese Rechte dreist und demonstrativ zu verletzen.
Ich weiß, dass es Menschen gibt – ich habe ihre Namen während des Prozesses genannt –, die uns weiter im Gefängnis sehen wollen. Für immer! Sie verheimlichen das im Grunde genommen auch nicht, indem sie öffentlich betonen, der Fall Jukos sei längst nicht abgeschlossen.
Weil sie demonstrieren wollen: Sie stehen über dem Gesetz, sie erreichen immer das, was sie vorhaben. Bisher haben sie das Gegenteil erreicht: Sie haben aus gewöhnlichen Menschen ein Symbol des Widerstands gegen die Willkür gemacht. Jetzt brauchen sie einen Schuldspruch, um nicht selbst zu »Sündenböcken« zu werden.
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass das Gericht diesem Druck ehrenhaft standhält. Wir wissen alle, wie und über wen er ausgeübt wird.
Ich möchte, dass eine unabhängige Justiz zur Realität wird und zum Alltag meines Landes gehört, dass die Worte vom »gerechtesten Gericht der Welt«, die in der Sowjetzeit geprägt wurden, aufhören, ironisch zu klingen. Dass wir unseren Kindern und Enkeln nicht die gefährlichen Symbole des totalitären Systems als Erbe hinterlassen.
Euer Ehren, mir ist klar, Sie haben es außerordentlich schwer, vielleicht haben Sie sogar Angst. Ich wünsche Ihnen Mut.
Wer ist Michail Chodorkowski?
Ein Essay von Erich Follath
Erich Follath, Jahrgang 1949, ist promovierter Politologe und Diplomatischer Korrespondent des »Spiegel«. Er hat in dem Hamburger Nachrichtenmagazin zahlreiche Titelgeschichten über Russland, China und den Nahen Osten veröffentlicht. Follath ist Autor mehrerer erfolgreicher Sachbücher (u.a. »Die letzten Diktatoren«, »Die Kinder der Killing Fields«).
Ein fast mitleidiges Lächeln auf den Lippen, die Stimme leise und fest, fordernd und verzeihend zugleich, die Haltung betont aufrecht, als wolle da jemand mit jeder Bewegung beweisen: Mich bricht niemand. Michail Borissowitsch Chodorkowski ist kein brillianter Romancier, kein mitreißender Revolutionär, auch kein Rhetoriker von Gnaden. Und doch erinnert das Schlusswort, das er während dieses bitterkalten Novembertags 2010 im Gitterkäfig des Moskauer Gerichtssaals hält, an zwei andere berühmte historische Reden, die alle Menschen aufgewühlt haben und dies bis heute noch tun. An Plädoyers, die nicht nur die Justiz eines Landes durcheinander gewirbelt haben, sondern ein ganzes Stück auch die Geschichte der Welt.
Emile Zola hat einst seine Wut herausgeschleudert, in Worten, die wie Blitze einschlugen, in einer einzigen Anklage. »J’accuse!« nennt der französische Schriftsteller denn auch seinen auf Seite eins der Pariser Zeitung »L’Aurore« am 13. Januar 1898 veröffentlichten Brandbrief an Félix Faure, den Präsidenten der Republik. Er plädiert nicht in eigener Sache; Zola ergreift für den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus Partei, der offensichtlich unter einem Vorwand als Landesverräter verhaftet wurde. Er prangert den herrschenden Antisemitismus an und beklagt die Willkür des Rechtssystems und deren Deckung durch die hohe Politik: »Sie, Herr Präsident, haben die Herzen erobert. Sie sind umstrahlt von dem Glanz des patriotischen Festes. Aber welch eine Befleckung Ihres Namens – ich hätte fast gesagt Ihrer Regierungszeit – ist diese abscheuliche Affäre Dreyfus! Ich werde die Wahrheit sagen, denn ich habe versprochen, sie zu sagen. Es ist meine Pflicht zu sprechen, ich will nicht Komplice sein. Meine Nächte würden gestört sein von dem Geist des Unschuldigen, der dort unten unter den furchtbarsten Qualen für ein Verbrechen büßt, das er nicht begangen hat. Für Sie Herr Präsident, schreie ich die Wahrheit in die Welt – mit der ganzen Gewalt der Empörung eines ehrlichen Mannes. Im Interesse Ihrer Ehre bin ich überzeugt, dass Sie nichts davon wissen. Vor wem soll ich den Haufen schuldiger Übeltäter anklagen, wenn nicht vor Ihnen, der ersten Autorität des Landes?«
Der Brief verursacht einen ungeahnten politischen Sturm, der Frankreich tief spaltet; die Staatsmacht zeigt sich beeindruckt. Erst reduziert man das Strafmaß von Dreyfus; dann wird er begnadigt, 1906 schließlich rehabilitiert. Zola, der berühmte Autor von »Der Totschläger« und »Der Zusammenbruch«, erlebt das nicht mehr. Er stirbt vier Jahre zuvor an einer Rauchvergiftung. Vielleicht ist es ein Unfall, vielleicht ein Mord – man weiß es bis heute nicht.
Fast ein halbes Jahrhundert später, am 16. Oktober 1953, steht Fidel Ruz Castro vor Gericht und hält seine Brandrede. Der Revolutionär und seine Männer haben eine der symbolischen Hochburgen der Batista-Diktatur, die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba, überfallen; die Mehrzahl der Angreifer starb bei dem selbstmörderischen Kommando. Ein Dutzend und der Anführer selbst kamen mit dem Leben davon, wurden aber gefasst und eingekerkert. »Es ist zu einem Rollentausch gekommen im Laufe dieser Verhandlung«, ruft Castro, der sich selbst verteidigt, vor Gericht triumphierend aus. »Die Ankläger wurden zu Angeklagten und die Angeklagten zu Anklägern! Es ist nicht entscheidend, dass hier einige aufrechte Leute verurteilt werden, entscheidend ist, dass das Volk schon morgen den Diktator und seine grausamen Schergen verurteilen wird. Kuba sollte ein Bollwerk der Freiheit und nicht ein schändliches Kettenglied des Despotismus sein! Was mich selbst betrifft, so weiß ich, dass der Kerker hart sein wird, verschärft durch Drohungen, durch gemeine und feige Wut. Ich fürchte das nicht, wie ich den Zorn des elenden Tyrannen nicht fürchte. Verurteilt mich, das hat nichts zu bedeuten. Die Geschichte wird mich freisprechen! «
Castro wird zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, im Rahmen einer Generalamnestie kommt er schon nach zwei Jahren frei und geht in den Untergrund. Am 1. Januar 1959 flieht Diktator Fulgencio Batista, die Guerilleros haben gesiegt. Aber: »La historia me absolverá«? Ob Castro, der sich schon bald zum Autokraten zu wandeln begonnen hat und viele seiner Mitstreiter verriet, von der Geschichte freigesprochen wird, bleibt offen. Vielleicht für seinen Aufstand, aber auch für seine spätere Repression? Darüber steht das endgültige Urteil noch aus.
Und nun also Michail Borissowitsch Chodorkowski. Der Ruhige. Der Nachdenkliche. Der sich die Brille putzt, bevor er spricht und so buddhistisch gelassen wirkt, als sei er ein jüngerer Bruder des Dalai Lama. Der fast schüchtern zu seinen Verwandten und Freunden hinüberwinkt, die wie an jedem Verhandlungstag in den kleinen, gerade einmal vier Dutzend Zuhörer fassenden Saal gekommen sind. Der Mann, der nicht so geschliffen formulieren kann wie Zola bei seiner Anklage und nicht so brachial argumentieren wie Castro bei seiner Abrechnung. Der eher appelliert als anklagt oder abrechnet, und immer höflich bleibt gegenüber dem »verehrten Gericht«. Der zum Zeitpunkt seines Moskauer Schlussworts schon eine lange Leidenszeit hinter sich hat: Der Chef des erfolgreichen Erdöl-Konzerns Jukos und reichste Mann Russlands hat, in einem höchst obskuren Prozess 2005 wegen schweren Betrugs verurteilt, sieben Jahre im Gefängnis abgesessen, größtenteils im sibirischen Tschita. Er überstand Messerattacken von Mithäftlingen und einen Hungerstreik. Im Oktober 2011 spätestens hätte man ihn freilassen müssen. Nun ist ein zweites Gerichtsverfahren gegen ihn angestrengt worden, diesmal wegen Unterschlagung und Geldwäsche. Es sieht nicht gut aus für seine Freiheit und eine Rückkehr in ein »normales« Leben.
Und doch hält der Angeklagte Chodorkowski am 2. November 2010 in Moskau eine Rede, die wie jene von Zola und Castro vielleicht noch in Jahrzehnten zitiert werden wird, die historisch werden könnte. Das Plädoyer steht am Beginn der in diesem Buch erstmals in deutscher Sprache vorliegenden Originaldokumente von Russlands berühmtestem Häftling. Es ist ein politisches Manifest.
Mit seinem juristischen Fall gibt sich Chodorkowski gar nicht mehr ab: »Alle, die etwas davon verstehen wollten, haben längst alles verstanden. Keiner erwartet ernsthaft ein Schuldeingeständnis von mir.« Stattdessen macht er in ebenso schlichten wie scharfen Worten klar, worum es wirklich geht: um die Hoffnung, Russland trotz aller Widerstände der Regierenden den Übergang in eine »entwickelte Zivilgesellschaft, frei von Beamtenwillkür, Korruption, Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit« zu ermöglichen und den »Menschenrechten«, die »grundsätzlich keine Geltung« hätten, Gewicht zu verschaffen. Der Sträfling sieht sich als »Patriot«. Er gibt sich, trotz seiner leisen und wenig revolutionären Töne in der Sache sehr selbstbewusst. Er weiß um die Bedeutung der Causa Chodorkowski weit über den kleinen Moskauer Gerichtssaal hinaus. »Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Millionen Augen in unserem Land und auf der ganzen Welt verfolgen den Ausgang des Prozesses.« Er endet mit einem dramatischen Appell an »Euer Ehren«, den Richter Viktor Danilkin, dem er – was für eine ungeheure Provokation in einem russischen Gericht – fast mitleidig »Mut« wünscht.
Chodorkowskis Skepsis ist augenfällig. Es ist unverkennbar, dass sich seine Worte über den Kopf des Justizbeamten hinweg an einen ganz anderen richten, von dem er annimmt, dass er sein Urteil schon gefällt hat: an den mächtigsten Mann im Land, an seinen großen Widersacher. An Ministerpräsident Wladimir Putin.
Die Anklage umfasst 3487 Seiten, das Urteil kommt mit vergleichsweise schlanken 689 Seiten aus. Die Verteidigung hat im Lauf des Prozesses Entlastungszeugen vorführen können, die alle Anklagepunkte ad absurdum führten. Der frühere Wirtschaftsminister German Gref und der Ex-Vizepremier Viktor Christenko bestätigten übereinstimmend, sie hielten es für ausgeschlossen, dass Chodorkowski gemeinsam mit seinem Mitangeklagten Platon Lebedew 350 Millionen Tonnen Öl gestohlen haben könnte. Das wäre ihnen – damals in Regierungsverantwortung – mit Sicherheit aufgefallen. Geradezu kafkaesk mutet das Verfahren an, die Vorwürfe sind nach Ansicht aller sachkundigen ausländischen Prozessbeobachter an den Haaren herbeigezogen, und auch Politiker von Angela Merkel bis Barack Obama schließen sich dieser Meinung an. Es nützt alles nichts. Am 27. Dezember 2010 verkündet der Richter den Schuldspruch, drei Tage später das Strafmaß. Es übertrifft in seiner Härte die Erwartungen der meisten Prozessbeobachter: 14 Jahre Freiheitsentzug. Das zweite Urteil hebt das erste auf; unter Berücksichtigung der noch nicht abgebüßten Reststrafe bedeutet das für Chodorkowski noch über sechs Jahre Haft. Gefasst und mit seinem üblichen ironischen Lächeln auf den Lippen akzeptiert Chodorkowski den Schuldspruch zum »Gulag light«, wie er den Strafvollzug im Putin-Reich ironisch nennt. Kommt es zu keiner Begnadigung, kann er erst 2017 seine Freiheit wiedererlangen.
Aber selbst dann wird Chodorkowski noch kein Greis sein, sondern gerade erst 54 – eigentlich im besten Alter für eine Karriere in der Politik oder Wirtschaft. Er hat in der Haft mit seinen Aufzeichnungen begonnen. Er reflektiert darin nicht nur seine eigene Vergangenheit, sondern schreibt auch auf, welchen politischen Weg seine Heimat gehen könnte; er diskutiert diese Gedanken in Briefwechseln mit einigen der interessantesten russischen Schriftsteller und Philosophen – und lässt dabei auch eigene Lernprozesse erkennen. Sie sind in diesem Buch dokumentiert mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der Autorin Ljudmila Ulitzkaja verrät er vieles über seinen Werdegang. Dem Essayisten Boris Akunin erzählt er von den Bedingungen seiner Gefangenschaft, in seinen Essays analysiert er das Justizsystem und die Chancen der Demokratisierung in seiner Heimat. Und Chodorkowski verrät auch Ambitionen. Er lässt zwischen den Zeilen der hier abgedruckten Interviews, Essays und Briefe deutlich erkennen, dass er in einem veränderten Russland durchaus auch eine wichtige Rolle für sich selbst sieht.
Vom Knast in den Kreml – ist so etwas auch nur im Ansatz denkbar? Und was genau will Chodorkowski politisch und ökonomisch, wie glaubt er es erreichen zu können? Ist er wirklich die strahlende Ikone der Freiheit, der Märtyrer, zu dem ihn seine Bewunderer machen oder doch eher ein reichlich spät geläuterter Raubtierkapitalist, womöglich zum Teil sogar zu Recht von der Staatsmacht abgestraft?
Drei Leben jedenfalls scheint dieser Mann schon geführt zu haben. Das erste, als er in den spätsowjetischen Zeiten jede Gesetzeslücke skrupellos ausnützt, zum Milliardär aufsteigt und sich als Lobbyisten Abgeordnete der Staatsduma hält; das zweite, als er sich zum modernen Konzernchef und Wohltäter seiner Belegschaft entwickelt, sich mutig, geradezu tollkühn gegen die Korruption an der Staatsspitze auflehnt; das dritte, als er sich unter schwierigen Haftbedingungen zum nachdenklichen, durch nichts und niemanden zu brechenden Idealisten entwickelt. Kann man diese drei Leben mit ihren so offensichtlichen und eklatanten Widersprüchen voneinander trennen? Den Rücksichtslosen vom Cleveren und den Cleveren dann vom Gutherzigen?
Wer ist dieser Michail Borissowitsch Chodorkowski, dämonisiert von den einen, verklärt von den anderen?
Ich habe Chodorkowski vor seinem Moskauer Prozess dreimal getroffen, in durchaus unterschiedlichen Lebensphasen.
Das erste Mal Ende 1999, als ich für eine Geschichte über Russlands Wirtschaft recherchiere. Es ist ein kurzes Kennenlerntreffen in seinem Büro.
Chodorkowski wirkt auf mich überraschend jugendlich, noch jünger als seine damaligen 36 Jahre, begeisterungsfähig, hemdsärmelig, gelegentlich ein wenig ruppig – eine Mischung aus Musterschüler und Rabauke, schon damals Unvereinbares miteinander vereinend. Und so, als könne er selbst seinen steilen Aufstieg noch gar nicht fassen, als sei er in ein Märchen geraten und müsse sich in den Arm zwicken, um sich zu vergegenwärtigen, dass er nicht träumte. Einer, der um die Zeitenwende weiß. »Ich bin Mitglied der letzten Generation von Sowjetmenschen, von denen, die im Zeichen der UdSSR geboren und sozialisiert wurden«, sagt er nachdenklich. »Ich war Mitte zwanzig, als die Sowjetunion unterging, schon mein ältester Sohn kennt diese Zeiten nur mehr von Geschichten, die wir ihm erzählen, von Eindrücken, die wir ihm vermitteln.« Wir unterhalten uns dann über die gerade überstandene Rubel-Krise, die Chancen der Erdölförderung in Sibirien und das »Corporate Governance«, das er seinen Worten nach bei seinem Jukos-Konzern eingeführt hat. »Der Westen wird meine Firma bald beneiden«, sagt er zum Abschied. Und im Hinausgehen gibt er noch eine Empfehlung: »Kaufen Sie Jukos-Aktien. Glauben Sie mir, es wird sich für Sie auszahlen.«
Das zweite Mal im Frühsommer 2002, als ich für den »Spiegel« ein Porträt über den »reichsten Mann Russlands« vorbereite. Wir sehen uns im Moskauer Jukos-Büro, einem Raum, an dessen Wänden nun neben einer Russlandkarte mit den markierten Standorten der Erdöl- und Erdgas-Anlagen des Konzerns auch moderne Kunstwerke hängen und der mit einer Ledergarnitur, Glastischen und Mahagoni-Tisch erkennbar auf internationale Repräsentation getrimmt worden ist.
Was haben sie ihm nicht damals schon alles nachgesagt, seine geschäftlichen Konkurrenten, seine kommunistischen Feinde und natürlich »diese Giftzwerge von der Journaille«, die er ganz selten nah an sich heranlässt: Er sei ein Mafia-Typ, ein Rohstoffdieb im großen Stil, ein Ausbeuter seines Volkes. Mehrere tausend Fundstellen mit Informationen zu seinem Namen gebe es im Internet, sagt Russlands vielleicht mächtigster Wirtschaftsboss. Fast alles Schund, seiner Meinung nach.
Bleibt die Frage, wie der Tycoon seine Unternehmerrolle in der postkommunistischen Wirtschaft selbst sieht? Chodorkowski, im ganzen Land nur MBC genannt, stößt einen tiefen Seufzer aus. Er hebt die Hände wie zum Schutz, ganz Unschuldslamm im Raubtiergehege – und überrascht mit einem Geständnis. »Hier herrschte in den Übergangszeiten nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems das Gesetz des Dschungels. Keiner wusste genau, welche Vorschriften noch galten – ich nutzte das aus, so wie andere Unternehmungslustige auch.«
Er gönnt sich eine kleine Verschnaufpause in Sachen Ehrlichkeit. Zögert, nimmt einen Schluck Mineralwasser. »Waren wir deshalb Räuberbarone? Vielleicht. In dem Sinne, wie die großen amerikanischen Firmengründer Ende des 19. Jahrhunderts Robber Barons waren.« Der Russe nennt die Rockefellers als sein Vorbild, allen voran John D., den Selfmademan und Gründervater der Ölindustrie. »Er war am Anfang seiner Karriere nicht der absolute Saubermann. Sein Sohn galt schon als respektabler, die Generation der Enkel dann über alle Zweifel erhaben. Hundert Jahre und drei Generationen dauerte dieser Prozess vom etwas dubiosen Beginn bis zur allgemeinen gesellschaftlichen Anerkennung – als ich kürzlich in Harvard eine Rede hielt, hat mir ein Professor versichert, ich hätte dasselbe allein und in wenigen Jahren geschafft.«
Als Unternehmer im Rampenlicht muss er auch repräsentieren, so schwer ihm das fällt. Und deshalb trägt Chodorkowski nicht mehr seine geliebten speckigen Jeans und den alten Rollkragenpullover bei der Arbeit. Er hat sich durchstylen lassen: der dunkle Anzug Maßarbeit, die Krawatte von Ermenegildo Zegna, die randlose Brille Porsche-Design. MBC ist immer bereit für einen Auftritt bei CNN. Sogar das stets kontrollierte Lächeln in dem jungenhaften Gesicht wirkt wie vom Designer verordnet. Eingefroren, bei Bedarf aufzutauen.
Jedes Wort, jede Geste macht es deutlich: Die Suche nach Respekt für seine Leistung und die Respektabilität des Jukos-Konzerns sind sein Antrieb, seine Droge. Mal springt MBC auf, um an der Landkarte in seinem Büro mit einer weit ausladenden Handbewegung zu zeigen, wo die Firma überall Erdöl und Erdgas fördert. An der Wolga bei Samara etwa, aber vor allem in den sibirischen Weiten, am Flusslauf des Ob. Mal schaut er, ganz Wall-Street-Manager, in seinem elektronischen Notizbuch nach dem Börsenkurs der Unternehmenspapiere.
Jukos gilt schon damals als die Erfolgsfirma im boomenden Markt der Energie-Anbieter, als »erste Adresse der russischen Investoren« (»Frankfurter Allgemeine Zeitung«). Über 90 000 Mitarbeiter, eine Börsenkapitalisierung von 20 Milliarden Dollar und ein Nettogewinn von über 3,5 Milliarden lassen Jukos bei den Produktionszahlen zwar (noch) nicht am russischen Konkurrenten und Branchenriesen Lukoil vorbeiziehen. Aber das von Chodorkowski geleitete Privatunternehmen ist um einiges effektiver als der bürokratische Lukoil-Konzern, der immer noch zu 14 Prozent dem russischen Staat gehört.
In den Weiten unter den Frostböden liegen noch ganze Meere des schwarzen Goldes – rund ein Viertel dieser Vorkommen kontrolliert der Jukos-Chef. Und macht sich einen Spaß daraus, der Konkurrenz eins auszuwischen. »Willkommen beim Branchenführer«, steht provozierend in großen Lettern auf dem Banner vor dem Jukos-Hauptquartier in Moskaus Stadtmitte. Das graue Monsterbauwerk aus Sowjetzeiten beherbergte einst eine Waffenfirma und liegt damals gleich ums Eck vom protzigen Glaspalast des Wettbewerbers. Es ist schwer für Lukoil-Mitarbeiter, auf dem Weg zur Arbeit nicht zu Jukos aufzusehen.
MBC scheut sich nicht, von Kapitalisten zu lernen – und beste westliche Fachleute für sich arbeiten zu lassen. Im Aufsichtsrat sitzen im Jahr 2002 schon drei Franzosen, sein Büromanager ist ein Norweger, der Vizepräsident ein Amerikaner. Joe Mach heißt der Mann, ein alter Hase im Geschäft. Mach arbeitete früher für die modernste US-Firma in Sachen Erdöl-Ausrüstung und empfahl seinem russischen Chef, deren teure Bohrmaschinen und Software-Programme zu kaufen. Das Hightech-Gerät amortisiert sich. Für ein nach westlichen Regeln geführtes Unternehmen von dieser Größenordnung ist es ungewöhnlich, dass die Eigentumsverhältnisse lange verschleiert wurden. Erst Ende Juni gab Jukos bekannt, dass MBC 36,3 Prozent der Firmenaktien hält – ein Riesenpaket. Nach Berechnungen des amerikanischen Magazins »Forbes« ist Chodorkowski mit konservativ geschätzten 3,7 Milliarden Dollar Vermögen damals der reichste Russe. Ein Big Shot von Weltniveau.
MBC hat den Durchbruch in Sachen Seriosität geschafft. Er rettet mit einer Finanzspritze von 100 Millionen Dollar ein traditionsreiches Unternehmen der kapitalistischen Welt. Jukos wird beim vom Konkurs bedrohten norwegisch-britischen Anlagen- und Schiffsbaukonzern Kvaerner zweitgrößter Anteilseigner. 30 000 Arbeitsplätze scheinen durch den Einsatz aus Moskau gerettet. Einen »Zusammenbruch der Stereotypen« konstatierte daraufhin nicht ohne Stolz die russische Zeitung »Nowyje Iswestija«. Und die »Frankfurter Allgemeine« befand, Jukos habe sich »vom Schmuddelkind zum Musterknaben« gewandelt.
Verschafft ihm das Genugtuung? Was macht er, plant er mit all seinem Geld? Und wie kommt er mit dem Präsidenten Wladimir Putin zurecht, der doch Chodorkowskis Mit-Oligarchen und Co-Milliardäre Boris Beresowski und Wladimir Gussinski außer Landes gedrängt hat?
MBC wählt bei unserem Treffen im Sommer 2002 seine Worte, als hätte sich bei diesen Reiznamen die eingebaute Selbstkontrolle angeschaltet: Achtung, vermintes Terrain. Er sagt, Putin sei generell auf dem richtigen Weg. Er sehe ihn in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit anderen Wirtschaftsführern »zum Gedankenaustausch«. MBC vermeidet aber Vieraugengespräche mit dem Kreml-Chef: »Ich will keine Privilegien, zu große Nähe zum Präsidenten muss nicht hilfreich sein.« Der Platz auf der Liste der weltweit Reichsten ist für ihn »Bestätigung, dass uns der Westen anerkennt«. Aber auch Verpflichtung, wie er gleich hastig hinzufügt, immer aufs Image bedacht: Verpflichtung, anderen zu helfen. Er sieht sich als Wirtschaftsführer in einer Vorbildrolle. Deshalb fördert er mit Millionengeldern Computerprogramme für Schulen. 300 000 Kinder sollen davon profitieren.
»Jeder kann es schaffen, wenn er eine gute Ausbildung und eine Chance bekommt«, sagt Chodorkowski. Er hat sich unweit von Putins Domizil am Stadtrand eine Villa gekauft, fährt einen großen BMW und lässt seinen 17-jährigen Sohn in der Schweiz studieren, die kleineren Kinder leben bei ihm und seiner Frau. »Dafür steht mein Lebensweg in den schwierigen Zeiten des Umbruchs.« Und dann lädt er mich ein zu einem Rückblick auf sein Leben, erzählt entlang der wichtigsten Stationen.