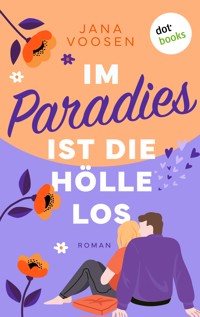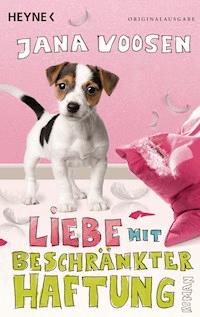8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Mädchen und der Traumprinz?
Fanny, gescheiterte Romanautorin und Dauer-Single, landet als Assistentin im Pressebüro der erfolgreichen Telenovela „Liebe à la carte” – und fühlt sich wie in eine ihrer eigenen Geschichten versetzt. Dramatische Szenen, Skandale und die ewige Frage »Wer mit wem?« beherrschen den Alltag hinter den Kulissen. Und dann ist da noch dieser Hauptdarsteller, der Fanny den Kopf verdreht. David ist einfach zu perfekt, um wahr zu ein. Und welche Rolle spielt Fanny denn nun wirklich in seinem Leben? Prinzessin? Oder Erbse?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
HEYNE <
Das Buch
Das Leben schlägt jede Seifenoper!
»Sei die Prinzessin, nicht die Erbse!«
»Wie meinst du das denn jetzt?«
»Ganz einfach. Du kennst doch das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse, oder nicht? Für einen Mann bist du entweder die Prinzessin, die er wahnsinnig gerne in seinem Bett hätte und für die er alles tun würde. Oder die Erbse, die ihm den Schlaf raubt und die er gerne los wäre. Weil sie nervt. Verstanden?«
»Nicht so ganz«, gebe ich zu.
»Sei die Prinzessin. Dräng dich nicht auf, sondern lass ihn ein bisschen zappeln. Dann wird alles gut werden. Du schaffst das schon.«
Der neue Roman der Erfolgsautorin von Allein auf Wolke Sieben: »Ein geradezu göttliches Lesevergnügen.«
Bunte
»Ein sommerlich heiterer Roman«
Freundin
Die Autorin
Jana Voosen, Jahrgang 1976, studierte Schauspiel in Hamburg und New York. Es folgten Engagements an Hamburger Theatern. Seitdem war sie in zahlreichen TV-Produktionen (Tatort, Marienhof, Hochzeitsreise zu viert u. a.) zu sehen. Jana Voosen lebt und arbeitet in Hamburg. Prinzessin oder Erbse? ist ihr siebtes Buch.
Mehr über die Autorin finden Sie im Internet unter www.janavoosen.de
Lieferbare Titel
Er liebt mich … – Zauberküsse – Mit freundlichen Küssen — Allein auf Wolke Sieben
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
»Und der diesjährige Deutsche Buchpreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels geht an ›Geborgte Stunden‹ von Stefanie May!« Tosender Applaus brandet auf, während ich mich mit wackeligen Knien erhebe und in Richtung Bühne stolpere. Jemand fasst mich am Handgelenk, wirbelt mich zu sich herum und drückt mir einen langen Kuss auf die Lippen.
»Herzlichen Glückwunsch, Fanny. Du hast es verdient«, sagt der Mann. Ich versuche, ihm in die Augen zu sehen, aber sein Gesicht ist merkwürdig verschwommen. Verwundert kneife ich die Lider zusammen. Muss der Schock sein, beschließe ich dann. Ist ja auch kein Wunder. Du meine Güte, mein Roman gewinnt einen Preis. Wo sich doch für meine ersten beiden Bücher niemand wirklich interessiert hat. Meine beste Freundin Julia sitzt in der ersten Reihe und klatscht wie verrückt in die Hände. Ich darf auf keinen Fall vergessen, sie in meiner Dankesrede zu erwähnen. Wie oft hat sie sich mein Gejammer angehört, dass niemand meine Bücher lesen will? Wie viele Teller Spaghetti hat sie für mich gekocht, wenn ich mich im Schreibrausch nicht vom Computer losreißen konnte? Ich löse mich von meinem Begleiter, streiche den Rock meines fliederfarbenen Kleides glatt, dessen fließender Schnitt meine etwas zu breiten Hüften geschickt kaschiert, und fingere aufgeregt in dem kleinen Beutel herum, der mit einem samtenen Band an meinem Handgelenk befestigt ist. Wie gut, dass ich meine Rede zu Papier gebracht habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so fühlen könnte. So losgelöst. Und so vollkommen verwirrt. Erneut werfe ich einen Blick auf den Mann, der mich eben so zärtlich geküsst hat und dessen Name mir nicht einfallen will. Vielleicht habe ich ihn ja in meiner Dankesrede erwähnt, hoffe ich und falte das kleine weiße Papier auseinander, während ich auf meinen hohen Absätzen die Treppe hinaufbalanciere. Wie in Trance nehme ich den Preis entgegen. Die applaudierende Menge verschwimmt vor meinen Augen, Männer in teuren Smokings, die Frauen in Abendkleidern aus edlen Stoffen. Und alle klatschen sie. Für mich. Mich überrollt ein Glücksgefühl, so übermächtig, dass es fast schmerzhaft ist. Schließlich verebbt der Applaus, und ich lehne mich ein wenig in Richtung des Mikrofons, das vor meiner Nase von der Decke herunterbaumelt.
»Danke«, sage ich krächzend und räuspere mich. Mit klarer Stimme fahre ich fort: »Ich danke Ihnen allen.«
»Fannyyyy!«, ruft Julia, und es sind vereinzelt Lacher zu hören.
»Juliaaaa«, rufe ich zurück und winke ihr lächelnd zu. Dann werfe ich einen Blick auf meinen Spickzettel und hole tief Luft: »Ich glaube, jeder, der selber schreibt, weiß …«
»Fannnyyyy«, erklingt es erneut aus der ersten Reihe, und ich hebe irritiert den Kopf. »Fanny, Fanny, Fanny!«
»Sie findet mich nicht lustig, das ist mein Spitzname«, erkläre ich dem Publikum.
»Fanny, Fanny!«
»Ja. Danke«, sage ich nachdrücklich. »Also, wie ich sagte, jeder, der selber …«
»Fanny, Fanny!« Jetzt beginnt Julia auch noch, mit den Fingerknöcheln auf ihrem Stuhl herumzuklopfen. Sie gebärdet sich wie eine Verrückte, und alle recken die Köpfe, um zu sehen, was sie da treibt. Fassungslos starre ich meine Freundin an, die jetzt aufsteht und sich dem Publikum in ihrem silbergrauen Seidenkleid präsentiert. Wie ein Megafon legt sie beide Hände um ihren Mund und ruft immer lauter: »Fanny, Fanny, Fanny.« Mir wird schwindelig, die Gesichter in der Menge verwandeln sich in eine wabernde, wogende Masse.
»Julia, hör auf damit«, versuche ich zu rufen, aber meine Kehle ist wie zugeschnürt. Wieso tut sie mir das an? Warum verdirbt sie mir meinen Triumph?
»Fanny, Fanny«, hallt es in meinen Ohren, und plötzlich verliere ich das Gleichgewicht und sinke zu Boden. »Fanny, du musst aufstehen«, ruft Julia mir zu.
Mit einem Ruck setze ich mich auf. Wo bin ich? Mein Blick fällt auf das goldgerahmte Engelsbild an der gegenüberliegenden Wand. Unter meinen Händen fühle ich den kühlen Satin meiner dunkelblauen Bettwäsche.
»Fanny, Fanny«, erklingt es von der anderen Seite der Tür. Es war nur ein Traum. Verdammt. Und wieder bin ich nicht dazu gekommen, meine Dankesrede zu halten.
»Ist ja gut«, rufe ich schlecht gelaunt und lasse mich in die Kissen zurücksinken. Die Türklinke wird heruntergedrückt, Sekunden später steht Julia vor meinem Bett und schaut kopfschüttelnd auf mich herunter. Sie hat den silbernen Fummel gegen einen knallengen, roten Jogginganzug getauscht, die soeben noch ihr Gesicht umspielenden, kastanienbraunen Haare zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden. Ihre braunen Augen leuchten, sie wirkt vergnügt und unheimlich fit. Wie immer.
»Willst du nicht mal aufstehen?« Sie macht Anstalten, mir die Bettdecke wegzuziehen, die ich mit den Oberschenkeln umklammere.
»Nö«, knurre ich, drehe mich auf die andere Seite und schließe die Augen. Vielleicht kann ich ja noch mal einsteigen bei der Preisverleihung.
»Wie lange hast du denn gestern Nacht noch geschrieben? «
»Du meinst wohl, heute Morgen? Bis halb sechs.«
»Donnerwetter!« Ich öffne ein Auge und sehe, wie sie neugierig auf meinen Schreibtisch zugeht und einen ehrfürchtigen Blick auf den dort liegenden Stapel beschriebenen Papiers wirft. »Sag nicht, du bist…?« Mit der ihr eigenen Grazie dreht sie sich halb um die eigene Achse und sieht mich mit leuchtenden Augen an.
»Fertig!« Mit einem Satz springt sie in mein Bett, um mich stürmisch zu umarmen. »Uff«, mache ich.
»Stell dich nicht so an! Gratuliere!«
»Ja, danke.« Sie mustert mich skeptisch.
»Na, du bist ja begeistert.«
»Ich bin müde. Wieso weckst du mich zu so nachtschlafender Zeit? Wie spät ist es eigentlich?«
»Gleich halb zehn.« Gut gelaunt beginnt sie damit, meinen Nacken zu massieren. »Du bist total verspannt«, kommentiert sie knetend, während ich irgendwo zwischen Schmerz und Wohlbehagen stöhne.
»Und warum bist du um diese Uhrzeit schon so wach und gut drauf?«
»Was heißt hier schon? Ich bin um sechs aufgestanden und habe bereits ›Yoga für Frühaufsteher‹ unterrichtet. Heute ist doch Montag.« Ach ja, stimmt. Ich werde nie begreifen, dass Menschen sich morgens um sieben zum Sport aufraffen. Auch wenn Julia immer behauptet, dass Yoga so viel mehr ist als nur Sport. »Yoga wäre genau das Richtige für dich. Das wirkt Wunder gegen diese Art von Verspannungen.« Ich grunze unwillig.
»Sport ist Mord.«
»Yoga ist so viel mehr als nur Sport«, erwidert sie, und ich grinse in mich hinein.
»Ja doch, ich weiß! Nächste Woche komme ich mal mit.«
»Wer’s glaubt«, unkt sie und beendet die Massage. Leider. »Stehst du jetzt auf?«
»Warum sollte ich?« Mein Job im Call-Center einer Bank beginnt erst um zwölf. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich häufig die Nächte durchschreibe. Ich werfe einen wehmütigen Blick auf den Papierstapel auf meinem Schreibtisch. Irgendwie ist es immer wie ein kleiner Tod, wenn man einen Roman abschließt. Ohne jetzt allzu pathetisch klingen zu wollen.
»Weil du einen Termin bei deinem Agenten hast«, antwortet Julia achselzuckend. »Oder ist der nicht heute?«
»Verdammt!« Mit einem Satz bin ich aus dem Bett und haste in Richtung Badezimmer. »Ich komme zu spät.«
»Sag ich doch«, bestätigt Julia gelassen und folgt mir, während ich bei meinem eigenen Anblick im Spiegel das dringende Bedürfnis verspüre, mich wieder unter der Bettdecke zu vergraben. Meine hellroten Locken stehen mir wie Putzwolle kreuz und quer vom Kopf ab und erinnern an ein frisch geborenes Rosettenmeerschweinchen. Mehr schlecht als recht bändige ich sie mit einer Haarspange, spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht, putze in Windeseile meine Zähne und lege dann ein notdürftiges Make-up auf.
»Ich finde ja immer noch, du solltest mal braune Wimperntusche ausprobieren. Bei so hellen Augen ist schwarz einfach zu dominant«, fachsimpelt Julia. Als hätte ich keine anderen Sorgen.
»Können wir darüber sprechen, wenn ich nicht gerade einen Termin mit meinem Agenten verpasse, der sowieso nicht allzu gut auf mich zu sprechen ist?«
»Natürlich.« Ich werfe einen abschätzenden Blick in den Spiegel. Das muss reichen, für mehr ist keine Zeit. Julia folgt mir zurück in mein Zimmer, wo ich mich in Jeans, hochhackige Stiefel und einen olivgrünen Pullover mit V-Ausschnitt werfe. »Ich finde, dein Agent hat allen Grund, stolz auf dich zu sein«, meint sie und nimmt mein Manuskript in beide Hände. »Du bist fleißig, fantasievoll und stellst kaum Ansprüche. Was kann man sich mehr wünschen von einer Autorin?« Ich sehe sie mit einer Mischung aus Rührung und Verständnislosigkeit an.
»Wie sollte man auch Ansprüche stellen, wenn keiner lesen will, was man schreibt?«, erkundige ich mich, bemüht, nicht allzu bitter zu klingen.
»Ich will es lesen!« Sie strahlt mich an.
»Lieb von dir.« Ich nehme ihr den Stapel aus der Hand. »Aber jetzt nehme ich es erstmal mit zu Herrn Krause.«
»Darf ich’s mir ausdrucken?« Ich zucke mit den Schultern, obwohl mir ihr Interesse natürlich schmeichelt.
»Klar. Wenn noch genug Tinte im Drucker ist.« Im Hinausgehen nehme ich meine Jacke von der Garderobe.
»Vielleicht wird das der Durchbruch. Qualität wird sich durchsetzen!«, ruft sie mir hinterher, aber da werfe ich die Tür unserer Drei-Zimmer-Altbauwohnung schon mit Schwung hinter mir zu. Ich renne die drei Stockwerke im Eilschritt hinunter und hinaus auf die Straße, wo ich vor Kälte erschaudere. In den letzten Tagen war es schon recht mild für Ende Februar, doch über Nacht scheint noch einmal der Winter über uns hereingebrochen zu sein. Schneeflocken fallen vom Himmel, und ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke bis unters Kinn hinauf. Suchend sehe ich die Marktstraße hinunter, die mitten im Hamburger Karoviertel liegt und von gemütlichen Cafés, schrammeligen Kneipen und witzigen Klamottengeschäften gesäumt ist. Wo habe ich geparkt? Alle Autos sind mit einer dünnen Puderzuckerschicht bedeckt, was die Sache nicht einfacher macht. Bevor ich erneut in Panik verfallen kann, entdecke ich meinen uralten, rostroten Fiat Punto schräg gegenüber. »Viel Rost, wenig Rot«, wie Julia immer so schön sagt. Aber Hauptsache, er fährt.
Während ich mich durch den Hamburger Verkehr kämpfe, der durch den plötzlichen Wintereinbruch noch zäher fließt als sonst, wandern meine Gedanken zurück zu dem Traum von heute Nacht. Der Deutsche Buchpreis. Ja, das wär’s! Aber eigentlich würde es mir schon genügen, wenn sich wenigstens eine einigermaßen ansehnliche Leserschaft für meine Romane begeistern könnte. Mehr als für die ersten beiden, die zwar veröffentlicht, aber leider kaum verkauft wurden. Mit einem tiefen Seufzer sehe ich auf das dicke Manuskript auf dem Beifahrersitz. Die Geschichte einer Ehefrau und Mutter, deren krebskranke erste Liebe plötzlich auftaucht und ihre heile Welt ins Wanken bringt. Über ein Jahr lang habe ich in jeder freien Minute daran geschrieben, neben meinem öden und unterbezahlten Job im Call-Center. Ich versuche, möglichst nicht darüber nachzudenken, warum ich mit Anfang dreißig noch immer von einem Aushilfsjob leben muss. Das hatte ich mir nach Abschluss meines Studiums der Germanistik zugegebenermaßen etwas anders vorgestellt. Aber eigentlich ist es schon so etwas wie ein Ritterschlag, wenn man als Autor überhaupt einen Verleger findet und sogar ein paar Euro verdient. Wenn auch in meinem Fall nicht genug, um davon leben zu können. Mein Agent hat mir ja schon mehrere Male durch die Blume gesagt, dass sich »fröhlichere Bücher« besser verkaufen würden als die schwermütigen, melancholischen Geschichten, die ich schreibe. Wieder fällt mein Blick auf das Deckblatt mit dem Titel »Geborgte Stunden«. Auch nicht gerade leichte Kost. Und wieder kein Happy End. Aber das Leben ist schließlich auch nicht immer leicht. Außerdem ist mir die Idee zu dieser Geschichte, genau wie bei meinen vorigen Romanen, einfach irgendwann zugeflogen. Wie genau das passiert, ist mir immer noch nicht ganz klar, aber so funktioniert es nun einmal. Und es sind immer die schwierigen, traurigen Aspekte des Lebens, über die ich schreibe. Das muss doch schließlich auch irgendwer tun, oder nicht? Und vielleicht hat Julia Recht, denke ich hoffnungsvoll. Vielleicht wird das der Durchbruch.
»Ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie, Frau May«, sagt mein Literaturagent, als ich ihm eine Viertelstunde später, abgehetzt und außer Atem, in seinem geräumigen Büro gegenübersitze. Entsetzt sehe ich ihn an. Norbert Krause hatte nämlich noch nie gute Nachrichten für mich, mal abgesehen von den zwei Anrufen vor mittlerweile einem und drei Jahren, in denen er mir berichten konnte, einen Verlag für mich gefunden zu haben. Danach kam nur noch eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Wie die Romane von einem Programm ins nächste geschoben wurden, das Werbebudget drastisch gekürzt, statt der versprochenen Doppelseite im Katalog gab es plötzlich nur noch eine halbe, und von den Verkaufszahlen möchte ich gar nicht anfangen. Aber nie hat Herr Krause es für nötig gehalten, schlechte Nachrichten anzukündigen.
»Ja …«, krächze ich, um Haltung bemüht. Er räuspert sich ausgiebig.
»Hrrm, hrrm.« Los doch, raus damit, möchte ich am liebsten schreien. Stattdessen umklammere ich mit den Händen das Manuskript auf meinem Schoß und bemühe mich, das flaue Gefühl in der Magengegend zu ignorieren. »Nun, die Abrechnungen sind gekommen, und, ähm, also …«
»Und?« Ich wage nicht einmal zu atmen. »Sagen Sie es einfach«, fordere ich ihn auf und versuche, meiner Stimme einen gefassten Tonfall zu verleihen. Es kann nicht schlimmer werden als beim ersten Gespräch dieser Art vor eineinhalb Jahren. Als ich noch daran glaubte, mit meinem Weltkriegsdrama »Im Wandel der Zeiten« möglicherweise einen Bestseller geschrieben zu haben. Die Zahl 2873 traf mich damals wie ein Schlag in die Magengrube. Mein Baby, mein Augapfel, mein erster Roman, in den ich so viel Arbeit und Herzblut gesteckt hatte, war bei den Lesern durchgefallen. Und zwar gründlich. Danach war ich eine Woche nicht aus meinem Bett aufgestanden. Schließlich habe ich mich doch aufgerafft. Und an meinen Schreibtisch geschleppt. Einen neuen Roman angefangen, eine moderne, weibliche Version der »Leiden des jungen Werther« über ein junges Fotomodell, das an seiner Hypersensibilität zerbricht. »Kalte Welt« erschien vor sechs Monaten. Und die Verkaufszahlen sind anscheinend so unterirdisch, dass Norbert Krause, seit zwanzig Jahren Literaturagent und mit allen Wassern gewaschen, jetzt nicht damit herausrücken will. »Nun sagen Sie schon.« Es klingt wie ein Jaulen. Er räuspert sich erneut und fährt sich mit der Hand über die schweißnasse Stirnglatze. »Machen Sie einfach den Mund auf und sagen Sie die Zahl«, spreche ich ihm Mut zu, obwohl das doch eigentlich sein Job wäre. »Ohne darüber nachzudenken, sprechen Sie es ein…«
»1508«, unterbricht er mich und mein Herz setzt für einen Moment aus. Habe ich das richtig verstanden? 1508 Bücher? Das ist nichts. Weniger als nichts. Und was am schlimmsten ist: Es ist weniger, als ich in meinen allerschlimmsten Alpträumen erwartet habe.
»Sehen Sie«, ich wundere mich selbst über die Gelassenheit in meiner Stimme, »das war doch gar nicht so schwer.«
»Nein«, kommt es dumpf zurück. Dann schweigen wir beide. Ich fühle mich wie betäubt. Müsste ich nicht irgendwie reagieren? Mein Roman ist ein Flop. Und zwar ein noch größerer Flop als der erste, was wahrscheinlich niemand für möglich gehalten hätte, auch nicht der Verlag, der mir trotz miesester Verkaufszahlen noch eine Chance gegeben hat. Die ich, wie es aussieht, gründlich vermasselt habe. Was wäre eine angemessene Reaktion auf die Zahl 1508? Doch wohl mindestens ein Tränenausbruch, oder? Stattdessen: Nichts. Nur Leere. »Das ist leider noch nicht alles.«
»Was denn noch?« Es geht noch schlimmer?
»Wegen der niedrigen Absatzzahlen wird ›Im Wandel der Zeiten‹ verramscht.« Das Wort jagt mir einen eisigen Schauer über den Rücken. So sieht also das Ende meines Werkes aus, verschleudert für ein paar Euro auf dem Grabbeltisch. Ich nicke langsam. »Geht es Ihnen gut, Frau May?« Ich zwinge mich zu einem humorlosen Grinsen.
»Gut wäre nicht das Wort meiner Wahl, aber ich werde nicht zusammenklappen, falls Sie das meinen.«
»Ah, ja, gut.«
»Allerdings könnte es durchaus sein, dass ich gleich auf Ihren teuren Teppich breche«, gebe ich zu bedenken, worauf er erschrocken aufspringt und mir hilfreich seinen braunen Plastikpapierkorb über die Schreibtischplatte hinweg anbietet.
»Danke, es geht schon«, lehne ich höflich ab. Das fehlte gerade noch. Wir schweigen einander an, die Stille nur hin und wieder unterbrochen von Herrn Krauses Geräusper, das mich langsam wahnsinnig zu machen beginnt. »Das sind in der Tat keine besonders guten Neuigkeiten. « Ich ringe mir so etwas wie einen kleinen Lacher ab, der aber gründlich misslingt. Mir gegenüber ohrenbetäubendes Schweigen. Dann wieder ein Räuspern.
»Hrmmm, hrmm.« Ich wünschte, er würde damit aufhören. Schon beim Zuhören tun mir die Stimmbänder weh. Außerdem wünschte ich, er würde etwas sagen. Irgendetwas.
»Nun, wir müssen nach vorne sehen, nicht wahr?«, versuche ich, mich optimistisch zu geben. »Ich habe gestern Nacht mein neues Manuskript fertiggestellt«, erkläre ich mit allem Selbstbewusstsein, das ich zusammenkratzen kann, »und ich habe es Ihnen mitgebracht.« Damit hebe ich den Papierstapel von meinem Schoß und präsentiere ihn mit einem verheißungsvollen Nicken.
»Soso.« Nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte.
»Wollen Sie es lesen?«, frage ich nach einer Pause.
»Hrrrmm, hrrmm.«
»Sie sollten es mal mit Ingweraufguss probieren«, sage ich so freundlich, wie meine bis zum Zerreißen gespannten Nerven es zulassen. »Ingweraufguss. Gegen Ihr Räuspern.«
»Ach so, danke. Hhhrrrrrrm.«
»Also, wollen Sie?«
»Was?«
»Mein Manuskript lesen«, wiederhole ich verzweifelt.
»Wissen Sie …« Seine Stimme klingt mitleidig.
»Ich bin sicher, es wird Ihnen gefallen«, falle ich ihm ins Wort, und er seufzt.
»Es kommt leider gar nicht darauf an, ob es mir gefällt. «
»Wie meinen Sie das?«, stelle ich mich dumm, obwohl ich ganz genau weiß, was er meint. Noch bevor er es ausspricht, weiß ich, dass meine Autorenkarriere beendet ist.
»Ich werde keinen neuen Verlag für Sie finden können«, sagt er bedauernd, »nicht mit diesen Verkaufszahlen. Selbst wenn Ihr Manuskript das Zeug zum nächsten Twilight-Roman hätte.«
»Was es Ihrer Meinung nach nicht hat«, erwidere ich steif und zutiefst beleidigt.
»Frau May …« Mein Gegenüber hört gar nicht mehr damit auf, den Kopf zu schütteln.
»Ja, schon gut«, lenke ich ein und suche verzweifelt nach einem Ausweg. »Wie wäre es, wenn man es unter Pseudonym veröffentlicht? Oder es zumindest so beim Verlag anbietet?«
»Frau May«, werde ich rüde unterbrochen, »sind Sie vielleicht schon mal auf den Gedanken gekommen, dass Verkaufszahlen irgendetwas aussagen könnten? Ganz offensichtlich gibt es für Ihre Romane keine Leserschaft. «
Eine halbe Stunde später öffne ich die Tür zu unserer Wohnung und blicke mich einen Moment verwirrt um. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich hierhergekommen bin.
»Julia«, rufe ich leise, aber sie antwortet nicht. Ein stechender Schmerz fährt durch meine rechte Schulter, und ich bemerke, dass ich mein Manuskript noch immer mit aller Kraft an mich presse. Habe ich es zum Autofahren überhaupt aus der Hand gelegt? War ich wenigstens angeschnallt? Kurz verdrängt die Erkenntnis, dass ich es wohl nur durch ein Wunder unfallfrei zurück nach Hause geschafft habe, die Erinnerung an den unerfreulichen Besuch bei meinem Agenten. Oder, um es korrekt zu sagen, meinem Ex-Agenten. Langsam stolpere ich in mein Zimmer und versuche, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich ab heute eine andere bin. Stefanie May, Nicht-mehr-Romanautorin. Was bleibt von mir übrig, ohne meinen Traum? Ohne meine Geschichten, meine imaginären Freunde? Eine Frau Anfang dreißig, mit feuerroten Locken, hellgrünen Augen, im Gesicht eine Million Sommersprossen. Eine schlanke Figur, wenn man von dem Brauereipferdearsch einmal absieht. Mein Hintern hat mich nie sonderlich gestört, schließlich saß ich sowieso meistens darauf. Wenn man tage- und nächtelang vor dem Computer sitzt, dann braucht man Sitzfleisch. Aber das ist nun vorbei. Gedankenverloren lasse ich meinen Blick umherschweifen. Seit zehn Jahren wohnen Julia und ich schon hier, und seit wir eingezogen sind, hat sich in meinem Zimmer nicht viel verändert, außer dass ich alle drei Jahre die freie Wand der Tür gegenüber in einer anderen Farbe gestrichen habe. Im Moment ist sie knallrot. An der linken Wand lehnt ein aus alten Obstkisten gezimmertes Regal, das mit Büchern und CDs vollgestopft ist, neben einer kleinen, roten Couch, ausgebleicht und verschlissen, aber urgemütlich, daneben das Bett, das nur aus einem Lattenrost und der darauf liegenden Matratze besteht. Rechts gegenüber und direkt unter dem großen Fenster steht mein Heiligtum – der Schreibtisch. Davor der sündhaft teure rückenfreundliche Sessel, darauf mein geliebter Computer mit der ergonomischen Tastatur, der Drucker, mit dem ich gestern Nacht »Geborgte Stunden« ausgedruckt habe. Meinen dritten und letzten Roman. Gedankenverloren starre ich auf den Ort meines Schaffens. Wie viele Stunden meines Lebens habe ich dort verbracht? Glückliche Stunden. Nutzlose Stunden. Die vierhundertsiebenundzwanzig Blatt Papier in meinen Händen fühlen sich plötzlich schwer an, als hätte ich die Buchstaben in Steinplatten gemeißelt. Ich sehe darauf herab und drehe mich kurz entschlossen auf dem Absatz um.
»Fanny, was ist passiert?« Vor meinen Augen tanzen tausend Lichter, und als ich in die Richtung blicke, aus der ich Julias Stimme höre, sehe ich sie durch einen Schleier dichten, schwarzen Qualms. »Geht es dir gut?« Sie rennt an mir vorbei und reißt das Küchenfenster auf. Der Rauch sucht sich seinen Weg nach draußen, die Sicht wird klarer.
»Au!« Überrascht sehe ich auf meine Hand hinunter und lasse das brennende Stück Papier darin in den großen Spaghettitopf fallen, in dem ein schönes Feuer lodert. Mit schmerzverzerrtem Gesicht reibe ich über die gerötete Haut, greife dann aber zum nächsten Blatt, um es den Flammen zu übergeben.
»Sag mal, bist du vollkommen übergeschnappt? Was machst du da? Willst du unsere ganze Bude abfackeln? Bist du noch ganz dicht? Moment mal, ist das etwa …?« Fassungslos schaut sie auf den Herd. Ich nicke düster. »Mein Spaghettitopf. Mein schöner Topf!« Reflexartig greift sie nach dem Henkel und zieht mit einem Aufschrei die Hand zurück. »Au, verdammt!«
»Vorsicht, heiß.« Mit einem grimmigen Lächeln entzünde ich Seite 78 meines Manuskripts. Noch liegt ein langer Weg vor mir, bis ich meine Vergangenheit gelöscht habe und ein neues Leben anfangen kann.
»Ist dir klar, dass unsere Küchenmöbel aus Holz sind?« Wütend entreißt Julia mir das brennende Papier und wirft es in den Topf, der mittlerweile schon ein wenig zu glühen begonnen hat.
Bevor ich wieder nach dem Stapel greifen kann, stürzt sie sich auf mich und ringt mich zu Boden. Ich bin dermaßen perplex, dass ich mich erst zu wehren beginne, als ich schon bäuchlings unter ihr liege und sie mir den linken Arm auf den Rücken gedreht hat. »Lass das«, keuche ich, ohne mich mehr als zehn Zentimeter in die eine oder andere Richtung bewegen zu können.
»Du beruhigst dich jetzt«, sagt sie nachdrücklich, ohne ihren Polizeigriff zu lösen.
»Lass mich los.« Ich sammele alle meine Kräfte und bäume mich auf, aber es ist deutlich zu erkennen, wer von uns beiden die letzten Jahre im Yogastudio verbracht hat. Ich habe nicht die geringste Chance gegen meine zierliche Mitbewohnerin. Während ich meine lächerlichen Versuche unternehme, sie abzuschütteln, ruht ihr Blick besorgt auf dem Spaghettitopf, aus dem mittlerweile etwas weniger Rauch quillt. Meine Muskeln erlahmen, ich lasse mich schwer auf den Boden zurücksinken und dann spüre ich Julias Hand an meiner Wange.
»Was ist denn bloß passiert?«, fragt sie leise, und ich breche in Tränen aus.
Nachdem das Feuer gelöscht und meine Tränen versiegt sind, sitze ich mit einer Tasse Yogi-Tee an unserem runden Küchentisch und starre düster vor mich hin, während Julia an ihrem Spaghettitopf herumscheuert.
»Also, ich glaube, der ist hin.«
»Tut mir leid!« Schuldbewusst sehe ich zu ihr auf.
»Ach, schon gut, den konnte ich sowieso nie leiden«, lügt sie und stellt ihn mit einem Seufzer neben unseren roten Küchenabfalleimer. Dann sieht sie besorgt auf die rauchgeschwärzte Wand über dem Herd. »Ich glaube, ich weiß schon, was wir nächstes Wochenende machen.«
»Was heißt hier, wir? Ich streiche die Küche. Das wäre ja noch schöner. Reicht ja schon, dass ich beinahe die Wohnung abgefackelt hätte.«
»Soll ich im Call-Center Bescheid sagen, dass du heute nicht kommst?« Ich schüttele den Kopf.
»Nein, danke. Ich rufe selber an und sage, dass ich gar nicht mehr komme. Ich bin keine Schriftstellerin mehr«, erkläre ich auf ihren verständnislosen Blick hin, »also muss ich auch keinen dämlichen Nebenjob mehr machen. «
»Du willst aufhören? Nur weil dein Agent ein Idiot ist?«
»Nein, nicht weil mein Agent ein Idiot ist, sondern weil niemand lesen möchte, was ich schreibe. Außer dir«, füge ich schnell hinzu, bevor sie den Mund öffnen kann. »Und meinen Eltern«, ergänze ich noch mit einem humorlosen Grinsen.
»Du kannst doch nicht einfach aufgeben.«
»Ich gebe nicht auf. Ich denke um«, sage ich knapp. »Ich suche mir einen richtigen Job und höre endlich auf, mir einzubilden, dass ich Talent hätte.«
»Du hast Talent.«
»Mach es mir nicht noch schwerer, bitte.«
»Na gut. Wie kann ich dir helfen? Soll ich das hier mit zum Altpapiercontainer nehmen? Die nächste Yogaklasse fängt gleich an.« Sie steht vom Tisch auf und greift nach meinem Manuskript, das noch immer, um die ersten achtundsiebzig Seiten ärmer, auf der Arbeitsfläche neben dem Herd liegt.
»Du willst es bloß lesen.« Ich springe auf, bereit, mich auf einen weiteren, hoffnungslosen Zweikampf einzulassen.
»Ich hab’s mir doch sowieso … Nein, ich verspreche dir, es wegzuwerfen«, antwortet sie, doch ich schüttele den Kopf.
»Das mache ich selbst.«
»Okay.« Sie drückt mir den Stapel in die Hand. »Ich muss los. Kann ich dich alleine lassen?« Ich nicke. »Machst du keine Dummheiten?« Ich schüttele den Kopf. »Okay«, sagt sie zweifelnd und drückt mir einen Kuss auf die Wange. »Weißt du, es ist schade um den Spaghettitopf, und es wäre auch echt blöd gewesen, wenn die Wohnung abgebrannt wäre, aber …«
»Ja?« Ihre braunen Augen schwimmen plötzlich in Tränen.
»Ich weiß nicht, ob ich es überlebt hätte, wenn du dich bei dieser Aktion selber abgefackelt hättest.« Sie schlingt ihren Arm um meinen Hals und drückt mich fest an sich.
»Ich hab dich auch lieb«, sage ich.
Mein Manuskript landet im Altpapier und alles, was ich jemals auf meinem Computer geschrieben habe, mit einem Klick im Papierkorb. »Möchten Sie diesen Ordner in den Papierkorb verschieben?« Ich atme tief durch und klicke auf JA. »Möchten Sie die Elemente im Papierkorb unwiderruflich löschen?« JA. Ich warte auf den Aufschrei in meinem Inneren, aber alles bleibt still. Ich fühle gar nichts. So leicht ist es also, sein bisheriges Leben auszuradieren und ein neues zu beginnen. Ich bin ein weißes Papier, ein unbeschriebenes Blatt. Bei diesem Gedanken erfasst mich dann doch so etwas wie Trauer, und ich suche nach einem Vergleich, der mich nicht schmerzhaft an das Leben erinnert, das ich vergessen möchte. Gerade noch rechtzeitig fällt mir ein, dass die Suche nach Worten nicht mehr zu mir gehört. Seit heute nicht mehr. Seufzend stehe ich von meinem Schreibtisch auf. Das Leben in Worte zu fassen, das ist meine Vergangenheit. Es zu leben, soll meine Zukunft sein.
Der Traumprinz und das Mädchen
Ein Rezept zum Verlieben
Wer hätte das gedacht? Ein von vielen schon totgesagtes Fernsehformat erhält neuen Aufschwung.
Die Telenovela »Liebe à la carte« bricht alle Rekorde. Mit fünf Millionen Zuschauern täglich hat die Serie sogar den Dauer-Quotenrenner »Schöne Tage, schlechte Tage« vom Thron gestürzt und wurde zudem gerade als beste tägliche Serie für die Goldene Rose nominiert. Was hat diese moderne Version des Aschenputtelmärchens, das anderen in der Vergangenheit fehlte und sie kläglich scheitern ließ (siehe zum Beispiel: »Spatzen auf dem Dach«)? An der Originalität der Story – tollpatschige Kellnerin verliebt sich in Starkoch und Restaurantbesitzer – kann es nicht liegen. Wohl eher an der erfrischend selbstironischen Inszenierung gepaart mit witzigen Dialogen und einer exzellenten Besetzung. Neben der beliebten Seriendarstellerin Nadja Reichert brilliert der bisher völlig unbekannte David Mory, der auf der Bühne des Stadttheaters Bruchsal entdeckt und vom Fleck weg für die Rolle engagiert wurde. Sein unvergleichlicher Charme gepaart mit den grünsten Augen des deutschen Showbiz allein ist ein Grund, um 18.15 Uhr den Fernseher einzuschalten. Und Nadja Reichert, bisher gerne als die schöne Unnahbare besetzt, überrascht in der Rolle der Lara durch eine ans Herz gehende Natürlichkeit und Naivität, die sie trotz ihrer atemberaubenden Ausstrahlung zu einer Identifikationsfigur für die weiblichen Fans werden lässt.
Kapitel 2
Mir ist alles andere als wohl in meiner Haut, als ich am nächsten Vormittag die Telefonnummer meiner Eltern wähle. Besonders mein Vater hat immer an meinen großen Durchbruch als Autorin geglaubt. Und ich kann erst dann wirklich loslassen, wenn ich auch diese Seifenblase habe platzen lassen. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm werden. Während ich inbrünstig bete, dass meine Mutter ans Telefon geht, meldet sich eine sonore Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Papa, hallo, ich bin es«, seufze ich. Auch das noch.
»Fanny, wie geht’s?«
»Ach, ganz gut eigentlich.«
»Raus damit, wo drückt der Schuh?« Er kennt mich einfach zu gut. Also rücke ich damit heraus, ohne lange um den heißen Brei herumzureden.
»Papa, bist du noch da?«, frage ich vorsichtig in den Hörer, nachdem ich geendet habe.
»Fanny, meinst du nicht, dass du das überstürzt?«
»1508 verkaufte Bücher. Hast du mir nicht zugehört? «
»Doch, doch, schon. Aber manchmal braucht Qualität eben Zeit, um sich durchzusetzen.« Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. »Soviel ich weiß, hat Franz Kafka erst nach seinem Tod wahre Anerkennung für seine Werke erhalten.«
»Papa«, sage ich vorwurfsvoll.
»Ja, nun, das ist vielleicht auch nicht wünschenswert.«
»So lange kann ich wirklich nicht warten.«
»Wenn du Geld brauchst …«
»Danke, aber darum geht es nicht.«
»Na dann.« Ich kann seinen enttäuschten Gesichtsausdruck förmlich vor mir sehen.
»Was ist denn los? Du machst ja ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter«, erklingt die Stimme meiner Mutter im Hintergrund. »Wer ist denn dran?«
»Es ist Fanny«, antwortet mein Vater mit Grabesstimme. »Sie will nicht mehr schreiben.« Er tut gerade so, als würde die Welt untergehen. Dabei wird sie doch nur von einer weiteren untalentierten Möchtegern-Schriftstellerin befreit, denke ich sarkastisch. Julia würde mir jetzt wieder eine Standpauke halten, weil ich zu viele negative Gedanken hege und damit ungewollte Bestellungen an das Universum herausschicke. »Mit deinen Gedanken erschaffst du dein Leben. Jeden Tag. Also bemühe dich, das Richtige zu denken.« Als ich allerdings noch dachte, meine Romane würden Bestseller werden, hat das meine Verkaufszahlen schließlich auch nicht positiv beeinflusst. Ein spitzer Aufschrei meiner Mutter reißt mich aus meinen Gedanken.
»Gib her, Karl-Heinz. Schätzchen, bist du endlich schwanger?« Wie kommt sie denn auf diese Idee?
»Nein.« Woher auch?
»Aber warum willst du denn dann aufhören zu arbeiten? «
»Ich will nicht aufhören zu arbeiten. Ich werde nur keine Romane mehr schreiben«, korrigiere ich sie.
»Und du bist nicht schwanger? Ganz sicher nicht?«
»Mama, ich habe doch seit drei Jahren keinen Freund mehr gehabt«, seufze ich.
»Ja, eben«, kommt es vorwurfsvoll zurück. »Meinst du nicht, dass es langsam mal Zeit wird? Dein Bindegewebe wird schließlich mit den Jahren auch nicht straffer.«
»Ute!«, ruft mein Vater empört.
»Ich meine das ja nicht böse«, gibt sie zurück, »aber es stimmt doch. Schließlich hat sie auch fünfzig Prozent von deinen Genen mitbekommen und hast du dir mal die Oberschenkel deiner Schwester angeschaut? Ich möchte nur nicht, dass meine Tochter mit Ende dreißig plötzlich dasitzt, mit nur noch einer Handvoll befruchtungsfähiger Eier und ohne Mann.«
»Gören kann jeder Hans und Franz produzieren. Aber meine Tochter könnte Literaturgeschichte schreiben«, gibt mein Vater zurück.
»Was ist denn mit dem Sohn von Meyers von gegenüber? Ihr habt euch doch als Kinder so gut verstanden. Wäre der denn nichts für dich?«, wendet sich meine Mutter wieder an mich.
»Er ist schwul«, erkläre ich ihr zum etwa zwanzigsten Mal, und wie jedes Mal seufzt sie:
»Ach ja, richtig. Das hatte ich vergessen.«
»Sie findet schon den Richtigen, wenn es sein soll«, ruft mein Vater im Hintergrund.
»Genau. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich fühle mich noch ziemlich fruchtbar.« Gerade will ich ihr erzählen, dass die Mutter von Sarah Connor mit fünfzig Jahren Zwillinge bekommen hat, beschließe dann aber, dass diese Geschichte ähnlich hinkt wie das Kafka-Argument meines Vaters.
»Das ist gut. Und was willst du jetzt machen?«
»Ich fahre morgen zum Arbeitsamt. Immerhin habe ich ein abgeschlossenes Studium.«
»Sehr schön. Dann sitzt du auch nicht immer nur alleine zu Hause herum. Vielleicht bekommst du einen Job in einem schönen großen Unternehmen.«
»Jetzt hör aber auf, Ute«, wirft mein Vater ein.
»Wieso? Ich habe doch gar nichts gesagt.«
»Ich weiß, Mama, Hochzeitsbörse Arbeitsplatz«, gehe ich dazwischen.
»Das meinte ich wirklich nicht«, beteuert sie.
»Schon gut. Wer weiß, vielleicht lerne ich ja wirklich jemanden kennen«, sage ich friedfertig und kann förmlich spüren, wie sie über das ganze Gesicht zu strahlen beginnt.
»Das wäre so schön. Fanny, wir wollen doch nur, dass du glücklich bist.«
»Ich weiß, Mama.«
»Ja, doch, ich gebe sie dir ja … Darf ich mich wohl noch… Also wirklich, Karl-Heinz. Schätzchen, dein Vater möchte dich noch mal sprechen.«
»Fanny, was ich dir erzählen wollte, gerade letzte Woche hat die Frau Breuer von nebenan dein Buch gekauft. Und sie war ganz begeistert davon.«
»Das freut mich.«
»Wirklich, sie fand es richtig toll. Und sie hat gefragt, wann sie dein nächstes Buch kaufen kann.«
»Karl-Heinz, jetzt hör endlich auf.«
»Schon gut, schon gut«, sagt mein Vater hastig. »Ich wollte dir ja nur sagen, dass du Fans hast.«
»Danke, Papa«, sage ich gerührt.
»Und ich freue mich auch immer, etwas von dir zu lesen.« Gedankenversunken starre ich vor mich hin, nachdem wir das Gespräch beendet haben. Bestens. Meine Mutter möchte Enkelkinder von mir, und mein Vater den Literaturnobelpreis. Und von beidem bin ich meiner Einschätzung nach etwa gleich weit entfernt.
Am nächsten Tag ist meine trübe Stimmung erstmal verflogen, denn direkt im Anschluss an meinen Besuch beim Arbeitsamt habe ich ein Vorstellungsgespräch für einen wirklich interessant klingenden Job. Ich dachte zuerst, diese Frau Schulze will mich verulken. Wer bekommt schon einen Job beim Fernsehen über das Arbeitsamt? Jedenfalls befinde ich mich auf dem Weg zu den Scarlett-Studios am Rande von Hamburg, um mich dort als Presseassistentin für die vor fünf Monaten gestartete Telenovela »Liebe à la carte« vorzustellen.
»Das ist ja Wahnsinn!«, kreischt Julia in den Hörer, der ich natürlich gleich per Handy davon berichten muss. Sie ist nämlich ein Fan. Gerade will sie anfangen, mir die Ohren über den Hauptdarsteller vollzuschwärmen, da unterbreche ich sie.
»Darüber können wir gerne ausführlich reden, wenn ich nach Hause komme. Und ich verspreche, wenn ich den Job bekomme, dann besorge ich dir sein Autogramm. « Sie quiekt wie ein Teenager, und ich fahre grinsend fort: »Aber dafür muss ich die Stelle erstmal haben, und darum muss ich jetzt von dir alles wissen, was du über die Serie weißt.« Ich fühle mich ein wenig unbehaglich, so unvorbereitet in das Gespräch zu gehen, aber Frau Schulze vom Arbeitsamt hat sofort einen Termin für mich vereinbart. »Bei denen brennt die Hütte«, hat sie gemeint, und dass ich möglicherweise genau die Richtige für den Job sei. Wie auch immer sie darauf kommt, ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als beim Fernsehen zu arbeiten.
»Also«, beginnt Julia, während ich einen Blick auf den Stadtplan auf meinem Beifahrersitz werfe, um sicherzugehen, dass ich noch auf dem richtigen Weg bin, »gedreht wird in den Scarlett-Studios in Hamburg-Wedel, die wurden extra für diese Produktion gebaut. Da steht eine riesige Villa, fast so eine Art Schloss, in der sich ein Restaurant befindet. Das Schlossrestaurant Castello, seit Jahrzehnten im Besitz einer alten Hamburger Adelsfamilie, den Lichtenbergs.«
»Aha.«
»Die weibliche Hauptrolle ist ein Mädchen aus armen Verhältnissen …«
»Was du nicht sagst«, sage ich mit kaum verhohlenem Spott in der Stimme.
»Sie heißt Lara und arbeitet seit kurzem als Kellnerin im Castello«, fährt Julia fort, ohne meinen Einwurf zu beachten. »Die Schauspielerin heißt Nadja Reichert, kennst du sie?«
»Äh, nein«, gebe ich bedauernd zu und folge den Schildern in Richtung Wedel.
»Du kennst sie, wenn du sie siehst. Sie ist wunderschön und hat schon in tausend Soaps mitgespielt.«
»So was gucke ich nicht.«
»Auch, als du so was noch geguckt hast«, sagt sie mit leicht genervtem Unterton, »und vielleicht solltest du in deinem Vorstellungsgespräch vorsichtig mit solchen Äußerungen sein.« Ich beiße mir auf die Unterlippe.
»Da hast du Recht. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch der reinste Trash, oder etwa nicht?«
»Jetzt komm mal von deinem hohen Ross runter«, gibt Julia gereizt zurück, »die Serie ist wirklich gut. Nicht einfach nur schmalzig, sondern richtig witzig und amüsant. Du kannst dir doch gar kein Urteil erlauben, wenn du sie noch nicht gesehen hast. Oder möchtest du, dass irgendjemand deine Bücher anhand ihrer Verkaufszahlen beurteilt?« Autsch, das ging jetzt aber weit unter die Gürtellinie. Das merkt Julia anscheinend auch, denn sie fügt zerknirscht hinzu: »Das habe ich nicht so gemeint, entschuldige.«
»Schon gut. Stimmt ja eigentlich«, gebe ich friedfertig zu. »Also, wie geht die Geschichte weiter?«
»Lara ist also diese leicht tollpatschige Kellnerin, bei der an ihrem ersten Tag so ziemlich alles schiefläuft. Ausgerechnet an dem Tag hat der Sohn des Hauses, der lange im Ausland war, um Spitzenkoch zu werden, incognito als Gast einen Tisch im Restaurant bestellt, um sich einen Eindruck von seinen zukünftigen Angestellten zu machen. Er heißt übrigens Maximilian.«
»Lass mich raten, sie gerät furchtbar mit ihm aneinander und erfährt dann, dass er ihr zukünftiger Chef ist. Oder nein, vermutlich übergießt sie ihn mit heißer Suppe, richtig?«
»Stimmt«, gibt Julia ein wenig überrascht zurück.
»Und zwischen den beiden funkt es ganz gewaltig, aber es darf nicht sein, weil sie seine Angestellte ist?«
»Äh, ja. Aber letzte Woche haben sie sich zum ersten Mal geküsst.« Sie seufzt verzückt, und ich grinse in mich hinein.
»Dann wird es ja höchste Zeit, dass seine ehemalige Liebe auftaucht, oder noch besser, die Ehefrau, die ihn schändlich verlassen und sein Herz gebrochen hat«, tippe ich ins Blaue hinein, und Julia ruft aufgeregt: »Meinst du, das war seine Frau?«
»Wer?«
»Also, gestern war eine große Festgesellschaft im Castello, und Maximilian hat sich mal wieder selbst übertroffen mit dem Menü und als er rauskommt, um die Gäste zu begrüßen, da öffnet sich die Tür und herein kommt eine wunderschöne, schwarzhaarige Frau. Das war ein Auftritt, sage ich dir!«
»Kann ich mir vorstellen. Und Maximilian wird gespielt von diesem Schauspieler, den du toll findest. Wie heißt er noch?«
»David Mory.« Ihre Stimme klingt weich wie Butter.
»Aha. Na, auf den Knaben bin ich jetzt schon gespannt.«
»Er ist der tollste Mann der Welt. Steht ganz oben auf meiner Liste«, schwärmt sie.
»Liste?«
»Na, die Liste. Darauf stehen die fünf Prominenten, mit denen man auch dann schlafen darf, wenn man in einer Beziehung ist, ohne dass der andere sauer wird.«
»Verstehe, du hast zwar keinen Freund, aber vorsichtshalber schon mal eine Liste«, grinse ich und bremse dann ziemlich scharf vor einer auf Gelb springenden Ampel. Im Rückspiegel sehe ich den Wagen hinter mir bedrohlich auf mich zu rutschen, bevor er geschätzte fünf Zentimeter von meiner Stoßstange entfernt auf der schneebedeckten Straße zum Stehen kommt. Mein Hintermann hupt vorwurfsvoll, und ich hebe entschuldigend die Hand. Das fehlte jetzt noch, mit Schleudertrauma zum Vorstellungsgespräch.
»Oh, du musst dich unbedingt mit ihm anfreunden, und dann bringst du ihn mit nach Hause, und ich koche Pasta, und wir trinken Rotwein und …«, plappert Julia, die von meinem Beinahe-Unfall anscheinend nichts mitbekommen hat, weiter.
»Moment mal«, bremse ich ihre Begeisterung, »noch habe ich den Job nicht, und selbst wenn …«
»Schon gut, man wird doch noch träumen dürfen.«
»Ja, später«, gebe ich ungeduldig zurück. »Könnten wir jetzt bitte noch mal auf ›Liebe à la carte‹ zurückkommen. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch und keinen blassen Schimmer. Das war also die Story der letzten fünf Monate? Und die schöne Unbekannte war der Cliffhanger der letzten Folge?«
»Genau. Ich habe alles aufgenommen, wir könnten am Wochenende einen Marathon machen.«
»Wenn ich den Job kriege – vielleicht«, bremse ich ihren Enthusiasmus. »Was weißt du noch?«
»Nadja Reichert und David Mory sind angeblich ein Paar«, sagt sie etwas weniger gut gelaunt.
»Tatsächlich? Woher weißt du das denn?«
»Na, woher wohl? Das liest man doch in jeder Klatschzeitung. Hast du hinterm Mond gelebt in der letzten Zeit?«
»Nein, hinter meinem Schreibtisch«, gebe ich bissig zurück.
»Verzeihung, also, ich weiß es auch nicht so genau, es steht eigentlich jede Woche was anderes drin. Ach, da fällt mir ein, es gibt da noch Konstantin, einen Kellner, das ist auch ein ganz netter Kerl, der sie umwirbt, aber er ist eben bloß – na ja, nett eben.«
»Und Maximilian hat diese Kombination aus männlichem Sanftmut und gefährlichem Temperament, die einfach unwiderstehlich ist, richtig?«
»Richtig.«
»Nun denn, ich bin da.« Ich biege auf das Studiogelände ein, wo ich vor einer Schranke stehen bleibe und den uniformierten Mann im Portiershäuschen freundlich grüße.
»Guten Tag, mein Name ist Stefanie May, ich habe ein Vorstellungsgespräch bei Herrn …«, Mist, wie heißt der Typ noch mal, »Sommerlein«, fällt mir da zum Glück wieder ein, »in der Presseabteilung.«
»Moment, bitte.« Er greift zum Telefon. »Frau May hier für Herrn Sommerlein. Gut, ich lasse sie durch. Sie können fahren«, nickt er mir zu und drückt auf einen Knopf, woraufhin sich die Schranke vor mir hebt, »geradeaus, und wenn es nicht mehr weiter geht, nach links, an der Halle 2 vorbei, dann fahren Sie direkt auf ein rot gestrichenes Gebäude zu, dort müssen Sie in den zweiten Stock! Viel Glück!«
»Danke. Julia, bist du noch da?«
»Ja, ich bin hier. Wer war das?«
»Der Portier. Also, vielen Dank, drück mir die Daumen! «
»Und wie«, sagt sie so begeistert, dass ich lachen muss. »Toitoitoi!«
In der Presseabteilung ist so stark geheizt, dass ich mir die dicke Winterjacke nebst Schal und Mütze herunterreiße, während ich den von Filmplakaten und Schauspielerporträts gesäumten Flur hinunterlaufe. Ich mache schnell noch einen Abstecher auf die Toilette und betrachte mich prüfend im Spiegel. Ich trage eine schmale schwarze Hose, hochhackige Stiefel und eine weiße Bluse, ein gutes Outfit für den Besuch beim Arbeitsamt, aber für eine Fernsehproduktion doch reichlich spießig. Aber das kann ich nun auch nicht mehr ändern. In der feuchten Luft, draußen schneit es noch immer, kräuseln sich meine Haare noch stärker als sonst und verleihen mir einmal mehr die altbekannte Meerschweinchen-Optik. Kopfschüttelnd sehe ich auf die Bescherung. Ich sehe aus, als hätte ich in eine Steckdose gefasst. In dem vergeblichen Versuch, sie einigermaßen zu glätten, fahre ich ein paar Mal mit den Händen durch meine Haare und gebe dann schließlich auf. Schließlich bin ich hier nicht auf einem Schönheitswettbewerb. Trotzdem ziehe ich noch mal rasch meine Lippen nach, nicke mir selbst beruhigend zu und mache mich festen Schrittes auf den Weg.
Als ich das Büro von Herrn Sommerlein betrete, erwartet mich eine Überraschung. Ein Riese von mindestens zwei Metern erhebt sich von seinem Schreibtisch und streckt mir eine gewaltige Pranke entgegen, in der meine Hand verschwindet.
»Sommerlein«, stellt er sich vor, und ich kann mir nur mit Mühe ein Grinsen verkneifen.
»Stefanie May. Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben.«
»Vielen Dank, dass Sie so schnell kommen konnten. Setzen Sie sich doch. Kaffee?« Damit lässt er sich hinter seinem Schreibtisch nieder und schiebt mir einen dampfenden Becher zu. »Zucker?«
»Nein, danke.« Während er drei Würfelzucker in seinen Becher gibt, umrührt und einen großen Schluck nimmt, betrachte ich mein Gegenüber verstohlen. Er kann nicht viel älter als Ende dreißig sein, mit seinem athletischen Körper, den durchdringenden blauen Augen und dem kahl geschorenen Kopf sieht er ziemlich gut aus. Ein bisschen wie ein Profi-Basketballer. Sicher nicht wie ein Herr Sommerlein.
»Sie finden, dass mein Name nicht zu mir passt«, stellt er fest, und ich zucke ertappt zusammen. Bin ich so leicht zu lesen? Prompt schießt mir das Blut in die Wangen. »Da lag ich wohl richtig. Wie wäre es, wenn wir uns beim Vornamen nennen, damit Sie nicht weiter darüber nachdenken müssen?«
»Äh, gerne«, sage ich verlegen, »ich heiße Fanny.«
»Und ich Leander.« Er lächelt unschuldig. Zu unschuldig. Der will mich doch verulken. Leander Sommerlein? Ich sehe ihm fest in die Augen.
»Ich glaube Ihnen kein Wort!«
»Und warum nicht?« Er hebt die Augenbrauen und durchbohrt mich mit seinen Blicken. Plötzlich wird mir heiß und kalt. Was, wenn er mich nicht verulken will? Was, wenn dieser Hüne von einem Mann mit den breiten Schultern und den Schuhen so groß wie Geigenkästen, tatsächlich den Namen Leander Sommerlein trägt? Schweigend sitzen wir da, Auge in Auge. Jetzt habe ich mich tief reingeritten, und kann nur hoffen, dass mein Impuls der Richtige war.
»Sie heißen nicht Leander«, sage ich mit Überzeugung.
»Nicht?«
»Nein.« Ich schüttele den Kopf.
»Mögen Sie den Namen Leander etwa nicht?«
»Doch. Für einen feingliedrigen, blassen Balletttänzer vielleicht.« Was soll’s? Wenn ich mir hier schon mein eigenes Grab schaufele, dann doch wenigstens mit Schwung. Er zieht die Augenbrauen noch ein bisschen höher, und ich gleichzeitig meinen Kopf ein. Fast rechne ich damit, dass er mich gleich hochkant aus seinem Büro schmeißt, da entspannt sich sein Gesicht.
»Eins zu null für Sie!« Puh!
»Und wie heißen Sie wirklich?«
»Volker.«
»Ja, das passt besser.« Er grinst.
»Und wie kommen Sie zu Ihrem ungewöhnlichen Vornamen?« Irritiert sehe ich ihn an. »Fanny?«, erinnert er mich.
»Ach so. Äh …« Ich gerate kurz ins Stocken. Dies ist ein merkwürdiges Vorstellungsgespräch.
»Sind Sie komisch?«
»Nicht besonders«, sage ich lahm. »Höchstens unfreiwillig. « Er grinst.
»Das ist doch ein Anfang. Also, wer hat Ihnen diesen Namen gegeben?« Na gut, wenn er es unbedingt wissen will.
»Ich mir selbst«, antworte ich, »da war ich fünf. Vorher wurde ich Steffi genannt. Dummerweise war Stefanie in meinem Geburtsjahr Platz 1 auf der Liste der beliebtesten Vornamen. Ich habe mir auf dem Kinderspielplatz die Hacken wundgelaufen, weil ständig irgendjemand Steffi rief. Also habe ich kurz vor der Einschulung verkündet, dass ich ab jetzt nur noch auf den Namen Fanny hören würde. Das ist die Geschichte.«
»Das ist eine schöne Geschichte.« Volker nickt zufrieden, und ich atme erleichtert auf. »Ist sie wahr?«
»Natürlich ist sie wahr«, gebe ich entrüstet zurück. »Warum sollte sie nicht?«
»Nun, weil Sie sich hier um den Job als Presseassistentin bei einer Fernsehproduktion bewerben«, antwortet er rätselhaft, und ich sehe ihn verständnislos an. »Was haben Sie denn bis jetzt so gemacht?«
»Nun«, sage ich gedehnt, um etwas Zeit zu schinden. Wie sehr kann ich ihn mit meiner zehnjährigen Erfahrung als Call-Center-Mitarbeiterin beeindrucken?
»Ich bin Romanautorin.«
»Veröffentlicht?«
»Zweifach.«