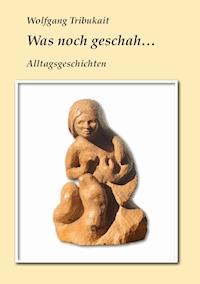Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Tribukait, aus bürgerlichen Verhältnissen in Ostpreußen stammend, in eine abgelegene Gegend der Lüneburger Heide verschlagen, Flüchtlingskind und Kriegswaise, suchte er nach den Kriegswirren eine neue Orientierung zwischen Naturwissenschaft und Christentum, deutscher Tradition und westlichem Denken. Nach mühsamen Umwegen hoffte er, lehrend zu lernen und einen eigenen persönlichen Weg zu finden; anfangs naiv, dann kritisch gegen alle sogenannten Autoritäten. Lebendig schildert er Episoden aus seiner Zeit, manchmal humorvoll, manchmal dramatisch. Am persönlichen Einzelschicksal zeigen sich zeittypische Züge. Kann einer, der nach Selbstfindung sucht, vielleicht auch anderen Wegweiser sein?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Tribukait, geboren 1932 in Ostpreußen, unterrichtete jahrzehntelang Englisch, Französisch, Deutsch und Geschichte am Wirtschaftsgymnasium Villingen. Reisen führten ihn in viele europäische Länder und in die USA. Für den Schwarzwälder Boten schrieb er zahlreiche Berichte über Gastspiele am Villinger Theater, Ortsbeschreibungen für den Almanach des Kreises Schwarzwald-Baar. Freude am Umgang mit Sprache und Gedanken ließ ihn Texte und Gedichte über Begebenheiten seines Alltags verfassen, selbstkritisch und kritisch auch gegenüber seiner Umgebung.
Weitere Veröffentlichungen von Wolfgang Tribukait:
Aus der Mitte gerückt
Geschichten unserer Zeit (2004)
BoD: ISBN 3-8334-1065-5
Gedankenspiele und Holzphantasien
Gedichte und Holzfiguren (2006)
BoD: ISBN 9-783741-23805-5
Im Lauf der Jahre
Berichte und Geschichten (2008)
BoD: ISBN-13: 978-3-8370-7016-3
Gedichte und Texte
Eigenverlag (2013)
Was noch geschah
Alltagsgeschichten (2016)
BoD: ISBN-13: 9-783-7412-7582-1
Dies und Das
Alltagsgeschichten (2020)
BoD: ISBN 9-783-751-923514
Inhalt
Das Medaillon
Gustes Familie
Kindheit im Krieg
Ein Fund
Nach dem Krieg
Jugend
Konflikte
Aufbruch
Unterwegs
Schwarzwaldsommer
Unterm Dach
Referendar
Milch und Räucheraal
Herausforderung
Abseits
Ein Besuch
Erinnern
Aufstieg
Dichte Hecke
Im Chörle
Falter
Kollegen
Heimreise aus England
Klassentreffen
Amerikanische Impressionen
Figura
Eine schwierige Zeit
Eine Hochzeit
Stromausfall
Mobbing
Im Bannwald
Gefördert
Auf und ab
Bei Mondlicht am Wildbach
Ein Lehrer
Redaktionssitzung
Kaliningrad 1994
Eingewöhnt
Holzarbeit
Juli
Ein später Anruf
Das Porträt
Reise nach Polen 2003
Abschied
New York 2008
Calanque
Alte Sachen
Ausblick
Kunstdiebstahl
Anhang
Das Medaillon
Meine Großmutter Friederike Tribukait wohnte zur Miete in zwei Dachkämmerchen in einem niedrigen kleinen Siedlungshaus am Stadtrand von Königsberg. Wir wohnten nicht weit entfernt und besuchten sie oft. Von der Rückseite des Hauses stieg man aus einem Garten mit Gemüsebeeten und Obstbäumen eine enge steile Holztreppe hinauf in eine winzige Kochnische. An Wänden und Balken überall hölzerne Schwälbchen, dunkelblau ihre Rücken, hell ihre Unterseiten. Wie freuten wir Kinder uns an denen! Links ging es in die Schlafkammer, und rechts im Wohnzimmer unter der Dachschräge duftete es herrlich nach Basler Pfefferkuchen. Eng drängten sich Schränkchen, Sofa, Tisch und Stühle. Wir bewunderten die bunten Porzellanfigürchen in der Vitrine, meine Schwester und meine Cousine übten kunstvolles Sticken. Wie gern ließen wir uns da Märchen und Geschichten erzählen! In Erinnerung blieben mir die Balladen vom Riesenspielzeug, von den Kölner Heinzelmännchen und vom Bäumchen, das andre Blätter hat gewollt, und der „deutsche Rat“: „Vor allem eins, mein Kind, sei treu und wahr!“
Meine Großmutter war 1874 als älteste von sechs Kindern geboren. Jung hatte sie ihren Cousin, einen Arzt, geheiratet, war mit ihm aus der Provinzhauptstadt in ein kleines Landstädtchen gezogen, zwei Eisenbahnstunden entfernt. Ihr erstes Kind erkrankte an Hirnhautentzündung und blieb geistig behindert; unverständige Leute schrieben das der „familiären Inzucht“ zu. 1899 bekam sie eine zweite Tochter, 1900 meinen Vater. Aber 1902 infizierte sich ihr Mann und starb wenig später an Blutvergiftung. Ärzte waren damals kaum sozial abgesichert. Die junge Witwe lebte in Armut, verdiente mit Stickereien und privatem Handarbeitsunterricht ein Zubrot zur winzigen Rente. Sie durfte im Haus ihres Vaters wohnen, eines angesehenen Stadtschulrats, und dort wuchsen ihre Kinder heran, hatten aber kaum Spielgefährten. Eine gute Ausbildung war teuer. Mein Vater wäre gern Arzt geworden, aber das war für ihn unbezahlbar. Sein Großvater riet ihm zur Pharmazie – da könnte er sich sein Studium als Apothekenhelfer verdienen. Und seine Mutter half ihm, ein Herbarium anzulegen – ihr Schönheitssinn machte es zu einem Prachtstück.
Und nun, da sie fast siebzig war, schien ein gesicherter Lebensabend nahe. Die behinderte Tochter war gestorben, die zweite Tochter gut versorgt, mein Vater auf dem Weg eine eigene Apotheke zu erwerben. Wie gern waren wir, ihre Enkel, bei ihr zu Besuch!
Am 27. Januar sagte sie, das sei ein besonderer Tag: des Kaisers Geburtstag! Umständlich kramte sie aus einem alten Sekretär ein Samtetui, das mit einem seidenen Band umwunden war. Sie öffnete es behutsam und ließ uns ein goldenes Medaillon betrachten. Ein mit bunten Emailleornamenten verzierter Deckel wölbte sich – drückte man auf eine Feder, sprang er auf, zeigte das Bildnis einer schönen jungen Frau. Ringsum war das Medaillon mit Granaten besetzt. Auf der Rückseite war die Jahreszahl 1893 eingraviert. Die junge Frau war die Kaiserin Augusta Victoria, die Gemahlin des Kaisers Wilhelm II.
Wir bewunderten das Medaillon und die Kaiserin. Die Großmutter erzählte: 1893 hatte das Kaiserpaar der Provinzhauptstadt Königsberg einen Besuch abgestattet. Ein junges Mädchen sollte den hohen Gästen einen Blumenstrauß überreichen. Ihr Vater, der Stadtschulrat, war ein angesehener Mann und Stadtältester (= Gemeinderat). Ihr, als seiner schönen Tochter wurde die Ehre zuteil. Als Dank erhielt sie das Medaillon mit dem Bildnis. Stolz und treu bewahrte sie es auf, auch als es längst keinen Kaiser mehr gab.
1945 blieb meine Großmutter in ihrer Heimatstadt, überlebte die Eroberung durch die russische Armee. Doch ihr Sohn – wie so viele andere – starb dort bald darauf an Ruhr oder Typhus. Ihre Tochter mit Familie gelangte nach Mecklenburg. Meine Großmutter kam in das nahegelegene Ostseebad Rauschen. Dort ist sie ein Jahr später verstorben.
Gustes Familie
Es muß in meinem fünften Lebensjahr gewesen sein. Damals, noch vor dem Krieg, lebten wir in einem kleinen ostpreußischen Städtchen nahe der litauischen Grenze. Ungeheuer weit der Marktplatz, von Hitze flirrend in der Sommersonne. Unsere Wohnung über der Apotheke angenehm kühl; oft spielten wir Kinder im schattigen Garten. Abends las meine Mutter uns Märchen vor, vom Froschkönig und vom Dornröschen, und vor allem von der gruseligen Knusperhexe. Unser Mädchen hieß Guste. Sie war etwa sechzehn Jahre alt, sang stundenlang immer wieder den Schlager vom Mägdelein am Golf von Biscaya, und ich sang nach: „Fahr nicht in die Fremde mein blonder Mitose“. Und sie sang auch den Schlager von Hamann, der mit dem Hackebeilchen kleine Jungen zu Hackfleisch verarbeitet. Ihre Familie, Landarbeiter, wohnte am Rand des Städtchens, wo es überging in die endlose Weite. In der Dämmerung eines Herbstabends nahm sie mich mit dorthin – anfangs Kopfsteinpflaster an der Kirche vorbei, dann Sandwege, Büsche an den Seiten, ein mannshoher Bretterzaun. Dahinter in einem halb verwilderten Garten ein kleines, an Holunder geducktes Haus. Eine offene Tür führt in eine große, halbdunkle Wohnküche – rechts ein riesiger Herd, unter den schwarz verrußten Töpfen und Pfannen sieht man das Feuer, riecht den Rauch, der sich mischt mit dem Duft von gebratenem Speck und Zwiebeln. Davor eine ältere Frau mit breiten Hüften, blaugraue, schmutzige Bluse, langer brauner Rock, geflickt, ein Kopftuch. Was mag sie alles brutzeln in ihren Töpfen und Pfannen? Draußen neben der Tür lehnt ein Brett an der Wand; in ihm zwei Nägel, daran gebunden, mit den Hinterläufen nach oben, ein Hasenkörper – gerade hat ein Mann ihm das Fell über die Ohren gezogen. Blaurot und plastisch jeder Muskelstrang – Beine, Hinterteil, Brustkorb, Arme – der Kopf ist unwichtig.
Die Frau lacht laut, scherzt mit den dunkel gekleideten Leuten, die um den Tisch hocken. Auf dem rohen Holz Messer und Gabeln, und die Gläschen mit Pillkaller – Schnaps mit Leberwurst. Die Männer und Frauen lassen breit sich wiegende Worte mit prallen Lauten erklingen, starke Melodien, kräftige Rhythmen, fremdartige Worte dazwischen, ostpreußisches Platt. Ich verstehe sie nicht. Was mögen sie sagen? Derbe Spoaskes, laute Lachsalven – auf was für Braten mögen sie warten? Die Guste, vor zwei Stunden bei uns noch vertraut, spricht jetzt unverständlich, ist für mich zu einer Fremden in der Gruppe geworden – bin ich allein unter Menschenfressern? Faßte nicht neulich meine Tante mich an und sprach von meinem schönen, festen Fleisch? Kaum traue ich mich, von der Milch zu trinken, die jemand vor mich hinstellt. Weit weg meine Eltern, die mich stets so behüteten! Im Halbdunkel, an der Seitenwand, noch ein Tisch, darüber, an einem Wandbrett, lange Messer – was wollen die Leute schneiden damit?
Erst bei Dunkelheit gehen wir heim. Ich weiß nicht mehr, ob ich mit meiner Mutter über den Besuch in jenem Häuschen sprach, ob sie mir etwas erklärte. In meiner Phantasie wirkte das Erlebnis nach. Wenn abends meine Schwester und ich in den Betten lagen, malten wir uns in langen Erzählungen aus, wie wir andere Kinder schlachten und braten wollten. Ein gruseliger Genuß müßte es sein, ihre prallen Hinterbacken abzuschneiden!
Bald darauf zogen wir fort in eine größere Stadt. Aber noch immer sehe ich vor mir jene dunklen Gestalten um den Tisch vor dem Herdfeuer, höre die mir unverständlichen Laute, und blaurot schimmern die Muskeln des gehäuteten Hasen.
Kindheit im Krieg
Im Frühjahr 1939 zogen meine Eltern in ihre Heimatstadt Königsberg. An einem kleinen Platz in einem besseren Viertel ein hohes Jugendstil-Haus, darin eine geräumige Dachwohnung. Im großen Wohnzimmer Parkettboden, zwei mal im Jahr vom Dienstmädchen mit Stahl-Spänen geschrubbt; auf dem Smyrna-Teppich in der Ecke ein schwarz glänzender Flügel. Am altmodischen Eichen-Schreibtisch mit seinem gedrechselten Aufsatz zeichnet mein Vater sonntags Pläne für das Häuschen, das er bauen will, nach dem Krieg; dann wird er auch eine eigene Apotheke kaufen können, droben im Baltikum vielleicht, das dann sicher zum Großdeutschen Reich gehören wird.
Hinter dem Eßzimmer haben wir einen großen beschatteten Balkon. Dort feiern wir Kindergeburtstage mit Vettern und Cousinen, Kaffee und Kuchen, Singspiele – meine Mutter will den Kindern die schöne heile Welt so lange wie möglich erhalten.
Ein schwüler Sommertag, Hitze und drohendes Unheil bedrücken. Die Mutter erzählt dem Sechsjährigen vom Ausbruch des Krieges. Doch zunächst merken wir nichts davon. Sonntags gehen wir spazieren, bei den Teichen draußen vor der Stadt, manchmal im Zoo. Im Sommer fährt man an die Samlandküste, das gehört sich so. Heiß brennt der Sand unter nackten Füßen, hinein in die Brandung, im Strudel kopfüber kopfunter, da kommt schon die nächste Welle. Am Strand zwischen Tang und Muscheln Bernstein, aus Borkenstückchen schnitzen wir kleine Schiffchen. Nachmittags in den Wald, Blaubeeren, die gibt’s abends mit Zucker und Milch – Hmmm!
Eines Morgens große Aufregung: Eine Mine ist, angetrieben an unserem Badestrand! Wehe, wenn sie explodiert! Aber sie wird entschärft, nichts Schlimmes passiert.
Der Bruder meiner Mutter, ein junger Lehrer, steht jetzt in Polen. Er schreibt, wie schön glatt der Vormarsch verlief, bis ihnen die Russen entgegenkamen. Weitere Siegesmeldungen begeistern uns Schulkinder. In den Pausen ziehen wir an zusammengerollten Papierstreifchen – bis zu welchem militärischen Dienstgrad werden wir es einst bringen?
Zwei Jahre später haben die Sommergäste an der Ostsee eine große Rußland-Karte an die Wand gepinnt, stecken mit Fähnchen den Front-Verlauf ab, schwadronieren über große Strategie. In der Stadt gibt es nachts manchmal Fliegeralarm, ein oder zwei Stunden im Keller, halblaut sprechende Menschen – aber nur einzelne Flugzeuge, harmlos, entfernte Detonationen; wer Glück hat, findet am Morgen einen Granatsplitter. Auf dem Messegelände eine große Ausstellung erbeuteter russischer Panzer, Kanonen und Lastwagen – welcher Junge turnt nicht begeistert darauf herum!
Oft fahren mein Freund und ich mit der Straßenbahn durch die Stadt, vorbei an hohen alten Häusern, am Schloß, warten vor hochgezogenen Brücken, dann alte Fachwerkspeicher am Hafen, wuchtige Backsteintore, verziert mit Gestalten der preußischen Geschichte.
Jeder Junge muß in die Hitler-Jugend. Nachmittags Exerzieren oder Geländespiel am Stadtrand, manchmal Partei-Unterricht in einem Keller. Wir Zehnjährigen sitzen auf ein paar Bänken, vorn erzählt ein Vierzehnjähriger voll Begeisterung über das Leben des Führers, wie er Baumeister werden wollte und nun ja auch tatsächlich Baumeister geworden ist, der größte Baumeister des deutschen Staates. Und wenn erst der Endsieg errungen ist, wird ewiger Frieden herrschen überall auf der Welt, und Deutschland wird groß und mächtig und herrlich sein für mindestens tausend Jahre. Einer schaut kritisch und etwas ungläubig drein. Sofort bemerkt es der Fähnleinführer, ein Donnerwetter geht auf ihn nieder, er kauert sich zusammen und würde am liebsten im Erdboden versinken.
HJ-Dienst draußen, hinter den Hammerteichen. Schuhappell. „Deine Schuhe sind nicht blitzblank, strafexerzieren! Rechtsum, linksum, zwanzig Liegestütze! Im Gleichschritt, marsch! Ein Lied, zwo drei!“ Vor uns marschieren mit sturmzerfetzten Fahnen die toten Helden der jungen Nation; und über uns die Heldenahnen, Deutschland, Vaterland, wir kommen schon!“ Geländespiel, manchmal im Wald, manchmal auf dem Judenfriedhof. Zwischen hohen Hecken graue Grabsteine mit für uns nicht lesbaren Zeichen und Symbolen. Ich verstand nicht, dass wir die Ruhe der Toten entweihten.
Zwei Polizisten zu Pferde. Zwischen ihnen, in Handschellen, ein jüngerer Mann. Bedrückendes Schweigen, ernste Gesichter. Die Polizisten verscheuchen die gaffenden Pimpfe. Sie haben Pistolen. Mit ihrem Gefangenen ziehen sie stadtauswärts – fort von allen Menschen.
Ich sage meinem Vater, dass ich das Jungvolk nicht mag. Mein Vater meint: „Es mag ja manches nicht schön sein heute in diesem Staat, aber so wie die Verhältnisse nun einmal sind, muß man sich eben anpassen.“ Auf Spaziergängen erzählt er mir über die griechische Götterwelt und den Krieg um Troja, über die Geschichte Preußens, den Inhalt vieler großer Opern; und er preist Kant: „Wie erhaben ist das: der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir!“
Auf dem Schulweg. Wir zwei Neunjährigen sangen laut. Ein Anwohner einer stillen Straße fühlte sich gestört, stürmte wütend aus dem Haus und ohrfeigte uns. Wir schrieben ihm, er habe den Urenkel des bekannten Stadtschulrats geschlagen, und wir unterzeichneten mit der gefälschten Unterschrift meines Vaters. Zufällig kannte der Mann meinen Vater. Ich bekam eine harte Strafpredigt und die strenge Mahnung: „Adel verpflichtet!“
Ja, meine Eltern fühlten sich als eine Art Adel. Mein Vater, Sohn eines früh verstorbenen Arztes, war von seinem Großvater erzogen worden; seine Mutter hatte in drückender Armut gelebt. Der Vater meiner Mutter war Studienrat gewesen, sein Heldentod 1914 hatte seiner Witwe eine äußerst knappe Pension hinterlassen, die für sie und ihre drei kleinen Kinder kaum reichte, schon gar nicht während der Inflation 1923. Ihre Schwester, kinderlos mit einem Berliner Professor verheiratet, hatte ihr immer wieder geholfen. Die Leute fühlten sich zu den besseren Kreisen gehörig, und so erzogen sie ihre Kinder. Aber als ich einmal eine niedere Arbeit auf das Dienstmädchen abschieben wollte, bekam ich einen scharfen Anpfiff: „Du hast noch überhaupt keine Würde! Erwirb sie dir erst! Arbeit adelt!“
Oft, wenn ich etwas ausgefressen oder mit meiner Schwester gestritten hatte, schwang mein Vater den Rohrstock. Ein paar Hiebe – lange, ermahnende Worte – wieder ein paar Hiebe, viele Worte, die ich vor Schmerz und Angst kaum zur Kenntnis nahm, wieder Hiebe. Mein Vater war leicht reizbar, oft fürchtete ich ihn mehr als dass ich ihn liebte. Sein Erziehungsgrundsatz: „Alt und grau darf der Jung werden, aber nicht frech!“
Mein Vater hörte wohl manches in der Apotheke, aber mit meiner Mutter sprach er nicht darüber. Noch viele Jahre später klagte meine Mutter: Die Sonntag-Vormittage verbrachte er mit seiner Mutter, kam viel zu spät zum Essen heim, das Dienstmädchen beschwerte sich, verlangte seinen freien Nachmittag. Meine Mutter ließ keinen Zweifel an sich heran, sie wollte ungestört weiterleben in einer von evangelischen Pfarrhäusern geprägten heilen Welt. Der jüngste Bruder meiner Mutter wurde 1915 geboren, fünf Monate nachdem sein Vater im 1. Weltkrieg gefallen war. Die sehr kleine Pension seiner Mutter reichte kaum zum Leben, vor allem während der Inflation 1923. Ihre Schwester, kinderlos verheiratet mit einem Professor in Berlin, unterstützte sie – aber ihr Leben war hart. Frustrierend die Fahrt mit dem plombierten Zug von Berlin durch den polnischen Korridor nach Königsberg! Und mußte man nicht das Deutschtum Ostpreußens gegen die slavische Umgebung verteidigen? Schon als Kind schloß sich mein Onkel den Nazis an, seine Mutter durfte das nicht wissen. Nach seinem Abitur ließ er sich zum Grundschullehrer ausbilden, er wollte einfache Leute erziehen. Freiwilliger Arbeitsdienst. Und dann kam gleich der 2. Weltkrieg. Von der Artillerie meldete er sich zur Infanterie, wurde Unteroffizier. Im Februar 1943 fiel er vor Leningrad. Ein Cousin, U-Boot-Arzt, kehrte nicht von Feindfahrt zurück, ein anderer Cousin, Feldgeistlicher, fuhr mit dem Zug auf eine Mine und flog in die Luft.
Nächtlicher Fliegeralarm wurde häufiger. Vom hochgelegenen Fenster aus sahen wir Scheinwerferarme am Nachthimmel kreisen, der gepflegte Rasen vor dem Haus wurde aufgerissen, Splittergräben gebaut.
Stunden im Luftschutzkeller, Hochbetten, ich pule Rinde von groben Stützbalken. Halblaut sprechen die Mitbewohner unseres Hauses, ein alter Herr spielt mit sich selber Schach. Aber in Königsberg schienen Meldungen über Luftangriffe aus einer anderen, fernen Welt zu kommen.
Dennoch quartieren wir uns ein bei einem Onkel in einem nahe gelegenen Dorf. Mittag unter den Bäumen in Pfarrers Garten – Kartoffelpuff er mit Apfelmus! Wir Kinder bewundern die Batterie von Pfeifen des alten Pfarrers – eine immer länger als die andere! Über mannshoch wachsen die Tabakspflanzen an der Sonnenseite des Hauses, heiß ist der Sommer, oft gehen wir baden im einsamen Waldsee. Heimweg neben dem Bahndamm, pausenlos Züge mit der Aufschrift: „Räder müssen rollen für den Sieg!“ Es ist die Hauptstrecke von Königsberg nach Westen.
Eine tote Maus in der Falle. Ich schneide sie auf, schabe das Fleisch heraus, präpariere das Fell. Onkel Bruno lacht, wochenlang singt er: „Ein Mann hat eine Maus, mi ma Mausemaus, er zieht ihr ab das Fell, was macht er mit dem Fell, er näht sich draus nen Sack, mi ma Mantelsack, er tut hinein sein Geld…“ Eines Tages werden Silbersachen und feine Tischwäsche irgendwo auf dem Pfarrhof vergraben. Im Juli an der Samlandküste. Große Erregung: auf den Führer ist ein Attentat verübt worden! Was müssen das für schändliche Verbrecher sein! Wenn man sie nur ermitteln und der Polizei übergeben könnte!
Aber, wieder in Pörschken, heißt es plötzlich: Manch einer wird wohl bedauern, dass das Attentat nicht geglückt ist. Und als ein anderer Geistlicher Onkel Bruno besucht, höre ich den halb scherzhaft fragen: „Was, Sie sind noch da? Ich dachte, Sie wären längst abgeholt!“ Onkel Bruno war Mitglied der bekennenden Kirche.
Nacht. Über den Wolken dröhnen Flugzeugschwärme. Wir hören Flakfeuer und ferne Explosionen. Hinaus aufs freie Feld: am Horizont sehen wir die riesige Glut. Hunderte von Toten. Drei Nächte später ein zweiter Angriff auf Königsberg. Wieder stehen wir auf dem Feld, sehen die Glut, davor die Silhouetten einzelner Häuser. Über uns die Flugzeuge – und trotz der Entfernung meinen wir das Prasseln der Flammen zu hören. Wir wissen, mein Vater hat Nachtdienst in der Innenstadt. Tage später sehen wir ihn, erschöpft, Hände und Arme voller Brandblasen, halbblind. Ausgebombte Familien werden im Pfarrhaus einquartiert. Ein junges Mädchen, das Haufen verkohlter Leichen hatte sehen müssen, schreit immer noch: „Nun bringt die Dinger doch endlich weg!“ Nach amtlichen Angaben kamen 4200 Menschen ums Leben, 200.000 wurden obdachlos.
Im Oktober Abschied von unserer unversehrten Stadtwohnung. Abends mit der Straßenbahn zurück zum Hauptbahnhof. Meine kleine Schwester schaut durchs Fenster und zählt Häuser ab: „kaputt, kaputt, kaputt, heil, kaputt, kaputt“. An einem trüben Tag stehen wir in Pörschken an der Bahnsteigkante. Frauen und Kinder werden aus Ostpreußen evakuiert. Mein Vater hat ein paar Tage Urlaub und darf seine Familie begleiten. Durch Nebel und Sprühregen, in der Dämmerung die Marienburg. Mein Vater preist die einfache, mitunter derbe Ehrlichkeit ostpreußischen Wesens – und er meint, im Westen seien die Menschen anders. Und ich soll nie vergessen, dass ich aus der Stadt der reinen Vernunft komme.
Am andern Morgen ein kaltes, nur notdürftig möbliertes Giebelzimmer in einem pommerschen Bauernhaus. Ein Kachelofen muß hinein – mein Vater besorgt den Handwerker im eine Stunde weit entfernten Städtchen. Dann fährt er mit mir in die Kreisstadt Cammin; doch das Gymnasium dort kann keine weiteren Schüler aufnehmen. Eine Schule aus Lünen im Ruhrgebiet ist nach Pommern evakuiert, deren Quinta kann ich besuchen und im Internat wohnen.
Allein. Kahle Gänge, ein Schlafraum für etwa zwanzig Jungen. Zum Essen drei Treppen runter, über den Hof, zwei Treppen rauf. Chor: „Gut Fraß, gut Fraß, gut Fraß!“ Mittags Eintopf, abends Kommißbrot mit Marmelade, morgens mit Kunsthonig. Der Heimleiter: „Du warst heute nicht zum Dienst bei der HJ!“ – „Ich geh’ doch zu denen aus Lünen, die haben nachmittags Unterricht, da kann ich nicht!“ – „Die HJ ist wichtig, das darfst du nicht versäumen, da müssen wir eine Regelung finden!“ Es wurde keine Regelung gefunden.
Die anderen Internatsschüler waren von ihrem HJ-Dienst begeistert. Sie erzählten über ihre tolldreisten Streiche. Ich stand verschreckt abseits, und einer versuchte mich zu trösten: „Anfangs fanden wir’s alle schrecklich, doch dann gewöhnten wir uns, jetzt mögen wir‘s nicht mehr anders, du wirst dich auch noch drein finden, wir sind eine prima Gemeinschaft!“ Doch am Abend zieht einer einen andern an den Hoden über den Gang in den eisigen Waschraum. Meine Leistungen sinken ins Bodenlose. Weihnachten darf mein Vater ein paar Tage lang seine Familie besuchen, er holt mich ab aus Cammin, und nach den Ferien brauche ich nicht zurückzukehren dorthin.
Weihnachtstage in Pommern. Die Bauern schlachten Gänse, lange Stangen mit darauf gebundenen Schinken stehen zum Räuchern auf dem Dachboden. Man kocht Rübensirup, und an klaren Frosttagen geht’s auf die Hasenjagd. Als Treiber ziehe ich mit durch den Wald. Daheim wird die Beute verteilt, wir bekommen auch ein Kaninchen.
Am Dorf vorbei fährt eine Kleinbahn nach Greifenberg, langsam, oft bleibt sie im Schnee stecken, sie braucht mehr als eine Stunde, morgens hin, mittags zurück. Dorthin darf ich jetzt täglich fahren. Im Zug schwatzen die Frauen: „Ja, wenn die von hier nach Ostpreußen hätten fliehen müssen, wir hätten sie aufjenommen mit Gastfreundschaft, hätten se behandelt wie Leute wie wir – aber die hier, die tun ja, wie wenn wir Jesindel wären und Lumpenpack, herjelaufenes. Ich wünsch denen ja nichts Böses, aber manchem tät es ganz jut, mal zu spürn wie das is, wenn man Haus und Hof und alles zurücklassen muß!“ Seit Wochen schon ziehen tagaus, tagein von früh bis spät endlose Flüchtlingstrecks durch das Dorf, Planwagen, viele nur notdürftig ausgerüstet. Die Leute gehen daneben; Menschen, Pferden und Wagen sieht man es an, dass sie schon lange im Winter unterwegs sind. Nacht für Nacht richten die pommerschen Bauern Massenlager ein, zehn, fünfzehn Flüchtlinge in einem Raum, auf einer Strohschütte, in ihren Kleidern. Zu essen geben ihnen die Bauern auch, am Morgen ziehen sie weiter, und am Abend sind andere da. So geht es den ganzen Januar und Februar. Am liebsten würden auch die Pommern alles Nötige und Wertvolle in ihre Wagen packen und sich dem großen Treck anschließen. Aber wehe dem, der dabei erwischt wird! Bürgermeister und Dorfpolizisten glauben fest an den Endsieg, sie vertrauen auf neue Wunderwaffen, immer wieder heißt es: „Alles wird sich noch wenden, bis hierher kommen die Russen nie, das wird der Führer nicht zulassen!“
Und dann, morgens am Sonntag, dem 4. März 1945, höre ich im Volksempfänger den Wehrmachtsbericht: „Russische Panzerspitzen im Raum Naugard.“ Ein Blick auf die Karte: das sind vierzig Kilometer von uns. Packen in fliegender Hast, jeder einen Rucksack und ein Köfferchen, meine kleine Schwester hat vierzig Grad Fieber, schnell ein paar Kissen, auf die Straße, ein Bauernwagen kommt gerade vorbei, scharfer Trab bis zum Bahnhof; ein Güterzug voller Menschen, meine Mutter sieht eine offene Tür, Leute schreien: „Alles voll!“ Aber meine Mutter schafft es, wir drängen uns hinein, finden noch ein Eckchen mit Stroh, ich sitze bei der Tür. Kaum sind wir drin, fährt der Zug ab – kein Mensch weiß wohin. Er war in Naugard schon beschossen worden – danach kommt keiner mehr.
Fahren – lange Wartezeit auf irgendeinem Abstellgleis – fahren; etwas Suppe auf dem Bahnhof von Swinemünde – fahren – warten auf dem Bahnhof von Rostock, während eines Luftangriffs – wieder fahren, lange warten, fahren – drei Tage und drei Nächte, kalt ist‘s Anfang März. Auf dem Lübecker Bahnhof gehe ich zur Toilette, der Zug soll weiterfahren – mit Mühe gelingt es meiner Mutter, ihn aufzuhalten, bis ich, durch Lautsprecher ausgerufen, atemlos angerannt komme. Dann ein sonniger Frühlingsmorgen bei Lauenburg an der Elbe – wir stehen vor der Brücke und warten, steigen aus, gehen zum Fluß hinunter, können uns endlich waschen. Meine kleine Schwester ist inzwischen gesund geworden, lacht und spielt. Endlich pfeift die Lokomotive, einsteigen, Weiterfahrt, wieder Unterbrechungen; nochmals eine Nacht im ungeheizten Güterwagen auf irgendeinem unbekannten Bahnhof. Jemand erzählt: „Die Station heißt Bremervörde. Man sagt, wir sollen hier bleiben.“
Am Morgen mit Rucksack und Köfferchen auf dem Bahnsteig. Aus den umliegenden Dörfern sind alte und invalide Bauern mit Pferdefuhrwerken bestellt worden, um Flüchtlinge abzuholen – so, wie Kunstdünger abgeholt werden muß, wenn ein Zug damit da ist. Da sagt dann ein Heidebauer zu Mutter Krüger mit Töchtern aus der Stadt Naugard in Pommern: „Tja, denn kummt nu man mit, wi künnt ja woll taufohrn!“ Mutter Krüger: „Ja sagen Sie mal, wo soll es denn überhaupt hingehn?“ „Na Eberstorf tau.“ „Ja wie weit ist denn das?“ „Tja, so säben Kilometer sin dat woll.“ „Nein, das geht aber nicht, wir sind aus der Stadt, wir wollen in der Stadt bleiben!“ „Do wart ji woll keen Glück mit hewwen, de Lüd hier sin all von’t Land!“ „Nein, ich will auf jeden Fall in der Stadt bleiben!“ „Na denn man tau, un veel Glück!“ Der Bauer läßt Mutter Krüger stehen und nimmt andere „Gäste“ mit in sein Dorf.
Ein anderer Bauer fordert Mutter Krüger auf, mit ihm zu kommen, nach Glinde, drei Kilometer von der Stadt. Nein, sie will in der Stadt selbst bleiben. Die Bauern reden miteinander in ihrem Platt, das die Flüchtlinge kaum verstehen, schon gar nicht, wenn’s schnell geht. Dann tritt Carsten Buck aus Kuhstedter Moor auf Mutter Krüger zu: „Nu kumm man mit, bi uns, dat is wie so ne lütte Stadt, do wart ji dat woll gefalln!“ Und alle andern Bauern bestätigen, was für ein schöner Ort Kuhstedter Moor ist, richtig eine kleine Stadt, und schließlich glaubt es Mutter Krüger und geht mit. Sie wird es wohl ein paar Jahre bei den paar Katen im Moor haben aushalten müssen.
Uns, d.h. meine Mutter, meine zwei Schwestern und mich, bringt ein Wagen nach Niederochtenhausen, eine gute Wegstunde von Bremervörde entfernt. Der Saal des Dorfwirtshauses ist voll von Flüchtlingen, immer mehr kommen hinzu, schließlich beginnt der Bürgermeister mit der Verteilung: „Jehann Breuer, du hest twe Kammern leer stohn, de Fru un de veer Kinner kümmt tau di!“ – „Nee, dat geit nich, wi hewwt nich gnaug tau freeten vör de all!“ – „Tau’n Dunner, du nimmst de Lüd, suns giwwt dat Krach!“ – „Du hest mi gor nix tau befehln!“ – „Dat heww ick doch!“ So geht das hin und her, die Flüchtlinge verstehen kaum etwas, es wird immer heftiger, lauter, man sieht befehlende und trotzige Gesten. Wie Vieh fühlen wir uns, das zwangsversteigert wird. Und wie Vieh werden wir auch zunächst behandelt: auf dem Hof weist uns die Bäuerin ein feuchtes, nicht heizbares Zimmer zu, der polnische Zwangsarbeiter muß eine Schicht Stroh auf den Boden schütten, eine Decke drauf, zwei Decken drüber – das muß reichen als Lager für die Familie. Die Nächte sind kühl, die Feuchtigkeit läßt das Stroh auf dem Boden schimmeln, Käfer krabbeln dazwischen herum, die Decken sind klamm. Wer nachts ein Bedürfnis verspürt, muß sich auf der Diele an die Seite der Kühe hocken. In einem alten Niedersachsenhaus ist die Diele der wichtigste Raum. Auf der einen Seite Kühe und Kälber, wiederkäuend, manchmal brüllend – auf der anderen Seite die Schweine, vor der Fütterung quieken sie ohrenbetäubend. Auf steiler Leiter hinauf auf den Heuboden – Vorsicht, dass man nicht durch die Luke fällt! Mit den Kindern des Bauern und der Nachbarn spielen wir Verstecken, suchen die Nester der Katzen für ihre neugeborenen Kätzchen, bauen uns selber Nester und Höhlen. Vorübergehend gehe ich in die Dorfschule, aber ich nehme sie nicht ernst, und mein Hochdeutsch wird von den Bauernjungs auch nicht ernst genommen.
Der Pole arbeitet nicht mehr. Vormittags schläft er, nachmittags trinkt er mit seinen Landsleuten in der Küche des Bauern Schnaps – niemand weiß, woher sie ihn haben. Niemand stellt sie auch zur Rede, alle haben Angst, fürchten, die Polen könnten auf schlimme Weise sich rächen für Jahre der Zwangsarbeit.
Meine Mutter putzt und flickt, aus abgetragenen Sachen Erwachsener näht sie neuwertige Kleider für die Kinder (vor ihrer Heirat war sie Handarbeitslehrerin). Schließlich lernt sie sogar melken. Bei fünf Kühen sind der Opa und die Bäuerin froh über die Hilfe, und wir Flüchtlinge dürfen dafür in der Küche mithalten: Abend für Abend erst Milchsuppe, dann fette Bratkartoffeln mit Speck und Apfelmus. Wir brauchen nicht zu hungern, und es schmeckt.
In den ersten Maitagen rücken die Engländer heran, eine deutsche Einheit soll sich im Dorf festsetzen und Widerstand leisten. Aber die Männer sind lustlos, hocken um ihre Gulaschkanone und warten. Eines Tages heftiges Artilleriefeuer, die Geschosse heulen von hinter dem Wald her über das Dorf hinweg, auf dem Feld hinterm Haus spritzen Dreckfontänen hoch. Beim Nachbarhof werden ein paar Baumstämme zerfetzt. Zitternd vor Schreck kommen die Leute herübergelaufen, suchen mit uns Deckung in der Rübenmiete.
Nach ein paar Stunden beruhigt sich das Feuer. Am Abend hinter einem anderen Waldstück Leuchtkugeln – erst einzelne, dann immer mehr, rote, grüne, gelbe, ganze Schwärme davon ziehen leuchtende Bahnen durch den Abendhimmel. Die Leute treten unter die Haustür, um das Schauspiel besser zu betrachten. Nach einem Weilchen kommt jemand vorbei, der es im Radio gehört hat: der Krieg ist aus.
Gleich am nächsten Tag gibt die Bäuerin meiner Mutter die große Hakenkreuzfahne. Die trennt die schwarzen Streifen ab und den weißen Kreis; das rote Tuch wirkt ein wenig verblaßt, aber das macht nichts, meine Mutter kann es so zuschneiden, dass es schöne rote Röcke gibt, weiße Blusen und schwarze Träger dazu. Welch prachtvolle Dirndlkleider!
Nach etwa zwei Monaten kommt der Bauer aus englischer Gefangenschaft, nach und nach auch andere Männer des Dorfes. Auch zu Flüchtlingsfamilien finden viele Männer über den Suchdienst. Wir warten und warten – einen Sommer, einen Winter, noch einen Sommer. Jeden Tag, wenn ich heimkomme aus der Schule in der Stadt, frage ich, ob es Nachricht gibt von meinem Vater. Zurückgegangen nach Königsberg im Januar 1945, um die Bevölkerung mit Arzneimitteln zu versorgen. Im September 1946 erfahren wir, dass er im April 45, bald nach der Eroberung der Stadt durch die Rote Armee, an Ruhr oder Typhus gestorben ist. Er ruht in einem Massengrab, einer von achtzigtausend, die damals nach Kriegsende dort starben.
Ein Fund
Ziellos wandere ich umher zwischen den Trümmern meiner Heimatstadt. Trauer nistet in leeren Fensterhöhlen. Fremd und doch seltsam vertraut die rauchgeschwärzten Mauern – ist nicht jene Ruine in der Nähe des Doms das Haus meines Urgroßvaters, des Schulrats? Nie habe ich ihn gekannt, nur über ihn erzählen gehört. Hohes Gras wächst zwischen Backsteinbrocken. Plötzlich breche ich mit einem Bagger ein Loch in die Seitenwand eines versteckten Gewölbes. Mühsam dringe ich in einen Keller, der zugemauert 55 Jahre unberührt überstanden hat. In einer Ecke am Boden eine Kiste – darin Bücher, die mir gehörten, als ich elf Jahre alt war.
Obenauf ein unscheinbares kleines graublaues Bändchen – die Geschichte eines Eisbären, durch Zufall waren sein Fell und sein Schädel wieder zusammen gekommen, in der Silvesternacht erzählt er der Autorin seine Erlebnisse in Alaska. Sie endeten damit, dass er einen von ihm bewunderten Deutschen, der ihn halb gezähmt hatte, fraß und dafür erschossen wurde. Eingeklebt auf die erste Seite des Büchleins ein Exlibris, Jugendstil, Linoldruck – Alfred Besch. Mein Patenonkel, ein junger Lehrer, 1943 in Rußland gefallen.
Ein Roman – ein junger Elsässer, aufgewachsen als Kolonistensohn in Algerien, flieht mit einem desertierten Fremdenlegionär auf abenteuerliche Weise nach Deutschland, gerade rechtzeitig zur Einweihung des Nord-Ostsee-Kanals 1895; er bewundert den Kaiser und seine Marine, stellt sich in den Dienst des Reiches und wird schließlich beim chinesischen Boxer-Aufstand sein Blut verspritzen fürs Vaterland. Das Buch hatte meinem Vater in seiner Jugend gehört, er hatte es mir gegeben – deutsch-nationale Tradition, über mich ausgegossen wie klebriger Sirup.
Ein anderes Buch: der Musiklehrer einer Kleinstadt hat seine Söhne nach deutschen Kaisern genannt, Otto der Große, Friedrich der Zweite, Heinrich der Dritte. In ihr enges idyllisches Leben hinein strahlt die Sehnsucht nach Weite und Weltgeltung: die Tochter heiratet einen jungen Mann, der in Deutsch Südwestafrika Grundbesitz aufbaut. Unsere Kolonien!
Ein dicker Wälzer, Realienbuch für deutsche Jungen und Mädchen, gedruckt 1913. Abschnitte über Optik, Astronomie und Geschichte. Der Krieg der Griechen gegen die Perser geht nahtlos über in die Verherrlichung deutschen Kaisertums, stülpt sie mir über wie ein Netz, in dem man Schmetterlinge fängt. Deutsche Heldensagen, Herzog Ernst – darin eine Orient-Reise zu seltsamen fremden Ländern mit phantastischen Völkern, Langohren und Menschen, die sich ausruhen im Schatten ihres einzigen überdimensionalen Fußes, den sie über sich aufrichten. Kranichmenschen mit schwert-langen Schnäbeln bedrohen Ritter in Kettenhemden – bedrohen sie auch mich? In der Kiste neben meinen Büchern eine Pappschachtel, halb gefüllt mit fingernagelgroßen Bernstein-Stückchen, die ich am Ostseestrand auflas. Ist der Besitz erlaubt, oder beansprucht der Staat alle wertvollen Fundstücke? Während ich noch überlege, höre ich um mich her Russisch sprechen. Zerknitterte Mütterchen in langen Röcken und mit schwarzen Kopftüchern humpeln zwischen den Trümmerfassaden dahin. Andere hocken am Straßenrand, bieten Vorübergehenden Blaubeeren und Pilze zum Kauf. Aber ein paar Schritte weiter patrouilliert bedrohlich die russische Miliz – wollen sie mich verhaften, weil ich verbotene Dinge bei mir habe? Muß ich fürchten, in ein elendes sibirisches Straflager verschleppt zu werden? Angst packt mich. Nur fort von hier! Was will, was kann, was darf ich mitnehmen in mein Leben in einer anderen, westlichen Welt? – Erwachend fahre ich hoch in meinem Bett, höre vor dem Fenster meines schönen Hauses im Schwarzwald das Gezwitscher der Vögel. Fünfundfünzig Jahre und mehr, zwölfhundert Kilometer – im Schlaf vom Traum überbrückt. Wie froh bin ich, mich freigestrampelt zu haben!