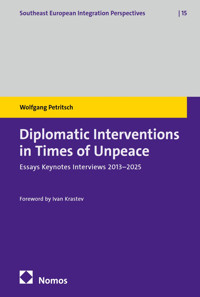Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die umfassende Biografie zum 100. Geburtstag des legendären Politikers! Bruno Kreisky war ein Mann mit Eigenschaften. Er besaß Charisma und Spontaneität, war abwägend und impulsiv, zugleich aber der politischen Aufklärung verpflichtet. Bruno Kreisky hatte eine lebenslange Vision: die Menschen in Arbeit halten. Seine faszinierende und durchaus widersprüchliche Persönlichkeit ist das Ergebnis eines außergewöhnlichen Lebens. Er war Sozialist aus bürgerlicher Familie, saß in den Gefängnissen der Austrofaschisten und der Gestapo, überlebte Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg als Emigrant in Schweden, wo er Demokratie und Sozialstaat kennenlernte und sie als reale Alternative zum Österreich der dreißiger Jahre verstand. Am Wiederaufbau seiner Heimat entscheidend beteiligt, hat Bruno Kreisky sein Land geprägt wie niemand sonst. Diese umfassende Biografie beruht auf der jahrzehntelangen Beschäftigung des Autors mit dem Phänomen Kreisky. Als enger Mitarbeiter konnte Wolfgang Petritsch ungewöhnliche Einblicke in das Denken und Handeln des Porträtierten gewinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang PetritschBruno Kreisky
Wolfgang PetritschBruno Kreisky
Die Biografie
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2010 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4240-0
ISBN Printausgabe:978-3-7017-3189-3
„Den Gleichmut wahr dirmitten im Ungemachwahr ihn desgleichen,lächelt dir hold das Glück.“
Horaz
Diese Zeilen aus einer Ode des Horaz hatteder SPÖ-Vorsitzende Bruno Kreiskyin seinem Arbeitszimmer in derWiener Löwelstraße hängen
INHALT
Vorbemerkung
1. Kindheit und Jugend
2. Die „Große Bewegung“
3. Häftling, Flüchtling
4. Exil in Schweden
5. Verzögerte Heimkehr
6. Staatssekretär und Staatsvertrag
7. Der Staatssekretär wird Außenminister
8. Vom Ballhausplatz in die Löwelstraße
9. Der Bundeskanzler
10. Der Nahe Osten rückt näher
11. Vom Wahlerfolg 1975 zum Wahltriumph 1979
12. Der internationale Friedensvermittler
13. Schatten über der letzten Legislaturperiode
14. Der lange Abschied
Danksagung
Quellen- und Literaturverzeichnis
Namensregister
VORBEMERKUNG
Dieses Buch hat eine lange Vorgeschichte. Und es hat sehr viel mit meiner eigenen Biografie zu tun: Seit ich politisch denken kann, ist die Figur Bruno Kreisky für mich gegenwärtig.
Während meiner Wiener Studentenzeit um das magische Datum 1968 herum – ich war über Intervention meines Glainacher Dorfpfarrers in einem katholischen Studentenheim untergekommen – bin ich erstmals Bruno Kreisky begegnet. Gemeinsam mit ein paar Mitbewohnern hatten wir den damaligen Oppositionsführer der SPÖ zu einem Vortrag ins Studentenheim eingeladen. Zweifellos eine Provokation, denn noch nie zuvor war ein sozialistischer Spitzenpolitiker dort aufgetreten. Eine Ungehörigkeit aus der Sicht der Heimleitung, ein politischer Affront für die vielen CVer des Heimes. Doch zum Verbieten sollte es damals nicht mehr reichen.
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre habe ich dann mehr als sechs Jahre lang als einer von Bruno Kreiskys Sekretären den „Dienst um die Person des Bundeskanzlers“ – wie es im Amtskalender der Republik heißt – versehen. Kreisky hatte 1976 meine kurze Analyse der damaligen österreichisch-jugoslawischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Kärntner Ortstafelkonflikt gelesen und mich kurze Zeit später wissen lassen, ich könne in seinem Kabinett mitarbeiten.
Der Bundeskanzler legte in seinem Büro keinen besonderen Wert auf eine strenge und systematische Aufteilung der anfallenden Arbeit. Jeder musste so ziemlich alles machen und vor allem stets zur Verfügung stehen. So konnte ich aus einer großen Palette der täglichen Themen weitgehend meine eigene Wahl treffen. Kreisky interessierte in erster Linie das Resultat, von wem es kam, war ihm in der Regel nicht so wichtig. In meinem Anfangsjahr, 1977, betreute ich etwa als Geschäftsführer die kurz zuvor eingeführte Presse- und Parteienförderung, kümmerte mich intensiv um das damals aktuelle Thema AKW Zwentendorf und um die spannende Kulturszene. Hinzu kamen bald enge Kontakte zu den Medien, bis ich schließlich 1981 auch formell Kreiskys Pressesekretär wurde.
In dieser zweiten Hälfte der Ära Kreisky konnte ich an seiner Seite die Höhepunkte seiner Laufbahn aus der Nähe miterleben: die Kehrtwendung nach der verlorenen Zwentendorf-Abstimmung 1978, den Wahltriumph 1979, seinen ungemein leidenschaftlichen Einsatz für die Lösung des Nahostkonflikts; und schließlich den schmerzlichen Niedergang: den Streit mit seinem präsumtiven Nachfolger und das Ende des jahrelang erfolgreichen Kreisky-Androsch Kurses, den Skandal um den Bau des Allgemeinen Krankenhauses, seinen sich stetig verschlechternden Gesundheitszustand. Und am Ende dann den Rücktritt nach dem Verlust der absoluten Mehrheit 1983.
In dieser langen, aufregenden, turbulenten, oft sehr schwierigen Zeit konnte ich Bruno Kreisky dabei beobachten, wie er an Probleme heranging, ihm dabei zusehen, wie er Politik machte.
Gerade als ehemaligem Pressesekretär ist mir bei der Abfassung dieser Biografie das Motto der New York Times in den Sinn gekommen: „All the News That’s Fit to Print.“ Der vorliegende Band ist allerdings in erster Linie eine politische Biografie, der die Schlüssellochperspektive meidet und mit intimen Enthüllungen, wenn es überhaupt etwas zu enthüllen gibt, sehr sparsam umgeht. Stets habe ich, seit ich für Kreisky gearbeitet habe, auch über die größeren Zusammenhänge seines Wirkens nachgedacht und herauszufinden versucht, wie dieser große Staatsmann „tickt“, was ihn motiviert. Zu meiner Zeit war er bereits im politischen Olymp angelangt, insofern ist mein Kreisky-Bild stärker beeinflusst vom bereits Erreichten. Wie aber ist er dorthin gekommen, was hat ihn in Österreich und weit darüber hinaus zum „Sonnenkönig“ und zum „Großen Zampano“ werden lassen?
Dieses Buch verspricht keine simplen politischen Antworten. Ebenso war der persönliche Umgang mit Bruno Kreisky nicht immer ganz einfach. Man musste sich immer im Klaren sein, wie man an ihn herankommen wollte, was man sagen würde, um eine brauchbare Antwort von ihm zu erhalten. Auch konnte Kreiskys Arbeitsweise, sein Verständnis des Politischen, durchaus widersprüchlich erscheinen. Sie war suchend angelegt. Besonders im Nahostkonflikt hatte er sich mit viel Geduld und Wissen umsichtig tastend an diesen schwierigen Komplex herangearbeitet. Informationen behandelte auch Kreisky als Machtinstrument und Manipulationsmasse, die es sorgfältig einzusetzen und abzuwiegen galt. Als durchaus visionär, wenn auch nicht unbedingt strategisch könnte man seine Politik charakterisieren; was ihn auszeichnete, war das rasche – raschere – Erkennen von Gelegenheiten.
Seine Position in Österreich als die beherrschende politische Persönlichkeit seiner Zeit – gestützt durch sein internationales Ansehen – hat sein Charisma nur noch verstärkt. In den späteren Jahren hat es kaum noch jemanden gegeben, der ihm ruhigen Tones zu widersprechen wagte. Vielfach bestimmte dann die Strahlkraft der Persönlichkeit sein Handeln, trieb seine Entscheidungen an, eröffnete ihm einen weiten Horizont nahezu unbegrenzter Möglichkeiten.
Naturgemäß machen meine eigenen Erfahrungen als Mitarbeiter Bruno Kreiskys nur einen kleinen Teil jener Quellen aus, aus denen ich schöpfen konnte. Es sind die zahllosen Gespräche mit nahezu allen Akteuren und Zeitgenossen der Ära Kreisky, die ich über viele Jahre geführt habe und die sozusagen das Grundmaterial zu diesem Buch ausmachen. Es sind aber auch meine eigenen Beiträge über Bruno Kreisky, die zum Fundus der Vorbereitungen für diese Biografie zählen. Beginnend mit dem Foto-Text-Band Bruno Kreisky, von Konrad R. Müller, Gerhard Roth und Peter Turrini, anlässlich des 70. Geburtstages, zu dem ich die erste – damals noch von ihm persönlich redigierte – Kurzbiografie verfasst habe, bis hin zu meinem 1995 bzw. 2000 veröffentlichten Beitrag „Bruno Kreisky, Ein politischer Essay“, der dem vorliegenden Band die inhaltliche Linie vorgibt. Gemeinsam mit Margaretha Kopeinig habe ich 2008 ein schmales Büchlein über Kreiskys Politik der Vollbeschäftigung verfasst, Das Kreisky Prinzip – Im Mittelpunkt der Mensch. Darin geht es um die Demaskierung des unsäglichen Vorwurfs, alle Schulden der Republik Österreich seien auf Bruno Kreisky zurückzuführen. Noch 2007 verwies ein Kurzzeit-Finanzminister in seiner Ratlosigkeit auf den „Kreisky-Malus“. Dessen Außenminister-Kollegin, eine Nutznießerin der Kreiskyschen Reformen, warnte noch Ende 2006 vor einer „Rolle rückwärts in die siebziger Jahre“.
Zu Kreisky, scheint’s, kann man auch heute – mehr als ein Vierteljahrhundert nach dessen Abtreten von der politischen Bühne – keine nüchterne Haltung einnehmen.
Diese Biografie unternimmt daher den Versuch, dem Politiker Kreisky in all seinen Dimensionen gerecht zu werden. Gerade als Mitarbeiter einer so beeindruckenden Persönlichkeit habe ich auch die Schattenseiten seiner Politik und Persönlichkeit unmittelbar miterlebt, gelegentlich miterlitten. Auch diese Aspekte sollen nicht verschwiegen werden. Kreiskys historischer Leistung tut dies gewiss keinen Abbruch.
Wie jede Biografie muss auch diese im sozio-kulturellen Kontext plaziert werden. Auch und gerade Kreiskys jüdische Abstammung, seine familiäre und seine – bei ihm so besonders wichtige – politische Sozialisation im mitteleuropäischen Kosmos Wiens der 1920er und 1930er Jahre haben seine Vision einer „Heimat Österreich ohne Pathos“ geformt. Insofern betrachte ich die präzise Nachzeichnung seiner Herkunft, der politischen und weltanschaulichen Strömungen seiner Jugendjahre für äußerst wichtig zum Verständnis seiner späteren politischen Entscheidungen.
Mehr als der Nationalsozialismus hat Kreisky die erbärmliche Episode des sogenannten Austrofaschismus emotional geprägt. Erst das Exil im demokratischen Schweden sollte ihm Mut für ein anderes Österreich einflößen. Kreiskys „kakanischer Möglichkeitssinn“ – den er sich von Robert Musil abgelesen hat – war in den Anfängen der demokratischen Republik wohl mehr Utopie als Vision. Erst mit seiner überraschenden Wahl zum Parteiobmann 1967 ist daraus – dank Kreiskys motivierenden Fähigkeiten – ein umfassendes Programm für ein modernes Österreich entstanden, das er in den 1970er Jahren mit einem engagierten Regierungsteam umzusetzen verstand.
Wenn es in Kreiskys politischem Leben einen zentralen Begriff gegeben hat, dann war dies die Vollbeschäftigung. „Die Menschen in Arbeit halten“, wie er es in seiner unvergleichlichen Wortwahl auszudrücken pflegte, war ihm Leit- und Lebensmotiv zugleich. Gerade weil er als überzeugter Aufklärer Sachpolitik vorangestellt hat, sind die Emotionen gelegentlich mit ihm durchgegangen. Auch davon handelt dieses Buch.
Womöglich erschließt sich der Zugang zu Kreiskys kreativen Gegensätzen und dialektischen Widersprüchen nicht zuletzt über seine Vorliebe für die Literatur. Nicht nur Musil oder, wie zu zeigen sein wird, Leo Perutz lieferten ihm Anregung, Ablenkung und Entspannung. Von seinen vielfach verwendeten Zitaten aus Dichtung, Geschichte und Politik ragen für mich zwei hervor. Der erste Merksatz aus einer Ode des Horaz ist diesem Buch vorangestellt. Der zweite – für die Ergründung von Kreiskys Psyche womöglich noch wichtigere – stammt aus Don Carlos von Friedrich Schiller: „Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird.“
Daran muss der Achtundsiebzigjährige wohl auch in den Tagen des europäischen Umbruchs 1989/90 oft gedacht haben, als er „zehn Jahre jünger“ sein wollte.
Damals wurde Bruno Kreisky auch an die von ihm so oft zitierte Weisheit erinnert, wonach der Sinn des Lebens im Unvollendeten zu suchen sei.
Paris, im September 2010
1. Kapitel
Kindheit und Jugend
1.
„Zehn Jahre jünger müsste man sein …!“, sinnierte der vom Alter und seiner schweren Krankheit gezeichnete Bruno Kreisky in einem unserer letzten Gespräche, wenige Tage nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Mit resigniertem Bedauern über seine altersbedingte Gebrechlichkeit, jedoch geistig auf der Höhe der Zeit, verfolgte der bedeutendste Staatsmann der Zweiten Republik die sich überstürzenden politischen Ereignisse der historischen Zeitenwende 1989.
Wenige Monate später, am 29. Juli 1990, ist er neunundsiebzigjährig in seiner Geburtsstadt Wien gestorben. Der Kalte Krieg, der Kreiskys mehr als dreißigjährige politische Karriere als Staatssekretär und Außenminister, Parteichef der SPÖ und Vizepräsident der Sozialistischen Internationale, Führer der Opposition und am längsten dienender Bundeskanzler der Republik Österreich geprägt hatte, war mit dem Fall der Berliner Mauer zu Ende gegangen. Der Zerfall des sowjetischen Imperiums, das Ende des großen Ringens der Ideologien zwischen Ost und West war aber nicht bloß der letzte Bruch in einem an biografischen und politischen Umbrüchen reichen Leben. Der Kalte Krieg war auch, so muss man es wohl sehen, der letzte Ausläufer jenes 19. Jahrhunderts, das die Themen des 20. vorgegeben hatte: Nationalismus, Sozialismus, Faschismus. Sie bildeten die ideologischen Konstanten im ereignisreichen Leben Bruno Kreiskys.
2.
Bei seiner Geburt im fünften Wiener Gemeindebezirk, am 22. Jänner 1911, hatte das Habsburgerreich, die k. u. k. Monarchie Österreich-Ungarn, noch knapp acht Jahre, davon vier Kriegsjahre, bis zu ihrem endgültigen Untergang vor sich. Bruno Kreiskys Familienbiografie reicht weit zurück in Geschichte und Geografie dieses multiethnischen Imperiums. „Ich habe mich immer als Ergebnis jenes gewaltigen melting pot gefühlt, der die Monarchie nun einmal war“, hielt Kreisky in seinen 1986 erschienenen Memoiren Zwischen den Zeiten fest, „als Ergebnis einer brodelnden Mischung von Deutschen, Slawen, Magyaren, Italienern und Juden.“ Aber auch das politische Spektrum der Familienmitglieder auf väterlicher wie auf mütterlicher Seite erscheint so uneinheitlich, wie die Donaumonarchie vielfältig war.
Urkundlich erwähnt sind die Kreiskys erst um 1780: als Bewohner des mährischen Ortes Kanitz (Kanice) nahe Brünn. Allerdings gibt es die Theorie einzelner Stammbaum-Forscher, der Familienname Kreisky könnte auf die katalanisch-sephardischen Gelehrten Abraham und dessen Sohn Jehuda Cresques zurückgehen. Sie seien, als König Pedro IV. den Juden 1381 das Tragen des „Gelben Flecks“ verordnete und sie mit der Inquisition bedrohte, in das Königreich Böhmen ausgewandert. Bruno Kreisky betrachtete diese Annahme allerdings mit der für ihn so typischen Skepsis: „Alle Juden wollen Spaniolen sein.“ Er begnügte sich mit der Deutung, das tschechische Wort krajský bedeute „am Kreis“, der Name sei mithin dem um 1780 nachweislich registrierten Jakob Kreisky gegeben worden, nachdem Kaiser Karl VI. 1727 „Familiantengesetze“ eingeführt hatte, um die Zahl der jüdischen Einwohner zu beschränken: In einem Landkreis durfte sich jeweils nur eine behördlich bestimmte Anzahl jüdischer Familien niederlassen.
Jakob Kreisky wurde Hausbesitzer in der Judengemeinde von Kanitz. Er hatte zwei Söhne, die zwei unterschiedliche Linien begründeten: Bernard wurde Lehrer an der örtlichen Schule, sein Bruder Moses aber Berufssoldat, der unter Feldmarschall Radetzky diente. Bernards Nachkommen waren überwiegend Lehrer; es hielt sie nicht in Kanitz, sie zogen nach Böhmen und nach Wien, während Moses’ Nachkommen mehrheitlich politisch konservative Gewerbetreibende, Kaufleute und Techniker waren, die ihre Heimat Kanitz in der Regel nicht verließen.
Benedikt, Bruno Kreiskys Großvater väterlicherseits, den der junge Enkel besonders liebte, wurde Oberlehrer und später stellvertretender Direktor der Lehrerbildungsanstalt Budweis. Seine Gattin Katharina, geborene Neuwirth, war eine der ersten Lehrerinnen Mährens. Das Ehepaar hatte zehn Kinder. In späteren Jahren zogen Brunos Großeltern nach Wien und wohnten im Bezirk Fünfhaus. Benedikt Kreisky war politisch keineswegs sozialistisch eingestellt, er bezeichnte sich als Deutsch-Freiheitlicher und soll nicht selten bemerkt haben: „Gott sei Dank kommen die Sozis nie ans Ruder!“
Benedikt und Katharinas 1876 geborener Sohn Max – Bruno Kreiskys Vater – absolvierte die Höhere Technische Textilschule in Brünn und schaffte den Aufstieg zum Generaldirektor der Österreichischen Wollindustrie und Textil A.G. mit Sitz in Wien. Als angesehener Manager berief man ihn zum Zensor der Österreichischen Nationalbank. Ehe er 1944 im schwedischen Exil starb, leitete er dort noch zwei Jahre lang eine Textilfabrik. Max Kreisky, der nie Sozialdemokrat wurde, war dennoch ein Mann mit sozialem Gewissen, der seine Ideale von Freiheit und Brüderlichkeit bei den Freimaurern1 suchte. Er nahm unter anderem an der Aktion der Industrieangestellten zur Durchsetzung der vollen Sonntagsruhe teil, wurde Mitglied des Zentralvereins der kaufmännischen Angestellten, und es gelang ihm – als Vorsitzendem eines Schiedsgerichts – einen langwierigen Streik zu beenden. Er war ein bürgerlicher Liberaler, ein Mann von vornehmer Gesinnung, der Politik und Kultur seiner Zeit aufmerksam verfolgte, ohne aber über sein standespolitisches Engagement hinaus politisch aktiv zu werden. Als Freimaurer verfügte er über viele Kontakte zu führenden Persönlichkeiten der Hauptstadt, er kannte vermutlich Arthur Schnitzler und verkehrte regelmäßig mit einer Reihe prominenter Journalisten und Intellektueller.
Die Beziehung zu seinem „strengen und gütigen“ Vater beschrieb Bruno Kreisky als innig. Auch wenn sie nicht einer gewissen Sprödigkeit entbehrte, hatte er ihn „sehr gern“. Wohl auch deshalb, weil der Vater der politischen Betätigung seines Sohnes viel Verständnis entgegenbrachte. In der Zeit der illegalen politischen Aktivitäten des jungen Kreisky und seiner damit verbundenen Inhaftierung durch die Austrofaschisten sollte diese tolerante Haltung des Vaters eine ernste Bewährungsprobe erleben.
Kein Wunder, dass der andere Kreisky-Zweig, die Nachkommen von Moses Kreisky, ihre Verwandten gerne als „die Roten“ bezeichneten: Rudolf Kreisky, Max Kreiskys jüngster Bruder, war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und leitender Funktionär der sudetendeutschen Konsumgenossenschaften. „Er war in meinen Augen der hervorragendste und derjenige, der mich eigentlich zur Sozialdemokratie hingeführt hat, soweit es noch eines Hinführens bedurfte“, erinnert sich Bruno Kreisky in seinen Memoiren. Der beginnende industrielle Kapitalismus produzierte Wohlstand, die Dynamik der Veränderung schuf aber auch neue soziale Fragen, die der junge Bruno in den frühen zwanziger Jahren auf den Fußwanderungen mit seinem Onkel in den verelendeten Dörfern des Böhmerwaldes und des Riesengebirges kennenlernte. Das angewandte Modell der Genossenschaften, wie es Rudolf Kreisky vertrat, schärfte den Blick des Kindes aus wohlhabendem Haus für die Veränderbarkeit gesellschaftlicher Ungleichheit. Rudolf überlebte den Zweiten Weltkrieg in England und kehrte nach Kriegsende nach Prag, später nach Wien zurück, wo er 1966 starb.
Zwei Brüder von Max Kreisky, Oskar und Otto, Lehrer der eine, Advokat der andere, waren Mitglieder einer schlagenden Verbindung und machten aus ihrer deutsch-freiheitlichen Einstellung nie ein Hehl. Ein dritter deutsch-freiheitlicher Onkel Bruno Kreiskys, Ludwig, auch er Lehrer, setzte sich mit Nachdruck für die Erhaltung des Deutschtums in Böhmen ein. Oskar Kreisky gelang die Flucht nach Amerika, wo er ein jüdisches Behindertenheim leitete. Er kam 1955 nach Wien zurück, behielt aber bis zu seinem Tod im Jahre 1976 die amerikanische Staatsbürgerschaft bei. Ludwig und Otto hingegen wurden trotz ihrer deutschfreundlichen Gesinnung – in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten umgebracht.
Fünfundzwanzig seiner engsten Verwandten, so errechnete der ehemalige Bundeskanzler, kamen durch den Naziterror um: Sie wurden vergast, verschleppt, vertrieben, erschossen, enthauptet. Kreisky resümierte: „Ich kann sagen, dass meine beiden Familien den Nazismus in seiner grauenhaftesten und umfassendsten Form erfahren haben und dass nur wenige von uns übrig geblieben sind. Über die Welt verstreut, trifft man hier und da den einen oder anderen. Jedesmal, wenn jemand herumzudividieren beginnt, ob das vier oder sechs Millionen gewesen seien, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind, kann ich trotz eines gewissen Verständnisses für die Schwächen der Menschen nur sagen: Von den mir Nahestehenden wurden so viele umgebracht, dass Zahlen mich nicht mehr interessieren.“
Eine Schwester Max Kreiskys, Brunos Tante Rosa, wanderte rechtzeitig nach Palästina aus, sie hat den Krieg in Tel Aviv überlebt. Ihr Sohn Viktor war Zionist der ersten Stunde, ein Anhänger Zeev Jabotinskys, der, wie Bruno Kreisky sich Jahrzehnte später erinnern sollte, „einen ganzen Sommer hindurch mit viel Geschick versucht (hat), mich für den Zionismus zu begeistern. Der Erfolg war, dass ich mich für diese Richtung zwar zu interessieren begann, sie aber ablehnte.“
Ganz anders sein vierzehn Monate älterer Bruder Paul: Er litt unter dem wachsenden Antisemitismus schon in der Ständestaat-Zeit und entschloss sich 1938 zur Flucht nach Palästina; seine Sehnsucht war schon lange das „Land der Juden“ gewesen. Dort nannte er sich Schaul und hatte kaum mehr Beziehungen zu seinem Bruder, was viele Jahre später zu gehässigen Vorwürfen gegen den Bundeskanzler in der Sensationspresse führen sollte. In Wahrheit hat Bruno Kreisky seinen Bruder über Jahrzehnte hinweg finanziell unterstützt und war darum besorgt, ihm in Israel ein Leben in Würde zu ermöglichen. Paul war wegen früher Krankheiten und einer Kopfverletzung durch einen Schulkameraden immer das Sorgenkind der Familie gewesen. Die Eltern bemühten sich mit aller Macht, das bedrückende Schicksal ihres ältesten Sohnes zu mildern. Viel Geld und Zeit wurde aufgewendet, die neuesten Erkenntnisse der Medizin wurden aufgeboten, und eine Zeitlang hoffte der Vater, mit Hilfe des Individualpsychologen Alfred Adler die Entwicklung seines Ältesten positiv beeinflussen zu können. Die Psychologin und Pädagogin Stella Klein-Löw erinnert sich in diesem Zusammenhang: „Als Bruno Kreisky vierzehn Jahre alt war, widmete er seinem Bruder viel Zeit und Geduld. (…) Statt zu spielen und zu sporteln“ habe er Paul in seiner Freizeit für „Stunden und Stunden in bewundernswertem, für sein Alter fast unglaublichem Einfühlungsvermögen“ zur Seite gestanden.
Ein von Bruno Kreisky hochverehrter Großonkel, der Bruder seiner Großmutter Katharina, war Joseph Neuwirth, der bis dahin einzige aktive Politiker der großen Familie Kreisky. Lange Jahre hindurch diente er als Vertreter der Brünner Handelskammer im Abgeordnetenhaus. Der langjährige Abgeordnete der Liberalen im Wiener Reichstag, ein Mitbegründer der Neuen Freien Presse und Verfasser zahlreicher wirtschaftspolitischer Abhandlungen, erntete große Hochachtung für seine Reden und Schriften zum Budget und zur Volkswirtschaft. Kaiser Franz Joseph wurde sein Name sogar einmal als möglicher Finanzminister vorgeschlagen. Neuwirth bekannte sich als konfessionslos, eine Haltung, die der Kaiser keineswegs guthieß; er strich ihn denn auch aus der Ministerliste mit den Worten: „Da wär’ mir schon lieber, er wär’ a Jud.“
Irene Felix, Paul und Bruno Kreiskys Mutter, heiratete Max Kreisky im Jahre 1909. Sie war eines von sechzehn Kindern, stammte aus Znaim in Mähren, wo ihr Vater – Kreiskys Großvater Moritz Felix – zusammen mit seinem Cousin Herbert Felix die Basis für einen bedeutenden Konservenkonzern schuf. Ein Unternehmen, das seine Waren, vornehmlich eingelegte Gurken und Sauerkraut, weit über die Grenzen der Monarchie hinaus exportierte. Irene Felix brachte eine beachtliche Mitgift in die Ehe, die den komfortablen Wohlstand der Kreiskys absicherte. Sie besorgte die Erziehung der beiden Söhne, führte den Haushalt und überwachte die Hausangestellten und Kindermädchen. Bruno erlebte sie als eine „unendlich gütige Frau“, die mit ihm aber wenig anzufangen wusste: „Der Liebling meiner Mutter war eigentlich mein Bruder Paul.“ Sie deckte jedoch immer Brunos Jugendstreiche: „Sie wusste mit fast instinktiver Sicherheit, wann ich in der Schule war und wann nicht.“ Sein früh einsetzendes politisches Engagement verfolgte sie hingegen mit leidendem Unverständnis. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1969 hat ihr zweitgeborener Sohn im Grunde nie zu einem besonders innigen Verhältnis zu seiner Mutter gefunden.
Seit den Zeiten Wallensteins sind Irene Felix’ Vorfahren in Mähren urkundlich nachweisbar, etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts brachten sie es dort auch zu beträchtlichem Wohlstand. Bereits 1694 wird der Name Felix in einem Empfehlungsschreiben einer Gräfin von Zierotin-Waldstein erwähnt, für die ein früher Ahne im mährischen Ort Trebitsch acht Jahre lang als Bader tätig war. In dem Geleitbrief, den die Reichsgräfin ihm mitgab, als er sie verließ, heißt es, dass er mit seinen ärztlichen Kenntnissen „mit profitio Christ und Jud“ gedient habe und daher jedem „männiglich bestens rekommandieret“ werden könne. Später wirkte er als Wundarzt und Chirurg.
In einem Gespräch, das Bruno Kreisky kurz vor seinem Lebensende mit der Fotografin Herlinde Koelbl führte, brachte er die Details seiner Herkunft wie folgt auf den Punkt: „Mein Vater stammt aus einer kleinbürgerlichen Beamtenfamilie. Meine Mutter stammt aus einer besser situierten Familie, in der die intellektuellen Berufe überwogen. Viele ihrer Vorfahren waren Ärzte. Die ersten Ärzte dieser Ahnenreihe sind offenbar aus Spanien eingewandert, haben sich in der Wallensteinischen Zeit bei der Reichsgräfin Zierotin-Waldstein im mährischen Trebitsch Verdienste erworben und sind dort in den Strudel des Dreißigjährigen Krieges geraten.“
In Trebitsch, unweit der Städte Znaim und Brünn, war seit dem Mittelalter eine Judengemeinde von beachtlicher Größe angesiedelt. Solche Gemeinden hatten überall in Böhmen und Mähren, nach Vertreibungen und Pogromen anderswo, bessere Lebensverhältnisse, größere religiöse Toleranz und mehr gesellschaftliche Akzeptanz vorgefunden, als dies etwa in den östlichen Teilen der Monarchie oder gar in Russland der Fall gewesen war. Seit den Reformen Kaiser Josephs II., Ende des 18. Jahrhunderts, fühlten sich die Juden Böhmens und Mährens mehr und mehr dem „deutschen Kulturkreis“ zugehörig. Das Haus Habsburg wurde als zivilisierende Macht gesehen, die Loyalität zu Krone und Kaiserhaus war bei den jüdischen Bewohnern dieser Landesteile daher besonders ausgeprägt.
Ein Nachkomme des erwähnten Urahnen der Familie Felix, Moritz Felix’ Vater Salomon, war ursprünglich Feldarzt, gab seinen Beruf jedoch auf, als er 1842 die kaiserliche Erlaubnis erhielt, Bier zu brauen und Branntwein herzustellen. Hundert Jahre später sollte die Familie, die seit Generationen in Böhmen und Mähren ansässig war und sich als Deutsche fühlte, von der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nicht verschont bleiben: Die meisten Geschwister und Verwandten Irene Kreiskys sind in den Vernichtungslagern umgekommen; nur wenigen gelang die Flucht. Eine dieser Ausnahmen war Bruno Kreiskys Cousin und Lieblings-Verwandter, der geschäftstüchtige Herbert Felix, ein Neffe von Irene Kreisky, der rechtzeitig eine Niederlassung des Konzerns in Schweden gegründet und diese mit zuletzt tausend Angestellten zum zweitgrößten Konservenunternehmen des Landes ausbauen sollte. Als er 1973 starb, hinterließ er ein beträchtliches Vermögen.
Der letzte Firmenchef in der bis 1939 noch freien Tschechoslowakei war Herberts Vater Friedrich Felix, Irenes jüngster Bruder; man deportierte ihn von Znaim zunächst nach Theresienstadt und dann weiter nach Auschwitz. Ein anderer ihrer Brüder, Julius Felix, ließ sich taufen. Er wurde Richter und Vizepräsident am Wiener Handelsgericht. „Was soll mir passieren?“, sagte er oft, „niemand weiß, dass ich vorher Jude war.“ Am Tag, da ihn eine Vorladung zur Gestapo ereilte, holte er seine besten Weine aus dem Keller und lud seine engsten Freunde ein. Am nächsten Morgen fand ihn seine Wirtschafterin tot im Bett – er hatte Selbstmord begangen.
3.
Bruno Kreisky muss ein frühreifes Kind gewesen sein: einen Tag nach Ende des Ersten Weltkriegs las der damals Siebeneinhalbjährige der tschechischen Köchin der Familie – während sie den Ofen saubermachte – den Leitartikel aus der Neuen Freien Presse vor: „Plötzlich merkte ich, dass Marie gar nicht zuhörte“, erinnert er sich. „Ihr genügte die Mitteilung, dass nun der Friede gekommen sei. Ich werde nie ihre Worte vergessen, dass ich das Lesen einstellen könne: ‚Wer weiß, für was gut ist!‘ “
Kreisky bezeichnete sich selbst im Rückblick als „Epigone des alten Österreich“. Dies keineswegs aus nostalgischer Hinneigung zu der siebenhundertjährigen Herrschaft der Habsburger, sondern aus dem Bedauern über den Untergang eines übernationalen staatlichen Gebildes. Die österreichische Politik im Kaiserstaat habe die großen historischen Möglichkeiten niemals genützt, empfand Kreisky, sie stellte sich ihm als „ein tragisches Gewebe aus Trugschlüssen, Missverständnissen und verpassten Gelegenheiten“ dar. Wäre diese große Wirtschaftsund Kulturgemeinschaft imstande und willens gewesen, ihre Möglichkeiten zu nützen, so meinte er, wären Europa die Katastrophen des 20. Jahrhunderts wohl erspart geblieben.
Den Tod Kaiser Franz Josephs, der Österreich-Ungarn achtundsechzig Jahre lang regiert hatte, erlebte Bruno Kreisky im November 1916 bewusst mit, obwohl er damals noch nicht fünf Jahre alt war: „Der Leichenzug führte durch Mariahilf, und die Kinder in den Bezirken, durch die er von Schönbrunn zur Stadt hineinzog, mussten Spalier stehen. Es war ein eiskalter, grausiger Tag, und wir froren entsetzlich. Als der Trauerkondukt endlich herankam, schien es mir, als fülle sich die ganze Welt mit Schwarz.“
Er hatte die Not und das Elend des Weltkriegs in den Straßen der Stadt gesehen. Die Verwundetentransporte zu den vielfach in Schulen untergebrachten Lazaretten, die ungezählten Kriegsinvaliden und Bettler im bürgerlichen Wohnbezirk seiner Eltern übten einen prägenden Eindruck auf ihn aus. „Der Krieg ließ uns rascher alt werden“, erinnerte er sich an jene Zeit des Untergangs der alten Ordnung. „Den Glanz der Monarchie, von dem meine Eltern erzählten, habe ich nicht erlebt. Für mich war der ganze Pomp der Monarchie nur düster.“
Das Auseinanderbrechen des Habsburgerreiches löste einen Schock aus, dessen Ausmaße man sich hundert Jahre später, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, kaum vorstellen kann. Aus der einstigen Großmacht Österreich-Ungarn war „ein halbes Dutzend Ohnmächte“ geworden und das kleine deutschsprachige Kernland ein Rumpf, dem man nicht zutraute, jemals aus eigener Kraft lebensfähig zu sein. Wien aber war mit seinen prunkvollen, zunächst beinahe leerstehenden Regierungsgebäuden, den zahllosen arbeitslosen Beamten und Berufssoldaten zum „Wasserkopf“ verkommen. Die ehemalige Hauptstadt eines blühenden Imperiums mit 53 Millionen Einwohnern wirkte mit einem Mal wie eine ärmliche Provinzstadt.
In den ersten Monaten nach Kriegsende wurde die Situation immer dramatischer: Der Ausbruch der Spanischen Grippe im Jahr 1918 forderte allein in Österreich Zehntausende Opfer, dazu gesellten sich Hungersnöte, Mehlkürzungen, Brotknappheit. Es war keine Kohle mehr vorhanden, da die neu gegründete Tschechoslowakei die Lieferungen eingestellt hatte; die Menschen froren bitterlich.
„Nach aller irdischen Voraussicht konnte dieses von den Siegerstaaten künstlich geschaffene Land nicht unabhängig leben“, schrieb Stefan Zweig in seinen Erinnerungen, „und alle Parteien, die sozialistische, die klerikalen, die nationalen, schrien es aus einem Munde – wollte gar nicht selbständig leben. (…) Einem Lande, das nicht existieren wollte – Unikum in der Geschichte! – wurde anbefohlen: ‚Du musst vorhanden sein!‘ “
Einen Tag nach der Abdankung Kaiser Karls I. von Österreich, Königs von Ungarn – er verließ an diesem 12. November 1918 mit Gemahlin Zita seine Heimat für immer – wurde vor dem Wiener Parlamentsgebäude durch die Präsidenten der Nationalversammlung, Franz Dinghofer und Karl Seitz, die Republik Deutschösterreich ausgerufen. Hunderttausende strömten aus allen Bezirken der Stadt zusammen, versammelten sich zwischen Rathaus und Oper. Es brach sogar eine kleine, von sogenannten „Roten Garden“ angeführte Revolution aus: Nach Ausrufung der Republik hissten sie rote Flaggen, hatten aus den gerade erst fabrizierten rotweißroten Österreichfahnen die weißen Streifen herausgerissen. Plötzlich brach Tumult aus, das Gerücht kursierte, auf dem Dach des Parlamentsgebäudes sei ein Maschinengewehr postiert, um auf die Revolutionäre zu feuern. Es kam zu einem Schusswechsel, im panischen Gedränge wurden zwei Menschen tödlich verletzt, zahlreiche Kundgebungsteilnehmer erlitten schwere Verletzungen. „Zweihundert entschlossene Männer hätten damals Wien und ganz Österreich in die Hand bekommen können“, heißt es bei Stefan Zweig. „Aber nichts Ernstliches geschah.“
Schon am nächsten Tag hatte sich die Lage beruhigt; soziale Unruhen und Revolten sollten das Land allerdings noch jahrelang nach dem Zusammenbruch erschüttern. Der auf die Republik verheerend wirkende Friedensvertrag von Saint-Germain – die Bezeichnung „Deutschösterreich“ wurde von den Siegeralliierten verboten –, der Bruch der Koalition zwischen Sozialisten, Christlichsozialen und Deutschnationalen im Jahr 1920, die Etablierung restaurativer, bürgerlich-klerikaler Kräfte, dies alles führte zu einer ungeheuren Polarisierung in jenem Staat, von dem man später sagen sollte, dass ihn keiner wollte.
Zur „Anschlussfrage“ der kleinen Republik Österreich an das Deutsche Reich hatte Bruno Kreisky – im Rückblick auf die Erste Republik – eine eher distanzierte Haltung. Er unterschied sich darin von seinem Idol Otto Bauer, dem großen Theoretiker und Politiker, dem Führer der Sozialdemokraten und Nachfolger des Gründers der österreichischen Sozialdemokratie, Victor Adler. „Eine der stärksten Triebkräfte des Anschlussgedankens war die österreichische Sozialdemokratie“, hält Kreisky fest; Otto Bauer habe sich immer nur als österreichischer Deutscher verstanden. Bis zur Machtergreifung Hitlers hatte die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), die übrigens ab 1920 in die Opposition verbannt war, die Anschlussforderung in ihrem Programm, und das Zentralorgan Arbeiter-Zeitung behielt bis zu ihrer Einstellung durch den Ständestaat 1934 „Deutsch-Österreich“ im Untertitel.
Als der Vertrag von Saint-Germain 1919 am Anschlussverbot festhielt, trat Bauer als damaliger Staatssekretär für Äußeres zurück. Selbst noch nach der nationalsozialistischen Annexion 1938 war er gegen eine Rückgängigmachung dieses so nicht gewollten „Anschlusses“ und hoffte auf eine „gesamtdeutsche Revolution“. Kreisky hat immer betont, den Anschlusswunsch weder in der Ersten Republik noch in der Zeit des Austrofaschismus oder gar in der Zeit danach akzeptiert zu haben. Als junger Funktionär sei er auch in den frühen Jahren in seiner Bildungsarbeit in der SDAP kein einziges Mal für das Thema „Anschluss“ in politisch militanter Weise eingetreten.
4.
Bruno Kreiskys Schulzeit war von der spürbaren Armut der meisten seiner Klassenkameraden geprägt, wenn auch seine eigene Kindheit von materiellen Sorgen frei war. Er stellte seinem Vater nicht selten die Frage, woran es denn liege, dass manche Menschen bettelarm, andere aber wohlhabend seien. Max Kreisky bemühte sich, seinem Sohn Erklärungen dafür zu geben, meinte sogar, die meisten Menschen seien an ihrer Armut keineswegs allein schuld, Antworten, die den Heranwachsenden allerdings nur partiell befriedigten.
Er war behütet von Kindermädchen, die seine Eltern aus Böhmen oder aus dem kärntnerischen Gailtal, wohin sein Vater berufliche Kontakte unterhielt, nach Wien holten. Ebenso wie die anderen Hausangestellten gehörten sie zur Familie. Ihnen allen bewahrte er „eine lichte und freundliche Erinnerung, denn sie haben es mit uns immer gut gemeint und besonders mit mir“.
Die Erziehung, die er in der weitläufigen, großbürgerlich eingerichteten Wohnung seiner Eltern in der Schönbrunner Straße 1222 genoss, war aufgeschlossen und liberal. Was Vater und Mutter offenbar nicht ahnten: Schon als Siebenjähriger, kurz vor Kriegsende, schloss er sich nach der Schule einer Gruppe von Kindern an, die sich in den Elendsvierteln der Vorstädte herumtrieb. Er stieß dort auf Deserteure und Unterweltler, beobachtete mit wachsender Neugierde das Wiener Lumpenproletariat. Dem Anführer der Bande, einem Buben, der zehn Jahre älter war als er, lieferte er, es ist kaum vorstellbar, Messingschnallen aus dem Kreiskyschen Haushalt ab, aber auch Zucker in rauen Mengen, damals ein Artikel, der am Schwarzmarkt besonders teuer gehandelt wurde. Körperliche Züchtigung erfuhr er nur ein einziges Mal: Seine Mutter hatte eines seiner Beute-Verstecke entdeckt, im Winter begann der Zucker hinter dem Ofen zu stinken. „Die Köchin legte mich übers Knie und verabreichte mir eine empfindliche Tracht Prügel.“
Da ihm sein Großvater, der Lehrer Benedikt Kreisky, sehr früh das Lesen und Schreiben beigebracht hatte, las er als Kind ungemein gerne und viel – am liebsten Grimms und Andersens Märchen –, seinen Klassenkameraden war er dadurch immer weit voraus. „Merkwürdigerweise“ las er „nie eine Zeile von Karl May“, allerdings mit besonderer Begeisterung Harriet Beecher-Stowes „Onkel Toms Hütte“, später mit Faszination eine vielbändige Ausgabe von Ullsteins Weltgeschichte, die ihm sein Vater zum vierzehnten Geburtstag schenkte.
In den Memoiren bleibt unerwähnt, dass Brunos Großvater Benedikt Kreisky dem Enkel die hebräischen Buchstaben beigebracht hat. Er konnte als Kind Hebräisch lesen und auch ein wenig schreiben, wie aus einem Interview hervorgeht, das die österreichische Autorin und Journalistin Barbara Taufar in den 1990er Jahren mit der israelischen, aus Pressburg gebürtigen Chefredakteurin der israelischen Tageszeitung Davar Hanna Semer geführt hat. Frau Semer erinnert sich: „Er hat mir gesagt, dass seine Eltern schon konfessionslos waren und dass er eigentlich nie eine jüdische Erziehung gehabt hat, außer von seinem Großvater, der ihn Hebräisch lesen gelehrt hat. Also er kann die Buchstaben lesen. Das hat damals mit dem Gebet zu tun gehabt. Er kann nicht beten, und er kann nicht schnell lesen, aber er kann die Buchstaben identifizieren, weil ihn sein Großvater das gelehrt hat. Aber außer dem hat er überhaupt vom Judentum keine Ahnung gehabt und wurde nicht dazu erzogen, wurde nicht in diesem Geiste von seinen Eltern erzogen. Und deshalb findet er nicht, dass er sich irgendwie vom Judentum mehr entfernt hat, als es seine Eltern getan haben.“
Als er 1921 ins Gymnasium kam, galt er als der große Rädelsführer. „Der Kreisky“, hieß es seitens seiner Lehrer, „ist ein reiner Bösewicht.“ Er trieb es so weit, dass man ihn schließlich, sehr zum Ärger seines Vaters, der Schule verwies. Er ließ sich in ein Gymnasium im dritten Wiener Gemeindebezirk versetzen, wo er – trotz zahlloser Abwesenheitstage – im Jahr 1929 die Matura ablegen sollte.
5.
Bruno Kreisky, der Spross einer assimilierten bürgerlich-jüdischen Familie, wuchs also konfessionslos auf. Viele Juden waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der urbanen Ausstrahlungskraft des kaiserlichen Wien gefolgt und hatten damit zur geistig-kulturellen Revolution des Fin de Siècle Entscheidendes beigetragen. Die aufgeklärten jüdischen Zuwanderer hofften, hier ihre Diaspora beenden zu können. Im Schutz der Metropole waren sie auch bereit, die alten Traditionen vollends aufzugeben; die Assimilation wurde vielfach nur noch als konsequenter letzter Schritt in eine scheinbar vollständige gesellschaftliche Emanzipation empfunden.
Zwar verleugnete man im Hause Kreisky sein Judentum nicht, tat Religion aber schlicht als unerheblich und gesellschaftlich irrelevant ab. Konfessionelle Unterschiede zu thematisieren erachtete man als „unfein“, so wie man auch nicht über Geld sprach. Mit der ostjüdischen, streng orthodoxen Gemeinde, die auf der sogenannten „Mazzesinsel“ im zweiten Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt lebte, gab es keinerlei Berührungspunkte. Im Gegenteil, man schämte sich dieser armseligen Glaubensbrüder, die zu großen Teilen vor den Pogromen im slawischen Osten geflohen waren. Man verleugnete gleichsam ihre Existenz, als habe man mit ihnen nicht das Geringste gemein. Ein gewisses Überlegenheitsgefühl gegenüber den Schtetl-Juden aus Galizien und der Bukowina, ein leicht überhebliches Selbstverständnis machte sich vielmehr breit, zur gesellschaftlichen Avantgarde der Großstadt zu gehören. Sigmund Freud und Karl Kraus, Peter Altenberg, Arthur Schnitzler, Theodor Herzl und Egon Friedell, Gustav Mahler und Arnold Schönberg, sie alle gehörten zu dieser aufgeklärten, assimilierten jüdischen Gesellschaft Wiens, und sie alle verdrängten die Leopoldstadt mit ihren streng religiösen Ghettobewohnern, die weniger als einen Kilometer von den Kaffeehäusern und Salons entfernt lebten, in denen sie in aller Mondänität verkehrten.
„Selbst wenn ich es wollte, ich könnte meine jüdische Herkunft nicht verleugnen“, pflegte Kreisky später zu sagen, bezeichnete sich aber als Agnostiker und setzte sich gegen „Vereinnahmungen“ durch Exponenten des Judentums zur Wehr, man denke nur an seine hasserfüllten Auseinandersetzungen mit Simon Wiesenthal, von denen noch ausführlich die Rede sein wird. Sein sehr persönlich bestimmtes Verhältnis zum Judentum, das auch nach 1945 von den Vor-Holocaust-Erfahrungen bestimmt geblieben war, sollte während seines späteren politischen Lebens eine Quelle des Konflikts, aber auch großer Missverständnisse bleiben. Eines jedoch steht fest: In den Matriken der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien findet sich ein Eintrag, Dr. jur. Bruno Kreisky sei am 13. Oktober 1931 aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten.
1 Im Freimaurermuseum in Rosenau, Niederösterreich, ist ein Foto ausgestellt, auf dem Max Kreisky abgebildet ist.
2 Bruno Kreisky wurde in dieser Wohnung auch geboren, die Hebamme wohnte im selben Haus.
2. Kapitel
Die „Große Bewegung“
1.
Bruno Kreiskys politische Neugierde, seine Begierde, die gesellschaftlichen Realitäten der Nachkriegszeit zu begreifen, zu analysieren, setzte sehr früh in seinem Leben ein. Im Jahr 1924, als 13-Jähriger, nahm er erstmals an einer Demonstration teil. Die Vereinigung sozialistischer Mittelschüler hatte zu einer Protestveranstaltung vor dem Gebäude des Wiener Stadtschulrats aufgerufen, nachdem ein Gymnasiast die Schikanen eines seiner Professoren nicht mehr ertragen und sich aus der elterlichen Wohnung zu Tode gestürzt hatte.3 Unmittelbar nach dieser Kundgebung trat Kreisky der Vereinigung sozialistischer Mittelschüler bei. Zunächst bedeutete diese Mitgliedschaft vor allem eine Art Wandervogeldasein, man fühlte sich als Teil einer großen Aufbruchbewegung, die vor allem im benachbarten Deutschland sehr viele jugendliche Anhänger hatte.
„Raus aus der Stadt!“, lautete damals eines der zentralen Leitmotive der Jugend. Ob deutschnationale Wandervögel, katholische Neuländer, ob Sozialisten oder junge Zionisten: Sie alle hatten eine zivilisationskritische Grundhaltung, verknüpft mit politischen Utopien, wie etwa die „klassenlose Gesellschaft“. Zumeist waren die Gruppen militärähnlich organisiert und von charismatischen Führern geleitet.
An Wochenenden traf sich der Wanderbund, dem Bruno Kreisky angehörte, und fuhr in die Natur, man übernachtete in Zeltlagern; der Heranwachsende genoß das Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn er es auch bedauerte, zunächst noch kaum politisch tätig sein zu dürfen. Das sollte sich jedoch bald ändern.
Ende Jänner 1927 war es in dem burgenländischen Ort Schattendorf zu Zusammenstößen zwischen einer rechtsgerichteten Bürgerwehr, den „Frontkämpfern“ und dem „Republikanischen Schutzbund“, einer paramilitärischen Organisiation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, gekommen. Mitglieder der Frontkämpfervereinigung attackierten aus dem Hinterhalt eine Versammlung des Schutzbundes, wobei zwei Menschen getötet wurden: ein vierzigjähriger Kriegsinvalider und ein achtjähriger Bub. Am 2. Februar 1927, dem Tag des Begräbnisses der beiden Getöteten, streikten in ganz Österreich die Arbeiter – eine Viertelstunde lang.
Im Juli 1927 kam es zum Prozess gegen die Todesschützen von Schattendorf, der nach zehn Tagen mit einem Freispruch endete: Der Mord wurde als Notwehr dargestellt und die Täter als „ehrenwerte Männer“ bezeichnet. Als die Nachricht am 15. Juli allgemein bekannt wurde, kam es zu einem Massenprotest Tausender Wiener Arbeiter gegen das als ungerecht empfundene Gerichtsurteil. Sie zogen in großen Scharen durch die Innenstadt, versuchten zunächst vergeblich, die Universität und das Parlament anzugreifen, wichen sodann auf den nahegelegenen Justizpalast aus, der als Symbol für die bürgerliche „Klassenjustiz“ empfunden wurde. Der Wiener Bürgermeister Karl Seitz sowie Theodor Körner, der Anführer des sozialistischen Schutzbundes, versuchten, die Massen zu beruhigen, die jedoch nicht mehr aufzuhalten waren. Zunächst wurden nur die Fensterscheiben des Justizpalastes eingeschlagen, doch dann drangen einige der Aufgebrachten in das Gebäude ein. Plötzlich schlugen Flammen aus den Stockwerken. Der Brand breitete sich rasch aus, verwüstete alle Akten – es war „das Nächste zu einer Revolution, was ich am eigenen Leibe erlebt habe“, wie Elias Canetti das Ereignis in seinen Erinnerungen festhielt. „Seither weiß ich ganz genau, ich müsste kein Wort darüber lesen, wie es beim Sturm auf die Bastille zuging.“ Polizeipräsident Schober erteilte Schießbefehl – der christlichsoziale Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel hatte ihm freie Hand gegeben –, und die Beamten schossen tatsächlich wahllos in die Menge. Im Zuge der erbitterten Straßenkämpfe kamen neunundachtzig Menschen ums Leben, tausend Verletzte waren zu beklagen. Der Justizpalast aber brannte bis auf die Grundmauern nieder.
Bruno Kreisky hatte sich mit seinem Cousin Artur, einem Sohn seines politisch aktiven Onkels Rudolf Kreisky, der Demonstration vor dem Wiener Justizpalast zunächst aus reiner Neugierde angeschlossen, doch „plötzlich peitschten Schüsse. Wir haben die Salven nicht nur gehört, wir haben auch die fallenden Menschen gesehen, das Blut. Zum ersten Mal sah ich Menschen sterben. Das Herz klopfte uns bis zum Halse.“ Auch Elias Canetti schildert diesen Moment in seinem Memoirenband Die Fackel im Ohr: „Das Rennen der Menschen, in Seitengassen, und wie sie dann gleich wieder erscheinen und sich wieder zu Massen formieren. Ich sah Leute fallen und Tote am Boden liegen (…) Furchtbare Scheu besonders vor diesen Toten. (…) Bis der Schutzbund kam, der sie vom Boden hob, war gewöhnlich leerer Raum um sie, als erwarte man, dass gerade hier wieder Schüsse einschlagen würden. Die Berittenen machten einen besonders schrecklichen Eindruck, vielleicht weil sie selber Angst hatten.“
Als Kreisky und sein Cousin Artur wohlbehalten, wenn auch tief erschüttert nach Hause zurückkehrten, erfuhren sie von dem Gerücht, ein Mann namens Artur Kreisky sei in der Wiener Innenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Es stellte sich heraus, dass ein entfernter, der Familie beinahe unbekannter Verwandter, ein angesehener Juwelier auf der Kärntner Straße, als gänzlich Unbeteiligter auf dem Nachhauseweg von Gewehrkugeln der Polizei getroffen worden war. Er erlag drei Tage später seinen schweren Verwundungen. Auch Brunos Cousin Artur sollte sechzehn Jahre später eines gewaltsamen Todes sterben: Er wurde wegen seiner Widerstandstätigkeit 1943 in Berlin-Plötzensee enthauptet.
Unter dem Eindruck der Ereignisse des 15. Juli – „es war ein furchtbarer Tag auch für mich“ – trat Bruno Kreisky der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) bei. Das politische System Österreichs hatte durch das Fehlurteil, den Brandanschlag auf den Justizpalast und die brutale Niederschlagung der Demonstration irreparablen Schaden erlitten – es war ein Wendepunkt in der politischen Geschichte der Ersten Republik. Wollte er zur gesellschaftlichen Veränderung Entscheidendes beitragen, so wurde Kreisky nunmehr bewusst, musste er den Verein der Mittelschüler verlassen und sich einem „wirklichen Engagement“ stellen.
Kreisky dürfte sich allerdings keinen Illusionen hingegeben haben, er befürchtete sogar, dass der Abstieg der Sozialdemokratie bereits begonnen hatte: „Im gleichen Moment, in dem der Staat bewies, dass er sich traute, auf demonstrierende ‚Rote‘ zu schießen, war der Bann ihrer Politik gebrochen“, sollte er rückblickend feststellen. Schutzbund und Partei sahen an diesem 15. Juli ihre Hauptaufgabe darin, einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern: „Wir sind nicht im Kampf besiegt worden, wir sind vielmehr dem Kampf ausgewichen“, lautete die Devise. Kreisky empfand diese Haltung seitens der sozialdemokratischen Politiker als Zeichen ihrer Führungsschwäche. Seine Enttäuschung war daraufhin so groß, dass er zunächst sogar darüber nachdachte, der Bewegung den Rücken zu kehren. Der Glaube an die Ideale der „Großen Bewegung“ gewann jedoch schließlich die Oberhand, mehr noch, er traute sich zu, einer wiedererstarkten Partei in Zukunft persönlich durchaus von Nutzen sein zu können.
Der Wechsel zur SAJ sollte nicht ohne anfängliche Schwierigkeiten verlaufen: Bruno tauchte stets makellos gekleidet bei den Arbeiter-Versammlungen auf, da er seiner besorgten Mutter – sie wollte immer wissen, wo er gerade sei – vorgaukeln musste, er besuche in Wirklichkeit die Tanzschule Elmayer. Die Arbeiterjugend trat dem Gymnasiasten aus bürgerlichem Hause daher lange Zeit mit Misstrauen gegenüber, verspottete ihn sogar ganz offen. Getreu dem Motto Victor Adlers, einen Intellektuellen müsse man dreimal wegschicken, wenn er dann immer noch zur Parteiarbeit bereit sei, dürfe er bleiben, überwand Kreisky die anfängliche Ablehnung – die durchaus auch auf antisemitische Ressentiments zurückzuführen war – und wurde endlich in den Kreis der SAJ aufgenommen. Es gelang ihm danach relativ rasch, das Vertrauen seiner neuen Genossen zu gewinnen, mehr noch, er sollte sich in ihrem Umfeld bald sehr wohl fühlen.
„Ich habe seinerzeit zu meinen Referaten bei der sozialistischen Arbeiterjugend ein Bündel Holzstäbchen mitgenommen“, erinnerte sich Kreisky Ende der 1980er Jahre während eines Gesprächs mit dem Schriftsteller Franz Schuh. „Was ich demonstrieren wollte, war, dass ein einzelnes Stäbchen ganz leicht zu brechen war, das Bündel jedoch nur sehr schwer. Dazu bedarf es einer beträchtlichen Anstrengung. Das heißt, die Macht der Machtlosen ist genau von dieser Art – das ist das Geheimnis der Organisation.“
Bereits ein Jahr nach seiner Aufnahme wählte man ihn zunächst zum 3. Stellvertretenden Parteiobmann, wenig später zum Obmann für den gesamten Bezirk Wieden, den vierten Wiener Gemeindebezirk. Zu seinen frühen Aufgaben zählte es unter anderem, die Bewegung gegenüber kommunistischer Einfluss- nahme abzugrenzen. Ein Freund, der im Verdacht stand, Kommunist zu sein, wurde von Kreisky gar persönlich aufgefordert, die SAJ zu verlassen. „Von da an galt ich sozusagen als Spezialist für die Bekämpfung von jungen Kommunisten.“
2.
Im Frühjahr 1929 legte Bruno Kreisky an der Bundesrealschule Radetzkystraße im Wiener Bezirk Landstraße die Matura ab. In der Maturazeitung hieß es: „Kreisky, der ein Idealist, ist ein wenig Kommunist. Jeder, der anders orientiert, ist ein Bourgeois, total borniert.“ Seine ehemaligen Mitschüler bescheinigten ihm darüber hinaus, man erahne in ihm bereits „den künftigen Gemeinderat“.
Tatsächlich widmete er sich gleich nach dem Schulabschluss mit großem Elan den Vorbereitungen zu einem internationalen Treffen sozialistischer Jugendlicher, das Mitte Juli 1929 in Wien stattfinden sollte. Rund 50.000 junge Menschen aus ganz Europa, darunter viele später führende Sozialdemokraten, nahmen an diesem größten Jugendtreffen in der Geschichte der sozialistischen Bewegung teil. Höhepunkte der dreitägigen Veranstaltungen waren ein Sportfest auf der Hohen Warte, ein mächtiger Fackelzug zum beleuchteten Rathaus und ein abschließender Festzug über die Ringstraße und die Prater-Hauptallee. Anlässlich des fünfzigsten Jahrestages des Treffens hielt Bruno Kreisky 1979 fest: „Unauslöschlich ist uns allen die Erinnerung an diese Tage. In den düstersten Zeiten politischer Bedrängnis haben wir uns die Erinnerung an dieses große Erlebnis unserer Jugend bewahrt. Es waren Tage erlebter internationaler Gemeinschaft und Solidarität, es war, wie wenn der Geist der Internationale für drei Tage lebendige Wirklichkeit geworden wäre.“
Wien hatte man aus guten Gründen für diese Zusammenkunft auserwählt: das „Rote Wien“ war ab 1918 die erste sozialistisch regierte Metropole außerhalb der Sowjetunion. Nicht der Marxismus bolschewistischer Prägung wurde in der Hauptstadt des republikanischen Österreich verwirklicht – der war seit dem Misserfolg der Rätebewegung 1919 diskreditiert. Wien wurde von den mit absoluter Mehrheit gewählten Sozialdemokraten beherrscht, und einer Reihe Kommunalpolitikern gelang es hier, das austromarxistische Postulat vom „neuen Menschen“ in die politische Praxis umzusetzen. Intellektuelle Politiker und Theoretiker vom Schlage Otto Bauers, Karl Renners, Friedrich Adlers oder Max Adlers forcierten den großen Wurf einer grundlegenden Umgestaltung der proletarischen Lebensweise.
„Was wir für die Jugendhorte ausgeben, werden wir an Gefängnissen ersparen. Was wir für Schwangeren- und Säuglingsfürsorge verwenden, ersparen wir an Anstalten für Geisteskranke“, verkündete etwa der Wiener Sozial- und Gesundheitsstadtrat Dr. Julius Tandler. Die Neuordnung des gesamten öffentlichen Fürsorgewesens reichte gleichsam „von der Wiege bis zur Bahre“ und fand ihren monumentalen Höhepunkt in der erfolgreichen Bekämpfung der extremen Wohnungsnot in der Nachkriegszeit: im kommunalen Wohnbau, als dessen weltweit bewundertes Beispiel der Karl-Marx-Hof in Wien-Heiligenstadt galt und bis heute gilt.
Im Herbst 1929 begann Bruno Kreisky an der Wiener Universität zu studieren. Er hatte zunächst den Wunsch, Mediziner zu werden, ein Gespräch im Hochsommer des Jahres 1929 sollte seine Einstellung jedoch grundlegend ändern. Otto Bauer, der stellvertetende Parteivorsitzende der SDAP, die damals in Wahrheit wichtigste Persönlichkeit innerhalb der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, stellte dem Achtzehnjährigen eines Nachts auf dem Weg zur Arbeiter-Zeitung, deren Redaktionsmitglied er war, die Frage, was er denn eines Tages werden wolle. Als Bauer von Kreiskys Vorstellungen erfuhr, meinte er, es sei kaum denkbar, Arzt zu sein und sich zugleich politisch zu betätigen. Er zählte eine ganze Reihe von Ärzten auf, die Parteimitglieder waren und ihren Beruf aufgeben mussten. „Die Partei braucht gute Juristen und hat davon zu wenige“, ließ Bauer den Jüngling wissen, „wenn Sie der Partei wirklich einen Dienst erweisen wollen, müssen Sie Jurist werden. Studieren Sie Jus!“ Und noch etwas gab er ihm schon damals mit auf den Weg, einen Rat, an den er sich viele Jahre später nur allzu gut erinnern sollte: „Sprechen Sie immer schön langsam und auch sonst so, dass die Leute Sie verstehen!“
Kreisky, der sich laut eigener Aussage „mit allen Fasern“ seines politischen Denkens an Otto Bauer gebunden fühlte, immatrikulierte denn auch an der juristischen Fakultät. Trotz mannigfacher Ablenkungen – seiner stets wachsenden politischen Interessen und Verpflichtungen wegen – kam er mit dem Lernen gut voran. Seine Erinnerungen an die Studentenzeit waren jedoch alles andere als positiv. Zum einen, da er der Jurisprudenz im Endeffekt nicht viel abgewinnen konnte, ein Studium, das laut seiner Aussage „für die praktische Arbeit in der Politik nicht viel Hilfe gibt“. Und zum zweiten: noch im hohen Alter betrat er das Auditorium Maximum der Wiener Universität mit einem Gefühl der Beklommenheit. Zu sehr hatten sich ihm die Militanz der immer rücksichtsloser und rüpelhafter auftretenden Deutschnationalen und der rabiate Antisemitismus eingeprägt, die die Studienatmosphäre der dreißiger Jahre vergifteten. „Es war schlicht und einfach eine Hölle“, stellte er fest; vor allem jüdische und linke Studenten wurden regelmäßig verprügelt, nicht selten sogar während des Unterrichts: „War man aus dem Hörsaal einigermaßen heil heraus, stand das Schlimmste noch bevor.“ Nicht selten wurde man während des Spießrutenlaufs durch die Korridore und über die Stiegen des Universitätsgebäudes verprügelt.
Das politische Klima in Österreich verdüsterte sich im Verlauf der 1920er und frühen 1930er Jahre zunehmend. Italien, seit 1922 von Benito Mussolini beherrscht, verwandelte sich in eine faschistische Hochburg, während in Ungarn und Jugoslawien rechts-autoritäre Regime die Macht übernommen hatten. In Deutschland gewann die Nationalsozialistische Arbeiterpartei unter Adolf Hitler zwar zunächst nur langsam an Boden, doch nach und nach zeichneten sich erste deutliche Erfolge ab. Der große Zuwachs an Wählerstimmen für die NSDAP anlässlich der Reichstagswahl des Jahres 1930 warf auch auf Österreich seine Schatten und führte zu einem Erstarken der rechtsgerichteten Gruppierungen, der Christlichsozialen, der von Bundeskanzler Ignaz Seipel unterstützten, von Ernst Rüdiger Starhemberg angeführten „Heimwehr“ und der nationalsozialistischen Bewegung österreichischer Prägung. Insbesondere unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise setzten sich zunächst jene Fraktionen immer mehr durch, welche die Vereinigung mit Deutschland beschleunigt herbeiführen wollten.
Parallel zu diesen Entwicklungen nahm Bruno Kreiskys politische Karriere in jenen Jahren einen deutlichen Aufschwung. Schon 1930 wurde er zum Vorsitzenden der Regionalorganisation für Klosterneuburg, Purkersdorf und Tulln der SAJ bestellt und schließlich in das Führungsgremium des Gesamtverbandes gewählt. 1933 wählte man ihn zum Vorsitzenden des „Reichsbildungsausschusses“ der SAJ; damit war er für die gesamte Bildungs- und Kulturarbeit des Verbandes zuständig. Seine damaligen Gefühle nach der Ernennung beschrieb Kreisky noch Jahrzehnte später mit den Worten: „Als ich den Saal verließ, war ich ganz einfach glücklich.“ Er empfand die Zeit als Mitglied der sozialistischen Jugendbewegung insgesamt „als so erlebnisreich, dass ich fast geneigt wäre, sie zu den schönsten meines Lebens zu rechnen“.
Der junge Kreisky positionierte sich als „linker Sozialdemokrat“ und stellte die „Theorie der Pause“ zur Diskussion, die vor allem den jungen Linken innerhalb der Partei gefiel. Diese These besagt sinngemäß, dass die Sozialdemokratie sich den revolutionären Gestus bewahren müsse, weil es Revolutionen und Phasen dazwischen gebe; und in einer solchen Pause befinde man sich eben. Die politischen Diskussionen der dreißiger Jahre kreisten daher auch um die Frage, ob die gegenwärtige nur eine der großen Krisen des Kapitalismus oder schon seine letzte sei.
Die Massenarbeitslosigkeit der dreißiger Jahre – auf ihrem Höhepunkt gab es in Österreich sechshunderttausend Arbeitslose – vernichtete das ohnehin nur in Ansätzen vorhandene staatliche Sozialnetz, sieht man von den Errungenschaften des „roten Wien“ ab. Und so erlebte der junge Sozialist in diesen Jahren der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche, wie sich die deklassiert fühlenden Arbeiter und Kleinbürger dem Faschismus zuwandten. „Sie nahmen bedenkenlos die rote Fahne und setzten in die Mitte die Swastika. Sie übernahmen die alten sozialistischen Lieder und unterschoben ihnen einen neuen Text. Und wie die Sozialisten und Sozialdemokraten marschierten sie an den Feiertagen. Nur teilten sie die Kapitalisten in Schaffende und Raffende ein und setzten dem Wort Sozialismus das Wörtchen national voran. Es war wie in der Legende, wonach am Jüngsten Tag der Teufel in Gestalt des Herrn erschien.“
Die Weltwirtschaftskrise mit ihren fatalen Folgen für die klassische Arbeiterbewegung hat Kreiskys politisches Denken tief geprägt; seine Politik der Vollbeschäftigung, die er in den 1970er Jahren mit großer Verve vertreten sollte und wider so manche scheinbare ökonomische Rationalität verteidigt hat, ist nur aus dem unmittelbaren Erleben jener Zeit zu verstehen.
3.
Im Frühjahr 1932 stand Österreich ganz im Zeichen eines tiefgreifenden politischen Umschwungs: Nach dem Rücktritt des christlichsozialen Bundeskanzlers Karl Buresch übernahm der bisherige Landwirtschaftsminister Engelbert Dollfuß die Regierungsgeschäfte. Der niederösterreichische Politiker, im Volksmund nicht zuletzt seiner kleinen Körpergröße wegen „Millimetternich“ genannt, koalierte mit den faschistischen Heimwehren und dem deutschnationalen Landbund für Österreich. Dollfuß’ Programm eines „sozialen, christlichen, deutschen Staates in Österreich (…) unter starker, autoritärer Führung dieses Staates“ lehnte sich deutlich am Modell des italienischen Faschismus an und rückte erstaunlicherweise von der Anschlussidee nachdrücklich ab. Dollfuß hob vielmehr die „besondere Mission“ Österreichs gegenüber Deutschland hervor, eine Haltung, die auch nach Adolf Hitlers Machtergreifung am 30. Jänner 1933 österreichische Staatsräson blieb. Den Führer dürfte das nicht sonderlich beeindruckt haben, längst sah er in seiner Heimat einen Teil des künftigen „Tausendjährigen Reichs“.
Die sukzessive Zerschlagung der seit November 1918 in Österreich errichteten demokratischen Strukturen erreichten im März 1933 mit der Ausschaltung des Parlaments ihren vorläufigen Höhepunkt. Es war das Jahr, „als die große Beschleunigung in die Welt kam, die alles mit sich fortreißen sollte“, wie Elias Canetti es formuliert hat.
Unter Ausnutzung einer Geschäftsordnungspanne im Nationalrat legte Dollfuß am 4. März 1933 die Volksvertretung lahm und schaltete in der Folge auch den Verfassungsgerichtshof aus. Er etablierte die „Vaterländische Front“ als Regierungspartei und herrschte fortan auf Basis des Notverordnungsrechts ohne Parlament. Sowohl der Republikanische Schutzbund als auch die Kommunistische Partei samt ihren Nebenorganisationen, der Freidenkerbund sowie der Verband Sozialistischer Mittelschüler wurden von der Regierung aufgelöst. Die Todesstrafe wurde wieder eingeführt. Zeitungszensur und die Einschränkung des Versammlungsrechts folgten. Ab Mai 1933 wurde auch die nationalsozialistische Partei Österreichs wegen ihrer Terrorakte mit Todesfolgen verboten, sollte in der Illegalität aber immer größere Triumphe feiern.
Stefan Zweig, in dieser Umbruchszeit vorübergehend in seine Heimat zurückgekehrt, stellte fest: „Aus der stillen und sicheren Atmosphäre Englands in dies von Fiebern und Kämpfen geschüttelte Österreich zu kommen, war, wie wenn man an einem heißen New Yorker Julitag aus einem luftgekühlten Raum plötzlich auf die glühende Straße tritt.“ Es sollte nicht mehr lange dauern, da verwandelte sich diese politische Hitze in einen regelrechten Flächenbrand.
„Am 12. Februar 1934 saß ich zu Hause über meinen Büchern, um mich auf Prüfungen vorzubereiten, als plötzlich das Licht ausging“, heißt es in Bruno Kreiskys Memoiren. „Da hatte ich gleich das Gefühl, dass etwas los sei.“ Er eilte zum Hauptquartier der Sozialistischen Partei auf der Rechten Wienzeile, wo aber niemand anzutreffen war. Die Stromversorgung war unterbrochen, dies galt unter der Arbeiterschaft als das Start-signal für einen Generalstreik. Was war geschehen? In den Morgenstunden des 12. Februar hatten Polizisten ein Linzer Arbeiterheim, das Hotel Schiff, unter dem Vorwand überfallen, dort ein Waffenlager zu vermuten. Es kam zu einem Schusswechsel, die Nachricht von den Auseinandersetzungen breitete sich sehr rasch im ganzen Land aus. Zwar wurde der Generalstreik kaum befolgt, dennoch griff der Aufstand auf größere Teile des Landes über und weitete sich schließlich sogar zu einem Bürgerkrieg aus. Vor allem in Wien und anderen Industriestädten (Steyr, St. Pölten, Weiz, Eggenberg bei Graz, Kapfenberg, Bruck an der Mur) wurde einige Tage lang heftig gekämpft.
In der Hauptstadt zogen sich die sozialistischen Schutzbündler in die Arbeiterheime sowie in die großen Gemeindebauten des „roten Wien“, in den Karl-Marx-, George-Washing-ton- und Reumann-Hof zurück und begannen von dort aus das Bundesheer, die Polizei und die Heimwehr zu beschießen. „Es sprach gegen jede Vernunft“, sollte Bruno Kreisky später kritisch anmerken, „den Kampf dorthin zu verlegen, wo Frauen und Kinder waren.“ Der Bürgerkrieg dauerte vier Tage, wobei die Regierungstruppen nicht davor zurückschreckten, auch Kanonen gegen die Arbeiterschaft aufzufahren. Als die hoffnungslos unterlegenen Schutzbündler am 15. Februar endgültig kapitulierten, waren auf beiden Seiten beinahe dreihundert Tote und rund achthundert Schwerverletzte zu beklagen.
Tausende wurden inhaftiert, angeklagt beziehungsweise aus ihren Berufen geworfen oder flüchteten ins Exil. Exakte Zahlen fehlen bis heute, rund zehntausend dürften aber von diesen Formen der politischen Verfolgung betroffen gewesen sein. 7.169 Personen wurden bis zum Februar 1938 amnestiert – vor allem Sozialdemokraten, aber auch einige Kommunisten.
Der junge Kreisky war nicht aktiv an den Februarkämpfen beteiligt, hatte jedoch einen Kampfaufruf der Partei redigiert, aktualisiert, hektografiert und die Flugblätter in einem Rucksack quer durch die bürgerkriegsgeschüttelte Stadt getragen und verteilt. Was ihm aber in diesen Tagen besonders auffiel und schmerzlich bewusst wurde, war die Desorganisation der schlecht vernetzten Partei und ihrer dilettantischen Führer. Die Zeitzeugin Rosa Jochmann brachte es auf den Punkt: „Otto Bauer blieb ein wunderbarer Mensch – General war er jedoch keiner.“
Zahlreichen Arbeiteranführern gelang die Flucht in die Tschechoslowakei, unter ihnen auch Bauer, andere jedoch wurden gefasst und im Auftrag des Justizministers Kurt Schuschnigg wenige Tage später gehängt – der charismatische Koloman Wallisch etwa oder Karl Münichreiter, der schwer verletzt auf einer Krankentrage zum Galgen geschleppt wurde.
Stolz verkündete Dollfuß, die „Revolution“ der Arbeiter erfolgreich niedergeschlagen zu haben. Die Toten des österreichischen Bürgerkriegs waren noch nicht bestattet, als die Bundesregierung am 16. Februar die Annullierung der sozialdemokratischen Mandate und die Beschlagnahme der Vermögenswerte der Sozialdemokratischen Partei und ihrer Organisation verfügte. Die Gewerkschaften wurden aufgelöst und ihr Vermögen beschlagnahmt. Das Gleiche geschah mit den wirtschaftlichen Organisationen der Partei, wie der Arbeiterbank und dem Vorwärts-Verlag; allekulturellenParteiorganisationen, etwa die Kunsthalle, die Kinderfreunde, die Naturfreunde, die Bibliotheken, und mehr als dreitausend sozialdemokratische Vereine aller Art wurden liquidiert. Innerhalb weniger Wochen waren ungefähr 40 Prozent der österreichischen Bevölkerung zu gesellschaftlichen Parias geworden.
„Nie wird die Arbeiterschaft diesen ‚Februar-Aufstand‘ vergessen, der sie Dollfuß fanatischer hassen (ließ) als sogar Hitler“, hielt der Schriftsteller und Filmemacher Georg Stefan Troller fest, der als Schüler in Wien die Kämpfe miterlebt hat. Für den jungen Parteiaktivisten Kreisky aber war infolge der Unruhen 1934 „das, was ich für meine Welt hielt, zusammengebrochen“.
In einem Gespräch mit der Politologin und Journalistin Elisabeth Horvath, wenige Jahre vor seinem Tod geführt, gab er zu Protokoll: „Es haben jene Leute recht, die sagen, ‚der Kreisky hat eigentlich die Christlichsozialen mehr gehasst als die Nazis‘. Die Christlichsozialen haben uns ja am 12. Februar 1934 besiegt, und wir sind die Unterlegenen gewesen. Unsere unmittelbare Niederlage hat in dem Feuer des Februar gebrannt. (…) Die wirklichen Faschisten waren für uns die Christlichsozialen. Das ist auch der Schlüssel, warum ich gegen junge Leute, die vom Hitler-Regime verführt worden sind, keinen Hass empfunden habe, außer jemand trägt durch seine Taten das Stigma des Holocaust.“
4.
Das formelle Verbot der Sozialdemokratie führte zu tiefgreifenden Veränderungen innerhalb der nunmehr im Untergrund agierenden Organisationen der Arbeiterbewegung. Die sozialdemokratische Führungsschicht hatte sich, soweit möglich, in die Tschechoslowakei abgesetzt, die Reste des alten Parteiapparats wurden von Brünn aus verwaltet. Auch die illegale Arbeiter-Zeitung wurde in Brünn gedruckt und über die Grenze nach Österreich geschmuggelt. Otto Bauer genoss noch einige Zeit eine scheinbar ungebrochene Autorität. Doch nach und nach sah sich die Führungsschicht der Partei einer rabiaten innerparteilichen Kritik ausgesetzt. Die Ablehnung war bei den jungen Ex-Funktionären besonders ausgeprägt, den Alten schlug oft sogar blanke Verachtung entgegen. Hinzu kam, dass der Hass auf die „schwarze Brut“, eine „Art Rachsucht, die aus der Niederlage kam“, in vielen Sozialisten eine perverse Hoffnung auf die Nazis aufkommen ließ. Sie würden mit dem Dollfuß-Regime „aufräumen“, spekulierte man. Kreisky lapidar: „Der Hass auf Dollfuß war stärker als die Angst vor allem anderen.“ Daher war sein „Verhältnis zu ehemaligen Nazis ein anderes“, so seine rückblickende, nicht ganz unproblematische Feststellung. Ein Vorgriff: In der „Affäre Friedrich Peter/Simon Wiesenthal“ der späten 1970er Jahre sollte diese Einschätzung politisch auf die problematischste Art und Weise wirksam werden.
Viele Basisfunktionäre und einfache Parteimitglieder wendeten sich in der Folge enttäuscht von der sozialdemokratischen Partei ab und traten, zum Teil als geschlossene Gruppen, zur ebenfalls illegalen Kommunistischen Partei über. Nicht jedoch Bruno Kreisky: Er hatte, wie noch zu zeigen sein wird, stets den „demokratischen Sozialismus“ im Blick; eine Bezeichnung übrigens, die er gerne als Abgrenzung zum „realen Sozialismus“ sowjetischer Lesart verwendete. Daher stand der junge Kreisky auch allen Einigungsbestrebungen der Linken, wie sie in der Sozialdemokratie namentlich von Otto Bauer betrieben worden waren, ablehnend gegenüber.
Wenige Tage nach dem Ende des Bürgerkriegs, am Sonntag, dem 18. Februar 1934, war Kreisky bei der Gründung der „Revolutionären Sozialistischen Jugend“ (RSJ) auf einer Lichtung im tiefverschneiten Wienerwald dabei. Gemeinsam mit seinem besten Freund in der Bewegung, dem Arbeiter Roman Felleis, übernahm er die Leitung der Gruppierung. „Revolutionär“ wollte man sein, denn nur eine Revolution könne die Demokratie wieder zurückbringen und den Menschen das geben, was ihnen im November 1918 versagt geblieben war.
Besorgt wegen der immer bedrohlicheren Verhaftungswelle rieten die Eltern ihrem Sohn, er solle sich für eine Weile zu den Großeltern nach Trebitsch zurückziehen. Bruno aber blieb in Wien, um sich an den zunächst nur zögernd einsetzenden illegalen Aktivitäten der zerschlagenen Partei zu beteiligen. (Seine Decknamen in der Zeit der Illegalität lauteten übrigens Rainer, Braun, Brand und Pichler.) Einerseits wollten die nun „Illegalen“ der Öffentlichkeit beweisen: Wir sind noch da. Andererseits galt es, die versprengten Reste der Parteiorganisation neu zu formieren.
Immer wieder reiste er in dieser turbulenten Zeit für einige Tage in die Tschechoslowakei, konnte den Behörden vorgaukeln, dort seine Verwandten zu besuchen, in Wirklichkeit leistete er heimliche Parteiarbeit: Er betätigte sich als Kurier, um beim Auslandsbüro der Partei Briefmarken für den Versand der Arbeiter-Zeitung abzuliefern, und sorgte außerdem dafür, dass das verbotene Blatt in klandestinen Säcken über die Grenze geschmuggelt wurde. „Man hat sie nach Znaim gebracht und dort in Gurkensäcke verpackt, und zwischen Znaim und Retz auf der österreichischen Seite der Grenze wurden die Gurkensäcke hin- und hertransportiert.“ Familie Felix, die Verwandten seiner Mutter, besaß Gurkenfelder in dieser Gegend – auch sie steuerten Säcke bei.
Während eines dieser Besuche kam es erneut zu einer längeren Unterredung Bruno Kreiskys mit Otto Bauer, die ihm sein Leben lang in Erinnerung bleiben sollte. Bauer sprach ausführlich von seiner Vision, Österreich werde in Bälde Opfer des deutschen Nationalsozialismus und von Hitler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dem Deutschen Reich einverleibt werden; ein zweiter Weltkrieg sei überdies unausweichlich. Seine Vorstellung zukünftiger Entwickungen ging aber noch weiter: Der neue Weltkrieg werde rund sieben Jahre, die ganze Schreckenherrschaft des Nationalsozialismus aber „unter Umständen zwölf bis dreizehn Jahre dauern, und da werden ungeheure Opfer gebracht werden müssen“.
Schon wenige Wochen später sollte Bauers apokalyptische Weltsicht eine Bestätigung erfahren. Am 25. Juli 1934 kam es zu einem von langer Hand vorbereiteten Putsch der illegalen österreichischen Nationalsozialisten – als Soldaten des