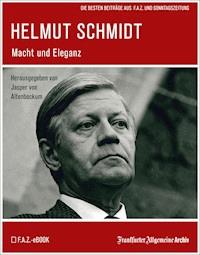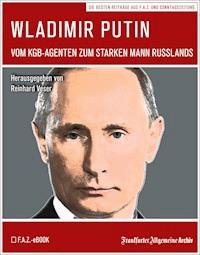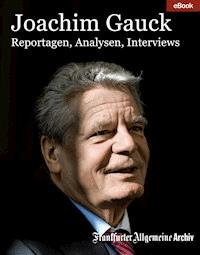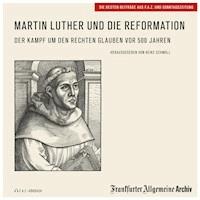Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der technische und gesellschaftliche Wandel bringt nicht nur in den Industrienationen tiefgreifende und bisweilen schmerzhafte Veränderungsprozesse im Wirtschaftsleben mit sich. Seit dem Jahr der Lehman-Pleite, 2008, befindet sich die Weltwirtschaft ohnehin im permanenten Krisenmodus, der im Einzelfall bis in das Privatleben abstrahlt. Veränderte Märkte und technische Entwicklungen geben häufig den Takt betrieblicher Entscheidungen vor. Krise und Wandel treiben die Manager vor sich her. "Change! Die Chancen des Wandels" zeigt, wie man vom Getriebenen zur treibenden Kraft werden kann. Es verdeutlicht die Mechanismen von Wandlungsprozessen und macht anhand von Erfolgsstorys Mut in wandlungsreichen Zeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Change!
Die Chancen des Wandels
F.A.Z.-eBook 22
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2013 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Titelgestaltung: Hans Peter Trötscher. Foto: © pencake / photocase.de
ISBN: 978-3-89843-229-0
Vorwort
Den Wandel gestalten, statt ihn zu erleiden
Von Hans Peter Trötscher
Der technische und gesellschaftliche Wandel bringt nicht nur in den Industrienationen tiefgreifende und bisweilen schmerzhafte Veränderungsprozesse im Wirtschaftsleben mit sich. Seit dem Jahr der Lehman-Pleite, 2008, befindet sich die Weltwirtschaft ohnehin im permanenten Krisenmodus, der im Einzelfall bis in das Privatleben abstrahlt. Veränderte Märkte und technische Entwicklungen geben häufig den Takt betrieblicher Entscheidungen vor. Krise und Wandel treiben die Manager vor sich her.
Vor diesem Hintergrund gehen wir zunächst auf die Lasten und die Verantwortung in krisenhaften Situationen ein. Besonders hier zeigt sich, wer ein Chef ist und wer einen solchen nur darstellt, sich vor der Verantwortung wegduckt und die Lasten auf die Schultern der Mitarbeiter ablädt. Im Großen leben das, mit gravierenden Folgen für die Demokratie, auch Regierungen vor.
Im nächsten Kapitel wenden wir uns einem der größten Transformationsprojekte zu, die es in Deutschland in den vergangenen Jahren gegeben hat: dem Umbau einer Armee aus Wehrpflichtigen zu einer Berufsarmee. Häufig hatte man den Eindruck, dass die Öffentlichkeit, abgesehen von der in den aufgegebenen Standorten, keine echte Notiz davon nimmt. Auch hier wirkt das Projekt bis in gesellschaftliche Strukturen und die Biografien der Beteiligten hinein: lässt sich nicht bei ehemaligen Wehr- und Zivildienstpflichtigen ein anderes Selbstverständnis ausmachen, als bei heutigen jungen Erwachsenen?
Die nächsten Abschnitte widmen sich den speziellen Aufgaben des Managements in Umbruchzeiten und dem fundamentalen Wandel durch die umfassende Digitalisierung des Lebens. Hier müssen nicht nur Ältere von Jüngeren lernen. Der Begriff von Wissen und die Verfügbarkeit von Information erfordern ein Umdenken in bisher kaum gekanntem Ausmaß.
Zwei besonders erfolgreiche Beispiele aktiv gestalteten Wandels stellen wir Ihnen zum Abschluss vor: Zum Einen die Evonik AG, ein aus der RAG hervorgegangenes Unternehmen der Spezialchemie, das unter anderem die Aufgabe hat, in einer zukunftsorientierten Branche die sogenannten Ewigkeitskosten des Kohlebergbaus zu finanzieren. Zum Anderen die Uhrenindustrie im sächsischen Glashütte, die das Kunststück fertiggebracht hat, mit einer ganz auf Tradition gerichteten Strategie die Folgen der Verstaatlichung in der DDR zu überwinden.
Vom Wandel: Lasten und Verantwortung
In der Krise muss sich der Chef zeigen
Nur Personen schaffen Vertrauen. Gerade in der Krise müssen daher Unternehmenslenker öffentlich stärker kommunizieren.
Von John-Philip und Nicolai Hammersen
Würden Sie als Nationaltrainer im Endspiel der Fußball-WM Ihren besten Stürmer auf der Bank versauern lassen? Oder beim Schach Ihre stärkste Figur, die Dame, nicht ausspielen? Nein. Umso erstaunlicher ist es, dass die Kommunikation vieler Unternehmen und Organisationen genau daran krankt: Das beste Pferd bleibt im Stall, der Chef wird nicht oder kaum öffentlich positioniert. Dafür mag es viele Gründe geben, sie vernebeln aber den Blick dafür, welche Chancen auf diese Weise – gerade in Zeiten der Krise – vertan werden.
Man muss nicht allzu weit in die Vergangenheit schauen, um Beispiele dafür zu finden, wie die fehlende oder fehlerhafte Positionierung eines Vorstandsvorsitzenden zu fatalen Entwicklungen geführt hat – auch für die betreffende Person selbst. Das unrühmliche Ende von Hartmut Mehdorn an der Spitze der Bahn war nicht allein auf den Datenskandal an sich zurückzuführen, sondern auf den öffentlichen Umgang damit und vor allem darauf, wie weit die Öffentlichkeit noch bereit war, ihm zu glauben. Am Ende blieb ein Trümmerfeld: ein geschasster Vorstandsvorsitzender, dessen Abgang mehrere Spitzenkräfte ebenfalls in den Abgrund riss, ein ruinierter Ruf des Unternehmens in der Öffentlichkeit und ein im Inneren zerrissener Konzern, dem die eigenen Mitarbeiter zutiefst misstrauen.
Hartmut Mehdorn ist das prominenteste Beispiel für misslungene Kommunikation in der jüngeren Vergangenheit, aber beileibe nicht das einzige. Gerade in der Wirtschaftskrise gehen viele Spitzenkräfte aus den Chefetagen öffentlich in Deckung. Ob Banken, Versicherungen, Energieversorger, Mineralölfirmen – trotz einer tief sitzenden Vertrauenskrise in breiten Schichten der Bevölkerung schweigen die Verantwortlichen. Dabei könnten sie gerade jetzt durch kluge Kommunikation mehr bewegen als in Boomzeiten und vor allem mehr Boden gutmachen als durch ihre übliche Managementarbeit.
Denn Menschen sind am ehesten bereit, anderen Menschen zu vertrauen – nicht Firmen, Marken oder Produkten. Die Bürger wollen in vielen Fällen wissen, wer hinter der Fassade steckt, wer verantwortlich ist, welche Ziele und welche Überzeugungen er hat. Sie wollen glaubwürdige Erklärungen, sich ein Bild machen und ein Gesicht haben, das für eine Sache steht. Dies haben Journalisten längst begriffen. In den vergangenen Jahren ist ein stetig weiter steigender Trend zur Personalisierung von Themen in den Medien zu beobachten. Komplexe Sachverhalte werden an Einzelfällen verdeutlicht, Geschichten „am Menschen entlang“ erzählt, in Interviews werden Unternehmenslenker „verhört“. Je schwerer ein Anliegen zu vermitteln ist, umso mehr muss der Macher an der Spitze in die Rolle des Erklärers rücken.
Doch auf Seiten der Unternehmen und Organisationen herrscht eine Mischung aus Zaudern und Überheblichkeit. Zum einen werden die Risiken einer offenen Kommunikation höher eingeschätzt als die Chancen. Andere Gründe der Sprachlosigkeit sind Bescheidenheit, Angst davor, als eitel wahrgenommen zu werden, Unsicherheit im Umgang mit Medien oder mangelndes Vertrauen zwischen Top-Führungskraft und den Unternehmenskommunikatoren. Zum anderen ist immer noch die Idee weit verbreitet, man könne Berichterstattung unterdrücken, wenn man schweigt. Gleichzeitig lassen sich viele Verantwortliche von der irrigen Annahme leiten, es sei – bei sonst weitgehendem Schweigen – jederzeit problemlos möglich, ein Thema „in den Medien zu lancieren“, an dem das eigene Unternehmen ein besonderes Interesse hat. Dies ist schon deshalb falsch, weil Medien sich nicht für eine durchsichtige Unternehmenskommunikation einspannen lassen, erstens, weil sie unabhängig sind und, zweitens, weil sie bei ihren Kunden an Glaubwürdigkeit einbüßen würden.
Was immer die Gründe aber für eine unzureichende Kommunikation des Chefs (Vorstandsvorsitzender oder Eigentümer) sein mögen, sie müssen identifiziert und beseitigt werden. Denn: Zusammen mit der Reputation der Produkte und der Marktstellung ist das Ansehen des Vorstandsvorsitzenden der ausschlaggebende Faktor für den Ruf eines Unternehmens. Studien der internationalen Agentur für Öffentlichkeitsarbeit Burson Marsteller haben schon vor Jahren gezeigt, dass der persönliche Ruf des Vorstandsvorsitzenden das Unternehmensimage in Deutschland zu nahezu zwei Dritteln beeinflusst. Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2005 sind 74 Prozent aller Befragten und 72 Prozent der Wirtschaftsjournalisten der Ansicht, die öffentliche Wahrnehmung der Position des Vorstandsvorsitzenden habe sehr große beziehungsweise große Bedeutung für den Geschäftserfolg eines Unternehmens.
Vor diesem Hintergrund kann die fehlende oder ungünstige Wahrnehmung des Chefs in der Öffentlichkeit fatale Folgen haben. Das gilt erst recht in der Krise. Krisen potenzieren sich medial sehr schnell. Ob Brent Spar oder Bilanztricks bei MLP, Ackermanns Victory-Zeichen oder Kleinfelds deutlich erhöhte Vorstandsbezüge bei gleichzeitiger Streichung von 3000 BenQ-Arbeitsplätzen – wem es nicht gelungen ist, in wirtschaftlich besseren Zeiten ein „Glaubwürdigkeitskapital“ (Wolfgang Kaden) aufzubauen, der hat wenig Chancen, der medialen Skandalisierung zu entgehen.
Es ist für die Unternehmenskommunikatoren natürlich schwer, objektiv messbare Kriterien für den Erfolg oder Misserfolg von Chef-Kommunikation festzulegen. Dennoch geben Medienresonanzanalysen und Maßnahmen des Kommunikations-Controllings Anhaltspunkte. Es liegt auf der Hand, dass eine Kommunikation durch den Verantwortlichen eines Unternehmens eine größere Authentizität und Glaubwürdigkeit hat als Maßnahmen des klassischen Marketings oder der Öffentlichkeitsarbeit. Umso erstaunlicher ist es, dass beispielsweise gerade der Bankensektor in diesen Monaten kommunikativ praktisch in der Versenkung verschwunden ist. Glaubt man in den Chefetagen ernsthaft, man könne allein mit Anzeigen, Fernsehspots und Plakaten das Vertrauen der Kunden zurückbringen? Dagegen ist die Wirkung eines wirklich guten öffentlichen Auftritts des Vorstandsvorsitzenden ungleich höher (und kostenlos).
Nicht nur für Banken gilt daher: In der Krise ist zuallererst der Chef gefragt. Dabei ist es wichtig, zwischen reiner öffentlicher Präsenz und Reputation zu unterscheiden. Nicht jeder, der häufig öffentlich kommuniziert, genießt auch einen guten Ruf. Ein Vorstand muss zunächst die gegenwärtige Situation des Unternehmens offen und ehrlich darstellen. Wo stehen wir? Warum ist die Lage so, wie sie ist? Was bedeutet sie für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter? Unliebsame Aspekte zu verschweigen ist dabei ebenso kontraproduktiv wie die Beschönigung bereits bekannter Tatsachen.
Die klare Darstellung der Unternehmensstrategie – intern wie extern – ist der zweite Schritt. Wo gehen wir hin? Was wollen wir bis wann erreichen? Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Schließlich geht es darum, die Aufgaben, die unternehmerische Agenda zu definieren. Was ist jetzt zu tun? Was werden wir künftig anders/besser, zusätzlich, nicht mehr machen? Wie sehen die einzelnen Schritte aus?
Vorstandsvorsitzende müssen sich dieses Programms aktiv annehmen und dürfen keinesfalls nur reagieren. Dabei müssen sie sich des wohl größten Risikos stets bewusst sein: Wer öffentlich etwas sagt oder gar verspricht, der wird daran gemessen. Es ist also ratsam, nur dann die Chancen einer offenen Kommunikation zu nutzen, wenn lautere Absichten dahinterstecken und die Geschäftspolitik dem Gesagten wirklich folgt.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8.2.2010
Die große Müdigkeit
Ausgebrannt zu sein ist heute kein persönliches Schicksal mehr, sondern ein gesellschaftliches. Es rührt von einem System her, das die Kosten historischer Umbrüche immer nur auf denselben Schultern ablädt. Von der politischen Ursache eines privaten Gefühls.
Von Nils Minkmar
Züge zur Weihnachtszeit sind ein soziales Experiment. Menschen, die sich nie begegnen würden, werden in einer Röhre komprimiert und manchmal bewegt, manchmal nicht. Schlecht, wenn die Bahn es versäumt, einen voll reservierten Wagen auch anzuhängen, und noch schlechter, wenn die Zugbegleiterin dann um »Verständnis wegen des Notfalls« bittet, denn zu Recht merkten die Passagiere an, dass es kein schicksalhafter Notfall, sondern schlicht eine Panne war – zudem eine, mit der die Bahn Geld spart. Denn auch stehende Passagiere zahlen den vollen Fahrpreis, und ob jeder wirklich die Formulare einreicht, damit die Reservierungsgebühr erstattet werden kann? Man unterstellt Absicht.
Doch in welchem Ton wird das vorgebracht, wie schnell ist der Vielfahrer mittleren Alters in Jeans und Baumwollhemd auf höheren Touren als das an jenem Tag defekte Triebwerk des ICE. Sein Gesicht nimmt die Farbe einer Aubergine an, er brüllt fast. Die Zugbegleiterin bittet, wie sie das immer tun, »um Verständnis«, aber er weist das mit der verhohlenen Sympathie des ganzen Waggons zurück: »Und wer versteht mich? Wer versteht mich denn auf der Arbeit?«
Es war mehr als die Empörung eines treuglaubenden Kunden, das war echte Verzweiflung, und jeder wusste, was er meinte. Hier sprach kein Fluglotse, kein Gehirnchirurg und keiner, der sekündlich die Milliarden bewegt, sondern ein eher gemütlich aussehender Angestellter, ein gestandener Mann, von dem man sagen würde, dass er mitten im Leben steht. Aber diese Mitte wird an den Rand gedrängt, so schnell dreht sich die Welt, und es gibt keine Pause und kein Pardon. Und oft genug nicht mal eine Erklärung: Man versteht ihn nicht, und er versteht die Welt nicht mehr. Bald entspannen sich um ihn herum viele Gespräche, alle kreisten um das große Kreisen des Geldes, die Krise und, wie man früher sagte, das System: die geringen Renten, Krankenhäuser, die Clochards abweisen, die Griechen, die HRE, Ackermann, was sind eigentlich Schulden, die geringen Renten. Wessen Schulden zahlen wir? Warum vermag unser Geld so wenig? Bahnfahrer auf der Suche nach der falsch gestellten Weiche.
Das späte neunzehnte Jahrhundert war das Zeitalter der Neurasthenie, und wir leben in Zeiten des Burnout. Egal ob man von der medizinischen Korrektheit des Begriffs überzeugt ist oder nicht, ob man also die vielfältige und diffuse Symptomatik als spezifische Krankheit anerkennen möchte oder nicht, der Begriff aus der vormodernen Kerzenzeit bezeichnet eine Phänomenologie, die jedem intuitiv verständlich ist. Er gehört zu jenen Geräten unseres Welterklärungswerkzeugkastens, die uns heuristisch weiterhelfen, auch wenn wir gar nicht genau verstehen, wie sie en détail funktionieren. Es vergeht kein Tag, in dem nicht ein Artikel über Burnout in Zeitungen und Magazinen erscheint. Dabei wird er immer als ein privates Problem besprochen, werden gute Ratschläge zu seiner Vermeidung oder Linderung gegeben, die alle auf der Ebene der persönlichen Lebensgestaltung liegen. Zauberformeln werden offenbart: Work Life Balance und Entschleunigung, digitale Abstinenz und Fokussierung auf das Wesentliche. Als wäre das so einfach. Burnout wird einerseits in all seinen dramatischen und zerstörerischen Konsequenzen beschrieben, als eine Krankheit die lebensbedrohlich ist, die »Kassen Milliarden kostet« und unbedingt ernst zu nehmen ist, die Mittel dagegen aber sind immer rein privat. Als würde man den Arbeitern einer Asbestfabrik empfehlen, zu Hause besser Staub zu wischen, um ihre Lungen vor Krebs zu schützen.
Das Syndrom, das wir mit dem Bild vom Ausgebranntsein beschreiben, also das Empfinden, müde zu sein, ohne auf Erholung hoffen zu können, und für die Mühen statt eines angemessenen Lohns nur noch mehr Mühen erwarten zu dürfen, das ist keine Privatsache, sondern ein gesellschaftliches, ein ökonomisches, ideologisches, kurz: ein politisches Problem. Es ist das Resultat gut zu identifizierender Entscheidungen und einer seit Jahrzehnten propagierten Ideologie. Diese Müdigkeit ist ein politisches Gefühl.
Sie befällt oft jene, die von einem Lohn oder einem Gehalt leben, die ihre Familie hier haben und nicht einfach wegziehen können, die gemeldet und vielfach registriert sind, deren Einkommen stets transparent ist und deren Steuern und Abgaben direkt einbehalten werden. Es ist dabei gar nicht mal so entscheidend, wie hoch das Gehalt ist, es ist diese Art des Einkommens, die überproportional belastet wird, sowohl systematisch wie historisch. Bis es kaum noch etwas vermag. Wer sich an die siebziger und achtziger Jahre erinnert, kann ermessen, wie stark der Wandel ist: In der alten Bundesrepublik waren beispielsweise Universitätsprofessoren sehr gut situiert bis wohlhabend, auch ohne Drittmittel einsammeln zu müssen wie die Eichhörnchen im November ihre Nüsse. Eigenheim, studierende Kinder, sogar noch eine kleine Kunstsammlung oder seltene Bücher – das alles wurde im Wesentlichen von einem guten Professorengehalt getragen. Und wer wusste schon, was ein Politiker verdient? Schon die Diäten reichten, um ein gutbürgerliches Leben zu führen. Löhne und Gehälter konnten einfach mehr. Taxifahrer erzählen oft davon: Eine Rentnerin mit einer monatlichen Rente von 2.000 D-Mark war gutsituiert und konnte Taxi fahren. Heute kommt sie mit tausend Euro nur dann über die Runden, wenn die Mieten, Nebenkosten und Krankenkassenbeiträge genug übrig lassen.
Der Wert des Eigentums an Wertpapieren, Immobilien, Edelmetallen, auch Kunstwerken, Weinkellern ist in derselben Zeit sehr stark gewachsen. Vermögen hat sich schneller vermehrt als Löhne und Gehälter, kein Vergleich. Besonders deutlich ist das in den Vereinigten Staaten: Im Jahr 1992 besaßen die oberen zehn Prozent etwa zwanzigmal so viel wie die ganzen unteren fünfzig Prozent. Im Jahr 2010 war es fünfundsechzigmal so viel. Das Vermögen wuchs, obwohl in der Zeit zwei Kriege zu bezahlen waren. Sie wurden durch Schulden finanziert, der Staat verarmt. Die Entwicklung ist überall ähnlich.
Vermögen leistet nur einen unverhältnismäßig geringen Beitrag zur Finanzierung der gemeinsamen Lasten. Das hat System, ein Versuch es anders zu machen, scheiterte derzeit schon an ganz praktischen Belangen: Welches Finanzamt hat schon die Möglichkeit, die Angaben von Sportlern, Showstars, Künstlern, Unternehmern oder Erben zu prüfen? Unser System hat die Arbeit belastet, um Gesundheit, Alterssicherung und sozialen Zusammenhalt zu bezahlen. Sie wurde auch immer dann herangezogen, wenn es galt, historische Umwälzungen zu bewältigen.