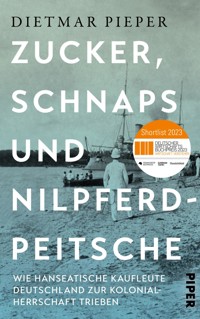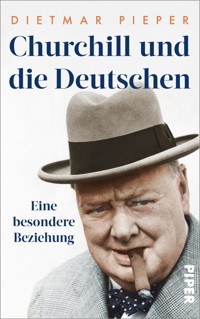
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Winston Churchill, der Mann mit der ewigen Zigarre und dem Victory-V, ist der wohl bekannteste Unbekannte unserer Geschichte. Ohne ihn hätte Deutschland nicht vom Nationalsozialismus befreit werden können. Sein aufregendes Leben mit allen Licht- und Schattenseiten gilt es aber noch zu entdecken. Gestützt auf neue Archivfunde, erzählt Dietmar Pieper, wie stark Churchills Werdegang über Jahrzehnte von seinem Verhältnis zu Deutschland geprägt war. Und er analysiert, was wir heute, im Zeitalter aggressiver Autokraten wie Putin, von seiner harten Haltung gegenüber Hitler lernen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Bettmann/Getty Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Einleitung Churchill, die Deutschen und ein fast gescheitertes Leben
Eine besondere Beziehung beginnt
Deutschland machte Churchill zu Churchill
Besiegter Sieger
Friedenspläne und ein Vorwurf
Wer war Winston Churchill?
Teil I
Der Unvollendete (1874–1931)
1 »Ein Mann von wachsendem Einfluss«: Churchill lernt Deutschland kennen
2 »Ich liebte sie von Herzen – aber aus der Ferne«: Eltern, Kindheit, Jugend
3 »Wie leicht es ist, einen Menschen zu töten«: Soldat und Kriegsreporter
4 »Diese Angelegenheit habe ich geerbt«: Aufstieg in der Politik
5 »Das starke, geduldige, fleißige Volk«: Was ihn im Deutschen Reich interessiert
6 »Winston in voller Kriegsbemalung«: Deutschland als Rivale, Gegner, Feind
7 »Der tödliche Wille, Deutschland zu bekämpfen«: Krieg – und Frieden
8 »Churchill hat das Land entwaffnet«: Autor, Schatzkanzler, Rebell
Teil II
Allein gegen Hitler (1931–1941)
1 »Best regards to Herr Hitler«: Eine historische Schlacht und eine verpasste Gelegenheit
2 »Das Ende der Welt«: Warnungen vor der deutschen Gefahr
3 »Ein wackeres und romantisches Relikt«: Churchill steht sich selbst im Weg
4 »Wahl zwischen Krieg und Schande«: Das britische Hitler-Appeasement
5 »Der einzige Engländer, vor dem sich Hitler fürchtet«: Churchills Freiheitskampf beginnt
6 »Klare Fronten«: Endlich Premierminister
7 »Sein Kampfgeist ist unbezwingbar«: Die große Bewährungsprobe
8 »Langsam wird’s Zeit für die 17«: Churchills Spiel
9 »And England shall be free«: Deutschlands Angriff scheitert
Teil III
Der Preis des Sieges (1941–1951)
1 »Ich mag diesen Mann«: Die Gipfeltreffen der Nazi-Gegner
2 »Sie legen Ihr Blatt nie auf den Tisch«: Das Rätsel Roosevelt
3 »Germany First«: Amerika im Krieg
4 »Sind wir Bestien?«: Casablanca und der alliierte Luftkrieg
5 »Eine Leibwache aus Lügen«: Auf dem Weg zum Sieg
6 »Wo sind die Deutschen?«: Verschobene Grenzen und der Eiserne Vorhang
Teil IV
Ruhm und Enttäuschung (1951–1965)
1 »Vereinigte Staaten von Europa«: Zukunftspläne und Nähe zu Adenauer
2 »Eine Konferenz auf höchster Ebene«: Der letzte große Traum
3 »Respektlosigkeit unseren Toten gegenüber«: Churchill, ein Kriegsverbrecher?
4 »Niemals verzweifeln«: Sein Vermächtnis
Dank
Bildteil
Bildnachweis
Quellen
Stichwortverzeichnis
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Register
Einleitung Churchill, die Deutschen und ein fast gescheitertes Leben
Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself,
(I am large, I contain multitudes.)
Walt Whitman, Song of Myself
Reisen, etwas erleben, andere Luft atmen, an die eigenen Grenzen gehen: Churchill hat das geliebt. Einem jungen, vor 150 Jahren geborenen Aristokraten der viktorianischen Epoche stand die Welt offen, und Winston Leonard Spencer-Churchill nutzte seine Möglichkeiten. Als Soldat und Kriegsreporter ritt, schoss und schrieb er für ein Empire, das die Erde umspannte und jederzeit kampfbereit war. Seine Verbindungen beim Militär sowie die glänzenden Beziehungen seiner Mutter öffneten ihm fast alle Türen, er lebte seinen Ehrgeiz auf vier Kontinenten aus.
Und was für einen Ehrgeiz: Wie in vielen Dingen hat Churchill auch darin alle Maßstäbe gesprengt. Dauernd wollte er sich beweisen, seine Gier nach Selbstentfaltung war unersättlich. Noch Jahrzehnte später, als er seine lodernde Energie im molligen Körper eines Zigarren rauchenden Patriarchen verbarg, nahm er ständig Risiken und Strapazen aller Art auf sich. Regieren war sein Leistungssport. Während des Zweiten Weltkriegs raste er nach Paris, Neufundland, Washington, Moskau, Casablanca, Adana, Algier, Québec, Kairo, Teheran, Rom, Athen, Jalta und Potsdam, oft unter Lebensgefahr. Mochten sich andere Staatenlenker am liebsten in ihren Machtzentralen verschanzen – Churchill wollte den Wind der Ereignisse, aus denen sich die Geschichte entwickelt, auf der eigenen Haut spüren. Er wollte ein Teil davon sein und die Richtung bestimmen.
Wie es dazu kam, dass dieser kleine, energische Mann mit der Vorliebe für seltsame Kopfbedeckungen und gepunktete Fliegen zu einem Giganten der Weltgeschichte wurde, werden die folgenden Seiten erzählen. Sie behandeln eine Vergangenheit, die genau genommen nicht vorbei ist – im Gegenteil. Einige der großen Fragen, die an Churchill gestellt wurden und die er auf seine Art beantwortet hat, beschäftigen die Menschheit zu ihrem Leidwesen immer noch.
Die wichtigste von allen dürfte sein: Welche Haltung ist die richtige gegenüber einem Machthaber, der seine Nachbarn drangsaliert, das Völkerrecht bricht, ein Regime der Angst errichtet und vor Krieg nicht zurückschreckt?
Das heutige Russland nach der Annexion der Krim 2014 ist nicht das Deutschland, das nach 1933 zuerst die Revision der Versailler Grenzen und dann die hemmungslose Expansion suchte. Aber es gibt Parallelen in der brutalen Entschlossenheit, mit der ein geopolitischer Herrschaftswille vertreten wurde und wird. Den nächsten Schlag könnte China führen, denn vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die rote Autokratie ihren Anspruch auf Taiwan mit Waffengewalt vorbringt. Dass sich der persönlich bedrohte ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi mehrmals auf Winston Churchill berufen hat, um den Kampfgeist seines Landes nach dem russischen Überfall zu stärken, ist mit Sicherheit kein Zufall. Genauso wenig wie die Entscheidung der »International Churchill Society«, Selenskyi mit ihrem Churchill-Preis zu dekorieren.
Kaum jemand hat die existenziellen Fragen von Krieg und Frieden durchdacht und durchlebt wie Winston Churchill. Hält der sagenumwobene Engländer also für uns heute Lehren bereit?
Vorsicht vor schnellen, steilen Thesen. Am Ende dieses Buchs wird sich darüber besser sprechen lassen als gleich zu Beginn. Dass Churchill uns vom Siegerpodest aus anblickt, bedeutet nicht, dass er mit seinem Leben, seinem ganz eigenen Weg zum Erfolg irgendwelche einfachen Rezepte liefern könnte.
Es war ein Leben wie ein Roman, packender und ereignisreicher als der eine, autobiografisch gefärbte, den er selbst geschrieben hat (Savrola, erschienen 1899). 1905, im Alter von dreißig Jahren, hatte er bereits in Indien, Südafrika, auf Kuba und im Sudan gekämpft und getötet, er hatte die USA, Kanada, Frankreich und die Schweiz bereist und einen Unterhaussitz erobert. Aber Deutschland, das vibrierende, dynamische Reich auf dem Kontinent, kannte er nicht, er hatte noch nie deutschen Boden betreten.
Der von Preußen geführte Nationalstaat war seit einiger Zeit der große Unruhestifter in Europa, ein Land, über das Benjamin Disraeli gesagt hatte, dass »die deutsche Revolution ein größeres politisches Ereignis« sei als die Französische Revolution. Vielleicht ein bisschen viel der Ehre für die kriegerische Reichsgründung von 1871? Disraelis Vergleich mit dem Umsturz von 1789 hört sich erst einmal weit hergeholt an, aber nach den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts wissen wir: In den Worten des britischen Premierministers steckte mehr düstere Vorahnung, als ihm und den Zeitgenossen bewusst sein konnte. Im deutschen Namen hat sich bekanntlich Unvorstellbares ereignet.
Churchill kannte seinen Disraeli, er bewunderte ihn und sah in dem großen Konservativen ein Vorbild. Was hatte es mit diesem merkwürdigen Deutschland auf sich? Im Sommer 1906 wollte er es endlich einmal kennenlernen, und da Churchill auch als Politiker im Herzen immer Soldat blieb, interessierte ihn nichts so sehr wie das Militär. »Kriege haben die Menschheitsgeschichte bestimmt«, glaubte er.
Seine Erfolgskurve wies steil nach oben. Mit Mitte Zwanzig hatte er sich als Neuling im Unterhaus schon einen Namen gemacht. Wenige im britischen Parlament wussten besser als er, wie man einen Minister in die Enge treibt. Mit Anfang Dreißig wurde er selbst Regierungsmitglied. Sein erstes von vielen Ämtern war das des Unterstaatssekretärs im Kolonialministerium – zweiter Mann nach dem Chef, dessen englischer Titel Secretary lautete. Keine geringe Aufgabe im größten Kolonialreich, das die Erde je gesehen hatte, aber für ihn nur ein Anfang. Auf seinen Schreibtisch stellte er als Erstes eine Bronzebüste von Napoleon.
Was hatte das Colonial Office mit dem deutschen Militär zu tun? Natürlich nichts, aber die eigenmächtige Überschreitung von Zuständigkeitsgrenzen sollte auf Churchills langem politischem Weg eines seiner Markenzeichen werden.
Eine besondere Beziehung beginnt
Wie von ihm gewünscht, erhielt er aus Berlin die Einladung, bei der alljährlichen Großübung des Reichsheeres dabei zu sein: Wilhelm II. werde ihn im September 1906 als seinen persönlichen Gast beim »Kaisermanöver« begrüßen. Was der Beobachter aus England auf seiner Deutschlandreise erlebte, worüber er mit dem Herrscher sprach und wie seine Gastgeber über ihn dachten, wird der erste Teil dieses Buchs berichten, gestützt auf zuvor nicht benutzte Archivquellen.[1] Wir werden sehen, wie er im Ersten Weltkrieg an der Front gegen das Kaiserreich kämpfte und als Politiker mit dessen Niederlage umging. Churchills Kindheit und Jugend, sein weiterer Aufstieg, gefolgt von einem tiefen Sturz, kommen dort ebenfalls in den Blick.
Churchill und die Deutschen: Das war in vieler Hinsicht eine besondere Beziehung. Weil das vorliegende Buch diese Beziehung in den Mittelpunkt stellt, muss manches andere unberücksichtigt bleiben. Wie er zu Irland stand; warum er als Finanzminister zum Goldstandard zurückkehrte; welche Spuren er in der arabischen Welt hinterließ; worüber er mit seinen Freunden Charlie Chaplin und Aristoteles Onassis redete – nur vier Beispiele aus seiner Vita, die jedes Interesse verdienen, hier aber nicht oder bloß flüchtig in den Blick kommen werden. In Churchills Leben ist die Fokussierung bereits angelegt: Obwohl er sich anderen Nationen näher fühlte, Frankreich vor allem, übte Deutschland den mit Abstand größten Einfluss auf seine Entwicklung als Politiker und Staatsmann aus.
Dass es so kommen würde, war für niemanden vorhersehbar, für Churchill selbst am allerwenigsten. Seine Neugier auf deutsche Geschichte und Kultur war begrenzt, Liebe war gewiss nicht im Spiel, höchstens Respekt, die Sprache fand er mühsam. Als er im Eliteinternat Harrow anfing, sie zu lernen, reichten ihm als Kommentar drei Buchstaben: »Ugh.« So schrieb es der 15-Jährige seiner Mutter. Weil er ein guter Sohn sein wollte, schob er noch hinterher: »Trotzdem hoffe ich, dass ich eines Tages in der Lage sein werde, zu ›sprechen ze Deutche‹.« Diese Hoffnung, falls er sie wirklich gehabt haben sollte, trog. Gut ein Jahr später ließ Churchill seine Mutter wissen, dass er nun Chemie statt Deutsch habe – »was für ein Glück«. Vor dem Ersten Weltkrieg knurrte er: »Ich werde die grässliche Sprache nie lernen, höchstens wenn der Kaiser auf London marschiert.«
Noch taugte das Schreckbild, die Insel könnte erobert werden, gerade so für einen kleinen Scherz. Der Krieg, der den Briten bis heute als Great War geläufig ist, änderte daran nichts. Im Schutz der rauen Gewässer auf allen Seiten fühlte sich die Nation sicher. War denn nicht sogar Napoleon auf dem Gipfel seiner Herrschaft mit seinem Invasionsplan gescheitert?
Als aber die Macht in Deutschland nicht mehr in den Händen eines Monarchen, eines Kanzlers oder Präsidenten lag, sondern in denen des nationalsozialistischen »Führers«, mussten sich die Inselbewohner auf eine neue Lage einstellen. Nur die wenigsten erkannten das. Der lauteste, hartnäckigste Mahner und Warner im Land war Winston Churchill. Er war nicht nur laut und hartnäckig, er stand auch ziemlich allein da. Denn von der Gefahr eines weiteren Weltkriegs, erst recht von einer drohenden Attacke auf ihre Heimat, wollten die Engländer am liebsten nichts hören. Appeasement war noch kein anrüchiges Wort.
Dass sämtliche Friedensbemühungen scheitern würden, weil Adolf Hitler unbeirrbar auf einen Krieg zusteuerte, hatte Churchill befürchtet und vorausgeahnt. Er hielt darüber flammende Reden, die ihm jedoch Spott und Unverständnis eintrugen.
Nach dem Überfall der Deutschen auf Polen war dieser viel belächelte Warner auf einmal der Mann der Stunde. Was gerade noch Alarmismus zu sein schien, leuchtete auf einmal wie ein Feuerzeichen zwischen den Irrtümern all der anderen hervor.
Churchill hatte in den Jahren davor harte Zeiten durchlebt. Nach einem Karriereknick konnte er sich nur am Rand des politischen Spielfelds bewegen, in der »Wüste«, der »Wildnis«, wie er klagte, abgeschnitten von der Regierungsgewalt, nach der er sich immer sehnte. Was nutzten ihm frühere Triumphe, seine Unterhausreden, die öffentliche Aufmerksamkeit, der Erfolg als Journalist und Buchautor? Politische Entscheidungen trafen andere. In seinem 65. Lebensjahr schien alles darauf hinzudeuten, dass Winston Churchill als gescheiterter Mann mit gelegentlich grandiosen Zügen in die Annalen der britischen Politik eingehen würde, als einer, der eher früher als später dem Vergessen anheimfallen würde.
Stattdessen kehrte er ins Kabinett zurück. Dann rief ihn der König zu sich und machte ihn zum Premierminister: Churchills lang gehegter Traum ging an diesem Tag im Mai 1940 in Erfüllung, spät, doch mit umso größerer Wucht und Verantwortung. Denn nur die Engländer konnten damals noch verhindern, dass die Nazi-Deutschen und ihre faschistischen Verbündeten bald über ganz Europa herrschten – mit unabsehbaren Folgen für die Welt.
Als Churchill den Buckingham-Palast verließ und sich an die Arbeit machte, kam es ihm vor, als habe eine höhere Macht auf seinem Lebensweg Regie geführt: »Ich fühlte mich wie vom Schicksal geleitet«, schrieb er in seinem Monumentalwerk über den Zweiten Weltkrieg (sechs Bände, ein Denkmal seiner selbst). Seine christlichere Ehefrau sagte: »Als er Premierminister wurde, war er ganz sicher, dass Gott ihn zu diesem Zweck geschaffen hatte.« Tatsächlich schien sich in der Rückschau fast alles wunderbar zu fügen, bis hin zum Triumph über Hitler fünf Jahre nach Churchills Ernennung zum Regierungschef: »Mein ganzes bisheriges Leben war nichts als eine Vorbereitung für diese Stunde und für diese Prüfung … Ich war mir sicher, nicht zu versagen.« So schön ist die Geschichte, dass sie seit Jahrzehnten immer wieder erzählt wird.
Sie ist zu schön, um wahr zu sein. Weder war Churchills Ernennung alternativlos, noch konnte er seinen Erfolg wirklich für gesichert halten. In den weltpolitischen Schlüsseljahren ab 1939/40 ging es in seinem Leben genauso irdisch und menschlich zu wie vorher. Nur dass sein Scheitern ungleich größere Folgen gehabt hätte.
Sein riesiges Ego schützte ihn vor allzu starken Selbstzweifeln. Außerdem half ihm, dass er mit dem Soldatentod seit Langem vertraut war. Musste er darüber hinaus den massenhaften Tod von Zivilisten anordnen? Hat er geltendes Völkerrecht gebrochen? Die Städtebombardements in Deutschland und Frankreich fanden unter seiner Verantwortung, zum Teil auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin statt. Deutsche Bomben lenkte er im Spätsommer 1940 auf London, damit militärische Anlagen verschont würden. Und noch ein Punkt, über den genauer zu reden sein wird: Die Eisenbahngleise, auf denen Waggons voller todgeweihter Menschen nach Auschwitz rollten, blieben unangetastet. Kein Bomberpilot bekam die Order, den Holocaust aufzuhalten.
Die hier über Churchills Leben erzählte Geschichte verläuft weniger glatt, aber kein bisschen weniger aufregend als das beliebte Melodram vom Schicksalsweg eines Auserwählten, wie es etwa Andrew Roberts in seiner viel gerühmten Churchill-Biografie – Untertitel: Walking with Destiny – oder der zeitweilige Premierminister Boris Johnson in Der Churchill-Faktor inszeniert haben. Auch die Abgründe und Widersprüche waren bei diesem Mann größer als gewöhnlich.
Deutschland machte Churchill zu Churchill
Die zweite Hauptrolle spielte, wie in jedem Krieg, der Feind: Ohne die Deutschen wäre Churchill nicht Churchill geworden.
Winston, der Kriegsheld; Winston, der Freiheitskämpfer; Winston, der Löwe, der den Faschismus besiegt hat; Winston Churchill, den die Briten laut einer BBC-Umfrage für die größte Persönlichkeit ihrer Geschichte halten – es war Deutschland, das durch den Absturz in die Dunkelheit diesen Mann, seine entscheidenden Taten und seinen Ruhm, erst hervorgebracht hat.
Genauso sicher ist: Ohne Churchill wäre Deutschland ein anderes Land, wäre Europa ein anderer Kontinent geworden. Sein unbedingter Freiheitswille war die Voraussetzung für den Sieg der Alliierten über das Nazireich, aus dessen Trümmern unsere heutige Demokratie gewachsen ist. Jene andere Welt, in der Hitler gewonnen hätte, mag man sich nicht vorstellen. Niemand kann genau sagen, welche Düsternis uns erspart blieb.
Churchill und Hitler haben sich aus der Ferne belauert, gehasst, beleidigt und sicher auch manchmal bewundert. Gesprochen haben sie nie miteinander, es gab zwischen ihnen keinen Handschlag, keine prüfenden Blicke, keinen direkten Austausch von Höflichkeiten oder Drohungen. 1932, während Churchills erster privater Deutschlandreise, wäre es beinah zu einem Gespräch gekommen. Die Begegnung in einem Münchner Hotel war bereits eingefädelt, doch Hitler ließ die Gelegenheit verstreichen.
Wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, wenn sich die späteren Kriegsgegner persönlich kennengelernt hätten? Es bleibt Spekulation. Mit Churchills Reise beginnt der zweite Teil dieses Buchs, in dem dann die Vorkriegs- und die ersten Kriegsjahre aus britischer Sicht erzählt werden. Für leidenschaftliche Debatten sorgt bis heute der Versuch seines Vorgängers Neville Chamberlain, Hitler durch Verhandlungen und Zugeständnisse vom Kriegskurs abzubringen. Es lohnt sich, die Argumente der Appeaser und ihrer Gegner genauer zu betrachten, denn der damalige Streit um Aufrüstung, Militärhilfe und die Sicherheit des eigenen Landes führt mitten hinein in unsere Zeit.
Besiegter Sieger
Nach dem Aufenthalt in München vergingen wieder viele Jahre, bis Churchill eine deutsche Stadt besuchte. Der Krieg in Europa war vorbei, das gerade noch so mächtige Reich lag am Boden, als die Sieger 1945 in Potsdam zusammenkamen, um über die Zukunft der Besiegten und ihrer europäischen Nachbarn zu verhandeln. Ehe die Konferenz begann, fuhr Churchill durch das zerstörte Berlin und ging zwischen den Trümmern der Reichskanzlei umher, in deren Bunker Hitler sich das Leben genommen hatte. Verblüffte, neugierige Menschen eilten herbei, um den berühmten Engländer zu sehen. Zu seiner Überraschung freuten sich die meisten, sogar Jubel wird er später in Erinnerung haben. Plötzlich überkam ihn Mitleid mit diesen ausgemergelten Gestalten in ihrem zerbombten Land.
Auf dem letzten Gipfeltreffen der »Großen Drei« (Großbritannien, USA, Sowjetunion) konnte Moskaus Diktator Josef Stalin staunend beobachten, wie sich vor seinen Augen ein demokratischer Machtwechsel vollzog: Churchills überragender Ruf als Kriegspremier reichte nicht aus, um ihm das Amt des Regierungschefs zu erhalten, er verlor die Unterhauswahl. Mit der Potsdamer Konferenz setzt in dieser Darstellung der dritte Teil ein, der dann in einer Rückschau Churchill und die Alliierten auf ihrem Weg zum Sieg begleitet.
Nach seiner Niederlage bei der Parlamentswahl musste er den Platz am Konferenztisch für Clement Attlee von der Labour Party räumen. Äußerlich ließ Churchill sich nichts anmerken, doch er litt schwer. Trotzdem bestimmte er schon bald wieder die Schlagzeilen der internationalen Politik, indem er den Begriff des »Eisernen Vorhangs« aufgriff und die neue Weltlage im Kalten Krieg analysierte.
Friedenspläne und ein Vorwurf
So spektakulär Churchills Abwahl 1945 war, so erstaunlich erschien sein Comeback sechs Jahre später. Niemand hatte bei den Konservativen die Kraft aufgebracht, den monumentalen Alten von der Parteispitze zu verdrängen, der darum als 76-Jähriger zum zweiten Mal in 10 Downing Street einzog.
Allerdings war der Premier häufig nur noch ein Schatten seiner selbst. Die britische Innenpolitik interessierte ihn immer weniger. Verbissen bemühte er sich nach Stalins Tod um den einen großen Wurf: eine Initiative zur Beendigung des Kalten Krieges, die ihn, den Sieger über Nazi-Deutschland, auch noch zum globalen Friedensstifter gemacht hätte. Doch in den anderen Hauptstädten (und sogar in der eigenen Regierung) hielt man seine Ideen für nicht sehr bedeutend, wie Churchill schmerzlich erfahren musste.
Als Europapolitiker bekam er mehr Applaus. Überzeugend setzte er sich für die Versöhnung mit den Deutschen ein, denen er während des Krieges alles Mögliche an den Hals gewünscht hatte. Immer wieder beschwor er die Einheit des Kontinents. Aber was meinte Churchill konkret, wenn er von einer Union der Europäer sprach? Mit den Briten oder ohne sie? Dass ihn später die Brexit-Befürworter als ihren prominentesten Ahnherren vereinnahmt haben, war zugleich schlüssig und irritierend.
Während der Nachkriegsjahre betrachteten ihn die meisten Zeitgenossen noch als treibende Kraft der Einigung und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das EU-Parlament ehrt darum bis heute seinen Namen. Der vierte Teil wird von Churchills Friedensplänen und den Europa-Ideen erzählen, die ihm 1956 den Aachener Karlspreis und die Laudatio des kaum jüngeren Bundeskanzlers Konrad Adenauer eintrugen. Als die Bonner Republik ihn zu seinem 90. Geburtstag und kurz darauf als Verstorbenen offiziell ehrte, bekamen ihre Vertreter viele empörte Briefe. Die damalige deutsche Churchill-Kontroverse wird hier erstmals anhand der Quellen beschrieben. War der Premierminister ein Kriegsverbrecher? Es ist noch immer nicht leicht, auf diese Frage eine Antwort zu finden.
Wer war Winston Churchill?
Churchills Tod liegt nun bald 60 Jahre zurück. Von seinen Landsleuten wurde er zum Abschied geehrt wie nur ganz wenige in der langen Reihe ihrer Könige, Königinnen und Premiers. Im 21. Jahrhundert hat sein Nachruhm neue Höhen erreicht, besonders in den USA. Wer war dieser Mann? Viele Antworten sind auf diese Frage möglich.
Er liebte den Krieg und wünschte sich Frieden. Er konnte eiskalt und brutal sein, aber auch gefühlvoll und gerührt; bei öffentlichen Auftritten rollten ihm oft Tränen übers Gesicht. Er wechselte von den Tories zu den Liberalen und wieder zurück. Er wollte alles genau wissen und ließ sich gründlich informieren, um im nächsten Moment impulsiv und gegen den Rat der Experten zu handeln. Er spielte, manchmal va banque, oder plante, beides mit voller Überzeugung. Er war ein Demokrat und Parlamentarier, dem die Freiheit über alles ging. Gleichzeitig hatte er ein rassistisches Weltbild und hielt das Kolonialreich, in das er hineingeboren wurde, für den Höhepunkt der Menschheitsentwicklung.
Steht Churchill also für alles und nichts? Zeigen die Statuen und Porträtbüsten, die auf öffentlichen Plätzen, in den Arbeitszimmern von Regierungschefs und auf unzähligen Schreibtischen und Kaminsimsen stehen, bloß einen Opportunisten, der sich besonders gewitzt und erfolgreich nach oben geschlängelt hat? Das Bild, das auf den folgenden Seiten Farbe und Kontur annimmt, zeigt uns doch einen anderen Menschen: Am Ende ist es die kerzengerade Haltung unter dem Druck der deutschen Gefahr, die sein widersprüchliches, wechselvolles, von Niederlagen gezeichnetes und fast schon gescheitertes Politikerleben einzigartig und groß gemacht hat. Schauen wir uns an, wie es dazu gekommen ist.
Teil I
Der Unvollendete (1874–1931)
Wir haben keine ewigen Verbündeten und keine dauerhaften Feinde. Ewig und dauerhaft sind nur unsere Interessen, und diesen Interessen zu folgen ist unsere Pflicht.
Lord Palmerston, britischer Premierminister in der Mitte des 19. Jahrhunderts
1 »Ein Mann von wachsendem Einfluss«: Churchill lernt Deutschland kennen
Hätte Churchill bei seinem ersten Deutschlandbesuch die Zeit gehabt, in der Stadt, die damals Breslau hieß, die Steinstufen zum Schweidnitzer Keller hinabzusteigen und im Gewölbe des mittelalterlichen Lokals ein frisch gezapftes Bier zu trinken, sein Name wäre dort vermutlich heute auf der Bronzetafel neben der Treppe eingraviert, in einer Reihe mit berühmten Gästen wie Goethe, Lessing, Chopin und Kaiser Sigismund.
Aber Churchill hatte keine Zeit. Nirgends in der niederschlesischen Metropole sind noch Spuren von ihm zu finden; das Hotel Zur Goldenen Gans, in dem er logierte, brannte im Zweiten Weltkrieg aus und wurde nicht wieder aufgebaut. Dass die Stadt einmal polnisch werden sollte, ja dass sogar Churchill selbst an der Verwandlung von Breslau zu Wrocław beteiligt sein würde – zur damaligen Zeit wäre wohl niemand im Traum darauf gekommen.
Es ist der September des Jahres 1906, eines der ruhigeren Jahre für das Deutsche Reich. Noch ein paar Wochen, und in Berlin wird ein Schuster sich eine Uniform anziehen, im Rathaus eines nahen Städtchens die Kasse an sich nehmen und als »Hauptmann von Köpenick« in die Geschichte eingehen. Im englischen Portsmouth ist ein halbes Jahr vorher die 160 Meter lange, 23 000 PS starke Dreadnought vom Stapel gelaufen, ein neuartiges, schwer bewaffnetes Modell, die Mutter aller Schlachtschiffe des kriegerischen 20. Jahrhunderts. Die Flottenrüstung ist zu jener Zeit eines der heikelsten britisch-deutschen Themen und wird es bis zum Ersten Weltkrieg bleiben.
In Breslau geht es jedoch nicht um die Flotte, sondern um das Heer. Die Deutschen haben Churchill als Beobachter zum »Kaisermanöver« eingeladen, das dieses Jahr in Schlesien stattfindet. Chef des Generalstabs ist immer ein Preuße: Anfang des Jahres hat Helmuth von Moltke das Amt von Alfred Graf von Schlieffen übernommen. Schlieffen hat bis zuletzt an seinem Plan für den Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und Russland gearbeitet, der jetzt auf dem Tisch seines Nachfolgers liegt. In nicht allzu ferner Zukunft wird der Schlieffen-Plan eine wesentliche Grundlage der deutschen Angriffsstrategie bilden.
Beim Kaisermanöver ist davon noch nichts zu erkennen. Dem 31-jährigen Besucher aus England steht eine anstrengende Woche bevor: In einem späteren Bericht klagt Churchill darüber, er habe »kaum jemals mit so wenig Schlaf auskommen müssen«. Abend für Abend sitzt er bis gegen Mitternacht an der kaiserlichen Festtafel, »um gegen drei oder vier Uhr morgens wieder geweckt zu werden«. Noch vor dem Morgengrauen muss er am Bahnhof sein, von wo aus ein Sonderzug ihn und die anderen Manöverbeobachter in das Gelände fährt, auf dem die Übungsschlacht stattfindet. Die rote Armee marschiert gegen die blaue, die ihre Stellungen ein gutes Stück nördlich von Breslau in einer Linie zwischen den Städten Glogau und Schrimm bezogen hat. Die Formationen erstrecken sich über Dutzende Kilometer.
Sobald der Zug die Beobachter am Schlachtfeld abgesetzt hat, steigen sie aufs Pferd und reiten zehn, zwölf Stunden umher. Dann geht es zurück nach Breslau, wo das nächste Bankett beginnt, gefolgt von der nächsten kurzen Nacht. Einige Mühe musste Churchill vorab auf die Frage der korrekten Kleidung verwenden. Der Militärattaché an der deutschen Botschaft in London hatte ihm übermittelt, er möge während des Manövers bitte Felduniform mit Schwert tragen, zur Parade und bei den Diners levée dress (Hofuniform). Zur Sicherheit konsultierte Churchill noch König Edward VII., der ihn wissen ließ, dass er mit seiner Kavallerieausstattung nichts verkehrt machen könne.
Churchill nimmt nach dem Ende seiner Militärlaufbahn regelmäßig an Reserveübungen teil, inzwischen im Rang eines Majors der Queen’s Own Oxfordshire Hussars. Allerdings ist seine Paradeuniform nicht mehr präsentabel, wie ihm sein Bruder Jack bedauernd mitteilt: Der Federbusch sei verschwunden, und das Leopardenfell diene seit sechs Jahren als Kaminvorleger. Churchill leiht sich beides von seinem Cousin »Sunny«, dem Herzog von Marlborough, erscheint dann aber doch ohne Leopardenfell zur kaiserlichen Truppenparade, da der Aufmarsch »in halber Manöverformation« abläuft, anstatt rein repräsentativ zu sein.
Über den Gast von der Insel ziehen die Deutschen selbstverständlich ihre Erkundigungen ein. Im Archiv des Auswärtigen Amts ist ein Schreiben vom 13. August 1906 aufbewahrt, in dem Botschafter Paul Graf Metternich aus London berichtet: »Unterstaatssekretär Winston Churchill … erfreut sich bei seinen früheren konservativen Parteigenossen und auch innerhalb der hiesigen königlichen Familie, insbesondere dem Herzog von Connaught, geringer Beliebtheit. Er ist aber ein Mann von Einfluss und von wachsendem Einfluss, und es wäre daher politisch zweckmäßig, wenn wir uns durch etwaige abfällige Urteile seitens des Herzogs von Connaught nicht präjudizieren ließen. Es wäre vielleicht gut, wenn S. M. der Kaiser hiervon Kenntnis erhielte.« Der Herzog von Connaught, der als Lieblingssohn der einige Jahre zuvor verstorbenen Queen Victoria galt, ist ein naher Verwandter des Kaisers. Auch durch seine Ehefrau, eine preußische Prinzessin, verfügt er über Kontakte nach Deutschland. Es liegt daher nahe, dass Wilhelm II. bereits von seinem Verwandten über Churchill informiert worden ist.
Mag sein, dass die diplomatische Vorbereitung geholfen hat, jedenfalls gestalten sich die Begegnungen zwischen Seiner Majestät und dem »Mann von wachsendem Einfluss« rundum harmonisch. Draußen im Feld erklärt Wilhelm II. seinem Gast das Manövergelände und kümmert sich um sein Wohlergehen; beim Bankett nach der Truppenparade nimmt er sich 20 Minuten Zeit für ein Gespräch unter vier Augen. Churchill berichtet seinem Minister: »Er war sehr freundlich und ist gewiss eine überaus faszinierende Persönlichkeit.« Der Kaiser kommt auf den laufenden Kolonialkrieg zu sprechen, den die Deutschen in Südwestafrika gegen die Herero und Nama führen. In angeberischem Ton lobt er die Kampfkraft seiner Truppen. Heute gilt die exzessive Gewalt gegenüber den Einheimischen als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts.
In der britischen Politik kennt sich der deutsche Herrscher bestens aus, was daran liegt, dass er eng mit dem Königshaus verwandt ist und vorzüglich Englisch spricht. Edward VII., der als ältester Sohn den Thron von Queen Victoria geerbt hat, ist ein Bruder von Wilhelms Mutter. Die Rivalität der beiden Länder wird durch diese Nähe allerdings nicht gemildert, eher sogar gesteigert, da Neffe »Willy« zu »Onkel Bertie« (abgeleitet von dessen Taufnamen Albert) nicht gerade ein gutes Verhältnis hat. Erst streiten sie sich bei den sommerlichen Regatten, die sie mit ihren Segeljachten an der englischen Küste austragen, dann nennt der Deutsche den Briten einen »alten Pfau«. Es ist Abneigung auf Gegenseitigkeit: »Durch und durch falsch« sei der Kaiser, »der erbittertste Feind, den England besitzt«, behauptet der König.
Aufmerksam registriert Churchill, wie Wilhelm II. bei einem der abendlichen Diners die Leistungen seines Landes herausstreicht. Vor genau hundert Jahren, sagt der Monarch vor der versammelten Reichselite aus Adel und Militär, sei Deutschland »auf dem tiefsten Punkt des Elends angelangt«. Er meint die Niederlage der Preußen gegen die napoleonischen Truppen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806. Den Stolz des Herrschers auf den preußischen Wiederaufstieg und die nationale Einigung kann Churchill gut nachvollziehen: »Es schien unglaublich zu sein, dass ein einziges Jahrhundert, vier flüchtige Generationen, genügt haben sollte, das kraftstrotzende Gebäude von Macht und Reichtum, Energie und Organisation zu errichten, dessen staunende Beobachter wir waren.« Verglichen mit der deutschen Dynamik kommt ihm sein eigenes Land behäbig und zurückhaltend vor. Wie ein alter Wal vertraut England, die führende Seemacht der Erde, auf seine lange angesammelten Kräfte.
Ehe Churchill heimkehrt, fährt er über Wien nach Süden. Britische Politiker jener Zeit gönnen sich wochen-, manchmal monatelange Sommerpausen. Churchill hat seinen Urlaub dieses Jahr im normannischen Badeort Deauville begonnen (mit langen Abenden im Spielcasino), in den Schweizer Alpen fortgesetzt und für den Manöverbesuch unterbrochen. Jetzt begibt er sich auf Italienreise.
In Venedig steigt Churchill einige Tage im luxuriösen Hotel Danieli ab, dann schließt er sich seinem Freund Lionel Rothschild an, der ihn und zwei Freundinnen auf eine Autotour mitnimmt: Über Bologna, Rimini, Urbino und Perugia geht es nach Siena – mit beachtlichen 40 Meilen die Stunde, wie Churchill aus der Toskana seiner Mutter berichtet. »So viele Kirchen haben wir gesehen, dazu Heilige und Gemälde in Hülle und Fülle.« Am nächsten Tag stehe die Rückreise nach Venedig an, 330 Kilometer am Stück. Etwas gespreizt fügt der unverheiratete Sohn im Hinblick auf eine der beiden Reisegefährtinnen hinzu: »Nichts könnte die stille banalité übertreffen, die mein Verhältnis zu M auszeichnet.« Muriel Wilson, die schöne Tochter eines reichen Reeders, hat zwei Jahre zuvor seinen Heiratsantrag abgelehnt. Beide kennen sich seit ihrer Teenagerzeit. Einst hat sie ihm geholfen, seinen leichten Sprachfehler zu beherrschen, ein lispelndes, zum Sch tendierendes S. Ihr Übungssatz für ihn lautete: »The Spanish ships I cannot see, for they are not in sight.«
Wenn Churchill unterwegs ist, lässt er es an nichts fehlen. Seine Enkelin Celia Sandys, die den Spuren ihres Großvaters ausgiebig gefolgt ist und fünf Bücher über ihn geschrieben hat, fasst zusammen: »Er reiste immer standesgemäß – es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dritter Klasse zu reisen oder den Bus zu nehmen, um Geld zu sparen.«
Sein Leben lang hat Churchill Bedienstete um sich. Als er das erste Mal eigenhändig eine Telefonnummer wählt, ist er 73 Jahre alt (er ruft die automatische Zeitansage an und bedankt sich höflich für die Auskunft). Darum bezweifelt Sandys, dass ihr Großvater jemals selbst seinen Koffer gepackt hat. Schon in seiner Zeit als junger Leutnant steht ihm ein Offiziersbursche zur Seite, später ein Kammerdiener. Er habe es gehalten wie Oscar Wilde: »Meine Vorlieben sind schlicht. Mit dem Besten bin ich immer zufrieden.« Für seidene Unterwäsche, auf die er wegen seiner »sehr zarten und empfindlichen Haut« nicht verzichten mag, gibt er jährlich mehr aus, als ein Arbeiter im selben Zeitraum verdient.
2 »Ich liebte sie von Herzen – aber aus der Ferne«: Eltern, Kindheit, Jugend
Churchills Hang zum Luxus wurde ihm in die Wiege gelegt. Seine Mutter Jennie bringt ihn am 30. November 1874 in Blenheim Palace zur Welt, einem der größten und repräsentativsten Schlösser des Königreichs, 186 Zimmer über einer Grundfläche von 28 000 Quadratmetern. Als einziges Gebäude des Landes, das weder der Krone noch der Staatskirche gehört, darf es offiziell als Palast bezeichnet werden.
Jennie Spencer-Churchill wird von der Niederkunft anscheinend überrascht. Es heißt, sie sei kurz vorher während eines Jagdausflugs hingefallen, habe dann ihr Reitpferd oder eine arg holpernde Kutsche bestiegen und sich dann noch abends ins Tanzvergnügen gestürzt, was die vorzeitigen Wehen ausgelöst habe. Ihr Ältester wäre demnach ein Siebenmonatskind. Manche wollen jedoch wissen, dass nichts davon stimme und nur erfunden worden sei, um die uneheliche Zeugung des Jungen zu vertuschen.
Geheiratet haben Churchills Eltern am 15. April 1874 in der britischen Botschaft in Paris: die 20-jährige, in New York geborene und europäisch erzogene Tochter eines US-Börsenspekulanten, der Rennpferde, ein Opernhaus und Anteile an der New York Times besitzt; und der fünf Jahre ältere zweite Sohn des Herzogs von Marlborough, Absolvent der Universität Oxford, ein frisch gewählter Unterhaus-Abgeordneter, der entschlossen ist, sich in der Politik zu beweisen. Seine Ambitionen sind gewiss nicht kleiner als sein extrabreiter Schnurrbart.
Jennie Jerome und Lord Randolph Churchill haben sich ein Dreivierteljahr vorher bei einer Segelregatta an der englischen Südküste kennengelernt. Der Prince of Wales und spätere König Edward VII. hat sie einander vorgestellt. Drei Tage später beschließen die beiden zu heiraten. Was mit stürmischer Liebe beginnt, wird zu einem Gegenstand längerer Finanzverhandlungen zwischen den Vätern, ehe das Brautpaar offiziell Ja sagen kann. Vordergründig passen alter englischer Adel und neues amerikanisches Geld perfekt zusammen. Doch Jennies Vater ist nicht so reich, wie er tut, und Randolphs Vater will seinen zweitältesten Sohn unter allen Umständen abgesichert sehen. Nach den Usancen des Königreichs erbt dieser weder die Herzogswürde noch das Familienvermögen; seine Kinder werden keine Adelstitel tragen.
Die schließlich erzielte Einigung verschafft den Eheleuten zwar ein stattliches Jahreseinkommen, doch da beide den Luxus lieben und keinerlei Einschränkungen gewohnt sind, leben sie meist über ihre Verhältnisse. Ihr Sohn Winston wird es später ganz ähnlich halten.
In der viktorianischen Oberschicht kommt zwischen Eltern und Kindern wenig Nähe auf. Zuwendung wird an Nannys delegiert, im Fall der beiden Churchill-Söhne ist es Elizabeth Everest, die über viele Jahre zu einer außerordentlich wichtigen Bezugsperson wird. Im Haus von Lord Randolph liegt die familiäre Kälte noch einige Grad unter dem Durchschnitt, aus heutiger Sicht scheint sie an emotionale Misshandlung zu grenzen. Viele Briefe das Schülers Winston aus dem Internat sind Schreie nach Aufmerksamkeit: Er bittet die Eltern, ihn zu besuchen – sie kommen nicht. Er hofft auf gemeinsame Festtage und Ferien – die Eltern verreisen wochenlang zu zweit. Wenn seine Noten nicht den Erwartungen entsprechen, machen sie ihm bittere Vorhaltungen – in feiner Schrift auf feinem Briefpapier.
Die Eltern richten sich bequem auf dem Standpunkt ein, Winston sei eben »ein äußerst schwieriges Kind«. So hat es Jennie ihrer eigenen Mutter geschrieben, als der Junge fünf Jahre alt ist, und bei dieser Meinung bleibt es. Für das Mutter-Sohn-Verhältnis findet Churchill später die vielsagenden Worte: »Sie strahlte für mich wie der Abendstern. Ich liebte sie von Herzen – aber aus der Ferne.«
Näher kommen sie sich erst, als er bereits erwachsen ist. Lady Randolph, wie sie als Ehefrau des Lords genannt wird, gehört zum innersten Kreis der englischen Society, berühmt für ihre Schönheit, geschätzt wegen ihres Esprits und ihrer Intelligenz, glamourös durch viele Liebesaffären, unter anderem mit dem Thronfolger, dem »Onkel Bertie« des deutschen Kaisers. Gemälde und Porträtfotos, auf denen ihre dunklen Augen zu leuchten scheinen, lassen ihre Ausstrahlung erahnen. Wie selbstverständlich geht sie davon aus, »immer die schönste Frau im Raum« zu sein. Die Familienlegende besagt, sie habe einen irokesischen Vorfahren gehabt, aber einen Beleg gibt es dafür genauso wenig wie für die blaue Schlange, die sich angeblich als Tätowierung um ihr Handgelenk ringelt.
Die gesellschaftlichen Verbindungen nutzt Lady Randolph, um ihrem Ältesten die von ihm begehrten Posten und Einsätze beim Militär zu verschaffen. Winston beweist ihr seine liebe- und respektvolle Zuwendung auch dann, als sie im Jahr 1900 nach dem frühen Tod des Vaters einen Offizier der Scots Guards heiratet, der bloß zwei Wochen älter ist als er selbst und finanziell nicht viel zu bieten hat. Der Ton zwischen Mutter und Sohn gleicht nun dem von Geschwistern oder guten Freunden. Mit 64 Jahren gibt die mittlerweile geschiedene Jennie 1918 dem dritten Ehemann das Ja-Wort, einem 41-jährigen Kolonialoffizier.
Drei Jahre später stolpert sie in neuen, hochhackigen Schuhen bei einer Freundin auf der Treppe, stürzt die Stufen hinunter und zieht sich einen komplizierten Knöchelbruch zu, der sich böse entzündet. Die Ärzte amputieren ihr das halbe Bein, eine schwere Blutung führt zu ihrem Tod. Auf das Kondolenzschreiben des Premierministers David Lloyd George antwortet Churchill: »Meine Mutter besaß die Gabe, im Geiste ewig jung zu bleiben.«
Dem hochtalentierten, charakterlich schwierigen Vater gelingt während Churchills Schulzeit der ersehnte Aufstieg in der Politik. Mit dem Namen Lord Randolph verbindet sich eine neue, zukunftsweisende Spielart des Konservatismus: die Tory Democracy, durch die sich die Partei – das Herrschaftsinstrument des adligen und bürgerlichen Establishments – für Wähler aus der Arbeiterklasse öffnet. Die Hinwendung zu sozialen Themen ist für Churchills Vater und seine Mitstreiter keine Herzensangelegenheit, sondern eine Strategie im Wettbewerb der Tories mit den Liberalen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mehrmals das Land regieren. Wahlrechtsreformen haben Millionen Männern aus den unteren Schichten während dieser Zeit die politische Teilhabe erlaubt. Warum sollte es nicht möglich sein, sie mit paternalistischen Zugeständnissen und geschickter Propaganda für die Konservativen zu gewinnen, statt sie den fortschrittlichen Liberalen zu überlassen? Die Labour Party formiert sich erst im Februar 1900. In Deutschland stellen die Sozialdemokraten da schon seit einem Jahrzehnt die stärkste Fraktion im Reichstag.
Auf Lord Randolph kommt schließlich das erste Regierungsamt zu: Mit 36 Jahren wird er Minister für Indien, den größten und wertvollsten Besitz des Empire. Nur ein Jahr später steigt er zum Finanzminister auf (Chancellor of the Exchequer), verbunden mit der Hoffnung, eines nicht allzu fernen Tages Regierungschef zu werden.
Doch dann schreibt er einen fatalen Brief. Im Streit um Haushaltskürzungen, die er dem Militär auferlegen will, erklärt er seinen Rücktritt, weil er fest davon überzeugt ist, unentbehrlich zu sein. Zur großen Überraschung des hochfahrenden Lords nimmt der Premierminister sein Gesuch an. Der Mann, dem gerade noch die Zukunft zu gehören schien, hat sich blitzartig ins Aus manövriert.
Winston ist zu dieser Zeit zwölf Jahre alt und müht sich in seinem Grundschul-Internat in Brighton mit Geometrie, Latein und Griechisch ab. Französisch und Geschichte gefallen ihm besser, Reiten und Schwimmen mag er am liebsten.
Obwohl sein Körperbau eher schmächtig ist, erweist sich der Junge als talentierter Sportler (allerdings nicht beim Fußball, für den er auch später wenig übrig hat). Als Jugendlicher tut er sich beim Fechten hervor, auf seinen Sieg 1892 bei der Fechtmeisterschaft der Privatschulen wird er sein Leben lang stolz sein. Er reüssiert als exzellenter Reiter und Polospieler, der sein Militärteam zu glanzvollen Turniersiegen führt. Erst mit Anfang fünfzig gibt er das Polospielen auf. Für den angeblichen Churchill-Ausspruch, das Geheimnis seines langen Lebens sei »no sports«, liegt nicht der geringste Beleg vor; das Pseudozitat kursiert fast nur im deutschen Sprachraum und wurde wohl in den Siebzigerjahren von einem Zeit-Redakteur erfunden.
An Brighton hat Churchill später gute Erinnerungen – vor allem im Kontrast zu seiner ersten Schule, der St George’s School in Ascot, auf die er als Siebenjähriger geschickt wurde, nachdem er sich schweren Herzens von seinen »ganz wunderbaren Spielsachen« verabschieden musste, »einer echten Dampfmaschine, einer magischen Laterne und einer fast schon 1000 Köpfe zählenden Sammlung von Soldaten«. Gegossen und bemalt wurden viele davon in den Werkshallen der Dresdner Firma Heyde, dem weltweit größten Hersteller von Zinnsoldaten. Winston liebt es, historische Schlachten nachzustellen. Als der unnahbare Vater ihm einmal 20 Minuten dabei zusieht, ist das für den Jungen ein unvergessliches Erlebnis.
Über das Institut in Ascot urteilt Churchill in seinem autobiografischen Bericht My Early Life (dem zugänglichsten seiner Bücher) voller Bitterkeit: »Die Züchtigung mit der Rute war ein bedeutender Bestandteil seines Lehrplans.« Sicher, auch die Zöglinge in Eton und Harrow lernen damals die Rute kennen. »Aber ich bin überzeugt, kein Etonschüler und ganz gewiss kein Harrowschüler wurde zu meiner Zeit jemals so grausam verprügelt wie von jenem Schulleiter, der sich gewohnheitsmäßig die kleinen Jungen vorknöpfte, die er in seiner Obhut und Gewalt hatte.« Vermutlich aus Sorge vor einem Rechtsstreit nennt er die Anstalt in seinem Buch St James’s School. Nichts scheint vergessen, als der viereinhalb Jahrzehnte älter gewordene Memoirenschreiber ausstößt: »Wie habe ich diese Schule gehasst, in welcher Angst lebte ich dort mehr als zwei Jahre lang.« Er habe die Tage gezählt, die einzelnen Stunden und kaum etwas gelernt.
Unter dem harten Regime zu kuschen ist nicht die Art des jungen Churchill. Als er in St George’s vom Direktor gezüchtigt wird, weil er in der Vorratskammer Zucker stibitzt hat, zahlt er es seinem Peiniger heim, indem er sich dessen »geheiligten Strohhut« (Zitat eines Mitschülers) schnappt und das gute Stück zertrampelt. Da Winston im verhassten Ascot häufig krank ist, schicken ihn die Eltern auf Anraten ihres Hausarztes schließlich nach Brighton auf die Schule – der heilsamen Seeluft wegen.
Seine nächste Bildungsetappe ist Harrow, eine jener renommierten Privatschulen, in denen die Söhne der Oberschicht lernen sollen, im Empire Verantwortung zu übernehmen. An der Schwelle zur Pubertät betritt Churchill nun, wie er schreibt, »das unwirtliche Gebiet der Prüfungen, welches zu durchqueren mir in den nächsten sieben Jahren bestimmt war«. Latein und Mathematik liegen ihm nicht – doch gerade darauf sei es in Harrow angekommen, während seine guten Aufsätze, seine Kenntnisse der Geschichte und Dichtkunst kaum jemanden interessiert hätten. Rückblickend malt Churchill seine angeblich schlechten Schulleistungen effektvoll aus, Erfolge lässt er beiläufig einfließen: Als 14-Jähriger gewinnt er einen Preis, weil er ein episches Gedicht von 1200 Versen aus Lays of Ancient Rome von Macaulay aus dem Kopf fehlerfrei aufsagen kann.
Mit seinem fabelhaften Gedächtnis sorgt Churchill immer wieder für Erstaunen: Komplette Shakespeare-Szenen gibt er anscheinend mühelos wieder und scheut sich nicht, Irrtümer in den Zitaten seiner Lehrer zu korrigieren. Noch im hohen Alter kann er lange Textpassagen, die er sich irgendwann einmal gemerkt hat, nach Belieben abrufen. Diese Fähigkeit nutzt und schult er auch als Parlamentarier; gerade während seiner Anfangsjahre in der Politik bereitet er seine Reden bis aufs Komma vor und lernt sie auswendig. Die meisterhafte Rhetorik, die zu Churchills Ruhm viel beigetragen hat, beruht nicht nur auf seinem Naturtalent, sondern auch auf harter Arbeit seit der Schulzeit.
Umso bedrückender ist die eisige Strenge, die ihm aus Briefen von daheim entgegenschlägt. Der Vater, der kaum zu wissen scheint, ob er seinen Sohn nach Eton oder Harrow geschickt hat, faucht ihn einmal an, Winston drohe »ein gesellschaftlicher Nichtsnutz« zu werden, »einer von Hunderten von Privatschul-Versagern, und du wirst zu einer schäbigen, unglücklichen und nutzlosen Existenz verkommen«. Der Ton der Mutter ist manchmal kaum milder.
Lord Randolph stirbt, als Churchill 20 ist. Schon eine Weile hat er an geistigen Ausfällen und unkontrollierten Bewegungen gelitten, die Ärzte behandeln ihn anscheinend wegen Syphilis. Heutige Experten bezweifeln diese Diagnose, von der offenkundig auch die Familie überzeugt war. Unklar bleibt, ob stattdessen ein Hirntumor oder eine seltene Nervenkrankheit den 45-Jährigen dahingerafft hat.
Die harte, abweisende Haltung des Vaters treibt den Sohn nicht dazu, rebellisch zu werden, im Gegenteil. Churchill verehrt diesen Mann und will ihm gefallen, weit über dessen Tod hinaus. Als Politiker knüpft Churchill immer wieder dort an, wo sein Vater aufgehört hat. Ganze Parlamentsreden seines toten Vorbilds lernt er auswendig. Er schreibt eine zweibändige Biografie über ihn (Lord Randolph Churchill, 1906), die vom Verlag gut honoriert und von Kritikern gelobt wird. Sein einziger Sohn bekommt den Namen Randolph.
Violet Bonham Carter, eine langjährige, vertraute Freundin Winstons, drückt es so aus: »Am Altar seines unbekannten Vaters hielt er Gottesdienst.« Was könnte nach zwei Jahrzehnten in einer Familie trauriger sein? Gelegentlich blickt Churchill selbst in diesen Abgrund seiner Kinder- und Jugendjahre, doch dem Sog des Selbstmitleids widersteht er. Die Geschichte, die er stattdessen erzählt, ist die vom starken Charakter, der durch Entbehrungen und gegen Widerstände gewachsen sei. Als er in einem vierbändigen Werk das Leben seines bedeutendsten Vorfahren, des ersten Herzogs von Marlborough beschreibt, bringt er darin die wie auf sich selbst gemünzten Sätze unter: »Man sagt, dass berühmte Männer gewöhnlich durch eine unglückliche Kindheit geprägt sind. Der harte Druck der Umstände, die Stachel der Widrigkeiten, der Ansporn durch Hänseleien und Spott in frühen Jahren sind notwendig, um die eiserne Zielstrebigkeit und den unbeugsamen Mutterwitz hervorzurufen, ohne die große Taten nur selten vollbracht werden.« In einem anderen Buch schreibt er über einen bedeutenden Mann, der früh den Vater verlor: »Einsame Bäume wachsen, wenn überhaupt, dann kräftig.«
Als er 73 Jahre alt ist, beschwört Churchill in einem enigmatischen kleinen Text den Geist seines Vaters herauf und beginnt ein Gespräch mit ihm. Lord Randolph will wissen, was sich seit seinem Tod verändert hat und wie es in der Welt von 1947 zugeht. Sein Sohn antwortet geduldig: Er ist verheiratet, hat vier Kinder und vier Enkelkinder. Die Monarchie besteht noch und wird sogar von den regierenden Sozialisten unterstützt. Frauen dürfen jetzt wählen. In Blenheim Palace residiert neben der herzoglichen Familie auch der Geheimdienst MI5. Die Briten haben in sämtlichen Kriegen gewonnen. Viele Millionen sind darin umgekommen. Die Deutschen haben »Schlachthäuser für Menschen« gebaut. Europa liegt in Trümmern. Der nächste Krieg könnte noch schrecklicher werden als alle bisherigen.
Nach einer langen Reihe solcher Aperçus steuert der Dialog auf seine Pointe zu: »Ich hätte nie erwartet, dass du dich so gut und gründlich entwickeln würdest«, sagt der Vater. »Wenn ich dich reden höre, wundere ich mich wirklich, dass du nicht in die Politik gegangen bist. Du hättest bei vielem helfen können. Du hättest dir sogar einen Namen machen können.« Und indem sich die Erscheinung eine Zigarette anzündet, verschwindet sie wieder.
Über die Geschichte seiner postumen Anerkennung durch den Vater setzt Churchill die Überschrift »Privater Artikel«, zu lesen nur im Familienkreis. Veröffentlicht wird der Text erst nach seinem Tod unter dem mehrdeutigen Titel »Der Traum«. Ob der schriftlich fixierte Tagtraum einen therapeutischen Sinn erfüllt hat? Der Kunstgriff, dass der Vater seinen Sohn endlich zu würdigen weiß, obwohl er dessen größte Leistung als Kriegspremier und Sieger über Nazi-Deutschland noch nicht einmal kennt, macht die Versöhnung auf dem Papier jedenfalls perfekt.
3 »Wie leicht es ist, einen Menschen zu töten«: Soldat und Kriegsreporter
Im September 1893 beginnt der 18 Jahre alte, 1,68 Meter große Harrow-Absolvent seine Ausbildung an der Militärakademie Sandhurst. Die Eingangsprüfung hat er erst im dritten Anlauf geschafft, weil er zunächst nur in Englisch und Chemie auf die erforderliche Punktzahl kam. Zum großen Ärger seines Vaters muss der Offiziersanwärter zur Kavallerie, was wegen der Unterhaltskosten für die Pferde teuer ist. Um sich der billigeren Infanterie anzuschließen, die als anspruchsvoller gilt, reicht sein Prüfungsergebnis nicht.
Churchill ist damit jedoch zufrieden, ja glücklich; den Umgang mit Pferden bezeichnet er als sein »größtes Vergnügen in Sandhurst«. Auch sonst ist das Militär seine Welt. Anders als während der Schulzeit schließt er jetzt einige feste Freundschaften. Der Unterrichtsstoff – Taktik, Festungsbau, Kartenzeichnen, Kriegsrecht – interessiert ihn, die Praxis noch mehr. Er lernt, wie man Bahngleise zerstört und Brücken sprengt. Nach anderthalb Jahren ist seine Offiziersausbildung beendet; unter den 130 Kadetten erreicht er Platz 20, in der Reitprüfung Platz 2.
Sein Ziel ist die große Politik, aber vorher will er sich als Soldat beweisen. Außerdem braucht er Geld, denn das väterliche Erbe von 54 237 Pfund (nach heutigem Wert mehrere Millionen Euro) reicht für ein sorgloses Luxusleben der drei Hinterbliebenen auf Dauer nicht aus. Fast alles, was der junge Mann sich vornimmt, wird er bald erreichen.
Als englischer Aristokrat und Offizier gehört Churchill am Ende des 19. Jahrhunderts zu den privilegiertesten Menschen der Welt. Persönliches Scheitern ist zwar niemals ausgeschlossen, aber seine Startbedingungen sind glänzend, denn das britische Empire befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Dominanz. London ist die größte und reichste Stadt, die es je gegeben hat. Mehr als ein Fünftel der Erdoberfläche wird von der Themse aus regiert. Mit gehörigem Abstand folgen als Kolonialmächte Frankreich, Deutschland, Russland und andere. Die USA sind bei aller wirtschaftlichen Stärke noch kein weltpolitischer Akteur. Die alte Großmacht China wurde von den Briten in zwei perfiden Opiumkriegen niedergekämpft und gedemütigt. Und in dieser mächtigsten Nation der Erde gehört Churchill zur winzigen Oberschicht.
Den Impuls, die globale Ordnung jener Zeit mit kritischer Distanz zu betrachten, verspürt er nie. Für Churchill ist sie die beste aller möglichen Welten, um die er trauert, als sie untergeht. Er ist, kurz gesagt, durch und durch Imperialist und stolz darauf.
Nach der Zeit in Sandhurst schließt er sich einem Husarenregiment an, das von einem Freund seiner Mutter kommandiert wird. Die Ausstattung inklusive Pferd und Paradeuniform kostet ihn das Fünffache seines Jahressolds. Zeitweilig dient er bei den Kolonialtruppen in Indien. Sein Bild vom Krieg, wie er es später beschreibt, ist ebenso romantisch wie rassistisch: Britische Soldaten haben zu seinem Bedauern schon lange, seit dem 1856 beendeten Krimkrieg, nicht mehr »auf weiße Truppen« geschossen. »Zum Glück gab es immerhin noch Wilde und barbarische Völker.« Doch verglichen mit einem »echten europäischen Krieg« erscheinen ihm Gefechte gegen Afrikaner, Inder oder Afghanen bloß wie eine halbe Sache.
Für seinen kurzen Einsatz an der Seite spanischer Truppen im Kolonialkrieg gegen kubanische Freiheitskämpfer bekommt Churchill einen Orden (es ist die erste von 37 staatlichen Auszeichnungen, die er im Lauf seines Lebens erhalten wird). Um das Abenteuer zu finanzieren, verfasst er für die Daily Graphic, Englands erste illustrierte Tageszeitung, Berichte über das Kampfgeschehen. Damit beginnt seine lange und äußerst erfolgreiche Karriere als Journalist und Schriftsteller. Für die Erwartungen der Leser hat er ein sicheres Gespür: »Ich halte nichts davon, Bücher zu schreiben, die sich nicht verkaufen.«
Dass ein Offizier nebenher Kriegsreportagen veröffentlicht, wird von der Militärführung zwar nicht gern gesehen, ist damals aber auch nicht verboten. Churchill geht ganz bewusst in diese Grauzone, indem er sich gegen manche Widerstände mithilfe seiner Mutter zu spannenden, berichtenswerten Einsätzen meldet.
Als 22-Jähriger nimmt er an Kämpfen im afghanisch-indischen (heute pakistanischen) Grenzgebiet teil und schreibt darüber. Ein Jahr danach berichtet er aus dem Sudan. Muslimische Truppen unter Führung des »Mahdi« hatten dort in einem »Heiligen Krieg« die Briten zurückgeschlagen – mit dem Ziel, das nilabwärts gelegene Ägypten von der Kolonialherrschaft zu befreien und ein Reich des Islam zu errichten. Die Gefolgsleute des Mahdi werden von den Europäern abschätzig »Derwische« genannt. Während der Anreise auf dem Nil schreibt Churchill seiner Mutter: »Tief in mir spüre ich den starken Wunsch, mehrere dieser widerlichen Derwische umzubringen.« Er freue sich schon sehr darauf.
In der legendären Schlacht von Omdurman begegnen sich am 2. September 1898 nicht nur zwei Armeen, zwei Religionen, zwei Kontinente, sondern auch moderne und vormoderne Militärtechnik, Maschinengewehr und Kampfschwert. Selbst die Briten, deren automatische Maxim gun die fürchterlichste Waffe jener Zeit ist, sind für den Nahkampf noch wie eh und je mit Schwertern ausgerüstet. Churchill vertraut allerdings lieber auf seine neue deutsche Mauser-Pistole, da seine Schulter seit einem Bootsunfall leicht auskugelt. Als er im Getümmel auf einmal von seiner Einheit abgeschnitten ist und die Feinde auf ihn zustürzen, feuert er mehrere Kugeln auf sie ab. Einen Verwundeten, der plötzlich seinen Speer schwingt, erschießt er aus nächster Nähe. Er sei »kein bisschen nervös« gewesen und habe mindestens fünf Gegner getroffen; allerdings könne er sich nicht mehr an alles genau erinnern, teilt er zwei Tage später seiner Mutter mit. In My Early Life sinniert er lange danach: »Wie leicht es ist, einen Menschen zu töten.«
Seine Zeitungsartikel und weiteres Material verarbeitet er zu Büchern, die eine große Leserschaft finden. Vor allem das Sudan-Buch The River War erregt Aufsehen, da Churchill den Krieg packend zu beschreiben versteht, ihn aber auch realistischer schildert als üblich. Außerdem nimmt er sich die Freiheit, seine Vorgesetzten, ihre Arroganz und ihre Propagandafloskeln in klaren Worten zu kritisieren. Seine naive Kriegsbegeisterung verflüchtigt sich.
Das Schreiben fällt ihm leicht, und es wird gut bezahlt. Vor seiner Abreise in den Sudan hat er mit der Morning Post ein Honorar von 15 Pfund pro Artikel vereinbart (in heutigem Geld rund 2000 Euro). Als er ein Jahr später nach Südafrika aufbricht, um über den Burenkrieg zu berichten, zahlt ihm die Zeitung den enormen Betrag von 250 Pfund monatlich plus Spesen. Mit Mitte 20 ist Churchill der bestbezahlte Kriegsreporter der Welt.
Das Geld braucht er nicht nur für Bedienstete, Pferde, Champagner und kubanische Zigarren, sondern auch, um sein Lebensziel zu erreichen: den Erfolg als Politiker. Großbritannien versteht sich zwar schon lange als Demokratie, folgt aber den harten Regeln einer Klassengesellschaft, in der ein Prozent der Einwohner über zwei Drittel des Vermögens verfügt. Die meisten, die in der nationalen Politik mitreden, zählen zu jener kleinen Oberschicht. Bis 1911 ist ein Unterhaus-Mandat ein reines Ehrenamt; wer sich das nicht leisten kann, muss draußen bleiben.
Im Burenkrieg darf sich Churchill dem Militär anschließen, allerdings gehört er nicht mehr zur Truppe. Nach seinen kritischen Berichten unterliegen Soldaten jetzt einem Publikationsverbot. Doch wo verläuft die Grenze zwischen Reporter und Kombattant? Als die Einheit, die er im November 1899 begleitet, in einen Hinterhalt gerät, organisiert er die Verteidigung und gibt Kommandos wie ein Vorgesetzter. »Bleibt ruhig, Männer«, ruft er, »das hier wird für meine Zeitung interessant sein.« Schließlich gewinnen die Buren die Oberhand, Churchill gerät in Kriegsgefangenschaft.
Etwas Besseres hätte ihm kaum passieren können, aber noch weiß er das nicht. Er findet es unerträglich, die Tage tatenlos dahinbringen zu müssen. An seinem 25. Geburtstag beklagt er sich bei einem Freund: »Mein Geist ist so träge wie mein Körper eingepfercht, während sich große Dinge ereignen und die Geschichte voranschreitet.« Nicht zum letzten Mal zeigt er sich besorgt, sogar gewiss, dass er kein langes Leben haben werde: »Daran zu denken, wie wenig Zeit noch bleibt, ist schrecklich!«
Bald danach gelingt ihm eine sensationelle Flucht. Bei dem oft reproduzierten Fahndungsplakat, das für seine Festnahme – »tot oder lebendig« – 25 Pfund Belohnung verspricht, handelt es sich jedoch um eine spätere Fälschung. Versteckt in einem Güterzug schafft es Churchill, sich nach Norden bis auf portugiesisch beherrschtes Gebiet im heutigen Mosambik durchzuschlagen. Der britische Konsul in Lourenço Marques, heute Maputo, lässt ein warmes Bad für ihn einlaufen und wirft seine schmutzstarrende Kleidung ins Feuer. Voller Tatendrang schließt sich der Reporter, der durch Glück und eigene Kraft dem Gefangenenlager entkommen ist, wieder den britischen Truppen an.
Nach seiner Heimkehr wird Churchill gefeiert. Seine aufsehenerregende Flucht, sein Mut und seine Ausdauer verschaffen ihm das Image eines jungen Helden. Mehr denn je fühlt er sich zu Höherem berufen: »Wir alle sind Würmchen«, sagt er einmal beim Diner zu seiner Tischdame, »aber ich glaube fest daran, dass ich ein Glühwürmchen bin.«
Von Niederlagen lässt er sich nicht beirren. Vor seiner Abreise nach Südafrika hat er gleich zwei einstecken müssen, eine private und eine politische. Die Konservativen in Oldham bei Manchester haben ihn für ihren Unterhaus-Wahlkreis nominiert, doch im Juli 1899 verliert Churchill gegen die beiden Kandidaten der Liberalen, die knapp vor ihm liegen. Nach den damaligen Regeln schickt der Wahlkreis zwei Abgeordnete nach London. Ungefähr zu dieser Zeit lehnt Pamela Plowden, die er während seiner Stationierung in Indien kennengelernt hat, seinen Heiratsantrag ab. Sie bleiben gut befreundet. Die nächste Absage erteilt ihm die erfolgreiche und glamouröse US-Schauspielerin Ethel Barrymore. Dass er mehrere Anläufe braucht, bis schließlich eine Ehekandidatin zu seinem Antrag Ja sagt, scheint ihn nicht sonderlich zu bedrücken.