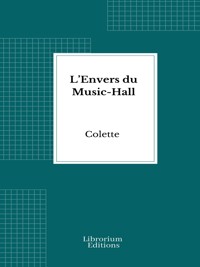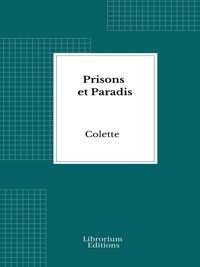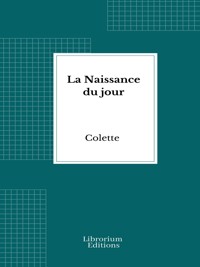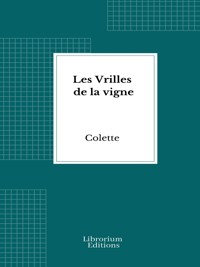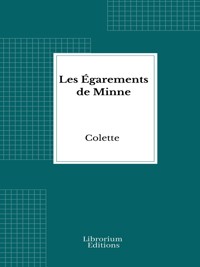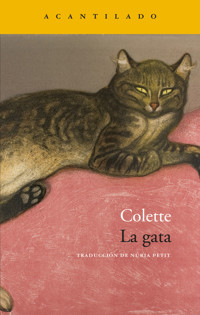Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Man bewundert an Colette eine Lebendigkeit, die es bei keinem männlichen Schriftsteller gibt.« Simone de Beauvoir Colette ist unvergleichlich. Die Frau, die heute neben Flaubert und Proust steht, beginnt als Enfant terrible: Ihre provozierenden »Claudine«-Romane veröffentlicht der Ehemann unter seinem Namen; später sorgt ihr freizügiges Leben für Skandale. In »Claudines Elternhaus« schreibt Colette ihre eigene Geschichte: Kindheit und Jugend in dem kleinen burgundischen Dorf, eine zärtliche, ironische Hommage an Eltern, Geschwister, an Handwerker, Honoratioren, Schulkameraden und nicht zuletzt die geliebten Tiere. »Claudines Elternhaus« erzählt davon, wie ein kleines Mädchen zu Colette wird – das wunderbare Selbstporträt einer großen Schriftstellerin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Colette ist unvergleichlich. Die Frau, die heute neben Flaubert und Proust steht, beginnt als Enfant terrible: Ihre provozierenden »Claudine«-Romane veröffentlicht der Ehemann unter seinem Namen; später sorgt ihr freizügiges Leben für Skandale.In »Claudines Elternhaus« schreibt Colette ihre eigene Geschichte: Kindheit und Jugend in dem kleinen burgundischen Dorf, eine zärtliche, ironische Hommage an Eltern, Geschwister, an Handwerker, Honoratioren, Schulkameraden und nicht zuletzt die geliebten Tiere. »Claudines Elternhaus« erzählt davon, wie ein kleines Mädchen zu Colette wird — das wunderbare Selbstporträt einer großen Schriftstellerin.
Colette
Claudines Elternhaus
Roman
Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Elisabeth Edl
Paul Zsolnay Verlag
Kinder, wo seid ihr?
Das Haus war groß, gekrönt von einem hohen Speicher. Die steil ansteigende Straße zwang Pferdeställe und Remisen, Hühnerhöfe, Waschküche, Milchkammer, sich ein Stückchen tiefer rings um einen geschlossenen Hof zu kauern.
Auf die Gartenmauer gestützt, konnte ich mit dem Finger am Dach des Hühnerstalls kratzen. Der Obere Garten überragte einen Unteren Garten, den eingepferchten, warmen Gemüsegarten, wo Auberginen gediehen und Paprikaschoten und im Juli der Geruch von Tomatenblättern sich mischte mit dem Duft der am Spalier gereiften Marille. Im Oberen Garten zwei Zwillingstannen, ein Nussbaum, dessen unverträglicher Schatten alle Blumen umbrachte, Rosen, vernachlässigte Rasenstücke, eine wacklige Laube … Ein kräftiger Gitterzaun ganz hinten, entlang der Rue des Vignes, sollte die beiden Gärten schützen; ich habe diese Gitterstäbe jedoch immer nur verbogen gekannt, aus dem Zement ihrer Mauer gerissen, hochgehoben und in die Luft gestemmt von den unwiderstehlichen Armen einer hundertjährigen Glyzinie …
Die Hauptfassade, an der Rue de l’Hospice, war eine Fassade mit doppelter Außentreppe, schwarz geworden, mit großen Fenstern und ohne jegliche Anmut, ein Bürgerhaus in einem alten Dorf, aber die steil ansteigende Straße brachte seinen würdigen Ernst ein bisschen ins Wanken, und seine Außentreppe hinkte, sechs Stufen auf der einen Seite, zehn auf der andern.
Großes tiefernstes Haus, grimmig mit seiner Waisenhausglocke an der Tür, seiner Toreinfahrt samt großem alten Gefängnisriegel, ein Haus, das nur seinem Garten zulächelte. Die Rückseite, unsichtbar für jeden Vorübergehenden, von der Sonne beschienen, trug einen Mantel aus Glyzinie und Bignonie, ineinander verschlungen, schwer lastend auf dem ermüdeten, in der Mitte wie eine Hängematte durchgebogenen Eisengerüst, das einer kleinen gefliesten Terrasse und der Schwelle zum Salon Schatten spendete … Lohnt es sich, dass ich den Rest beschreibe, mit armseligen Worten? Ich helfe niemandem, all das zu sehen, was in meiner Erinnerung den roten Ranken einer herbstlichen Weinrebe Glanz verlieh, zerstört durch ihr eigenes Gewicht, in ihrem Sturz festgekrallt an ein paar Kiefernzweigen. Die mächtigen Fliederbüsche, deren Blütentraube, blau im Schatten, purpurn in der Sonne, rasch verrottete, erstickt durch ihre eigene Üppigkeit, diese längst abgestorbenen Fliederbüsche steigen durch mich nicht wieder herauf ans Licht, so wenig wie der furchteinflößende Mondschein — Silber, Bleigrau, Quecksilber, scharfkantige Amethystfacetten, stechende spitze Saphire —, der zusammenhing mit einer gewissen blauen Fensterscheibe, am Pavillon ganz tief im Garten.
Haus und Garten leben noch, ich weiß, doch was soll’s, wenn der Zauber sie verlassen hat, wenn das Geheimnis verloren ist — Licht, Gerüche, Harmonie aus Bäumen und Vögeln, Gemurmel menschlicher Stimmen, ausgelöscht durch den Tod —, das eine Welt eröffnete, derer ich nicht mehr würdig bin? …
Es kam vor, dass ein Buch, aufgeschlagen im Gras oder auf der steinernen Terrasse, ein sich schlängelndes Springseil in der Mitte eines Wegs oder ein winziger Garten, von Kieseln gesäumt, mit Blütenköpfen bepflanzt, einstmals, in jener Zeit, als dieses Haus und dieser Garten bewohnt waren von einer Familie, die Anwesenheit der Kinder verrieten und auch ihr verschiedenes Alter. Aber diese Zeichen waren fast nie begleitet von kindlichem Geschrei oder Lachen, und das Logis, warm und vollgestopft, glich auf wunderliche Weise jenen Häusern, denen ein Ferienende in Nullkommanichts alle Freude raubt. Die Stille, der bezähmte Wind im umfriedeten Garten, die vom unsichtbaren Daumen einer Sylphe gewendeten Buchblätter, alles schien zu fragen: »Kinder, wo seid ihr?«
Da tauchte unter dem betagten eisernen Bogen, den die Glyzinie nach links drückte, meine Mutter auf, rundlich und klein in jener Zeit, als sie noch nicht abgezehrt war vom Alter. Sie spähte ins dichte Grün, hob den Kopf und schleuderte ihren Ruf in die Lüfte:
»Kinder! Wo seid ihr, Kinder?«
Wo? Nirgendwo. Der Ruf drang durch den Garten, stieß gegen die hohe Mauer des Heuschuppens und kam zurück als ganz schwaches und wie erschöpftes Echo: »Ohhh … Kinder …«
Nirgendwo. Meine Mutter warf den Kopf in den Nacken, blickte hoch in die Wolken, als erwartete sie, ein Schwarm geflügelter Kinder müsse herabschießen. Nach einer Weile stieß sie noch einmal denselben Schrei aus, dann wurde sie der Himmelsbefragung überdrüssig, knackte mit dem Fingernagel eine trockene Mohnkapsel, schabte an dem von grünen Blattläusen umhäkelten Rosenstock, steckte die ersten Nüsse in ihre Tasche, schüttelte den Kopf über die verschwundenen Kinder und ging ins Haus. Doch über ihr, zwischen den Blättern des Nussbaums, glänzte das dreieckige, nach unten schauende Gesicht eines Kindes, hingestreckt auf dem dicken Ast wie ein Kater und mucksmäuschenstill. Hätte eine nicht ganz so kurzsichtige Mutter aus den hastigen Verneigungen, welche die Zwillingswipfel der beiden Tannen austauschten, eine Ursache herausgelesen, die nichts zu tun hatte mit den jähen Oktoberwindböen? Und hätte sie in der quadratischen Luke unter der Seilrolle fürs Viehfutter nicht mit ein bisschen Blinzeln die zwei hellen Flecken im Heu erraten: das Gesicht eines jungen Burschen und sein Buch? Doch sie hatte es aufgegeben, uns zu entdecken, verlor jede Hoffnung, uns zu erwischen. Unsere seltsame Wildheit begleitete kein einziger Schrei. Ich glaube nicht, dass es quirligere Kinder gab und stillere. Erst jetzt wundere ich mich darüber. Niemand hatte von uns diese fröhliche Stummheit verlangt, auch nicht diese beschränkte Geselligkeit. Mein neunzehnjähriger Bruder, der hydrotherapeutische Apparate aus Tuchwürsten, Draht und gläsernen Lötlampen baute, hinderte den jüngeren, mit seinen vierzehn Jahren, nicht daran, eine Uhr auseinanderzunehmen, noch eine Melodie, ein in der Kreisstadt gehörtes symphonisches Stück fehlerlos am Klavier nachzuklimpern; und auch nicht, mit unergründlichem Vergnügen den Garten mit kleinen, aus Pappe geschnittenen Grabsteinen zu schmücken, wobei jeder unterm Kreuz einen Namen trug, ein Epitaph und die Genealogie des ausgedachten Toten … Meine Schwester mit dem allzu langen Haar konnte endlos, pausenlos lesen: Die zwei Burschen liefen vorüber, streiften, wie ohne es zu sehen, dieses dasitzende, verzauberte, entrückte Mädchen und störten es nicht. Ich durfte, als ich klein war, dem großen Schritt der Burschen folgen, ihnen hinterherrennen, wenn sie in die Wälder stürmten, auf der Jagd nach dem Großen Eisvogel, dem Segelfalter, dem scheuen Schillerfalter, oder der Blindschleiche nachstellten oder den hochgewachsenen Julifingerhut zu Sträußen banden, tief in den schütteren Wäldern, rot von Heidekrautpfützen … Aber ich folgte ihnen geräuschlos, sammelte Brombeeren, Vogelkirschen oder Blumen, streunte durchs Unterholz und über die wasserdurchtränkten Wiesen wie ein eigenwilliger Hund, der keinem Rechenschaft gibt …
»Kinder, wo seid ihr?« Plötzlich stand sie da, ganz außer Atem durch ihr ständiges Suchen, wie eine allzu zärtliche Hundemutter, mit erhobenem Kopf im Winde schnüffelnd. Ihre in weißem Leinen steckenden Arme erzählten, dass sie gerade Galette-Teig geknetet hatte oder Englischen Pudding, übergossen mit einer heißen Samtschicht aus Rum und Konfitüre. Eine große blaue Schürze hatte sie umgebunden, wenn sie die Havaneser Hündin wusch, und manchmal fuchtelte sie mit einer Fahne aus knisterndem gelben Papier vom Metzger; denn sie hoffte, zusammen mit den verstreuten Kindern auch ihre stromernden Kätzinnen anzulocken, gierig auf rohes Fleisch …
Zum gewohnten Schrei kam noch, im selben dringlichen und flehenden Ton, die Erinnerung an die Zeit: »Vier Uhr! Sie sind nicht zur Jause erschienen! Kinder, wo seid ihr? …« — »Halb sieben! Kommen sie zum Abendessen? Kinder, wo seid ihr? …« Die hübsche Stimme, ich weinte vor Freude, wenn ich sie hörte … Unsere einzige Sünde, unsere einzige Missetat war das Schweigen und eine Art wundersames Verschwinden. Unschuldiger Vorhaben zuliebe, einer Freiheit zuliebe, die niemand uns streitig machte, kletterten wir über Zäune, zogen die Schuhe aus, benutzen auf dem Rückweg eine überflüssige Leiter, die niedrige Mauer eines Nachbarn. Die feine Nase der besorgten Mutter erschnupperte an uns den Bärlauch aus einer fernen Schlucht oder die Minze aus den unter Gras versteckten Sümpfen. Die nasse Tasche eines der Jungen verbarg die Badehose, die er mitgenommen hatte zu den Fieberteichen, und die »Kleine«, mit aufgeschlagenem Knie, abgeschabtem Ellbogen, blutete still vor sich hin unter Verbänden aus Spinnweben und gemahlenem Pfeffer, umwickelt mit Grashalmen …
»Morgen werdet ihr eingesperrt! Alle, hört ihr, alle!«
Morgen … Morgen, da rutschte der Ältere vom Schieferdach, auf dem er einen Wasserbehälter installierte, brach sich das Schlüsselbein und blieb stumm, höflich, halb bewusstlos am Fuß der Mauer sitzen und wartete, dass ihn jemand aufsammeln kam. Morgen, da knallte dem Jüngeren, ohne dass ihm ein Wort entschlüpfte, eine sechs Meter lange Leiter gegen die Stirn, und er brachte ein blaurotes Ei zwischen den Augen nach Hause …
»Kinder, wo seid ihr?«
Zwei ruhen im Grab. Die andern werden von Tag zu Tag älter. Falls es einen Ort gibt, wo man nach dem Leben wartet, dann ängstigt sich die Frau, die auf uns wartete, immer noch wegen der zwei Lebenden. Was die Älteste von uns allen angeht, starrt sie wenigstens nicht mehr durch die schwarze Fensterscheibe am Abend: »Ach! Ich spür’s, dieses Kind ist nicht glücklich … Ach! Ich spür’s, sie leidet …«
Was den älteren Burschen angeht, horcht sie nicht mehr mit Herzklopfen auf das Rattern eines Arzt-Kabrioletts im nächtlichen Schnee, und genauso wenig auf den Schritt der grauen Stute. Ich weiß jedoch, für die zwei Übriggebliebenen irrt sie noch immer suchend umher, unsichtbar, kummergeplagt, weil sie uns nicht genug schützt: »Wo seid ihr, Kinder, wo seid ihr? …«
Der Wilde
Als er sie um 1853 ihrer Familie raubte, die nur aus zwei Brüdern bestand, in Belgien verheiratete französische Journalisten, und ihren Freunden, lauter Maler, Musiker und Dichter, eine ganze junge Bohème aus französischen und belgischen Künstlern, da war sie achtzehn. Ein blondes Mädchen, nicht sehr hübsch, aber einnehmend, mit großem Mund und zartem Kinn, fröhlichen grauen Augen, im Nacken ein tiefsitzender Knoten aus glattem, den Nadeln entschlüpfendem Haar, ein freies junges Mädchen, gewöhnt, anständig mit Burschen, Brüdern und Kameraden, unter einem Dach zu leben. Ein Mädchen ohne Mitgift, Aussteuer oder Schmuck, dessen schlanker Oberkörper sich anmutig über dem bauschigen Rock bewegte: ein Mädchen mit schmaler Taille und runden Schultern, klein und kräftig.
Der Wilde erblickte sie eines Tages, als sie aus Belgien nach Frankreich gekommen war, um ein paar Sommerwochen bei ihrer Ziehmutter auf dem Land zu verbringen, und er zu Pferd seine benachbarten Äcker inspizierte. An seine Dienstmägde gewöhnt, die er, kaum erobert, sofort wieder fallenließ, träumte er von diesem ungenierten jungen Mädchen, das ihn angeschaut hatte, ohne den Blick zu senken und ohne zu lächeln. Der frische schwarze Bart des Reiters, sein kirschrotes Pferd, seine vornehme Vampirblässe missfielen dem jungen Mädchen nicht, doch sie vergaß ihn bereits, als er sich nach ihr umhörte. Er bekam ihren Namen heraus und dass sie »Sido« genannt wurde, als Abkürzung für Sidonie. Auf Äußerlichkeiten bedacht, wie so viele »Wilde«, setzte er Notare und Verwandte in Bewegung, und so erfuhr man in Belgien, dieser Sohn von Landjunkern und Glasfabrikanten besitze Bauernhöfe, Wälder, ein schönes Haus mit Außentreppe und Garten, Bargeld … Verwirrt und stumm lauschte Sido, wickelte ihre blonden Korkenzieherlocken um die Finger. Doch ein Mädchen ohne Vermögen und ohne Beruf, das ihren Brüdern auf der Tasche liegt, muss den Mund halten, ihr Glück beim Schopf fassen und Gott danken.
Sie nahm also Abschied vom warmen belgischen Haus, von der Küche im Souterrain, die nach Gas roch, nach warmem Brot und Kaffee; sie nahm Abschied vom Klavier, von der Geige, dem großformatigen Salvator Rosa, den ihr Vater hinterlassen hatte, vom Tabaktopf und den schlanken irdenen Pfeifen mit langem Stiel, den Koksöfen, den aufgeschlagenen Büchern und zerknitterten Zeitungen, um als junge Ehefrau in das Haus mit Außentreppe zu ziehen, umgeben vom harten Winter waldreicher Landstriche.
Sie fand dort einen unerwarteten weiß-goldnen Salon im Erdgeschoss, doch einen kaum verputzten ersten Stock, vernachlässigt wie ein Dachboden. Zwei gute Pferde, zwei Kühe im Stall taten sich an Grünfutter und Hafer gütlich, man schlug Butter und presste Käse in den Wirtschaftsgebäuden, aber die eiskalten Schlafzimmer erzählten weder von Liebe noch von sanftem Schlaf.
Tafelsilber, mit der Gravur einer auf den Hinterhufen stehenden Ziege, Kristallgläser und Wein gab es im Überfluss. Finstere alte Frauen spannen abends bei Kerzenlicht in der Küche, brachen und haspelten den Hanf von den Landgütern, um Betten und Anrichte mit schwerer Leinwand zu versorgen, unverwüstlich und kalt. Ein zähes Gegacker streitsüchtiger Köchinnen schwoll an und ab, je nachdem, ob der Hausherr heimkam oder fortging; bärtige Feen suchten mit einem Blick der neuen Gattin Unglück anzuhexen, und eine vom Hausherrn verlassene schöne Wäscherin weinte voll Ingrimm, an den Brunnen gelehnt, während der Wilde jagte.
Dieser Wilde, ein Mann von zumeist guten Manieren, behandelte seine kleine Zivilisierte anfangs gut. Doch Sido, die Freunde suchte, eine unschuldige und heitere Geselligkeit, traf in ihrem eigenen Haushalt nur auf Dienstboten, abgefeimte Bauern, mit Wein und Hasenblut bekleckerte Jagdaufseher, umweht von Wolfsgeruch. Der Wilde redete wenig mit ihnen, von oben herab. Vom vergessenen Adel bewahrte er sich Hochmut, Höflichkeit, Brutalität und den Hang, sich mit Niedriggestellten zu umgeben; sein Spitzname kam nur von der Gewohnheit, allein auszureiten, ohne Hund oder Gefährten zu jagen, stumm zu bleiben. Sido liebte das Gespräch, den Spott, die Lebendigkeit, die despotische und hingebungsvolle Güte, die Sanftheit. Sie schmückte das große Haus mit Blumen, ließ die düstere Küche weißen, überwachte die Zubereitung flämischer Gerichte, knetete Rosinenkuchen und wartete auf ihr erstes Kind. Der Wilde schenkte ihr ein Lächeln zwischen zwei Ausflügen und verschwand. Er kehrte zurück zu seinen Weinstöcken, zu seinen schwammigen Wäldern, verweilte lange in Gasthöfen an Wegkreuzungen, wo alles schwarz ist, im Umkreis einer langen Talgkerze: die Deckenbalken, die rauchigen Wände, das Roggenbrot und der Wein in eisernen Bechern …
Als leckere Rezepte, Geduld und Bohnerwachs erschöpft waren, weinte die in Einsamkeit abgemagerte Sido, und der Wilde sah die Spur der von ihr verleugneten Tränen. Er begriff vage, dass sie sich langweilte, dass ihr eine gewisse, seiner ganzen Schwermut eines Wilden fremde Art von Komfort und Luxus fehlte. Was tun? …
Er ritt eines Morgens auf seinem Pferd davon, trabte bis in die Kreisstadt — vierzig Kilometer —, durchkämmte sie und kam in der folgenden Nacht zurück, wobei er mit größter Unbeholfenheit zwei erstaunliche Gegenstände heimbrachte, welche die Begehrlichkeit einer jungen Frau entzücken mussten: einen kleinen Mörser zum Zerstoßen von Mandeln und Pasten, aus ganz seltenem Lumachella-Marmor, und einen Kaschmirschal aus Indien.
In dem stumpf und schartig gewordenen Mörser könnte ich noch Mandeln zerstoßen, vermischt mit Zucker und Zitronenschale. Aber ich mache mir Vorwürfe, dass ich den Kaschmirschal mit seinem kirschroten Grund zu Kissen und Handtaschen zerschneide. Denn meine Mutter, sie war die Sido ohne Liebe und ohne Tadel eines ersten hypochondrischen Ehemanns, behandelte Schal und Mörser sorgsam und mit sentimentalen Händen.
»Siehst du«, sagte sie zu mir, »er hat mir das mitgebracht, dieser Wilde, der es nicht verstand, Geschenke zu machen. Dennoch hat er mir das mitgebracht, unter großen Mühen, festgezurrt auf seiner Stute Mustapha. Er stand vor mir, die Arme beladen, so stolz und so linkisch wie ein riesiger Hund, der im Maul ein Pantöffelchen hält. Und ich habe begriffen, dass für ihn diese Geschenke keinen Mörser darstellten und keinen Schal. Sie waren ›Geschenke‹, seltene und teure Gegenstände, die er von weither geholt hatte; das war seine erste selbstlose Geste — und leider! auch die letzte —, um eine junge Frau zu zerstreuen und zu trösten, die in der Fremde lebte und weinte …«
Eifersucht
»Es gibt heute nichts zum Abendessen … Heute Morgen hatte Tricotet noch nicht geschlachtet … Er wollte zu Mittag schlachten. Ich geh selbst zum Metzger, so, wie ich bin. Ärgerlich! Ach! Warum muss man essen? Was sollen wir heute Abend essen?«
Meine Mutter steht mutlos vor dem Fenster. Sie trägt ihr »Hauskleid« aus gepunktetem Satinet, ihre Silberbrosche, die zwei über ein Kinderbildnis gebeugte Engel zeigt, ihre Brille an einer Kette und ihr Lorgnon an der schwarzen Seidenkordel, die sich in allen Türschlüsseln verfängt, an allen Schubladengriffen zerreißt und unzählige Male wieder verknotet wird. Sie mustert uns der Reihe nach, ohne jede Hoffnung. Sie weiß, keiner von uns gibt ihr eine brauchbare Empfehlung. Um Rat gebeten, wird Papa antworten:
»Rohe Tomaten mit viel Pfeffer.«
»Rotkohl in Essig«, hätte Achille gesagt, der ältere meiner Brüder, den seine Doktorarbeit in Paris festhält.
»Eine große Tasse Schokolade!«, wird Léo verkünden, der jüngere.
Und ich, denn ich vergesse oft, dass ich schon über fünfzehn bin, werde mit Luftsprüngen verlangen:
»Pommes frites! Pommes frites! Und Nüsschen mit Käse!«
Doch anscheinend sind Pommes frites, Schokolade, Tomaten und Rotkohl »kein richtiges Abendessen« …
»Warum, Mama?«
»Stell doch keine dummen Fragen …«
Sie ist ganz vertieft in ihre Sorgen. Sie hat schon nach dem geschlossenen schwarzen Rohrkorb gegriffen und geht, so, wie sie ist. Sie behält ihren Gartenhut auf dem Kopf, leicht angesengt durch drei Sommer, breite Krempe, flach, verziert mit einer kastanienbraunen Rüsche, ihre Gärtnerinnenschürze umgebunden, deren eine Tasche ein Loch hat, vom krummen Schnabel der Heckenschere. Trockene Schwarzkümmelsamen und ihre Papiertütchen rascheln, im Takt der Schritte, wie Regen und aufgeraute Seide, tief in der andern Tasche. Mit stellvertretender Koketterie rufe ich:
»Mama! Zieh die Schürze aus!«
Im Gehen dreht sie ihr von zwei breiten Haarsträhnen umrahmtes Gesicht, das bei Kummer seine fünfundfünfzig Jahre verrät, und dreißig, wenn sie vergnügt ist.
»Warum denn? Ich geh nur in die Rue de la Roche.«
»Lass deine Mutter zufrieden«, brummt mein Vater in seinen Bart. »Wo geht sie eigentlich hin?«
»Zu Léonore, wegen des Abendessens.«
»Gehst du nicht mit?«
»Nein. Heute hab ich keine Lust.«
Es gibt Tage, an denen die Metzgerei von Léonore, ihre Messer, ihr Hackbeil, ihre aufgeblähten Rinderlungen, die im Luftzug schillern und schaukeln, rosarot wie das Fleisch der Begonie, mir so gut gefallen, als wäre es eine Konfiserie. Léonore schneidet einen hauchdünnen salzigen Streifen Speck und reicht ihn mir mit kalten Fingerspitzen. Im Garten der Metzgerei spielt Marie Tricotet, obwohl sie am selben Tag geboren ist wie ich, noch immer mit nicht geleerten Schweins- oder Kalbsblasen, sticht mit einer Nadel hinein und tritt mit dem Fuß drauf, denn »so spritzt ein Springbrunnen«. Das schaurige Geräusch der vom frischen Fleisch abgezogenen Haut, die Rundheit der Nieren, braune Früchte in der makellosen Polsterung ihrer zartrosa Fetthülle, erregen mich in einer verzwickten Abscheu, die ich suche und zugleich verberge. Aber das feine Schmalz, das in der Kerbe des gespaltenen kleinen Hufs zurückbleibt, wenn das Feuer die Füße des toten Schweins zerreißt, das esse ich wie eine gesunde Leckerei … Ganz egal. Heute habe ich keine Lust, Mama zu begleiten.
Mein Vater fragt nicht weiter, stellt sich geschmeidig auf sein einziges Bein, greift nach seiner Krücke und seinem Stock und geht hinauf in die Bibliothek. Zuvor faltet er sorgfältig Le Temps, versteckt die Zeitung unterm Kissen seines Lehnstuhls, stopft in eine Tasche seines langen Paletots La Nature mit ihrem azurblauen Kleid. Das kleine funkelnde Kosakenauge unter seiner hanffaserig grauen Braue rafft auf den Tischen alle gedruckte Nahrung zusammen, und sie verschwindet in der Bibliothek, um nie wieder ans Licht zu kommen … Doch gut dressiert auf diese Jagd, haben wir für ihn nichts liegengelassen …
»Hast du irgendwo den Mercure de France gesehen?«
»Nein, Papa.«
»Und die Revue bleue?«
»Nein, Papa.«
Er durchbohrt seine Kinder mit einem Folterknechtblick.
»Ich würde allzu gern wissen, wer in diesem Haus …«
Er ergeht sich in düsteren, unpersönlichen Vermutungen, gespickt mit giftigen Demonstrativpronomen. Sein Haus ist dieses Haus geworden, darin herrscht diese Unordnung, darin bekunden diese Kinder »von niedriger Abkunft« ihre Verachtung für bedrucktes Papier, ermutigt außerdem noch durch diese Frau …
»… Übrigens, wo ist diese Frau?«
»Aber Papa, sie ist bei Léonore!«
»Immer noch!«
»Sie ist doch eben erst gegangen …«
Er zieht seine Uhr aus der Tasche, schaut drauf, als wollte er zu Bett gehen, grapscht sich, weil nichts Besseres da ist, L’Office de publicité von vorgestern und geht hinauf in die Bibliothek. Die rechte Hand meines Vaters schließt sich fest um den Querstab einer Krücke, die unter seiner rechten Achsel klemmt. Die andere Hand benutzt nur einen Stock. Ich lausche diesem sich bestimmt und gleichmäßig entfernenden Rhythmus von zwei Stäben und einem einzigen Fuß, der meine ganze Jugend begleitet hat. Doch heute überfällt mich neues Unbehagen, denn plötzlich habe ich die vorspringenden Adern und die Runzeln auf den so weißen Händen meines Vaters bemerkt, und auch, wie sehr der dichte Haarsaum im Nacken seit kurzem an Farbe verloren hat … Also ist es möglich, dass er bald sechzig wird? …
Es ist kühl und trübselig auf der Außentreppe, wo ich die Rückkehr meiner Mutter erwarte. Ihr kleiner eleganter Schritt erklingt endlich aus der Rue de la Roche, und ich wundere mich, dass ich so froh bin … Sie biegt um die Straßenecke, läuft herunter zu mir. Scheusal-Patasson, der Hund, trottet voraus, und sie hat es eilig.
»Lass mich, Liebling, wenn ich die Lammschulter nicht sofort Henriette gebe, damit sie ins Rohr kommt, essen wir Stiefelleder … Wo ist dein Vater?«
Ich folge ihr, zum ersten Mal irgendwie empört, weil sie sich nach Papa erkundigt. Wo sie ihn doch vor einer halben Stunde gesehen hat und er das Haus fast nie verlässt … Sie weiß genau, wo mein Vater ist … Viel dringlicher wäre, dass sie zum Beispiel sagt: »Minet-Chéri, du bist ein wenig blass … Minet-Chéri, was hast du?«
Wortlos schaue ich zu, wie sie ihren Gartenhut in die Ecke schleudert, mit einer jugendlichen Bewegung, die graues Haar zum Vorschein bringt und ein Gesicht in frischer Farbe, aber hier und da von unauslöschlichen Falten durchzogen. Also ist es möglich — ja, sicher, ich bin die Letztgeborene von uns vieren — also ist es möglich, dass meine Mutter bald vierundfünfzig wird? … Daran denke ich nie. Ich möchte es gern vergessen.
Da ist er, der, nach dem sie gefragt hat. Da ist er, mit zerzaustem Haar, strubbeligem Bart. Er hat auf das Zuschlagen der Eingangstür gelauert, er ist herabgestiegen aus seinem Reich …
»Da bist du ja? Lang hast du gebraucht.«
Sie dreht sich um, blitzschnell wie eine Katze:
»Lang? Das ist wohl ein Witz, ich bin nur einmal hin und zurück.«
»Wohin? Zu Léonore!«
»Ach! Nein, ich musste auch noch zu Corneau, wegen …«
»Wegen seiner blöden Visage? Und seinen Vorträgen über die Temperatur?«
»Du gehst mir auf die Nerven! Ich war auch bei Cholet, Johannisbeerblätter holen.«
Das kleine Kosakenauge funkelt boshaft:
»So! So! Bei Cholet!«
Mein Vater wirft den Kopf zurück, fährt sich mit der Hand durch sein dichtes, fast weißes Haar:
»So! So! Bei Cholet! Ist dir wenigstens aufgefallen, dass ihm die Haare ausgehen, dem Cholet, und dass man seine Platte sieht?«
»Nein, ist mir nicht aufgefallen.«
»Ist dir nicht aufgefallen! Nein, ist dir natürlich nicht aufgefallen! Du warst viel zu sehr mit Scharwenzeln beschäftigt, wegen der Laffen vom Wirtshaus gegenüber und der zwei Mabilat-Söhne!«
»Oh! Das geht zu weit! Ich, ich, wegen der zwei Mabilat-Söhne! Hör zu, also wirklich, ich begreife nicht, wie kannst du es wagen … Ich versichre dir, nicht einmal den Kopf hab ich in Richtung Mabilat gewandt! Und der Beweis, ich habe …«
Meine Mutter kreuzt voller Leidenschaft ihre hübschen, von Alter und frischer Luft welk gewordenen Hände vor der Brust, die ein Korsett mit Körbchen betont. Rot angelaufen zwischen ihren ergrauten Haarsträhnen, aufgewühlt von einer Empörung, die ihr schlaffes Kinn erzittern lässt, ist diese kleine alte Dame niedlich, während sie sich ganz im Ernst gegen einen eifersüchtigen Sechzigjährigen verteidigt. Auch er meint es ganz ernst, wenn er sie jetzt beschuldigt, »auf galante Abenteuer aus zu sein«. Nur ich lache über ihr Gezänk, denn ich bin erst fünfzehn und habe noch nichts durchschaut: unter greisen Augenbrauen die Grausamkeit der Liebe und auf den verblühten Wangen einer Frau jugendliches Erröten.
Die Kleine
Ein Geruch von zertretenem Rasen schwebt über der dichten ungemähten Wiese, die das Spiel wie schwerer Hagel in alle Richtungen umgeworfen hat. Wilde kleine Schuhabsätze haben die Wege aufgewühlt, den Kies über die Rabatten geschleudert; ein Springseil hängt am Brunnenschwengel; die Teller einer Puppenküche, groß wie Margeriten, bestirnen das Gras; ein langgezogenes ärgerliches Miauen kündet vom Ende des Tages, vom Erwachen der Katzen, vom nahen Abendessen.
Soeben sind sie gegangen, die Spielgefährtinnen der Kleinen. Voller Verachtung für die Tür sind sie über den Gartenzaun gehüpft, haben in der menschenleeren Rue des Vignes ihre letzten dämonischen Schreie ausgestoßen, ihre aus vollem Hals gebrüllten kindlichen Flüche, begleitet von flegelhaftem Schulterrollen, breitbeinigen Posen, Krötengrimassen, absichtlichem Schielen, herausgestreckten violett-tintenfleckigen Zungen. Über die Mauer hinweg hat die Kleine — auch Minet-Chéri genannt — auf ihre Flucht alles ausgekippt, was noch übrig war an schallendem Gelächter, derbem Spott und Patois-Ausdrücken. Sie hatten heisere Stimmen, Backen und Augen kleiner Mädchen, die jemand betrunken gemacht hat. Sie gehen völlig erschöpft, wie entwürdigt durch einen ganzen verspielten Nachmittag. Weder Müßiggang noch Langeweile veredelten diesen endlosen und erniedrigenden Spaß, der die Kleine angeekelt und hässlich zurücklässt.
Sonntage sind manchmal verträumte und leere Tage; die weißen Schuhe, das gestärkte Kleid sind Schutz vor gewissen Exzessen. Der Donnerstag jedoch, ordinärer Stillstand, Streik in schwarzer Kittelschürze und genagelten Stiefelchen, erlaubt alles. Fast fünf Stunden lang haben diese Kinder die Donnerstagsfreiheiten genossen. Eine markierte die Kranke, die andre verkaufte einer dritten Kaffee, einer Viehhökerin, die ihr anschließend eine Kuh andrehte: »Dreißig Pistolen, Allmächtiger! Ein Schwein, wer sein Wort zurücknimmt!« Jeanne lieh sich vom alten Gruel das Gemüt eines Kuttelhändlers und Hasenfellmachers. Yvonne verkörperte Gruels Tochter, ein dünnes Geschöpf, zerquält und liederlich. Scire und seine Frau, Gruels Nachbarn, erschienen in Gestalt von Gabrielle und Sandrine, und aus sechs Kindermündern schwappte der Dreck einer armseligen Straße. Abscheulicher Klatsch über Gaunereien und schmutzige Liebschaften verzerrte so manche Lippe, blutigrot vom Kirschsaft und noch glänzend vom Honig des Jausenbrots … Ein Kartenspiel schlüpfte aus einer Tasche, und es ertönte lautes Gejohl. Konnten drei kleine Mädchen von sechsen nicht bereits schwindeln, den Daumen ablecken wie in der Kneipe, die Trumpfkarte auf den Tisch knallen: »Und wieder Trumpf! Und du hast eine Klatsche kassiert; hast keinen einzigen Punkt gemacht!«
Alles, was man in den Straßen eines Dorfes so aufschnappt, haben sie voller Leidenschaft hinausgeschrien, nachgeahmt. Es war einer von den Donnerstagen, denen Minet-Chéris Mutter ausweicht, im Haus verkrochen und ängstlich wie vor einem einfallenden Feind.