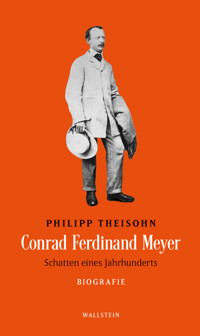
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Philipp Theisohn erzählt die Lebensgeschichte C.F. Meyers neu – als Roman einer Epoche, ihrer Sehnsüchte und Ängste. Das Bild, das uns von C.F. Meyer, dem ersten modernen Lyriker deutscher Sprache, geblieben ist, wird durchzogen von Widersprüchen. Hier der realistische Novellist, der versierte Poet, der Nationaldichter. Dort der dekadente Zögling des Zürcher Patriziats, der fromme Sonderling, nicht nur in seinem Konservatismus ein Antipode Gottfried Kellers. Hinter den Masken des Ruhms, schlimmer noch, ein missverstandener Bruder und missratener Sohn, ein kranker Mann, ein Irrenhäusler. Vielleicht ist die Zeit für eine weitere, für eine letzte Erzählung gekommen: Die Erzählung einer literarischen Existenz, die vierzig Jahre lang ohne Werk bleibt, um dann sogleich wieder hinter den Texten zu verschwinden, den eigenen wie den fremden. Die Erzählung einer Krankheit, die sich von Zeile zu Zeile ausbreitet, eine ganze Schreibgemeinschaft befällt und ihre Sinne verdunkelt. Eine Biographie, die uns das 19. Jahrhundert neu verstehen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 837
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Erinnerung an Peter von Matt
Philipp Theisohn
Conrad Ferdinand Meyer
Schatten eines Jahrhunderts
Biografie
Inhalt
I. Das Gespenst auf der Rigi
Hotel »Rigi-Scheideck«, Juli 1897 – Das offene Geheimnis – CFM oder Ein Jahrhundert beschwört seine Geister
II. Die Väter der Geschichte
Zürich, 1802 – Unsagbare Abkunft – Der Historismus und wie man ihn wieder loswird – Der Vater, die Berge, die Bücher – Zürich, 1839
III. Die Dämonen in den Wänden
Préfargier, September 1856 – Betsy Meyer-Ulrich, Textmaschine – Die innere Sprache – Ein Sohn zum Fürchten – Der Genius oder Poesie als Dämonendienst – Das begrabene Herz – Lausanne, 1843 – Der Fremde – Orakel und Grabesreden – Préfargier, 1852 – Cécile Borrel und die Schuld in Briefen – Le grand ennemi, c’est le moi – Frauen, irgendwann – Die trügerischen Mächte – Stadelhofen, 1854 – Der Tod des Herrn – Die Rechnung
IV. Das Halbwesen
In den Texten der Anderen – Vischer – Clara (1853/54) oder Der Ursprung des Erzählens im blinden Fleck der Geschichte – Die Bilderstürmerinnen und das Recht der Poesie
V. Im Wartesaal
Geld – Paris, 1857: Eine Entzauberung – Betsy trifft Anstalten – Rom, 1858: Das Auge der Dichtung – Form geben, Form werden: Michelangelos Mortifikationen – Das zweite Vermächtnis: Bettino Ricasoli – Conrad liest Paulus – Ulrich Meister, Unsichtbarer – Zwanzig Balladen eines Schweizers (1864) oder Die Schrift der Parze – Die Geburt des Sekretärs – Romanzen und Bilder (1869): Ein Brunnen und was aus ihm wird – Der Dichter ein Traum
VI. Unter Deutschen
Erfolg – Wille, Wagner, Wesendonck: Das Milieu von Mariafeld – Teutonifikation: Der Schmied – Huttens letzte Tage (1871): Schwert und Feder – Die Ufenau als Geisterinsel – Adieu
VII. Seelenmalerei
Venedig, 1871/72 – Blutige Allegorese: Engelberg (1872) – Im Schatten der Kastanien – Der Mann ohne Prosa – Novellistik oder Die Kunst des Versagens – Vergilbte Blätter: Das Amulet (1873) – Die entsiegelte Ödnis – Der angefochtene Erzähler
VIII. Die Versteinerten
Tschamut, 1873 – Louise – Jenatsch, verfrüht – Korsika – Jürg Jenatsch (1875) – Der Stoff: Bündner Wirren – Die Logik des Traums – Die Macht der zerrissenen Persönlichkeit
IX. Die Dioskuren
Ein Brief aus der Enge – Das Haus des Conrad Ferdinand – Der Comtur, eine gute Idee – Wertmüllers Wiederkehr – Tolles Zeug: Der Schuß von der Kanzel (1878) – Die Abfigürten – Ein unerhörtes Stück – Ein anderer wie er: Heinrich Leuthold – Der Vampir
X. Gnadenlos
Pfeil, Bogen und Schreibrohr: Der Heilige (1880) – Die verlorene Gnade – Das Medusenhaupt der Dichtung – Überfromme und Angefasste – Dr. Meyer – Abschiede: Die Schwester und der Baron
XI. Wahrheit
Eine andere Louise – Der Dynast, noch eine gute Idee – Gottlose Komik: Plautus im Nonnenkloster (1882) – Was Wahrheit ist – Spyri – Die Bittsteller: Druskowitz, Bender, Spitteler
XII. Das Flattern
Realistisch werden – Gedichte (1882): Eine Textvoliere – Der Techniker der Seele – Der erste Symbolist – Der Tag ist richtbar – Das abgespiegelte Ich
XIII. Montierte Menschheit
Gustav Adolfs Page (1883) oder Die künstliche Welt – Lettern, Silben, Larven – Das Leiden eines Knaben (1883) oder Wie man kein Mann wird – Animalische Einbildungskraft – Petrus Vinea und das verschwiegene Weltgeheimnis – Gebrochene Gelübde: Die Hochzeit des Mönchs (1884) – Dantes Therapeutik – Die schönen Gespenster
XIV. Zwischenspiel: Louise
XV. Blut und Schande
Der Familienroman: Freud liest Meyer – Das innerste Heiligtum – Die Richterin (1885) oder Das infernalische Paar – Das Recht der Mütter – Die verwitterte Männlichkeit
XVI. Der Unversuchte
Der Heilige von Kilchberg – Musik – Die sanfte Klosteraufhebung – Spät, aber doch: Flaubert – Die verspätete Tragödie: Die Versuchung des Pescara (1887) – Menschen zu Bildern
XVII. Die Blendung
Diesseits von Gut und Böse – Pseudisidor oder Der Autor als Geschichtslüge – Alfred Meißner oder Der Autor als grauenvolle Spaltung – Das Spinnen und Weben der Fantasie: Kellers Tod – Duno Duni – Hedda Meyer-Ziegler und die Rückkehr des Sekretärs – Angela Borgia (1891), eine ophthalmologische Novelle
XVIII. Am Ende war ich gar nicht dort
Das Ende des Traums: Der Schrei um Mitternacht – Königsfelden, Juli 1892 – Der Wärter – Kein Grund zur Besorgnis
XIX. Die Stimmen, die Hände, der Autor, das Ende
Die Verräterin – Worüber man nicht reden kann – Kleine Änderungen und nachgemachte Buchstaben: Weiterschreiben – Hotel »Rigi-Scheideck«, Juli 1897
XX. Nachspiel: Camilla
Anmerkungen
Literatur
Siglen – Allgemeines Literaturverzeichnis
Abbildungen
Register
Dank
I. Das Gespenst auf der Rigi
Das Innerschweizer Hotel »Rigi-Scheideck«, 1840 in der Nähe einiger Mineralquellen errichtet, gehört zu den exquisiteren Tourismuszielen des 19. Jahrhunderts. Nicht nur die vom Alpinismus infizierten Viktorianer machen, wie das Fremdenbuch des Hotels verrät,[1] hoch über dem Vierwaldstättersee Station. Auch die Großbürger des benachbarten Auslands begeben sich regelmäßig zur Kur in die Schweizer Voralpen, unter ihnen der Schriftsteller und Publizist Karl Emil Franzos. Schon die Sommer 1892 und 1894 hat der einflussreiche Herausgeber der Deutschen Dichtung, einer der bedeutendsten Literaturzeitschriften ihrer Zeit, auf der Rigi verbracht, um sich in der Höhenluft von der Hektik Berlins zu erholen.[2] Im Juli 1897 führt ihn sein Weg einmal mehr dorthin – und wider Erwarten trifft er dort auf einen Bekannten:
Ich kam […] gegen Mittag nach Rigi-Scheidegg, ohne Ahnung, daß er oben sei, wie er nicht wußte, daß ich eintreffen würde. Auf dem Bahnhof hörte ich zufällig, daß er in einer halben Stunde abreisen würde, und im Korridor des Hotels begegnete er mir; langsam, gebeugten Haupts kam er daher. Einen Augenblick schwankte ich, dann trat ich rasch bei Seite, daß er mich nicht sehen konnte. Als er’s erfuhr, war er sehr erschüttert: »Das war gut, er hat’s uns beiden ersparen wollen!«[3]
Bei dem begegnungslos davongekommenen Kurgast handelt es sich um Conrad Ferdinand Meyer. Anderthalb Jahre hat der Schweizer Schriftsteller, neben Storm und Fontane zu den wichtigsten Beiträgern der Deutschen Dichtung zählend, da noch zu leben. Mit Franzos, der jene Episode in seinem 1899 abgehaltenen Berliner Nekrolog erzählt, verbindet Meyer in erster Linie eine Arbeitsbeziehung, die sich in einem späten Briefwechsel niederschlägt. Im Mai 1884 hatte ihn der damalige Redakteur der Wiener Neuen Illustrirten Zeitung erstmals kontaktiert und um »einen poetischen Beitrag« für sein »deutsch-österreichisches Blatt, welches kräftig die Pflege des deutschen Culturgedankens vertritt«, gebeten.[4] Meyer hatte daraufhin Franzos offensichtlich Hoffnungen gemacht, dann zunächst nicht geliefert, um ihm dann im Folgejahr zumindest »eine Kleinigkeit« in Form der Ballade Kaiser Sigmunds Ende zu überlassen.[5]
Mit der Gründung der Deutschen Dichtung 1886 beginnt Franzos, seine Bemühungen um Meyer zu intensivieren: »Alles, was Sie mir spenden wollen«, ist ihm für das neue Blatt »höchst willkommen«, und »geradezu als ein Glück« würde er es betrachten, wenn er von ihm »schon zum Beginn eine größere epische Dichtung in Prosa oder Vers erwerben könnte.«[6] Daraus wird erst einmal nichts: Meyer besieht sich den Prospekt der Deutschen Dichtung, wünscht dem »Unternehmen guten Erfolg« und verweist bedauernd auf seine »körperliche Ermüdung«.[7] In der Folge wird er der Zeitschrift jedoch immer wieder Gedichte liefern,[8] später auch nicht ganz folgenlose Erinnerungen an Gottfried Keller und einen ebenfalls bedeutungsvollen Beitrag über seinen »Erstling« Huttens letzte Tage. Zugleich wird er selbst zum Sujet: Die siebte Nummer der Deutschen Dichtung (1889 /90) ist ihm gewidmet, trägt sein Konterfei auf dem Titel und enthält neben einigen Gedichten Meyers auch einen werkbiografischen Aufsatz Adolf Freys. Meyers letzter Beitrag für die Zeitschrift erscheint 1892, es handelt sich um das Wanderlied.
Das alles ist dokumentiert und Literaturgeschichte. Man kann das wissen, es bleibt aber vor allen Dingen Statistik. Aussagekraft allein erlangt die Distanz, die sich zwischen Papier und Person erstreckt, eine Distanz, die Franzos immer wieder vergeblich aufzuheben versucht. Im Juli 1886 hat er es fast geschafft. Er sitzt schon im Zürcher Nobelhotel »Baur au lac«, zu Meyers Kilchberger Residenz ist es nur ein Katzensprung. Da erreicht ihn ein Telegramm aus Walzenhausen: »Bedaure herzlich. Bin hier oben im Kanton Appenzell.«[9] Fünf Jahre später scheitert ein zweites Treffen: Franzos kündigt im Sommer 1891 seinen Besuch in Kilchberg auf einen Donnerstag an und meint damit den 13. August. Meyer, gerade einmal wieder auf der Rigi, sagt per Postkarte zu, meint aber den 20. August, denn er hat Franzos’ Mitteilung erst am 13. August zur Kenntnis genommen. Vom Dichter dafür gewohnt karger Trost: »Das dritte Mal aber wird es gelingen, so hoffe ich.«[10]
»Das dritte Mal« aber, davon ist mit Blick auf Meyers Krankheitsgeschichte auszugehen, dürfte sich nicht vor besagtem Juli 1897 zugetragen haben.[11] Glaubt man Franzos’ Darstellung, dann handelt es sich bei jener Begegnung auf Rigi-Scheidegg somit weniger um ein ›Wiedersehen‹ als vielmehr um eine Epiphanie. Zum ersten Mal, so scheint es, wurde Meyers Schutzschild der Unpässlichkeit durchbrochen: Doch was Franzos dahinter entgegentritt, ist nicht begegnungsfähig, kein Gesprächspartner. Diese Autorschaft muss eine sekundäre bleiben. Auf dem Briefpapier des Hotels, das Meyer bei seinen Aufenthalten zu Korrespondenzzwecken nutzt, ist er nahbarer als auf dessen Korridoren.
So bleibt dann auch die kolportierte Reaktion Meyers nichts als Franzos’ eigene Schrift, ist nirgends sonst verbürgt und nicht allein deswegen schon anzuzweifeln. Tatsächlich scheint sie sich vor allem dem Bemühen des Trauerredners zu fügen, den Verblichenen zu verlebendigen. »[A]uch durch meinen Mund soll, so weit dies irgend möglich ist, er selbst zu Ihnen sprechen«,[12] proklamiert der Redner und unterstellt sich damit einer Rhetorik des maskierten Wortes, deren Subjekt im Dunkeln bleibt. Je ostentativer Franzos Meyers Stimme beansprucht, Figurenzitate für Ausrufe des Autors ausgibt,[13] briefliche Mitteilungen in ›Schreie‹[14] verwandelt oder sich die Augen desjenigen leiht, der Meyer »so in dem schönen Anwesen, in herrlicher Landschaft, mit der trefflichen, ihm seit 1875 angetrauten Gattin, der lieben Tochter hausen sah«[15]: umso deutlicher wird, dass dies alles Projektionen sind. Die Erinnerung an den Dichter beherrscht der Wunsch, ihn zu einem Zeitgenossen zu machen, zu einer Gestalt, in der Leben und Text sich verbinden.
Zwischen Wunsch und Wunscherfüllung tritt freilich das Problem, dass man es hier offensichtlich mit einem Menschen zu tun hat, der darauf besteht, keine Spuren eines Innenlebens zu hinterlassen, keine Heimlichkeiten zu pflegen, ja: mit einem Menschen, der es sich »zum Gesetze gemacht« hat, »kein Wort zu schreiben, noch selbst zu reden, das nicht alle Welt wissen darf«, und der, »außerhalb dieser Sphäre der Loyalität, nicht wohl existieren« kann.[16] Der hermeneutische Stolz derjenigen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die ›Wahrheit‹ dieser Existenz zu bergen, hängt dementsprechend weniger am vermeintlich Geäußerten als am vermeintlich Verschwiegenen, das allein noch deutbar scheint. »Aber über eins sprach er nie, er fürchtete die ›Gespenster‹ – das Schicksal seiner Mutter …«,[17] raunt Franzos, und die Trift der Auslassungspunkte markiert die Spur der okkupatorischen Empathie. Nächstmöglich rückt der Nekromant an ein Wissen heran, das ihm durch den beschworenen Toten einerseits zugänglich wird, vor dem ihn dieser aber andererseits schweigend schützt. Indem er die »Gespenster« beruft, mit denen Meyer verkehrte, wird immer deutlicher, dass der Verstorbene ihm vor allem als Grenzfigur dient: als Wächter am Tor zur Welt der Dämonen. Innerhalb der Kolportage eines miterlebten Schriftstellerdaseins garantiert das Schweigen des Wächters, das natürlich ein beredtes, nämlich zu Dichtung geronnenes Schweigen sein soll, die Begehbarkeit einer Tiefe. Meyer nimmt auf sich, was sich nicht ertragen lässt, ästhetisiert es und lässt es damit für die Erinnerungsgemeinschaft verhandelbar werden. Jenes »Es« aber, dies die Suggestion, ist ein privates »Es«, ist »Schicksal«, »Erbe«, »Fluch«, »Wesen« oder »Krankheit«, ist ein Geheimnis, das so schlecht verwahrt ist, dass alle darum wissen.
Alle, denn Franzos bleibt in seinem Unterfangen nicht allein. Vielmehr spiegelt sich in seinem Nekrolog nur ein weit verbreitetes Begehren nach Meyers »Lebensschrift«, das die unterschiedlichsten Blüten treibt. Vorzeitig materialisiert es sich in jenem Intervall, das sich zwischen Meyers geistigem Ableben, datiert durch seine Einlieferung in die Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden am 7. Juli 1892, und seinem physischen Tod am 28. November 1898 erstreckt. Das in diesen Zeitraum fallende endgültige Zerwürfnis zwischen Meyers Gattin Louise Meyer-Ziegler auf der einen und seiner Schwester Betsy, dem Verleger Hermann Haessel und dem Germanisten Adolf Frey auf der anderen Seite entziffert sich letztlich als das Auseinandertreten zweier konkurrierender Entwürfe literarischer Einverleibung. Hier der Biograf, dem Meyer angeblich in gesunden Tagen schon seinen »Kadaver übergeben« habe, den dieser »untersuchen u. zerlegen« solle, womit Frey nach seinem ersten Besuch in Königsfelden beginnt;[18] dort eine Frau, die ihrem Gatten die Feder führt, vermutlich nicht nur in seinem Namen und mit seiner Hand korrespondiert, sondern auch dichtet. Man mag das eine für seriöser als das andere halten: Das Verlangen, sich schreibend mit einem lebenden Leichnam zu verbinden, wohnt beiden Unternehmungen inne. Und es setzt sich fort in den zahlreichen Nachrufen und biografischen Umtrieben, die schon bald – Frey[19] macht den Anfang – nach Meyers Tod einsetzen: in den 1903 erstmals erschienenen Erinnerungen Betsy Meyers,[20] in Isidor Sadgers »pathographisch-psychologische[r] Studie«[21] (1908), in den Biografien August Langmessers[22] (1905), Robert d’Harcourts[23] (1913), Max Nußbergers[24] (1919), Erich Everths[25] (1924) und Karl Emanuel Lussers[26] (1926). Worin aber gründet dieses Verlangen, der immense Energieaufwand, der sich auf diesen Menschen richtet?
Da sind zunächst und naheliegend Scham und Pietät. Die Autorschaft C. F. Meyer verlangt Kuratel, denn das, was sie verantwortet, das Wesen, das sich hinter den Texten verbirgt, ist nicht vorzeigbar, nicht gesellschaftsfähig, beschädigt sie und andere. Das bereits vom begeisterten Meyer-Leser Freud[27] bedauerte Verschweigen, das Moderieren und Metaphorisieren des Meyer zugerechneten psychopathologischen Befunds, die Abtrennung des Werks von der Krankheit, die in trivialer Dialektik zugleich immer auch die Erklärung des Werks aus der Krankheit nach sich zieht – aus all dem spricht zweifellos die Überzeugung, dieses Leben nachträglich einhegen zu müssen. Wer sich nur ein wenig in Meyers Biografik umgesehen hat, kennt die Mutmaßungen und deren Zurückweisungen, die Beschönigungen und Verdeckungen auf Seiten der Familie, denen die meist nur auf Hörensagen und Leerstellen beruhenden Ferndiagnosen der Analytiker gegenüberstehen. Alle Fakten, die sich zu Meyers Leben einsammeln lassen, rücken unweigerlich in diese Zusammenhänge ein. Schwer nur lässt sich ausblenden, dass, wie Friedrich Kittler in seiner 1977 veröffentlichten Dissertation einführend bemerkt, dieses Werk »im Zwischenraum zweier Internierungen in Irrenanstalten geschrieben« wurde.[28]
Allerdings darf man mit Blick auf das sich im Vagen verlierende, unmittelbar nach Meyers Tod einsetzende psychiatrische Protokoll,[29] das sich von der Zwangsstörung über die endogene Depression bis hin zur Dementia praecox erstreckt, festhalten, dass auch die pathologische Erzählung »C. F. Meyer« im Grunde nichts definiert, dass sie ihr Objekt nirgends in den Griff bekommt, sondern vielmehr ein hohes Maß an Verdrängungskräften freisetzt. Verdrängt wird freilich nicht nur oder immer weniger die Krankheit des Patienten Meyer; verdrängt wird in der Beschwörung des Patienten vielmehr die eigene Verstrickung, die eigene Pathologie. Je instinktiver, ingeniöser, elaborierter die Exegeten Krankheit und Textarbeit zu verknüpfen bemüht sind, umso deutlicher wird, dass man es hier zweifellos auch mit Selbstbeschreibungen eines Zeitalters zu tun hat. So ist, um es einmal deutlich zu sagen, der ganze Familienroman vom Verlust des Vaters, der Deformation des Sohns durch die ihrerseits deformierte Mutter, aber auch die suggerierte inzestuöse Beziehung zur Schwester und der im Suizid der Mutter durchbrechende und im Freitod der Tochter nochmals bestärkte Schuldkomplex nicht etwa als ›Werkkontext‹ zu verstehen, weil sich uns Meyers literarisches Werk daraus erklären ließe, wie das die in ihrer Entstehung mit diesem Werk so eng verwachsene psychoanalytische Literaturwissenschaft lange geglaubt hat. All diese pathogenetischen Konstellationen stellen letztlich keine Deutungsschlüssel, sondern selbst wiederum Erzählungen dar, die einen bestimmten Zweck erfüllen. Vorgeblich dienen sie dem Schutz, der Pflege oder dem besseren Verständnis einer Autorschaft. In Wahrheit aber bedurfte der Autor seiner Pfleger nie, sondern immer schon verhielt es sich umgekehrt: Man hat es bei C. F. Meyer mit einer Gestalt zu tun, die mit ihrem Werk auch die Existenz derer verbürgen soll, die sich als ihre Satelliten verstehen. Viel hängt von Meyer ab, für manche sogar alles. Man braucht ihn. Auf vielfach verdrehte Weise hat der Sohn damit den Wunsch seiner Mutter am Ende doch erfüllt: »Versuche es nur einmal recht, lieber Conrad Andern etwas zu sein«.[30]
Dieses Buch nimmt jenes Verlangen, das Leben und die Literatur Conrad Ferdinand Meyers miteinander zu verknüpfen, ernst. Dies aber nicht in dem Sinne, dass darüber die Triebkräfte vergessen werden, die die biografische Textwelt mitsamt all ihrer Spekulationen evoziert haben. Natürlich kann man, wie das seit mehr als einem Jahrhundert geschieht, alle Zeugen nochmals aufrufen und befragen, sie sich widersprechen oder wechselseitig stützen lassen und damit zumindest die Kontur eines Autorenprofils erzeugen. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Ein literarisches Œuvre, das stets durch das sich in seinem Schatten Bewegende definiert wird, das sich der unentwegten Gefährdung entgegenstemmt und von dieser sukzessive eingeholt wird.
Wenig, zumindest nichts Neues wäre damit gewonnen, und vieles spräche im Gegenzug dafür, an die Stelle der biografischen Mutmaßung eine rigorose philologische Selbstbeschränkung zu setzen. Zugegeben: Die Versuchung ist groß, Meyer auf seine Werke zu reduzieren, deren poetologischer Selbstverortung größere Bedeutung zuzumessen als irgendwelchen verschwommenen Entstehungskontexten. Man möchte das gerne tun, man hat es ja auch so gelernt: beim Text bleiben. Indessen lebt dieses Buch von der Überzeugung, dass der Text »Conrad Ferdinand Meyer« weitaus mehr umfasst als das unter diesem Namen veröffentlichte und unveröffentlicht gebliebene Konvolut an Gedichten, Novellen, Briefen und Fragmenten. In einem ersten Schritt bedeutet dies, sich von der beliebten und von Meyer selbst perpetuierten[31] Erzählung der ›zwanzigjährigen Verspätung‹ zu verabschieden. Denn in weitaus größerem Maße als seine Zeitgenossen ist Conrad Ferdinand Meyer nicht nur ein schreibender, sondern vor allem auch ein erschriebener Autor. Ein Roman, an dessen Abfassung sich schon frühzeitig viele beteiligen – unter anderem er selbst.
So erweist gerade die Mutwilligkeit, mit der man ihn ein ums andere Mal erinnert und aus der Schrift wiederauferstehen lässt, das Leben C. F. Meyers als das Projekt einer untergehenden Erzählgemeinschaft, an dem das Selbstverständnis eines ganzen Säkulums hängt. Dort, wo sich Risse zeigen, geht es sogleich in die Tiefe. Literarisieren, in Zeichen einspinnen muss man diese Existenz, weil man insgeheim genau weiß, dass Meyers Dämonen keineswegs nur die seinen sind. Die Einbildungskraft, das Familienübel, vor dem ihn die Mutter so eindringlich gewarnt hat und das ihn zur Dichtung zieht, ist ein Fieber. Dessen frühes Symptom ist die Ahnung, dass Conrad Ferdinand Meyer womöglich nicht nur ein Geisterseher, sondern selbst ein Geist ist – ein unzeitiges Phänomen. Einer, dem man nicht umstandslos begegnen kann. Ein Mensch, der eigentlich nie wirklich da war. Und all jene, die ihn umringen, die mit ihm über seine Texte Kontakt aufnehmen, die selbst über ihn zu schreiben beginnen, um ebenjene Wahrheit zu verdecken (und sie zugleich auszusprechen) – auch sie infizieren sich, auch sie verwandelt er in Bewohner jener Geisterwelt, die das 19. Jahrhundert ist.
Diese Geisterwelt soll hier zum Sprechen gebracht werden. Wir sind beileibe nicht die Ersten, die sich um sie bemühen, und vielleicht ist die Vergiftung, der auch wir unterstehen, nicht das beste Argument, um den von uns eingeholten Auskünften so etwas wie Objektivität zuzusprechen. Wir wissen natürlich, dass man es hier mit einer Welt zu tun hat, die über dem verzweifelten Versuch, ihre Statik aufrechtzuerhalten, sich immer weiter destabilisiert, mit einem Jahrhundert, das mit dem Projekt einer »Naturalisierung der Welt bei gleichzeitiger Rettung des alten heilsgeschichtlichen Erklärungskomforts […] überfordert« ist.[32] Wir wissen, dass die technologischen Revolutionen, die es durchziehen – genannt seien die Fotografie, die Telegrafie, die Eisenbahn –, die Distanzen, in denen seine Menschen verkehren, in gleichem Maße aufheben, wie sie die provinziellen und globalen Räume, die diese Menschen bewohnen, entwirklichen, an Handlung und Erfahrung des Einzelnen binden.[33] Wir wissen, dass die Heimsuchung der Dichtung durch die Gesellschaft, die Wandlung der Schriftstellerei zum Beruf, dem Jahrhundert die Frage aufnötigte, »[w]ie Kunst in einer bürgerlichen Welt überhaupt noch möglich sei.«[34] Wir wissen um die mit dieser Frage verbundene Aufdrängung von ökologischen und volkswirtschaftlichen Denkmustern, die die Literatur nicht nur thematisch, sondern auch in ihrer diätetischen Konstitution beschäftigen: im Ansammeln von »narrativen Reserven«[35] und im Aufbrauchen von »Metacodes«.[36] Wir wissen, dass auch andere die Geister schon gesehen haben; den Grund ihres Erscheinens erkannten sie freilich im Auseinandertreten von mimetischem Impuls und ästhetischer Konstruktion.[37]
Zugleich jedoch liegt der Versuch, die Geschichte des 19. Jahrhunderts durch das Prisma dieser Gestalt zu erzählen, keinesfalls auf der Hand. Es gibt wenige Autoren, die weiter abseits vom Geschehen zu stehen, die den Zeitläuften so entzogen scheinen wie Conrad Ferdinand Meyer. Selten bricht er einmal offen in die Gegenwart aus. Der Anbruch der modernen Welt hat für ihn eine größere Bedeutung als das, was aus ihm folgt. Meyer zu lesen – im Ganzen –, das könnte auch ein Projekt zur Umgehung des 19. Jahrhunderts sein, wäre nicht diese Umgehung selbst wieder ein Impuls des 19. Jahrhunderts, zu dessen Psychopathologie es gehört, sich selbst loswerden zu müssen.
Die Versuchung, aus ihm einen Zeitgenossen zu machen, hat oft dazu verleitet, sein Rinascimento, seine Bartholomäusnacht, seinen Dreißigjährigen Krieg als ein historisches Kostüm zu verstehen, hinter dem sich eigentlich ein Kommentar zur Zeit, zum Kulturkampf, zur Reichsgründung etc. verbirgt. Die vergangene, die verstorbene Welt ist Meyer jedoch weniger Kulisse als vielmehr Denkform. Sie ist Maske um der Maske willen, gespenstische Hülle. Die Diagnose, die er seinem Jahrhundert stellt, ergibt sich aus der Überzeugung, dass sich durch die Geschichte nichts mehr erhellen lässt. Die Bilder, die Conrad Ferdinand Meyer der Vergangenheit entnimmt, schieben sich vor das Zeitgeschehen. Sie verdecken den Tag, verfinstern nach und nach diese Welt – bis diese am Ende völlig augenlos geworden ist.
II. Die Väter der Geschichte
Aus welcher Welt er kommt und wozu sie ihn verurteilt hat, das scheint er recht genau zu wissen:
Geboren bin ich in Zürich, den 12. October 1825. Mein Geschlecht ist seit mehr als zwei Jahrhunderten hier einheimisch. Im Jahre 1802, als Zürich von den Truppen der helvetischen Regierung bombardirt wurde, befehligte mein Großvater, Oberst Meyer, die Vertheidigung der Stadt, während mein anderer Großvater, Statthalter Ulrich, der Stellvertreter der helvetischen Regierung, sich hatte flüchten müssen. Dem Zusammenfließen des Blutes zweier sich schroff entgegenstehender politischer Gegner, eines Föderalisten und eines Unitariers schreibe ich meine Unparteilichkeit in politischen Dingen zu.[1]
Dies ist der Anfang einer autobiografischen Aufzeichnung, die Conrad Ferdinand Meyer im Alter von sechzig Jahren verfasst hat, um eine kleine Huldigungsschrift des Jusstudenten Anton Reitler einzuleiten.[2] Nicht ohne Stolz wird hier Abkunft beschworen, aber der pathetische Rückbezug auf die Vorfahren hat einen Preis. Will man sich mit ihnen verbinden, dann verändern sie rasch ihre Gestalt und verwandeln sich in Allegorien des eigenen Lebens. Immerhin liefern die Blutslinien der Großväter hier die epigenetische Begründung für den ›unparteilichen‹ Standort ihres Enkels. Die Urszene seiner Autorschaft bekommt ein Datum: 1802.
Was geschieht da aber nun wirklich im Kanton Zürich, im Jahr 1802? Man muss schon sehr genau hinschauen, um das von Meyer beschworene historische Bild ausfindig zu machen, denn eigentlich ist die »Bombardierung«, von der Meyer spricht, beinahe eine Randnotiz, eine etwas skurrile Nebensache. Sie ereignet sich am Ende der Helvetik, im Nachgang des Abzugs der französischen Besatzung, in dessen Folge sich überall in der helvetischen Republik Unitarier und Föderalisten gegenüberstehen. Zwar existiert die Zentralregierung noch, aber sie schaut machtlos der Autonomisierung der Kantone zu. Ab Juli 1802 wird Zürich wieder von der alten Stadtaristokratie regiert. Dennoch kommt es am 10. und 13. September 1802 zu jenem Vorfall, den Meyer in seine Familiengeschichte einschreibt. Es ist die Stunde des Joseph Leonz Andermatt aus Baar, des Generals jenes unitarischen Restaufgebots, das in völlig aussichtsloser Mission die widerspenstigen Kantone einzuschüchtern versucht. So verkämpft sich Andermatt mit seinen Truppen am 28. August zunächst an der Rengg gegen die aufständischen Unterwaldner und fordert in höchster Not Verstärkung aus Zürich an. Dies hat zur Folge, dass die helvetische Regierung auf einmal überhaupt keine militärischen Einheiten mehr in der Limmatstadt befehligt und es am 1. September dann zur offenen Insurrektion kommt, die Zürcher Stadtbehörde den Gehorsam gegenüber der helvetischen Regierung offen aufkündigt. Andermatt schließt daraufhin mit Uri, Schwyz und Unterwalden einen vorübergehenden Waffenstillstand, verlegt seine Truppen zurück nach Zürich und belagert die Stadt. Das Weitere kann man bei Johann Jakob Leuthy nachlesen:
Nach abermaligem vergeblichem Anklopfen ließ derselbe [Andermatt] am Abend des 6. Septembers 1802 einen Theil seiner Artillerie, welcher aus einigen Vierpfünder=Kanonen und leichten Haubitzen bestand, auf Erfolg hoffend, auf dem Bürgli, in Enge, aufführen und, nach abermaligem erfolglosen Parlamentiren, die Stadt mit Haubitzen ein paar Stunden lang so auffallend überschießen, daß auch nicht eine einzige Kugel die Stadt traf. Alle flogen bis Hottingen und Fluntern, was man allgemein dahin deutete, er sei mit den Städtern mehr oder weniger einverstanden. Nach diesem so geheißenen Bombardement, das mehr einem kleinen Feuerwerke glich, ließ Andermatt (wahrscheinlich damit das abscheuliche Benehmen der helvetischen Regierung gegen eine so fromme, friedfertige und gute Stadt nach allen Enden, wo die Revolution eingeleitet war, gelange und das Volk gereizt werde) alle seine Artillerie, sammt seiner 14–1500 Mann starken Armee, im Dunkel der Nacht über den See schiffen, beim Schlößli, auf dem Zürichberg, von Neuem Posten fassen und die rebellisch gewordene Stadt mit aller seiner Artillerie beschießen, ohne daß jedoch bedeutender Schaden entstand. Das Bombardement ward ihm ab den Wällen Zürich’s, damit es recht weit gehört werde, aus ganz schweren Kanonen zehnfach erwiedert.[3]
Nicht, dass hier gar nichts geschieht. Friedrich von Wyß berichtet von dreißig Bränden, die in der Stadt ausbrechen, die aber auch alle gleich gelöscht werden – und zählt einen Toten, nämlich den Diakon Johann Georg Schulthess, der auf dem Peterplatz von einer Haubitzgranate getroffen wird und den Verletzungen wenige Tage später erliegt.[4] In der Tat steht der Kanton kurz vor dem Bürgerkrieg, bis Andermatt dann doch einen Waffenstillstand abschließt (denn er wird schon wieder in Bern gebraucht) und damit auch wieder aus der genealogischen Erzählung Conrad Ferdinand Meyers verschwindet. Er hinterlässt die historische Kulisse, vor der sich dessen väterliches und mütterliches Erbe gegenüberstehen: Meyers Großvater väterlicherseits, Johann Jakob Meyer, steigt bereits 1792 in Genf zum Major auf und befehligt dort eine Abteilung Zürcher Milizen. Während der Helvetik dient er als Unterhändler zwischen den Kriegsmächten und den lokalen Regentschaften. Als antifranzösisch gesinnter Anhänger der alten Ordnung versucht er mit seinem Bataillon nach der russischen Niederlage 1799 die Stadt vor Vergeltungs- und Plünderungsaktionen der Franzosen zu schützen, verliert das Bataillon jedoch und flieht mit seiner Familie nach Tübingen, wo ihm im Februar 1800 seine Frau, eine leibliche Cousine und Mutter von sieben Kindern, stirbt.[5] Im gleichen Jahr noch kehrt er nach Zürich zurück, verteidigt 1802 die Stadt gegen Andermatts Truppen und avanciert nach der Mediation zum eidgenössischen Oberst und Mitglied des Großen Rates, später zum Oberamtmann in Grüningen. Von jenen vier Söhnen, die ihm nicht schon vorzeitig sterben, ist Ferdinand der jüngste. Er wird der Vater von Conrad Meyer werden, der erst viele Jahre später den Vornamen des Vaters zur Distinktion übernehmen wird.
Auf der anderen Seite, der der Unitarier, findet sich Johann Conrad Ulrich, aus einem verarmten Zürcher Geschlecht stammend, aber mit einem seltenen Plan: Er will eine Taubstummenanstalt gründen. Protegiert von Lavater und dem Schlierener Pfarrer Heinrich Keller nimmt ihn der Genfer Gehörlosenpädagoge Charles-Michel de l’Epée als seinen persönlichen Schüler an,[6] und der junge Zürcher stellt tatsächlich seine Fähigkeit in der Erziehung eines taubstummen Mädchens unter Beweis, wird vom Genfer Senat geehrt und nach dem Einmarsch der Franzosen vom helvetischen Direktorium 1799 zum Mitglied des kantonalen Erziehungsrates ernannt. Im gleichen Jahr bringt er es zum Zürcher Regierungsstatthalter, als welcher er dann in der Konfrontation des Jahres 1802 die Zentralregierung davon abzubringen versucht, Landgarnisonen in die Stadt verlegen zu lassen. Wie die Munizipalität der Stadt erkennt auch Ulrich in dieser Maßnahme eine überflüssige Provokation der Stadtbevölkerung und ist besorgt um den öffentlichen Frieden. Die Zusicherungen, die man ihm sowohl von Seiten des Regierungsrats als auch von Seiten Andermatts gibt, erweisen sich jedoch als hohl. Noch am 2. September lässt der General ihm brieflich mitteilen, »qu’il n’envoyera point de troupes à Zurich, à moins cependant que des vues militaires ne l’y obligent, ce dont il vous préviendroit toujours.«[7] Einen Tag später erhält Ulrich »endlich, nach wiederholtem dringendem Begehren, seine Entlassung« vom Statthalteramt und zieht sich vorübergehend ins angrenzende Hirslanden zurück, um »nach so vielen stürmischen Tagen einiger Ruhe zu geniessen«.[8] Dass er »sich hatte flüchten müssen«, wie sein Enkel behauptet, darf man als gezielte Übertreibung werten. Gleichwohl erleidet er infolge von Andermatts Offensive einen nicht geringen Reputationsschaden. Gegenüber dem Zürcher Munizipalrat verwahrt er sich gegen die Gerüchte, er »zöge […] mit dem General und gäbe ihm Einschläge«.[9] Nach dem endgültigen Abwurf der Helvetik lässt seine Rehabilitation aber nicht lange auf sich warten. Man beruft Johann Conrad Ulrich erst ans Stadtgericht, später ans Obergericht – und schließlich erfüllt sich sogar noch sein alter Traum: Er gründet ein Blindeninstitut, dem er fortan als Präsident vorsteht und das er kurz vor seinem Tod noch um eine Taubstummenanstalt erweitern kann.[10] Mit seiner Frau Anna Cleopha Zeller aus dem Balgrist hat er zwei Kinder, den 1798 geborenen Heinrich und Elisabeth Franziska Charlotte, genannt Betsy – die Mutter Conrad Ferdinand Meyers.
Die stadt- und kantonsgeschichtliche Bedeutung all dessen gewürdigt und beiseitegestellt: Bei Conrad Ferdinand Meyer selbst steht das nicht so. Sein Bezug zu diesen Dingen, zur eigenen Herkunft ist ein durch und durch literarischer. Zunächst einmal gehorcht seine autobiografische Notiz einer narrativen Logik, die Gesellschaft und Privates gezielt vermengt. Meyer braucht das Bombardement des Generals Andermatt, weil erst im Feuer der Haubitzen als »schroffer« Gegensatz sichtbar wird, was sich der genaueren Betrachtung als episodenhafte, kaum erinnerbare Polarisierung zweier Karrieren herausstellt, die alsbald wieder pragmatisch aufgehoben wird. Zugleich rückt Meyer seine Eltern damit in den Status einer Versöhnung des Gegensatzes. In der Liebe zwischen Ferdinand Meyer und Betsy Ulrich versöhnt sich auch die Eidgenossenschaft in der Posthelvetik, verwandelt auch seine eigene Existenz sich zum Zeugnis der Überwindung eines politischen Zwiespalts.
Damit könnte man zufrieden sein, aber ganz so einfach bekommt sich dieser Mensch nicht zu fassen. Er wird im Laufe seines Lebens zahlreiche Genealogien erkunden, entwerfen, erzählen, aber diese eine, seine eigene, bleibt ihm über das bloß Allegorische hinaus versperrt, unsagbar. Zwischen ihm und den Sinnbildern der Geschichte, aus denen er sich erklären könnte, liegt etwas Unüberwindbares. Die Erzählung von der wundersamen Vereinigung der Gegensätze, von der dialektischen Vernunft der Geschichte findet ohne ihn statt. Man muss nur ein wenig weiterlesen, bis zum gerade noch beschworenen »Zusammenfließen des Blutes«, denn nun wäre eben von den Eltern zu sprechen. Doch dieser Erzähler, man muss sich daran gewöhnen, tritt selbst nie hervor. Er lässt andere und anderes für sich erinnern, er folgt nur »dem Urtheile Aller«.[11] Den Stoff meistern kann er nur, wenn aus ihm eine ichlose Welt geworden ist. Und so überlässt der sechzigjährige Conrad Ferdinand Meyer nach wenigen Zeilen dann auch »die Bildnisse meines Vaters und besonders meiner Mutter« einfach den Erinnerungen Johann Caspar Bluntschlis, die just ein Jahr vor dieser Selbstskizze erschienen waren. Zu Meyers Mutter empfand er »eine verehrungsvolle Freundschaft«, die dem Portrait, das er von Betsy Meyer-Ulrich zeichnet, durchaus anzumerken ist:
Sie erschien mir wie das lebendig gewordene Ideal der Weiblichkeit. Geistreiche Frauen, die mit den Männern wetteiferten, waren mir unangenehm. In ihr aber fand ich die edelsten Eigenschaften des Geistes, schnellen und klaren Verstand, tiefen Durchblick, feines sittliches Gefühl mit lieblichster Anmut, Sanftheit und Milde gemischt. Sie war eine treue, sorgende Gattin, eine gute Mutter, eine aufopferungsfähige Freundin der Armen, eine anspruchslose Hausfrau und eine freundliche und heitere Wirtin. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich wie gehoben und reiner als sonst. Sie war tief religiös, aber nicht unduldsam und nicht kopfhängerisch. Die Religion gab ihr einen Halt, dessen sie um so mehr bedurfte, als ihr beweglicher und entzündlicher Geist sie leicht hätte ins Masslose und ins Weite fortreissen können. […] Am Ende ihres schweren Lebens und am Schlusse eines langen Wittwenstandes wurde sie noch ein Opfer ihrer kranken Stimmung und ihrer leidenden Nerven. Zur Heilung in eine Anstalt für Gemütskranke gebracht, fand sie Kühlung und Tod in den Fluten.[12]
Man schaut schon auf das Ende, aber von diesem lässt sich wie vom Rest sagen, dass der Sohn der von Bluntschli erinnerten Frau sich darüber ausschweigt, dass er selbst kein Urteil fällt, sondern auf andere verweist, dass er sich hinter einer Geschichte versteckt, die schon geschrieben ist, in die man sich selbst nicht mehr einschreiben kann noch will. »[I]ch hätte kein Wort dazu und keines davon zu thun«[13] – so steht es da, und es liegt auf der Hand, dass sich hier jemand hinter einem fremden Text versteckt.[14]
Kein Zweifel: Meyers Schrift wirft Schatten. Alles, was sie preisgibt, deckt zugleich etwas zu. Gerade da, wo sie persönlich zu werden scheint, übt sie sich in der Kunst der Maske. So erinnert sie etwa vom Vater ein Lächeln, mit dem dieser eine Frage seines Sohnes anlässlich eines »antistraußische[n] Pamphlets« quittiert. Doch »den Knaben« – er erscheint hier tatsächlich in dritter Person – bindet an diesen Moment nicht dessen Intimität, sondern der Zürcher »Straußenhandel« als öffentliches Ereignis, das auch seine »bedeutendste Jugenderinnerung« darstellt. Die Gestalt des Vaters kann somit erst dort erscheinen, wo sich die Zeitgeschichte in einen Text verwandelt hat. Erst dort wird das eigene Leben sagbar, erst dort lächelt ihm der Vater zu. Im Folgeabsatz kehrt dieser noch einmal zurück in jene Selbsterzählung, hat er doch immerhin – neben einigen anderen kleineren wissenschaftlichen Publikationen[15] – auch »ein von Ranke rühmlich erwähntes Buch« über die evangelische Gemeinde in Locarno verfasst, ist also Teil einer prominenten Bibliografie geworden. Das ist so nicht ganz richtig, denn Leopold von Ranke, der große Historiker, hat sich bei Ferdinand Meyer wenn auch enthusiastisch, so doch lediglich brieflich für die Zusendung der Publikation bedankt;[16] ›rühmlich erwähnt‹ wird diese von ihm nirgends. Umso deutlicher tritt aber der Wille zur vollkommenen Medialisierung des Vaters zutage. Ranke gratifiziert dessen Eingehen in die Textwelt. Im amorphen Gelehrtenmaterial des renommierten Historikers soll man ihm dann wiederbegegnen, ihn für einen Moment ins Gedächtnis heben können. Nirgends ist man weniger Ich, nirgends ungreifbarer als in der Historiografie und es ist nicht ganz ohne Ironie, dass diese Karbonisierung des Lebens hier Ferdinand Meyer selbst trifft – denn von dem hat sein Sohn dieses Verfahren schließlich gelernt.
So findet sich im Vorsatz jenes 1835 /1836 erschienenen, knapp 900 Seiten umfassenden Werks, für das Ferdinand Meyer die Doktorwürde der wenige Jahre zuvor gegründeten Universität Zürich erhielt, folgender Passus:
Möchte man auch von meinem Versuche sagen können, daß sich in ihm der Geist des Zeitalters abspiegele; nicht jener Geist, der die Welt bewegt, sondern der stille Geist ernster und tiefer Geschichtschreibung, wovon die deutsche Nation gegenwärtig so unnachahmliche Muster aufzuweisen hat; der, von gewissenhafter Erforschung der Thatsachen ausgehend, mit den Eigenthümlichkeiten der Personen, des Volkes, des Zeitalters sich vertraut zu machen versteht, in dem Individuellen und Oertlichen die Schicksale und die Geistesrichtung der Gesamtheit zu erkennen, und diese hinwieder durch die Fülle des Individuellen und Oertlichen zu beleben weiß.[17]
Zweifelsfrei stehen solche Hoffnungen ganz im Zeichen des Historismus, und es ist ein durchaus poetischer Anspruch, der sie trägt. Ranke wird nicht von ungefähr der Adressat dieses Buches: Die Vorstellung von Geschichtswissenschaft als Erkenntnis epochaler Geistesformen aus der Betrachtung der irreduziblen Einzelspuren einerseits, als ›Belebung‹ des Geistes aus der Fülle der Individualgestalten und Szenen andererseits – das ist im Grunde eine Übersetzung von Rankes Definition der Historie, die im Unterschied zu allen anderen Wissenschaften auch »Kunst« sei, wie Ranke in seiner Idee der Universalhistorie anmerkt:
Wissenschaft ist sie: indem sie sammelt, findet, durchdringt; Kunst, indem sie das Gefundene, Erkannte wiedergestaltet, darstellt. Andere Wissenschaften begnügen sich, das Gefundene schlechthin als solches aufzuzeichnen: Bei der Historie gehört das Vermögen der Wiederhervorbringung dazu.[18]
Nicht nur Ferdinand Meyers Die evangelische Gemeinde in Locarno lebt ganz vom Gedanken jener literarischen »Wiederhervorbringung« des Vergangenen. Nimmt man die Dichtung seines Sohnes in den Blick, dann gelangt man zweifellos rasch zu jenen Figuren, an denen sich der geschichtliche Augenblick erweisen, plastisch werden soll, zu Hutten, Jenatsch, zum Pescara: allesamt ›historische Größen‹,[19] manche von ihnen scheinen auch bereits in den Schriften des Vaters auf.[20] Die geschichtspoetische Linie der Väter, in die sich auch noch der Lausanner Historiker Louis Vulliemin einreihen wird, gibt den Maßstab vor, an dem sich Conrad Ferdinand Meyers Werk abarbeiten wird. In der Rückschau erscheint die Einübung in die historiografische Praxis sogar als Propädeutikum der literarischen Produktion, das an die Stelle des abgebrochenen Jusstudiums tritt, wie Meyer sich zu erinnern meint:
Ich habe damals unendlich viel gelesen, mich leidenschaftlich aber ohne Ziel und Methode in historische Studien vertieft, manche Chronik durchstöbert und mich mit dem Geiste der verschiedenen Jahrhunderte aus den Quellen bekannt gemacht. Auch davon ist mir etwas geblieben: der historische Boden und die mäßig angewendete Localfarbe, die ich später allen meinen Dichtungen habe geben können, ohne ein Buch nachzuschlagen.[21]
Ob diese Dichtung tatsächlich so ganz ohne Lektüre auskommt, wird noch zu prüfen sein. Die Wahrheit dieser Passage liegt aber ohnehin woanders: Der historiografisch gebildete Dichter C. F. Meyer muss nichts mehr nachschlagen, weil ihm poetisierte und recherchierte Welt eins geworden sind. Wo der Historismus der Väter janusköpfig Kunst und Wissenschaft trennt, um doch immer beides sein zu wollen, wird das Werk des Sohnes sich einst den Zwischenschritt sparen. Wer Geschichte erdichtet, der rekonstruiert sie – und umgekehrt. Das heißt aber auch, dass der Akt der Modellierung, der künstlichen Verfertigung des historischen Bildes stets in diesem bewusst bleibt, immer wieder die Illusion stört. Ob nachgeschlagen oder nicht: Die vergangene Welt mitsamt ihrer »Localfarbe« ist und bleibt Textarbeit, ein Reich des Sekundären. Und das gilt nicht minder für das eigene, vergangene Dasein. Ehe es wieder vor Augen kommt, muss es erst einmal untergegangen sein.
Lässt man jedoch die Geschichte nicht ihn selbst, sondern andere erzählen, dann zeigen sich Kindheit, Jugend und selbst die Eltern Conrad Ferdinand Meyers als lebende Gestalten. Nähert man sich den beiden, dann gewärtigt man zwei Bewohner eines »Juste-Milieu« (so hat es Ferdinand Meyer selbst bezeichnet[22]), gestützt durch eine gewisse Frömmigkeit, politisch einem gemäßigten Konservatismus zugeneigt. Ihre Liebe geht schon früh durch den Tod, denn was Ferdinand Meyer und Betsy Ulrich zueinander finden lässt, ist Betsys Bruder Heinrich, der der beste Freund Ferdinands ist und im September 1817 im Alter von 19 Jahren an Schwindsucht stirbt. Wie und wann genau man zusammenkommt, liegt im Dunkeln. Dass sich die Paarbeziehung im gesellschaftlichen Umfeld des Pfarrhauses im Hirzel und der dort wohnhaften Lyrikerin Meta Heusser-Schweizer intensiviert, mag sein und würde ins Bild passen.[23] Was man weiß: Als Betsy von 1821 bis 1822 bei Bekannten in Lausanne weilt, wo sie sich die französische Kultur aneignen soll, für sich dann aber auch das Studium der Chemie entdeckt, zieht es Ferdinand aus Gründen der sprachlichen Weiterbildung in die gleiche Stadt.[24] Hinter sich hat er da bereits ein juristisches Studium, das ihn nicht zuletzt für drei Semester nach Berlin und Göttingen führt, wo er Savigny und wohl auch Schleiermacher hört.[25] 1822 arbeitet Ferdinand Meyer bereits als Sekretär der Justizkommission und lehrt nebenher am »Politischen Institut«, wo er Vorlesungen über Staatswirtschaft und Statistik hält. 1826 ist er bereits Staatsschreiber, 1831 rückt er in den Regierungsrat des Kantons Zürich auf und arbeitet auch für den kantonalen Erziehungsrat.[26]
Eine steile Karriere: »[K]urz nach der Pariser Julirevolution, deren Wellenschlag auch die schweizerischen Verhältnisse beeinflußt hatte, stand unser Vater, der zur jungen liberalen Partei gehörte, mit seinen Freunden an der Spitze des zürcherischen Staatswesens«, wird seine Tochter im Rückblick zu Protokoll geben[27] – im Wissen, dass es sich um eine trügerische Solidität handelt. Infolge der Julirevolution verschieben sich auch im Kanton die Machtverhältnisse. Eben noch wähnt sich das in der Mediation ans Ruder gekommene Akademikerpatriziat der Stadtliberalen obenauf, da erhebt sich das ländliche Bürgertum, die Bauern im Gefolge, setzt eine neue Verfassung durch und verwandelt den Kanton 1831 in eine Repräsentativdemokratie mit allgemeinem Wahlrecht (von dem die Frauen und die Falliten ausgenommen sind), deren höchstes Gremium der Große Rat ist.[28] Der erste Bürgermeister der neuen Zeit ist der ehemalige NZZ-Chefredakteur und Mediziner Paul Usteri; er kann sein Amt aber gar nicht mehr antreten, weil er bereits drei Wochen nach Verabschiedung der neuen Verfassung einem Fieber erliegt. Die Mehrheit im Großen Rat besitzen die Vertreter des alten Liberalismus und die neuen Radikalen, die gemeinsam ab 1832 den Umbau des Kantonswesens rasant vorantreiben, die Schanzen schleifen und das Justiz- und Finanzsystem revolutionieren. Es ist eine Zeit harter Konfrontationen. Herkunft, Freundschaften und kulturelles Selbstverständnis zählen in der Regel mehr als Gruppenzugehörigkeit, Parteien gibt es ohnehin keine. Die zentrale Polarisierung verläuft nun nicht mehr zwischen den demokratisch und den aristokratisch gesinnten Kräften (die ebenfalls noch im Großen Rat vertreten sind), sondern mitten durch das liberale Lager. Dort geben vor allem die Radikalliberalen wie der Savigny-Schüler und -Nachfolger Friedrich Ludwig Keller, Wilhelm Füßli oder Ludwig Snell, seines Zeichens Redakteur beim Schweizerischen Republikaner, den Ton an. Insbesondere Füßli profiliert sich dabei immer wieder durch rigorose Forderungen und plant mitunter auch schon einmal die Umerziehung des Landes mithilfe politischer Gewerkschaften. Die gemäßigten Altliberalen können mit derartigen Vorstellungen freilich nur wenig anfangen; sie wechseln das Lager und schließen sich mit den pragmatisch orientierten Aristokraten zu einer neuen, konservativen Bewegung zusammen, deren politisches Programm dann der vorhin erwähnte Johann Caspar Bluntschli verfassen wird.[29] Bluntschli hatte Ferdinand Meyers Vorlesungen im »Politischen Institut« zur »Staatengeschichte der Schweiz« gehört, war also sein Schüler, bald aber auch sein Freund. Als Rechtsprofessor wird er später Entscheidendes zur Schaffung eines kantonalen Privatgesetzbuchs beitragen und auch für kurze Zeit Rektor der Universität Zürich werden. Seinem ehemaligen Lehrer attestiert er »staatsmännische Begabung«, schränkt jedoch zugleich ein: »Aber er war mehr dazu gemacht, in Zeiten des ruhigen Fortschrittes zu führen; in den Zeiten der Revolution war seine Natur zu feinfühlig und sein Charakter zu wenig hart und energisch, um durchzugreifen.«[30] Die neue Konfliktlage empfindet Ferdinand Meyer in der Tat wohl als Überforderung. Im März 1832 scheidet er freiwillig aus dem Regierungsrat aus,[31] bleibt aber dem Erziehungsrat erhalten und beteiligt sich dort insbesondere an der Gründung von Universität und Kantonsschule, an welcher er dann auch im Folgejahr eine Lehrstelle für Geschichte und Geografie übernimmt.
Nebenbei: Er hat nun auch Familie. Nach einer Umzugsodyssee durch Zürich, die das junge Paar von Unterstrass, wo im Haus zum Stampfenbach[32] 1825 das erste Kind, ein Sohn, geboren wird, zunächst in die Kuttelgasse führt, wohnen die Meyers seit 1830 im »Grünen Seidenhof« in der Nähe des Rennwegtors. Dort kommt ein Jahr später die Tochter Elisabeth Cleophea – wie ihre Mutter nennt man sie in der Kurzform »Betsy« – zur Welt, und sie wird später das Haus ihrer Kindheit wie folgt beschreiben:
Wir bewohnten ein großes, altes Haus mit einem weiten Garten, den ein schattiges Wäldchen abschloß. Inmitten dieses Gehölzes, aus dem uralte Pappeln und weißstämmige Birken aufragten, stand ein einsamer gemauerter Pavillon, der meist verschlossen war, auf einem freien, von wohlriechenden Gebüschen umsäumten Platze. Die stille Bank, die sich dort an das Gemäuer lehnte, ist der einzige Ort im Garten, den unser Vater, selten genug, mit einem Buche in der Hand aufzusuchen pflegte. Er war dort ungestört, und die hinter der dichten Weißdornhecke vorüberrauschenden Wasser des Sihlkanals, der das Grundstück begrenzte, verbreiteten Kühlung.[33]
Der Ort, an dem gelesen wird, verrät sehr vieles über die Vorstellung, die man sich in dieser Familie von Literatur macht. Fern von der Arbeit sitzt man über dem Buch, dicht, sehr dicht an den Ufern der Sihl, jenem Fluss, der die Erinnerung an eine »dicht vor der Stadt liegende romantische Wildnis« mit sich führt, die seit »hundert Jahren […] von den zürcherischen Genies, Philosophen und Dichtern mit Degen und Haarbeutel begangen worden« war, wie Kellers 1877 erschienene Züricher Novellen das rapportieren.[34] An der Limmat regiert man, an der Sihl liest man – aber dann doch nicht so ganz. Dem schönen Wahnsinn darf man sich nicht ungeschützt aussetzen; beschirmt durch den Garten, in Besitz verwandelte Natur, bleibt von ihm nur noch die Brise.
Bisweilen flieht Ferdinand Meyer auch die Stadt, verschlägt es ihn in die Bergwelt, und sobald der Sohn ihm alt genug scheint, muss er mit ihm ziehen, erstmals im Juli 1836. Begeistert berichtet der Vater der Mutter von der Besteigung der obern Sandalp am Vortag; der Sohn habe sich »ritterlich« gehalten und erkläre »diesen Tag für den glücklichsten seines Lebens.«[35] Unter Lawinendonner hält man bescheiden sein Mittagsmahl, bevor es über den Klausen nach Altdorf auf die Rigi und dann wieder heimwärts geht. Zwei Sommer später sieht man die beiden im Bündner Land. Die Reise beginnt etwas misslich, da sie – nach einer Schifffahrt nach Rapperswil über Weesen, den Walensee hinauf nach Sargans – kaum in Ragaz angekommen, feststellen müssen, dass ihr Reisegepäck versehentlich mit dem Eilwagen wohl wieder zurück nach Zürich geschickt wurde, so dass man sich für alle Fälle von der Mutter das Nötigste nach Chur nachschicken lässt.[36] Ansonsten begegnen einem allerorten Bekannte: Zunächst ein ehemaliger Schüler des Vaters namens Emil Muller, später der Industrielle Johann Jakob Hürlimann-Landis nebst Gattin, und schließlich kreuzt auch der vormalige Thalwiler Gemeindepräsident und liberale Bildungspolitiker Johann Jakob Wieland unversehens den Weg.[37] Letzterer erweist den Reisenden einen großen Dienst, denn der Vater, der auf dieser Reise manchen »herrlichen Traum durchlebt«, will unbedingt die Taminaschlucht durchwandern, was ein machbares Unterfangen ist, wenn man »nur für sich selber zu sorgen hat«.[38] Zum Glück hat Wieland Bücher im Gepäck und gibt, während er selbst mit Ferdinand Meyer zur Expedition aufbricht, dem Sohn, der im Gasthaus in Ragaz bleiben muss, »inzwischen Langbeins Gedichte zu lesen«.[39]
Vor die Berglandschaft schiebt sich Text, solide Unterhaltungslyrik. August Friedrich Ernst Langbein, drei Jahre zuvor verstorben, hat ein üppiges Oeuvre hinterlassen.[40] Das Meiste davon ist Moraldichtung, nimmt Anteile an der Anekdote, an der Geschichtsszene, am Schwank und an der Fabel, entwirft mehr oder weniger solide Lebens- und Liebesallegorien. Eine Dichtung, die viel erklärt und wenig sagt. Ab und an finden sich durchaus schön gearbeitete Stücke darunter, etwa das Lob des Schweigens[41] oder die Ballade Die Ruinen am See.[42] Sieht man genau hin, kristallisiert sich auch eine poetische Haltung heraus, die sich in diese Zeit der Inkonsequenzen bestens fügt: So wird die ungeschminkte Tänzerin der Natur gegen die »weder Lust noch Schmerzen« hervorrufende Kunst[43] berufen, einem »jungen Dichter« wiederum die Weltabgeschiedenheit, das Leben jenseits aller Stätten, »wo die Seelen sich entkleiden«, fern »dem Pfuhl, wo Seuchen hausen«,[44] zur conditio poetica erklärt, und so fort. Man ahnt den Widerspruch schon: die völlig in Figur aufgehende Schöpfungsursprünglichkeit, den Mythos als Bildungszitat, das Märtyrerpathos der dichterischen Askese, das zugleich dann eben doch so viel von der Welt und ihrer Lust verraten möchte. Was ein Zwölfjähriger in solchen Büchern liest, so er sie überhaupt liest, lässt sich nicht wirklich sagen. Zur Kenntnis nimmt er aber womöglich die Konvention zeitgenössischer Lyrik, den Erwartungshorizont, der populäre Schriftsteller wie Langbein zu ihren Stoffen, Formen und Normkategorien wie »Balladen und Romanzen« treibt.
Wie dem auch sei: Nach dieser verordneten Zwischenlektüre werden Vater und Sohn noch eine gehörige Strecke gemeinsam zurücklegen. Von Ragaz geht es zunächst nach Chur;[45] in einem Char à banc fährt man am Folgetag nach Thusis, wandert durch die Viamala, das Schams und die Rofla bis nach Splügen, über den Splügenpass nach Chiavenna, und dann durchs Bergell und über die Maloja zurück ins Engadin und von dort gelangt man auf dem einen oder anderen Weg wieder nach Zürich.[46]
Später, wenn der Sohn einmal gedruckt worden ist, wird man sich auf die Suche nach Spuren der Erinnerung an diese Fahrten machen und sie in seiner Gebirgslyrik zu finden glauben,[47] etwa in dem ein halbes Leben später entstandenen Gedicht Der Reisebecher:
Gestern fand ich, räumend eines langvergeßnen Schrankes Fächer,
Den vom Vater mir vererbten, meinen ersten Reisebecher.
Währenddes ich leise singend reinigt’ ihn vom Staub der Jahre,
War’s als höbe mir ein Bergwind aus der Stirn die grauen Haare,
War’s als dufteten die Matten, drein ich schlummernd lag versunken,
War’s als rauschten alle Quelle, draus ich wandernd einst getrunken.[48]
Man greift nicht vor, wenn man konstatiert, dass dies keine Erlebnislyrik ist. Nicht das Erinnerte, sondern der Akt der poetischen Erinnerung tritt in den Vordergrund. Das dem Vergessen entrissene Erbe des Vaters avanciert zum Medium der Stimme. Die Erinnerung entsteht erst in der Reinigung des Bechers im Gesang; sie ist Effekt, auch wenn sie als Ursache erscheinen mag. Das dreifach wiederkehrende »War’s als« distanziert nicht nur die Unmittelbarkeit der Naturerfahrung: Es lässt auch die Vergangenheit aus dem poetischen Sprechen hervorgehen. Es handelt sich um einen Aneignungs-, einen Bemächtigungsprozess: Die »Quelle«, die Stimmen, die vor dieser Dichtung liegen, aus denen sie sich speist, werden nun alle durch diese erst ersprochen. In der letzten Zeile legt sich das Gedicht seinen eigenen Grund, schließt einen Erinnerungsraum, aus dem der Vater selbstverständlich ausgeschlossen bleibt.
Im Gedächtnis bleibt er dem Knaben, wie bereits gesehen, wegen anderem. Das Lächeln, das Ferdinand Meyer seinem Sohn schenkt, als dieser ob der in jenem »antistraußische[n] Pamphlet« gefassten Parole »Jagt den Strauß in die Wüste zurück!« die Frage stellt, ob der Rückbezug eines angeblich biblischen Mottos (es ist keines) auf die Zürcher Lokalpolitik nicht »Volksbetrug« sei: Es dürfte ein gequältes Lächeln gewesen sein. Der »Straußenhandel« besiegelt letztendlich das Schicksal dieses Mannes.
Gut vorbereitet ist er gleichwohl auf das Beben, das die Stadt bald heimsuchen wird. Von der liberalen Neuordnung des Kantonswesens bleiben auch Kirche und Religionslehre nicht unbehelligt. Schon im Vorfeld der Berufung des Tübinger Theologen David Friedrich Strauß, eines Studienfreundes von Mörike und Vischer, als Nachfolger von Heinrich Christian Michael Rettig auf den Zürcher Lehrstuhl für Dogmatik und Kirchengeschichte hatte sich Ferdinand Meyer mit dessen Auslegung des Neuen Testaments befasst, freilich nicht mit Strauß’ dann zum Skandalon erhobenen Leben Jesu, sondern mit den im Freihafen erschienenen »Selbstgesprächen« Vergängliches und Bleibendes im Christenthum. Kern der Schrift ist die konsequente Ethisierung des christlichen Glaubens: Die Bedeutung Christi liegt nicht in der sich durch das Wunder der Auferstehung erweisenden Gottessohnschaft, sondern in seinem innerweltlichen Handeln beschlossen. Für Strauß muss sich das Christentum aus dem Diesseits heraus rechtfertigen. Es ist kein Verdienstglaube: Der »Antrieb zum Guten« darf nicht »in der Aussicht auf die Gestaltung meines Schicksals nach dem Tode«[49] liegen. Das Bleibende der Lehre Christi ist die in seinem Tod offenbarte »Möglichkeit einer Sündenvergebung ohne Opfer«. Die historischen Umstände dieser Offenbarung, die Kollision des Jesus von Nazareth und seines Plans mit »der Gesinnung und Stimmung der damaligen Juden und ihrer Obern«[50] – das ist hingegen alles akzidentiell, Erzählmaterial zur Schaffung des im Tod Jesu sich fügenden Symbols.
Für Ferdinand Meyer sind das nachvollziehbare, dennoch gleich in zweifacher Hinsicht inakzeptable Gedankengänge. Zum einen ist ihm die Reduktion Christi auf dessen Menschsein unerträglich, auch wenn er einräumt, dass »es kaum möglich ist, auf dem Wege der Reflexion viel weiter zu kommen«.[51] Aber eben: Reflexion. Strauß »reflektirt über Christus, aber er liebt ihn nicht.«[52] Lieben kann man Christus aber nur, wenn man ihn kennt, und »kennen« bedeutet, dass man die Göttlichkeit dieses Menschen begreift, sein Bild im Herzen trägt, mit ihm »Umgang« pflegt, der einen wie von selbst »freudig zu allem Guten« treibt.[53] Zum anderen jedoch stellen Strauß’ Erwägungen eine ungeheure Kränkung des Historikers dar, insofern sie die geschichtliche Seite der Offenbarung konsequent profanieren. Folgt man Strauß, dann begegnet einem das Unsterbliche zwar notgedrungen in der Geschichte, aber die Geschichte selbst erfährt dadurch keine Heiligung, wird nicht über sich selbst hinausgehoben. Für Ferdinand Meyer hingegen steht »Jesu Persönlichkeit […] historisch fest«,[54] will sagen: Der Sohn Gottes musste just zu jenem Zeitpunkt geboren, gekreuzigt werden, wiederauferstehen. In die Geschichte schreibt sich der Wille Gottes ein, und wer sie studiert, der schließt sich mit jenem Willen zusammen, kommuniziert mit ihm – verleiht ihm in der erzählerischen Verdichtung, im Geschichtsbild Form. Erinnert man sich an Rankes Bestimmung der Historiografie als Wissenschaft und Kunst, als sinnliche Vergegenwärtigung des Vergangenen am Material, dann versteht man, warum die von Strauß im Leben Jesu extensiv vorgenommene und begründete Sonderung der mythischen Anteile des Neuen Testaments von dessen historischem Substrat für Ferdinand Meyer eine Provokation darstellen musste. Neben die Entgöttlichung des historischen Jesus tritt nämlich auch die Entheiligung des ästhetisierenden Aktes, der sich zwar pragmatisch begründen lässt, aber keineswegs zeigen kann, »wie es wirklich war«. Die erzählerische Verdichtung der Persönlichkeit »Jesus« im Neuen Testament, das von dorther auf uns gekommene ›tröstende‹ Bild: Das alles besitzt eine ethische Wahrheit, deren literarisches wie imaginatives Arrangement ihr jedoch äußerlich bleibt, sie im Zweifel nur verdeckt oder verzerrt. Trifft den frommen Protestanten somit Strauß’ Auflösung der Heilsgeschichte in Weltgeschichte (die zugleich den religiösen Kern des Christentums unangetastet lassen soll), so trifft den Historisten dessen Entkopplung der Darstellung des Geschehenen von der geschichtlichen Wirklichkeit.
Es ist wichtig, diese scheinbaren Nebensächlichkeiten hier festzuhalten, bevor das Getöse des Züriputsches von 1839 sie gleich wieder übertönt. Expliziert werden in ihnen nämlich Grundfragen des historischen Erzählens, die für die literarischen Unternehmungen von Ferdinand Meyers Sohn noch große Bedeutung erlangen werden. Schonungslos wird man dort die Figuren und ihre Fama, bisweilen auch ihre Körper (man denke an den Pagen Leubelfing) zergliedern, man wird die Wunderzeichen des Christentums drehen und wenden und wiegen (wie das Kreuz in Plautus im Nonnenkloster), man wird sich auch immer wieder auf die Suche nach dem Ursprung der Mythe machen, nach denen, die sie verantworten und das Erzählen kontrollieren. Mit Sicherheit gelangte man hier noch einmal weiter, über die Geschichte der Väter hinaus: Nichts muss das Geschehene mit seiner Überlieferung mehr vermitteln, das eine mit dem anderen in Beziehung setzen, wenn das Erzählen selbst in der historischen Wirklichkeit und ihrer Dinglichkeit gründet, wenn die Vergangenheit sich selbst erzählt und unseren Blick aus der Tiefe selbst steuert. Thomas Becket, der »Heilige«, ein Wiedergänger Christi, wird zu dieser Diskussion noch etwas beizutragen haben.
Doch das liegt fern, in einer Zukunft, die Ferdinand Meyer nicht mehr erleben wird. Die akademische Auseinandersetzung mit Strauß währt nur kurz. Abgelöst wird sie durch einen gewaltsam-politischen Konflikt, an dessen Anfang die Berufung von Strauß an die Universität Zürich am 26. Januar 1839 steht. Was folgt, ist hinlänglich unter dem Lemma »Straußenhandel« bekannt geworden, ein Vorgang, in dessen Wirren sich dann auch bereits bekannte Akteure wieder einfinden, etwa der gerade noch in Ragaz gesichtete Johann Jakob Hürlimann-Landis, alsbald Vorsteher des konservativen »Glaubenskomitees«, das die kantonsweite Opposition gegen Strauß’ Berufung durch den liberalen Regierungsrat organisiert und in seiner Petition nicht nur Strauß’ Demission, sondern auch die grundsätzliche Rückführung des Schulwesens in kirchliche Verantwortung fordert. Die zur Befriedung der Situation vom Regierungsrat bereits am 18. März 1839 beschlossene Zwangspensionierung Strauß’ kann folglich nicht verhindern, dass das »Glaubenskomitee« die Gelegenheit zu einer fundamentalen Abrechnung mit der liberalen Regierung gekommen sieht, die bewaffnete Konfrontation mit dem Regierungsrat nicht scheut und am 6. September einen Landsturm unter der Führung des Pfäffiker Pfarrers Bernhard Hirzel – ein Jugendfreund Bluntschlis mit wunderbar »unordentlicher Lebensführung« und dementsprechend bemerkenswerter Biografie[55] – in die Stadt schickt. Im Gefecht mit den Infanterietruppen der Regierung bleiben vierzehn Putschisten auf der Strecke. Auf der anderen Seite erschießen die in die Stadt eingefallenen Bauern unter anderem den Regierungsrat Johannes Hegetschweiler, der auch der Gönner der Familie Fröbel ist, die wiederum in nächster Nachbarschaft der Meyers wohnt. Die schreiend in den Seidenhof hinübergerannte, sich die Haare raufende Nachbarin ist den beiden Kindern des Hauses angeblich in steter Erinnerung geblieben.[56] Wie dem auch sei: Der Stadtpräsident Carl Eduard Ziegler – genannt »Oberst Ziegler«, er taucht noch einmal an anderer Stelle in diesem Leben auf – beruhigt die Lage, indem er sich auf die Seite des Aufstands stellt, der Regierungsrat löst sich auf, kurz darauf der Große Rat, es gibt Neuwahlen, die die Konservativen noch einmal an die Macht bringen.[57]
Das ist alles hundertfach erzählt worden und auch an dieser Stelle viel zu ausführlich, denn Bedeutung besitzt es hier doch nur, insofern im Zuge des Züriputsches auch Ferdinand Meyer noch einmal zu Amtswürden gelangt, wohl mehr genötigt als gewollt das Präsidium des Gesamterziehungsrats übernimmt, obwohl er da schon schwer kränkelt und gerade von einer Kur aus Blumenstein zurückgekehrt ist.[58] Regieren aber verschleißt, und so befällt ihn im Frühjahr 1840 ein Leiden, das wohl die Schwindsucht ist, vielleicht auch ein Typhusbefall, man weiß es nicht so recht. Jedenfalls verstirbt er am 11. Mai desselben Jahres im Alter von 41 Jahren.
An dieser Stelle ließe sich nun eigentlich mit der üblichen Erzählung vom familien- und entwicklungspsychologischen Einschnitt dieses Ablebens fortfahren. Kerben gibt es ja genug, auch wenn keine einzige mit der Feder von Conrad Ferdinand Meyer geritzt wurde. Jedoch sieht seine Schwester, sein »Leben als Ganzes überschauend, […] doch nach dem Tode unseres Vaters die Spur sich abzweigen, die meinen Bruder auf einsame Pfade führen mußte und zu jahrelanger fruchtloser Anstrengung, sich eine unbeschrittene Bahn zu brechen.«[59] Das, was Wirkung zeigt, was das Verhältnis dieser Gestalt zu ihren Vätern im Wesentlichen prägt, ist ihre unrettbare Hinterlassenschaft. Die als »bedeutendste Jugenderinnerung« in dieser Erzählung verbleibende Zäsur des »Straußenhandels« steht sowohl auf biografischer wie auf historisch-philosophischer Ebene für den Aufbruch zum Untergang. Denn nicht nur der eine, persönliche Vater des Conrad Meyer wird sich in seinem neuen, alten Amt restlos verbrauchen. Tatsächlich bäumt sich im Züriputsch zugleich jenes fromm-konservative Milieu ein letztes Mal auf, dem dieser Sohn zeit seines Lebens nicht mehr entkommen wird. Schon 1842 verlieren die Konservativen wieder die Mehrheit im Großen Rat, in den zwei Jahre später ein fünfundzwanzigjähriger Liberaler namens Alfred Escher einzieht.[60] Er wird bald das Gesicht der neuen Schweiz werden, ihre Diskurse bestimmen, ihre Mythen stiften, ihre Tunnel graben und ihre Tempel bauen, kurzum: eine Welt schaffen, zu der man sich verhalten muss, ob zustimmend oder ablehnend. Manchen gelingt im Laufe ihres Lebens sogar beides, und manche avancieren über ihrem Seitenwechsel auch zu Staatsschreibern und Nationaldichtern der jungen Eidgenossenschaft. Doch dort, wo Gottfried Keller mit erstaunlicher Wendigkeit sich vom Radikalen zum Liberalen wandelt, Escher erst bekämpft und sich dann ihm andient, wird Conrad Ferdinand Meyer abseitsstehen. Die Welt, der er entstammt, die an ihm haftet, lässt sich mit den Mentalitäten, die ab 1848 die politische und kulturelle Landschaft der Schweiz formen, nicht mehr verbinden. Wenn er 1891 in einem Album-Blatt für Gertraud von Gerhardt-Amyntor sich »[z]u der conservativen« Richtung zählt, da es »der retadirenden Elemente« bedarf,[61] so liegt dieser Konservatismus schon Jahrzehnte hinter der Gegenwart, die ihn beruft. Aber was fängt man an im Zeitalter des Liberalismus, wenn man selbst weder ein Liberaler ist, noch jemals einer werden kann?
III. Die Dämonen in den Wänden
An einem Herbsttag 1856 liegt auf dem Schreibtisch eines Studierzimmers, durch dessen Fenster man auf den Neuenburger See hinaussieht, ein Brief.
Theures, innig geliebtes Kind u. auch du mein guter Conrad. Mit einem unaussprechlichen Seelenschmerz reiße ich mich von Euch los, wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen; aber es muß geschehen, damit ich nicht Sünde auf Sünde häufe und Euch immer unglücklicher mache. O klammert Euch doch recht an Christi Kreuz u. Verdienst an damit ihr die entsetzliche Prüfung[1]
Wie endet dieser Satz? »durchsteht«? »durchmacht«? Wurden hier Lettern durchgestrichen, nachträglich eingefügt, überschrieben? Seltsam verändert, in die Unlesbarkeit zerfallen ist die Schrift an dieser Stelle, als stammte sie von einer anderen Hand, die den manieristischen Aufstrich, die hohen, geschwungenen Zeichen nicht kennt. Ein erstes Innehalten? Man könnte es verstehen, denn diese Zeilen fordern Tat ein. Hart wenden sie sich gegen ihre Verfasserschaft, die sogleich in den Blick kommt:
Ich schaudere vor mir selbst – Ach, Allbarmherziger, erbarm dich meiner auch an dem dunkeln Orte, wohin ich mich jetzt stürze – Vielleicht darf ich wieder von vorn anfangen u. im übrig gebliebenen Guten wachsen.[2]
Vielleicht ja, vielleicht nein. Allerhand lässt sich jedenfalls aus jenem letzten Brief Elisabeth Meyer-Ulrichs an ihr geliebtes Kind, und ja: auch an den guten Conrad herauslesen, vor allem anderen die Überzeugung, verworfen zu sein. Unumkehrbare, unentrinnbare Verworfenheit; mit jedem Tag wächst die Sünde, verstrickt man sich dichter in sein Lügennetz. Missetäterin bleibt Missetäterin, je mehr man auch mit Liebe bedacht wird, umso eindringlicher raunt es einem ins Ohr: »es ist zu spät. Du bist rabenschwarz –«.[3] Und es ist eine ansteckende Schwärze, so viel weiß diese Frau. Unglücklich ist sie, aber diejenigen, an die sie ihren Brief schickt, macht sie in ihrer Verbundenheit noch unglücklicher: ein »schauerliche[s] Schicksal« bereitet sie ihnen. Aber immerhin: Man kann sie retten, die Kinder, besonders das eine, man kann sie noch unters Kreuz Christi stellen, aus dessen Gnadenschatten man selbst verstoßen wurde. Es bedarf dazu nur dieses einen Schritts in die Hölle, dann wird er es schon begreifen: »Conrad, Lieber Sohn, – Ich glaube, der entsetzliche Schlag werde dich im Christenthum befestigen. Thue an deiner Schwester was nur immer möglich ist.«[4]





























