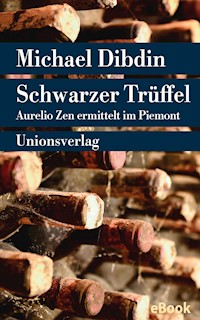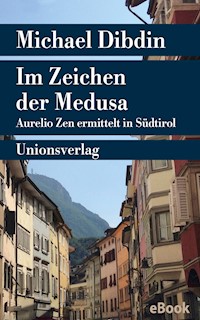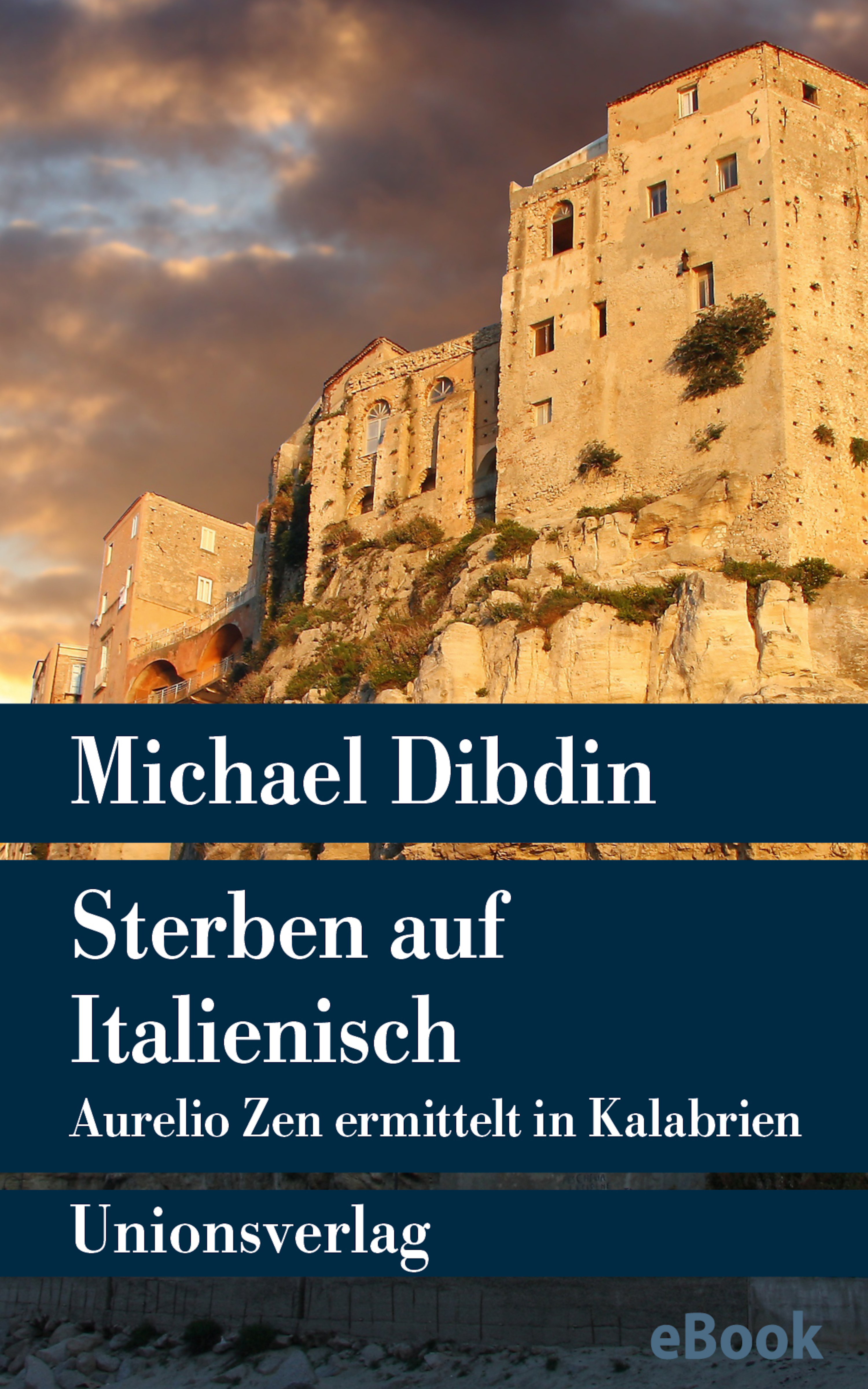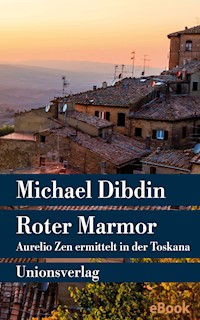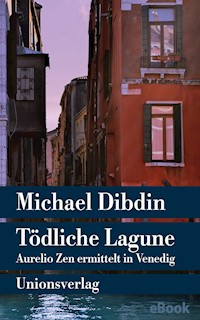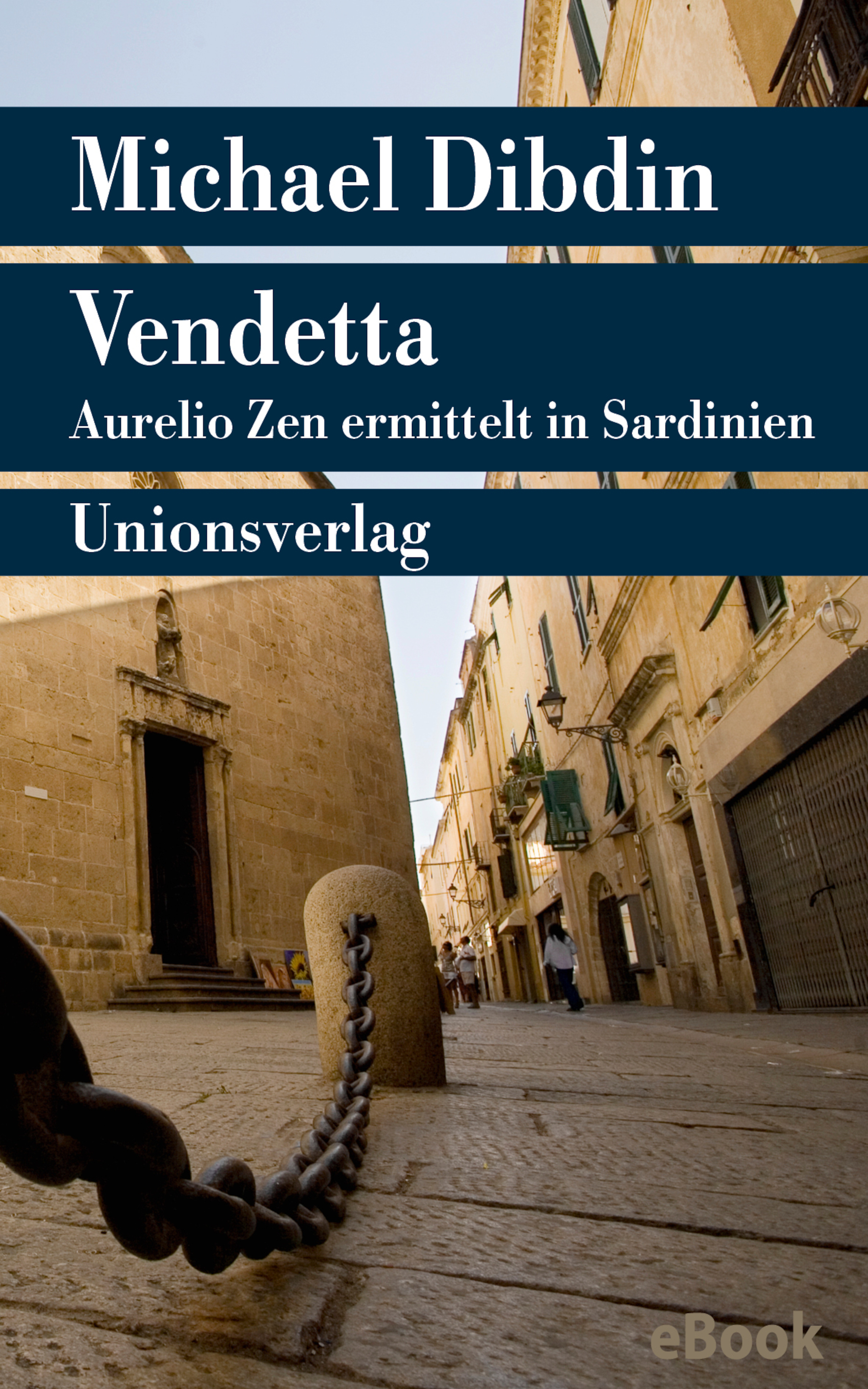11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Polizeikommissar Aurelio Zen lebt im Chaos: Man hat ihn nach Neapel strafversetzt, seine Frau will sich scheiden lassen, und seine Geliebte erwartet ein Kind von ihm. Zu allem Überfluss findet in der Stadt am Vesuv gerade eine politische Säuberungsaktion statt. Zunächst verschwinden dubiose Geschäftsmänner, korrupte Politiker und stadtbekannte Mafiosi spurlos. Und als der Kommissar sich auf die Suche nach den Drahtziehern begibt, gerät er selbst in höchste Lebensgefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Kommissar Aurelio Zen lebt im Chaos: Man hat ihn nach Neapel strafversetzt, seine Frau will sich scheiden lassen, und seine Geliebte erwartet ein Kind von ihm. Als in der Stadt am Vesuv Mafiosi und korrupte Politiker spurlos verschwinden, macht er sich auf die Suche nach den Drahtziehern – und gerät dabei selbst in höchste Lebensgefahr.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Michael Dibdin (1947–2007) studierte englische Literatur in England und Kanada. Vier Jahre lehrte er an der Universität von Perugia. Bekannt wurde er durch seine Figur Aurelio Zen, einen in Italien ermittelnden Polizeikommissar.
Zur Webseite von Michael Dibdin.
Ellen Schlootz arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie hat u. a. Werke von Ian Rankin und David Hosp ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Ellen Schlootz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Michael Dibdin
Così fan tutti
Aurelio Zen ermittelt in Neapel
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ellen Schlootz
Aurelio Zen ermittelt (5)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel Così fan tutti im Verlag Faber and Faber, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 im Goldmann Verlag, München.
Originaltitel: Così fan tutti (1996)
© by Michael Dibdin 1996
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Prosiaczeq
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30884-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 13:24h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
COSÌ FAN TUTTI
Der Schauplatz ist angeblich NeapelDie Ursache ist LiebeSchön ist das SoldatenlebenBeide spielen ihre Rolle gutFreund Don AlfonsoZwei DelinquentenOhne Liebe, aber nicht ohne LiebhaberEin Mann versteckt sichEr spricht eine Sprache, die wir nicht verstehenBeamte und GentlemenDie beiden naiven LiebhaberEin Hauch von VerdachtNur zu wahrAuf der StraßeZwei seltsame MädchenWas für interessante GesichterDas Schicksal ist schuldWas sie nur gemacht habenKeiner weiß, wo er istEine Frau, die nichts wert istEtwas NeuesEs scheint unmöglichWir sollten besser tun, was sie wollenDas Herz einer FrauEin kleiner DiebDas nenn ich wahre TreueDas glaubst du, aber es ist nicht wahrWir müssen ihn erwischenVerwirrt und beschämtEine hoffnungslose LeidenschaftSo viele SprachenDie Stunde der Wahrheit ist gekommenEine nette ÜberraschungAm vereinbarten OrtDas Tor zur HölleWo bin ich?Die juristischen FormelnFinaleAnmerkung des AutorsMehr über dieses Buch
Über Michael Dibdin
Über Ellen Schlootz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Michael Dibdin
Zum Thema Italien
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Für Katherine,fedel quanto bella
Ah, chi mai fra tanti mali,chi mai può la vita amar?
Lorenzo Da Ponte: Così fan tutte
Der Schauplatz ist angeblich Neapel
Wäre an dem betreffenden Morgen jemand in der Via Greco auf gewesen, dann hätte er Folgendes beobachtet.
Die Sonne hatte gerade den Dachrand der fünfstöckigen Häuser in der Via Martucci erfasst, und das nun scharfkantige Licht veränderte in wenigen Sekunden die ganze Szene, so wie Theaterbeleuchtung plötzlich das Bühnenbild zur Geltung bringt. Jedes Ding, gleich wie profan, wurde von dem sanften, aber intensiven Leuchten umschmeichelt und mit einer besonderen Bedeutung versehen.
Die Zuschauer, wären denn welche da gewesen, hätten zweifellos jedes auf diese Weise ins Rampenlicht gerückte Ding genau betrachtet und sich gefragt, welche Rolle es wohl in dem Stück, das gleich beginnen würde, einnehmen mochte. Zum Beispiel jener Baum an der Straßenecke, der einen klar umrissenen Schatten auf die genarbten schwarzen Pflastersteine wirft – ist er reine Dekoration, nur ein Teil des Bühnenbilds, oder wird er eine wichtige Rolle in dem Drama spielen, gar zu einer Art Figur werden, vielleicht als Schauplatz des berühmten Duetts der Verführung und Hingabe im zweiten Akt, das wohl jedem Musikliebhaber bekannt ist?
Ebenso die Gebäude, die so intensiv und zugleich liebevoll von dem immer heller werdenden Licht hervorgehoben werden – tragen sie nur zum Lokalkolorit bei, oder wird jedes von ihnen, wenn der Vorhang schließlich fällt, dem Zuschauer als Stätte der Bedrohung oder Zuflucht vertraut geworden sein? Die Eingänge sehen ganz echt aus, doch die Fassaden könnten genauso gut gemalte Kulisse sein, die ihre Zweidimensionalität durch übertriebene Liebe zum Detail auszugleichen versucht.
Andere Teile des Bühnenbilds scheinen weniger problematisch. So sind beispielsweise die zahlreichen Mülltonnen sicher programmatisch für die angeblich »radikal« neue Inszenierung. Ebenso wie die Autos, die in Zweier- und Dreierreihen entlang der Via Greco geparkt sind und aus ihr quasi einen Parkplatz machen, mit nur einer schmalen freien Spur in der Mitte für den Verkehr, und eindeutig die Absicht des Regisseurs dokumentieren, dass dies das heutige Neapel sein soll, ein Netzwerk von politischen, sozialen und ökonomischen Gegebenheiten, das sich stark von dem malerischen, eher universellen Schauplatz unterscheidet, der dem Komponisten und seinem Librettisten vorschwebte, und damit einen erfrischend modernen Seitenhieb auf das, offen gesagt, ziemlich banale ursprüngliche Konzept abgibt – obwohl die Musik natürlich göttlich ist.
Doch trotz all dieser cleveren Einfälle kann eine leere Bühne nur begrenzt das Interesse fesseln. Es bedarf menschlicher Akteure, um Dramatik zu erzeugen. Und da, nach einer perfekt bemessenen Verzögerung, kommen sie auch schon.
Es wird jedoch sofort klar, dass es sich nur um Statisten handelt, quasi um eine mobile Erweiterung des Bühnenbilds, die sich der Regisseur als Einlage ausgedacht hat, bevor die eigentliche Handlung beginnt. Entsprechend dem harschen Realismus, der das Ganze prägt, tragen sie die Kluft von Müllarbeitern – blaue Overalls, dicke Handschuhe und Stiefel. Hinter einem großen orangen Wagen mit der Aufschrift »Commune di Napoli« bewegen sie sich zielstrebig die Via Strozzi entlang, entleeren die zahlreichen Mülltonnen und Plastiksäcke, bevor sie nach rechts in eine kleinere Seitenstraße abbiegen.
Und jetzt tritt auch endlich einer der Hauptdarsteller auf, nicht durch einen der Hauseingänge, sondern über eine Rampe, die geschickt zwischen zwei Bahnen des Bühnenhintergrundes versteckt ist, die ein modernes Wohnhaus auf der linken Seite der Via Greco darstellen, das ein Stück die Anhöhe hinauf gegenüber der hohen Tuffwand liegt, hinter der sich weiter oben die Gärten einer imposanten Villa erheben.
Obwohl er offensichtlich einer der Stars ist, wirkt er unscheinbar. Trotz der selbst um diese frühe Stunde bereits milden Luft ist er in einen teuer aussehenden Mantel gehüllt, dazu trägt er Lederhandschuhe und einen karierten Schal. In einer Hand hält er einen Diplomatenkoffer, in der anderen ein Schlüsselmäppchen. Mit großen Schritten geht er auf die parkenden Autos zu und betätigt eine elektronische Fernbedienung, die an seinem Schlüsselbund hängt. Eines der Fahrzeuge – ein silbergrauer Alfa Romeo – reagiert mit mehrfachem Aufleuchten der Blinklichter und begeistertem Hupen.
Und jetzt geschieht etwas Merkwürdiges, etwas, das genauso unheimlich wie mühelos scheint wie der Wechsel in eine andere Tonart. Um zu seinem Auto zu kommen, muss der Mann an dem orangen Fahrzeug vorbei, das gerade auf die Müllcontainer neben dem Wohnhaus zusteuert, aus dem er herausgekommen ist. Doch da stellen sich ihm plötzlich zwei der Arbeiter in den Weg, die neben dem Müllwagen durch die schmale Spur laufen, die die parkenden Autos frei gelassen haben.
Statt in eine der Lücken zwischen den Autos zu treten, geht der Mann unbeirrt weiter geradeaus und zwingt die beiden Arbeiter im blauen Overall, ihm Platz zu machen. Das tun sie auch, als ob sie die Aura von Macht, die den Mann umgibt, spüren würden, die Aura, die ihn zu jemandem macht, dem man sich beugen muss und nicht entgegenstellen darf. Einer von ihnen tritt zur Seite zwischen den silbergrauen Alfa und das Auto dahinter, einen ramponierten Fiat Uno. Der andere bleibt stehen und wartet anscheinend darauf, dass der Müllwagen an ihm vorbeifährt, damit er hinter ihm hergehen kann und nicht mehr im Weg ist.
Da passiert das Merkwürdige. Denn als der männliche Hauptdarsteller an dem ersten Statisten im blauen Overall vorbeigeht, dreht dieser sich um und hält plötzlich etwas in der Hand, das in einer der vielen Taschen seines Overalls versteckt gewesen sein muss. Es sieht aus wie eine zusammengerollte Zeitung, zweifellos L’Unità oder Il Manifesto oder sonst ein Blatt, das sich den Kämpfen und Zielen des Proletariats verschrieben hat und damit wunderbar zur platten Neuinterpretation des Regisseurs passt. Mit merkwürdig eleganten Gesten schwingt der Arbeiter die Zeitung hinter dem Mann im Mantel, als ob er nach einer Fliege schlagen wolle, die diesem um den Kopf schwirrt. Im selben Augenblick, wenn auch ohne erkennbare kausale Verknüpfung, gerät der Mann ins Taumeln, als ob er über die vorstehende Kante eines der schwarzen Pflastersteine gestolpert sei, die immer eine Gefahr darstellen, selbst in diesem relativ wohlhabenden Stadtviertel.
Zum Glück kommt der andere Arbeiter, der jetzt auf einer Höhe mit dem Heck des immer noch fahrenden Müllwagens ist, gerade rechtzeitig hinzu, um den stürzenden Mann aufzufangen und damit zu verhindern, dass er sich ernsthaft verletzt. Die Geste scheint zunächst auf einen Kompromiss in der bisherigen Intention des Regisseurs hinzudeuten, als ob er sagen wolle, dass die Menschen trotz aller ideologischen Klüfte, die sie anscheinend trennen, im Grunde gut sind – ein Kompromiss, der, wie die eine Hälfte der Zuschauer fürchtet und die andere insgeheim hofft, auf etwas hinauslaufen wird, das Letztere als menschliche Wärme begrüßen und Erstere als schwach und sentimental kritisieren wird.
Wie um diese Hypothese zu stärken, wirft der erste Arbeiter nun seine Zeitung beiseite, wo sie mit einem lauten metallischen Klirren auf die Pflastersteine fällt, und beugt sich hinunter, um das Opfer bei den Füßen zu fassen. Ohne ein Wort zu sprechen, heben die beiden den Mann hoch und lassen ihn einen Augenblick an Schultern und Waden gepackt schlaff in der Luft hängen. In diesem Moment ist der unaufhaltsam weiterfahrende Müllwagen an ihnen vorbei. Mit einem einzigen knappen Schwung schmeißen sie den reglosen Körper über die Ladekante, wo er verschwindet.
Während der erste Arbeiter den Schraubenschlüssel aufhebt, der in der Zeitung steckte, drückt sein Kollege einen grünen Knopf an einem Kästchen, das am Heck des Wagens angebracht ist. Mit lautem Getöse beginnt sich der massive Schieber zu senken. Der obere Teil und die Seiten sind total verdreckt, doch die gewölbte untere Kante hat durch die ständige Abnutzung einen wunderbar silbrigen Glanz erhalten. Unaufhaltsam bewegt sich der Schieber in den Bauch des Wagens. Der Lärm der kraftvollen Maschinerie übertönt alle Geräusche, die man sonst vielleicht hören könnte.
An dieser Stelle gibt es eine willkommene komödiantische Einlage, weil nämlich die Füße des Mannes über der Ladekante des Müllwagens auftauchen. Mit ihren auf Hochglanz polierten geschnürten Halbschuhen und den rot-schwarz karierten Socken, über denen ein kleines Stück nacktes weißes Bein zu sehen ist, beginnen sie, ein wildes Tänzchen zu vollführen, immer hin und her wie Puppen im Kasperletheater – möglicherweise eine spitzfindige Anspielung auf die Commedia dell’arte, die bekanntlich ihren Ursprung in dieser Stadt hat.
Der Schieber ist mittlerweile unter heftigem Rütteln, das den ganzen Wagen erschüttert, zum Stillstand gekommen. Einer der Arbeiter läuft hinüber, drückt einen weiteren Knopf an dem Schaltkästchen, sodass der Schieber wieder ein Stück hochgeht, während sein Kollege die vorwitzigen Gliedmaßen nach unten drückt und so zum Verschwinden bringt. Dann senkt sich der Schieber wieder nach unten und vollendet diesmal seine Arbeit. Er packt allen Müll, der im Wagen gelandet ist, und presst ihn zu einer kompakten Masse, in der die einzelnen Teile kaum voneinander zu unterscheiden sind.
Die Arbeiter in den blauen Overalls klettern auf die Plattform am Heck des orangen Wagens und geben dem Fahrer ein Zeichen. Dieser fährt sofort los, ungeachtet der überlaufenden Müllcontainer neben dem modernen Wohnblock, aus dem der Mann im Mantel gekommen war. Das Fahrzeug donnert die in sanften Windungen absteigende Straße hinunter und verschwindet dann links um die Ecke. Einige Sekunden ist sein Motor noch leise in der Ferne zu hören, dann ist alles wieder still.
Wäre an dem betreffenden Morgen jemand in der Via Greco auf gewesen, dann hätte er dies beobachtet. Und es waren tatsächlich mehrere Leute auf: ein alter Mann, der sich in dem Licht, das durchs Fenster fiel, rasierte, um Strom zu sparen; eine alleinerziehende Mutter, die die ganze Nacht wach geblieben war, weil ihr Baby Bauchschmerzen hatte; ein zehnjähriges Kind, das die Wäsche auf einem Flachdach hoch über der Straße abhängte; und ein Stadtstreicher, der mit Erlaubnis des Besitzers in einem der parkenden Autos geschlafen hatte. Aber merkwürdigerweise meldete niemand von ihnen den außergewöhnlichen Zwischenfall, den sie gerade beobachtet hatten, der Polizei oder den Zeitungen, noch erwähnten sie ihn einem Familienangehörigen gegenüber, mit Ausnahme von Signora Pacca, der Mutter, die in dieser Nacht nicht zum Schlafen gekommen war. Sie erzählte die ganze Geschichte am folgenden Abend mit leiser Stimme ihrem Vater beim Essen. Er lächelte und nickte und murmelte ab und zu »Tatsächlich?« oder »Erstaunlich!«. Doch Signor Pacca war stocktaub, und sonst war niemand im Zimmer.
Von den anderen sagte niemand ein Sterbenswörtchen über das, was sie gesehen hatten, obwohl die Angelegenheit schon bald zu einer Sache von nationaler Tragweite wurde. Als hätten sie eine stillschweigende Übereinkunft getroffen, verhielten sich alle wie Opernbesucher, die – wie es sich in bestimmten Kreisen gehört – zu spät gekommen waren und die Ouvertüre verpasst hatten.
Die Ursache ist Liebe
Gesualdo doch nicht!«
»Sabatino? Niemals!«
Der Mann, der sich gegen die Theke lehnte, lächelte reserviert, ja beinahe herablassend, und schwieg.
»Mamma hat Sie dazu angestiftet, stimmts?«, fragte die ältere der beiden Schwestern mit wissendem Blick.
Der Mann hob vielsagend die Augenbrauen.
»Sie hat mir natürlich von ihren Sorgen erzählt. Wiederholt und zu diversen Anlässen, wie ich zugeben muss. Aber ich teile ihre Sorge nicht.«
»Worum gehts Ihnen denn?«, entgegnete die jüngere Schwester prompt.
Statt zu antworten, hob der Mann die Hand, um den Barmann herbeizuwinken. »Ich glaube, ich könnte noch einen Kaffee vertragen. Was ist mit Ihnen beiden? Hier gibts angeblich das beste Gebäck in der Stadt.«
»Ich kann wirklich nicht.«
»Ich sollte wirklich nicht …«
Der Mann lächelte wieder. »Genau, was Ihre Freunde nach Meinung Ihrer Mutter sagen werden, wenn sich die passende Gelegenheit ergibt.«
Er wandte sich an den Barmann. »Zwei Sfogliatelle für die Damen und für mich noch einen Kaffee.«
Die ältere Schwester starrte ihn wütend an. Sie war groß für eine Neapolitanerin, hatte aber die typische teigige Haut, feurige dunkle Augen und sehr feines schwarzes Haar, das sie kurz geschnitten trug. Sie hatte ausgeprägte Gesichtszüge mit einem auffallend festen, entschlossenen Mund und einer langen geraden Nase. »Es ist mir ganz egal, ob das Ihre Idee war, Dottor Zembla, oder die von Mamma«, erklärte sie. »Jedenfalls ist das ein leicht durchschaubarer, sinnloser und zugleich widerwärtiger Versuch, die Gefühle, die Gesualdo und ich füreinander hegen, zu untergraben, Gefühle, wie sie Leute Ihrer Generation überhaupt nicht mehr empfinden können und deren Stärke und Reinheit sie infolgedessen auch nicht verstehen. Wenn ich gemein wäre, würde ich vielleicht sagen, dass Ihre Unfähigkeit zu solchen Empfindungen die Ursache für den Neid und die Boshaftigkeit ist, die hinter diesem widerlichen Versuch stecken, unsere armen Freunde in Misskredit zu bringen.«
Aurelio Zen schüttelte den Kopf. »Sie haben viel zu viel Fantasie, Signorina Orestina. Mein Interesse an dieser Sache ist rein finanziell.«
»Pronti, Dottore!«, rief der Barmann und stellte den Kaffee und die beiden muschelförmigen Blätterteigtaschen auf die Marmortheke.
»Wieso spielt Geld bei der Sache eine Rolle?«, fragte die jüngere Frau und sah auf den Teller vor sich. Sie wirkte sanfter und weniger imposant als ihre Schwester. Ihre Haare waren länger und heller, ihre Haut blasser und ihre Figur molliger.
»Wessen Geld?«, erkundigte sich Orestina unverblümt.
Zen nippte an dem glühend heißen Kaffee, der in einer Tasse serviert wurde, die mit heißem Wasser aus der Espressomaschine vorgeheizt worden war. »Das Ihrer Mutter«, sagte er.
»Aha!«
»Lassen Sie mich Ihnen ihre Meinung erklären …«
»Die kennen wir nur zu gut«, entgegnete die jüngere Frau. »Sie hält Sabatino und Gesualdo für Schläger, Verbrecher, Gangster, Drogendealer und weiß der Himmel noch was!«
»Gewiss, Signorina Filomena! Das steht außer Frage. Doch in einem Punkt sind Ihre Mutter und ich anderer Meinung. Sie glaubt nicht, dass die beiden wirklich in Sie verliebt sind. Nicht nur verschwenden Sie beide – um Ihre Mutter zu zitieren – Ihre Schönheit, Ihren Verstand und Ihre gute Erziehung an zwei nutzlose Individuen, sondern – noch viel schlimmer – die beiden amüsieren sich nur mit Ihnen und werden nach neuer Beute Ausschau halten, sobald sie bekommen haben, was sie wollen.«
»Das ist ja eine bösartige Unterstellung!«, rief Filomena. Ihre grünen Augen waren feucht. »Sabatino ist immer so lieb und aufmerksam zu mir, und er nimmt große Rücksicht auf meine Gefühle. Mamma hat kein Recht zu behaupten, dass er mich nicht liebt. Sie ist bloß eifersüchtig.«
»Gesualdos einziges Verbrechen ist, dass seine Eltern arm waren und im falschen Teil der Stadt lebten«, beteuerte ihre Schwester. »Es ist wirklich eine Schande, dass Mamma ihn deswegen verurteilt. Er ist der beste, aufrichtigste, netteste und offenste Mann, den ich je getroffen habe, und viel mehr wert als diese eingebildeten, unverschämten und verzogenen Typen, mit denen sie uns am liebsten verheiraten würde!«
Aurelio Zen trank seinen Kaffee aus und langte nach seiner Jackentasche. Doch dann hielt er mit gerunzelter Stirn inne und schüttelte die Finger, als ob er einen Krampf hätte. »So sehe ich das auch«, antwortete er. »Deshalb ist es doppelt schade, dass Sie nicht bereit sind, die Treue der beiden auf die Probe zu stellen. Also werden Ihre Mutter und ich möglicherweise lange warten müssen, um festzustellen, wer von uns gewonnen hat.«
»Gewonnen?«, ereiferte sich Orestina. »Was gewonnen?«
»Wollen Sie etwa sagen, dass Sie mit Mamma eine Wette über unser künftiges Glück abgeschlossen haben?«, fragte ihre Schwester. »Wie können Sie es wagen, so etwas zu tun? Als ob unser Schicksal nichts weiter als ein Pferderennen oder ein Fußballspiel wäre!«
Aurelio Zen zuckte die Achseln. »Ich wollte doch nur beweisen, dass Ihre Mutter unrecht hat. Aber da Sie nicht mitspielen wollen …«
Filomena konnte sich nicht mehr zurückhalten und schnappte sich eine der Sfogliatelle. »Und warum sollten wir mitspielen?«, fragte sie. »Was springt für uns dabei heraus?«
»Zunächst mal eine Reise nach London.«
»London?«
»Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass Ihre plötzliche Abreise plausibel erscheint. Und was ist schon Merkwürdiges dabei, wenn zwei Literaturstudentinnen kurz vor dem Examen nach England fahren, um ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen?«
»Ich wollte immer schon mal nach London«, murmelte Orestina wehmütig.
»Dann ist das Ihre Chance«, bemerkte Zen mit breitem Grinsen. »Und wenn Sie dieses Angebot ablehnen, meine Damen, muss ich annehmen, dass Sie sich trotz aller inbrünstigen Beteuerungen Ihrer Freunde gar nicht so sicher sind, wie Sie behaupten.«
»Sabatino würde mich nie betrügen!«, sagte Filomena.
»Ich vertraue Gesualdo wie mir selbst!«, erklärte Orestina.
»Ich hab ein sehr gutes Pauschalangebot gefunden«, fuhr Zen fort. »Flugtickets, ein nettes Hotel im Zentrum, großzügige Rabatte in ausgewählten Geschäften, Clubs und Discos. Sie müssten allerdings mit der Alitalia fliegen, aber ein Kollege von mir kennt jemanden, der beim Bodenpersonal am Flughafen arbeitet, und der könnte dafür sorgen, dass Sie nicht in der Economyklasse zu fliegen brauchen.«
Die jüngere Frau wischte sich die Kuchenkrümel von ihrem üppigen Busen. »Wann würden wir denn fliegen?«
»Sofort. Dann können Sie noch zwei Wochen drüben bleiben, bevor Sie hier zu Ihren Prüfungen antreten müssen.«
»Kommt überhaupt nicht infrage«, sagte Orestina.
»Ich muss erst mit Sabatino darüber sprechen«, sagte Filomena.
Zen fasste sich an die Stirn. »Um Gottes willen! Der Witz bei der Sache ist doch, dass die beiden nicht wissen, dass es sich um einen Test handelt.«
»Aber ich erzähle Sabatino immer alles!«, jammerte die jüngere Schwester und fing wieder an zu weinen.
»Hören Sie!«, sagte Zen. »Wenn Sabatino und Gesualdo tatsächlich solche Muster an Tugendhaftigkeit sind, wie Sie behaupten, was haben Sie dann zu verlieren? Sie bekommen nicht nur einen wunderbaren Urlaub in London, ohne was dafür zu bezahlen, sondern erhalten auch die Chance, ein für alle Mal zu beweisen, dass diese jungen Männer trotz all ihrer Fehler Ihre Zuneigung verdienen und würdig sind, Sie zu heiraten. Kurz gesagt, Sie haben die Chance zu beweisen, dass Ihre Mutter unrecht hat, und das auch noch auf deren Kosten!«
Einen Augenblick herrschte Schweigen.
»Wie viel?«, fragte Orestina.
Zen lächelte sie unbefangen an. »Was meinen Sie?«
»Sie haben vorhin zugegeben, dass Ihr Interesse an der Sache rein finanziell ist. Also, um wie viel geht es?«
Zen gestikulierte mit der linken Hand wild in der Luft herum. »So um die hunderttausend? Ich hab den genauen Betrag vergessen. Das Geld ist auch gar nicht so wichtig. Ich hab das eigentlich nur vorgeschlagen, um die ganze Angelegenheit ein bisschen pikanter zu machen.«
Orestina nickte. »Ich verstehe. Vielleicht können wir diese ›Angelegenheit‹ ja noch ein bisschen mehr für Sie würzen, Dottor Zembla. Ich schlage Ihnen eine Nebenwette um den gleichen Betrag zwischen uns dreien vor. Wenn Sie gewinnen, zahlen wir Ihnen jede noch fünfzigtausend zu den hunderttausend von Mamma dazu. Wenn Sie verlieren, teilen Filomena und ich uns den Pott, 100 000 Lire für jede von uns. Was halten Sie davon?«
Aurelio Zen runzelte die Stirn und schien einen Augenblick mit sich zu ringen. Dann streckte er den Arm aus, ergriff Orestinas zierliche, aber erstaunlich muskulöse Hand und schüttelte sie heftig. »Was werden Sie denn mit Ihrem Gewinn machen?«, fragte er.
Filomena klatschte in die Hände. Die Vorfreude stand ihr ins Gesicht geschrieben. »Ich werde Sabatino einen Abend groß ausführen!«, rief sie begeistert. »Erst gehen wir ins Kino, dann irgendwo schick essen, und dann tanzen wir die ganze Nacht durch. Das wird ein Abend, den wir nie vergessen, selbst wenn wir mal so alt sind wie Sie, Don Alfonsetto!«
Zen wandte sich an die ältere Schwester. »Und Sie, Signorina?«
»Ich tus auf mein Sparkonto«, antwortete sie kühl.
»Sie können offenbar gut mit Geld umgehen«, bemerkte Zen. »Wie Ihr Vater.«
»Lassen Sie unseren Vater aus dem Spiel!«, blaffte Orestina.
Sie nahm den Rest der Blätterteigtasche, den ihre Schwester bereits beäugt hatte, packte ihn in eine Papierserviette und steckte ihn in die Tasche. »Und jetzt müssen wir los, sonst kommen wir zu spät in die Uni.«
Aurelio Zen legte beiden eine Hand auf den Arm. »Und erzählen Sie ja nichts Ihren Freunden! Sonst ist unsere Abmachung hinfällig.«
»Ich brauche Gesualdo gar nichts zu erzählen«, antwortete Orestina verächtlich.
»Genau!«, pflichtete Filomena ihr bei. »Sabatino weiß immer schon, was ich ihm sagen will. Wir sind perfekt aufeinander eingestimmt. Es ist schon fast mystisch, wie gut wir uns verstehen.«
Aurelio Zen sah die beiden Schwestern an – so verschieden, und doch so gleich, so selbstbewusst, und doch so verletzlich. Einen Moment spürte er ein gewisses Bedauern, fast ein Schuldgefühl, wegen dem, was er tat. Dann schüttelte er den Kopf, zahlte, nahm beide am Arm und führte sie hinaus in das gleißende Sonnenlicht, das Stadt und Bucht überflutete.
Schön ist das Soldatenleben
Im Gegensatz zur angenehmen Wärme in den Straßen war es in der Funicolare-Station dunkel wie in einer Höhle. Die Luft war kühl, roch leicht nach Öl und Moder, und es zog. Ein Paar junger Ratten spielte zwischen den Schienen Fangen. Die Kabel waren bereits in Bewegung und glitten wie silbrige Schlangen über die Laufschienen. Wenige Sekunden später tauchte die Bahn unten aus dem Dunkel auf, bewegte sich langsam den Hang hinauf und kam sanft abgebremst an dem abschüssigen Bahnsteig zum Stehen.
Zen stieg in den mittleren Wagen, dessen Boden wie eine Treppe in Stufen abfiel, und schlug seinen Il Mattino auf. Die Überschriften wirkten eindeutig angestaubt, weil es sich um die Fortsetzung von Geschichten handelte, über die bereits Anfang der Woche berichtet worden war – der Streit über den künftigen Standort eines Stahlwerks in Bagnoli; die Pläne des Bürgermeisters, bestimmte Maßnahmen beizubehalten, die man unter Zeitdruck eingeführt hatte, um die Stadt vor Beginn des G-7-Gipfels zu säubern; das Verschwinden eines ehemaligen Ministers der Regionalregierung, gegen den wegen angeblicher Verbindungen zum organisierten Verbrechen ermittelt wurde.
Die morgendliche Rushhour war längst vorbei und der Zug fast leer. Hauptsächlich Studenten waren unterwegs und einige ältere Damen, die zu den Einkaufsstraßen um die Via Toledo wollten. Theoretisch hätte Zen seit mindestens anderthalb Stunden im Büro sein müssen, doch das schien ihn nicht im Geringsten zu kümmern. Wieder irrte seine Hand zur Jackentasche, als ob er etwas suchte. Es war jetzt zwei Wochen, drei Tage und zehn Stunden her, dass er seine letzte Zigarette geraucht hatte, aber alte Gewohnheiten sind hartnäckig. Das Verlangen nach Nikotin hatte sich erstaunlich schnell gelegt, aber bei bestimmten alltäglichen rituellen Handlungen – wie bei einer Tasse Kaffee oder wenn er die Zeitung las – merkte er, wie er nach der Geisterpackung Nazionali griff, deren verlockenden Ruf er immer noch leise zu hören glaubte.
Auf halber Strecke den Hang hinunter beschrieb die Bahn eine Schleife, um den entgegenkommenden Zug vorbeizulassen. Auf der mit Graffiti übersäten Betonwand des Tunnels konnte Zen in schwarzen krakeligen Buchstaben den Slogan Strade Pulite – »Saubere Straßen« – ausmachen. Das klang wie eine Anspielung auf die Maßnahmen gegen behördliche Korruption, die unter dem Motto »Saubere Hände« die politische Kaste, die Italien seit dem Krieg regiert hatte, zu Fall gebracht hatten. Aber es war schwer zu verstehen, wie das mit den »Sauberen Straßen« gehen sollte, besonders wenn man aus der Endstation der Funicolare in die schmutzigen, überfüllten und chaotischen Gassen des Stadtteils Tavoliere trat, wo das allmorgendliche Markttreiben in vollem Gange war.
Zen ging auf das grimmig wirkende, klobige Castel Nuovo zu, überquerte den breiten Boulevard, der am Meer entlangführte, und wartete an der gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle auf die nächste Bahn. Theoretisch hätte er mit dem Bus von zu Hause zum Hafen fahren können, mit einmal Umsteigen an der Piazza Municipio, aber angesichts der Unberechenbarkeit des öffentlichen Verkehrssystems der Stadt zog Zen es vor, die Funicolare und die Straßenbahn zu benutzen und den Rest zu Fuß zu gehen. Bushaltestellen in Neapel waren rein symbolische Einrichtungen, die ohne Vorwarnung verlegt werden konnten, was auch häufig geschah, und die ohnehin keine Garantie dafür boten, dass jemals ein Fahrzeug auftauchte. Aber wenn Gleise existierten, so musste doch, sagte sich Zen, früher oder später irgendwas kommen.
Außerdem hatte er keine Eile. Ganz im Gegenteil! Zum ersten Mal in seiner beruflichen Laufbahn war Aurelio Zen sein eigener Boss, soweit man das bei der Polizei überhaupt sein konnte. Wenn er zu spät kam oder früher ging oder überhaupt nicht auftauchte, konnte das nur auffallen, wenn ihn einer seiner Mitarbeiter verpetzte. Und er hatte alles darangesetzt, um sicherzugehen, dass es in ihrem eigenen Interesse war, dafür zu sorgen, dass das nie passierte.
Eine der ersten Auswirkungen von Zens Versetzung nach Neapel, sogar noch vor seiner Ankunft, war die hastige Beendigung diverser gewinnbringender und seit Langem bestehender Unternehmungen, die von der Polizeistation im Hafen getätigt wurden – sehr zum Leidwesen aller Beteiligten. Diese Entscheidung war auf einer Dringlichkeitssitzung widerwillig von Management und Mitarbeitern getroffen worden. Es war das erste Mal, soweit man sich erinnerte, dass jemand von außerhalb zum Chef des Hafenkommandos ernannt wurde. Und das nicht irgendwer, sondern ein ehemaliger Beamter der berühmten Criminalpol, die direkt dem Ministerium in Rom unterstellt war.
Dass ein solcher Überflieger zu einem niederen Routinejob in den Süden versetzt wurde, konnte nur eines bedeuten – darin waren sich alle einig. Eine Säuberung war angeordnet worden, und dieser Zen – der Name klang noch nicht mal italienisch – sollte sie mit schonungsloser Härte durchführen. Einzig merkwürdig bei der Sache war, weshalb man sich ausgerechnet ihre kleinen Betrügereien vorgenommen hatte, wo doch, wie allgemein bekannt war, sehr viel größerer und schwerwiegenderer Missbrauch getrieben wurde. Aber das war vielleicht genau der Punkt, hatte jemand zu bedenken gegeben. Die Leute im Ministerium wagten sich nicht an die großen Namen heran, mit denen sie zu eng verbunden waren und in deren Schuld sie standen, deshalb schickten sie, um den Anschein zu erwecken, überhaupt was zu tun, einen ihrer Vollstreckungsbeamten und ließen ihn in viertrangigen Aktivitäten herumrühren, in die sie nicht verstrickt waren.
Als Erstes hatte Zen seine neuen Kollegen davon überzeugen müssen, dass das nicht der Fall war. Das hatte sich als eine der schwierigsten Aufgaben erwiesen, vor der er je gestanden hatte. Nachdem er mehr als drei Wochen lang keinerlei Fortschritt erzielen konnte, entschloss er sich zu etwas für ihn völlig Untypischem, etwas, das so sehr seiner Natur widersprach, dass er bis zur letzten Minute mit sich rang, ob es denn auch wirklich ein weiser Schritt wäre. Schließlich machte er es nur, weil er keine andere Wahl hatte. Er beschloss, ihnen die Wahrheit zu sagen.
Da er wohl kaum zu diesem Zweck die ganze Truppe zusammenrufen konnte, wählte er bewusst den feindseligsten und renitentesten seiner Untergebenen aus, einen gewissen Giovan Battista Caputo. Caputo war ein drahtiger, energiegeladener Mann Anfang dreißig mit spitzem Gesicht, Hakennase, einem üppigen schwarzen Schnurrbart und einem Mund voller scharfer weißer Zähne, die er bis zum Zahnfleisch fletschte, wenn er eins seiner seltenen, leicht bedrohlich wirkenden Lächeln aufsetzte. Er sah aus, als ob er die Gene aller Völker, die jemals um den Golf herum ihre Blütezeit hatten, in sich vereinigen würde – etruskische Händler, griechische Siedler, römische Playboys, barbarische Piraten und spanische Imperialisten. Wenn er Caputo auf seine Seite ziehen könnte, sagte sich Zen, dann besäße er nicht nur den Schlüssel zu seinem neuen Arbeitsplatz, sondern zur ganzen Stadt.
»Sie fragen sich alle, was ich hier tue«, erklärte er lapidar, als Caputo in seinem Büro erschien.
»Das geht uns nichts an«, lautete die trotzige Antwort.
»Ich werds Ihnen trotzdem sagen. Setzen Sie sich.«
»Ich möchte lieber stehen.«
»Ist mir scheißegal, was Sie möchten. Ich befehle Ihnen, sich hinzusetzen.«
Caputo gehorchte steif.
»Die Antwort auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, ist sehr einfach«, fuhr Zen fort. »Ich habe selbst um diese Versetzung gebeten.«
Bei der Wirkung, die diese Worte auf Caputo hatten, hätte Zen genauso gut den Mund gehalten haben können.
»Sie glauben mir nicht«, bemerkte Zen.
»Das geht uns nichts an«, wiederholte Caputo stur.
»Und es ist völlig klar, warum Sie das nicht tun«, fuhr Zen unbeirrt fort. »Warum sollte sich jemand freiwillig aus der Hauptstadt auf einen Posten in einer Provinzstadt versetzen lassen, wo er keine Familie hat, keine Freunde, und auch den Dialekt nicht spricht? Und dann noch nicht mal zur Haupt-Questura, sondern auf eine aussichtslose Stelle beim Hafenkommando.«
Caputo sah Zen zum ersten Mal an, gab aber immer noch keinen Kommentar ab. Zen nahm ein Päckchen Nazionali heraus und bot seinem Untergebenen eine an. Dieser schüttelte den Kopf.
»Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz so einfach«, sagte Zen und stieß eine Rauchwolke aus. »Um ein klassisches Bild zu verwenden, ich musste mich zwischen Szylla und Charybdis entscheiden. Ich hatte mir Feinde im Ministerium gemacht, mächtige Feinde. Ich wusste, dass sie mich auf meiner bisherigen Stelle nicht weiterarbeiten lassen würden, und fürchtete, sie würden versuchen, mich strafzuversetzen. Meine einzige Chance lag darin, ihnen zuvorzukommen, indem ich selbst um eine Versetzung bat. Ich hab mir die Liste mit den freien Stellen angesehen und mich für diese hier entschieden. Den richtigen Rang hatte ich ja, um diese Abteilung zu leiten, und da es sich im Grunde um eine enorme Degradierung handelt, konnten meine Feinde nicht einschreiten, ohne sich selbst zu verraten. So habe ich die Niederlage zwar hinnehmen müssen, aber zu meinen Bedingungen, nicht zu ihren.«
»Wer sind Ihre Feinde?«, flüsterte Caputo, der jetzt ganz Ohr war.
»Politische.«
»Rechts oder links?«
Zen lächelte herablassend. »Das ist doch kein Thema mehr, Caputo. Heutzutage sind wir alle in der Mitte. Und meine Feinde stehen der Mitte ungefähr so nahe, wie das nur möglich ist. Zu dem Zeitpunkt, von dem ich rede, war einer von ihnen der Innenminister persönlich.«
Caputo bekam große Augen. »Sie meinen …?«
»Allerdings.«
Caputo leckte sich nervös die Lippen. »Ich glaub, ich möchte jetzt doch eine Zigarette«, sagte er.
Zen schob das Päckchen über den Schreibtisch. »Das ist die Erklärung, weshalb ich hier bin«, sagte er. »Und es erklärt auch mein absolutes Desinteresse an dem Job hier. Diese Versetzung habe ich mir erzwungenermaßen als kleinstes Übel ausgesucht, aber ich bin nicht im Mindesten engagiert und fühle mich in keiner Weise verantwortlich. Ich bin überzeugt, dass Sie und Ihre Kollegen absolut in der Lage sind, Ihre Aufgaben in angemessener Weise zu erfüllen, und mein einziger Wunsch ist es, Ihnen dabei freie Hand zu lassen, ohne jede Einmischung oder Kontrolle. Kurz gesagt, tun Sie einfach so, als wäre ich nicht da, und machen Sie so weiter wie bisher. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
Caputo fletschte grinsend seine Haifischzähne. »Ja, Sir.«
»Es geht mir lediglich darum, dass nichts passiert, was unerwünschte Aufmerksamkeit auf diese Dienststelle lenken und meinen Feinden einen Vorwand liefern könnte, mich auf die Schlachtfelder von Sizilien oder in irgendein gottverlassenes Nest in den Bergen zu versetzen. Ich bin überzeugt, dass ich mich auf Ihre Erfahrung und Diskretion verlassen kann, Caputo, damit so etwas nicht passiert. Was alles Übrige betrifft, das überlasse ich ganz Ihnen. Je weniger ich über die Dinge Bescheid weiß, umso lieber ist mir das.«
Caputo nickte forsch und stand auf. »Gibt es sonst noch was, Sir?«
Zen wollte schon den Kopf schütteln, da fiel ihm etwas ein. »Ich hätt ganz gern einen Cappuccino scuro. Nicht zu heiß, mit viel Schaum und ohne Kakao.«
Er lehnte sich zurück und sah auf die Uhr an der Wand. Es dauerte keine fünf Minuten, da klopfte es an der Tür, und ein uniformierter Polizist trat mit einem Tablett ein, auf dem ein Glas Mineralwasser, eine Auswahl an frischem Gebäck und der Cappuccino standen.
Von da an erschien jeden Morgen, zehn Minuten nachdem Zen gekommen war, ein solches Tablett in seinem Büro. Für eine Weile war das alles. Dann stand etwa drei Wochen nach seinem Gespräch mit Caputo eines Tages ein großer Karton in einer Ecke des Raumes. Er enthielt fünfzig Stangen Nazionali, also insgesamt 10 000 Zigaretten. Zen nahm drei Stangen mit nach Hause und verstaute den Rest in den leeren Schubladen seines Aktenschrankes.
Danach änderten sich die Dinge schlagartig. Er wurde von allen respektvoll, aber freundlich gegrüßt, und seine Bitten und Befehle wurden eiligst ausgeführt, manchmal noch bevor ihm richtig bewusst war, dass er sie überhaupt ausgesprochen hatte. Normalerweise erschien er jeden Morgen gegen elf, falls er nichts Besseres vorhatte, und ging kurz vor dem Mittagessen wieder. Heute hatte er jedoch Valeria zu sich nach Hause eingeladen, deshalb wollte er nur pro forma im Büro erscheinen, um dann auf den Markt zu gehen und nach Lust und Laune einzukaufen.
Autos, Lieferwagen und Lkws bewegten sich träge auf der abgeteilten Spur, die eigentlich für die Straßenbahn reserviert war, in der Praxis aber von allen als Ausweichstrecke für die verstopfte Via Cristoforo Colombo benutzt wurde. Ab und an starteten die städtischen vigili einen Überraschungsangriff und fingen an, Strafzettel zu verteilen. Doch solche Aktionen fanden nur sporadisch statt und waren rein symbolisch, sozusagen das Säbelrasseln einer Kolonialmacht, die wusste, dass sie den Kampf gegen die einheimische Bevölkerung nicht gewinnen konnte, dies aber nicht offen zugeben wollte.
Auf einer Seite des Passagierterminals am Dock hinter Zen hatte die weiße Terrenia-Fähre, die am Morgen aus Sardinien gekommen war, festgemacht. Auf der anderen lag ein schnittiges graues Kriegsschiff, das eine Flagge führte, die ihm bekannt vorkam, die er aber nicht einordnen konnte. Weiter hinten, an einem der Außendocks, prangte auf einem riesigen Flugzeugträger unverkennbar die Fahne der Vereinigten Staaten.
Ein gedämpftes Sirren der eingelassenen Schienen kündigte die Ankunft einer leicht antiquierten Straßenbahn an, die schwankend aus dem Tunnel unter dem Monte di Dio gerumpelt kam. Zen faltete seine Zeitung zusammen und wartete geduldig, bis sich die Bahn mit traurigem Geklingel durch den dichten Verkehr zur Haltestelle gequält hatte. Zehn Minuten später stieg er an der Piazza del Camino vor einem der Haupteingänge zum Hafen aus. Er ging durch das offene Tor und nickte flüchtig einem der bewaffneten Wachposten zu, der einen Salut andeutete.
Zen überquerte den asphaltierten Innenhof und ging dann nach rechts auf das vierstöckige Gebäude zu, das die Abteilung der Polizia dello Stato beherbergte. Deren Aufgabe war es, dem Gesetz im Bereich des Hafens Geltung zu verschaffen. Der größte Teil dieser Enklave war ebenso wie der angrenzende Teil des Stadtzentrums während des Krieges von alliierten und deutschen Bombenangriffen dem Erdboden gleichgemacht worden, nur das Polizeirevier war wundersamerweise verschont geblieben. Dank seiner maßvollen Proportionen, der stabilen Bauweise und der traditionellen Materialien stach es unter den architektonischen Monstrositäten, die es umgaben, als ein Musterbild von Anmut und Charme einer längst vergangenen Zeit hervor.
Die Größe des Gebäudes stand im Widerspruch zur bescheidenen Zahl der dort beschäftigten Personen, da es zu einer Zeit errichtet worden war, als der Hafen sehr viel mehr Bedeutung hatte als heute, wo sich nach endlosen Arbeitskämpfen ein großer Teil des Betriebs weiter südlich nach Salerno verlagert hatte. Parterre und erste Etage waren die einzigen Stockwerke, die offiziell in Gebrauch waren. Die zweite Etage wurde lediglich als Abladeplatz für verstaubte Akten und kaputte Möbel benutzt. Das oberste Stockwerk wirkte um diese Tageszeit ebenso ausgestorben, doch sobald die Nacht hereinbrach, wurde es zu einer der lebhaftesten Lokalitäten der ganzen Gegend. Dann wimmelte es dort von Seeleuten, die aus irgendeinem Grund keinen Passierschein hatten, der ihnen erlaubte, die Hafenenklave zu verlassen. Doch Zen bemühte sich wohlweislich, nichts davon mitzubekommen, auch nichts darüber zu wissen, wie die Prostituierten, die dort arbeiteten, an den Wachen am Tor vorbeikamen, und schon gar nichts über die Schmuggelware und die illegalen Substanzen, die angeblich ebenfalls in diesen Räumen den Besitzer wechselten.
Er ging durch die offene Tür, erwiderte den Gruß von drei uniformierten Männern, die lässig in der Eingangshalle herumstanden, und stieg die Treppe zu seinem Büro im ersten Stock hinauf. Das Trio unterbrach diskret seine Unterhaltung, bis er den Treppenabsatz erreicht hatte, und nahm sie dann in gedämpftem Tonfall wieder auf. Das Gemurmel erfüllte das kühle, schattige Treppenhaus wie das leise Summen von Bienen.
Beide spielen ihre Rolle gut
Er war noch nicht ganz eine Minute in seinem Büro, da klopfte es an der Tür.
»Herein!«, rief Zen überrascht und zugleich erfreut, dass sein Cappuccino heute so schnell kam.
Doch in der Tür erschien Giovan Battista Caputo. Er wirkte ungewöhnlich gedämpft. »Entschuldigen Sie die Störung, Chef. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen?«
Zen winkte ihn mit einer matten Handbewegung herein.
»Letzte Nacht gabs Ärger«, verkündete Caputo, während er hereinkam und die Tür schloss.
»Mmm?«
»Wir haben zurzeit ein paar Kriegsschiffe hier liegen, einen amerikanischen Flugzeugträger und eine griechische Fregatte. Einige Seeleute von dem Flugzeugträger waren gestern Abend in dieser Bar am Passagierterminal.«
Zen nickte. Er hatte dieses Lokal vor ein paar Wochen besucht, als Caputo ihn kurz durch den Dockbereich geführt hatte, damit es so aussah, als würde Zen in seinen neuen Job eingearbeitet. Die fragliche Bar, so hatte man ihm zu verstehen gegeben, wurde von dem gleichen Konsortium betrieben, das auch für die diversen Phantomgeschäfte verantwortlich war, die im Obergeschoss des Polizeigebäudes abliefen. Und außerdem lieferte die Bar eine absolut legale Fassade, um potenzielle Kunden abchecken zu können, bevor man ihnen Einlass ins Allerheiligste gewährte. Es war nur ein winziges Lokal, dem es aber trotzdem gelang, der absolut tristen Stazione Marittima ein bisschen Leben und Farbe zu geben.
Das Bemerkenswerteste an dem Laden war eine große Neonreklame im Fenster, auf der in Englisch stand: Mix Drinks. Laut Caputos Bericht über den Zwischenfall in der vergangenen Nacht hatte eine Gruppe amerikanischer Seeleute diese Aufforderung offenbar wörtlich genommen und eine unglaubliche Menge und Vielfalt an Weinen, Bieren, Schnäpsen und Likören in sich hineingeschüttet, bevor sie schließlich aufbrachen, um die Stadt zu erkunden. Alles ging gut, bis sie auf eine andere Gruppe Seeleute stießen, die gerade zu der griechischen Fregatte zurückkehrten.
»Einer der Amerikaner kommt aus einer griechischen Familie«, erklärte Caputo, »und versuchte, mit ihnen zu reden. Aber anscheinend ist sein Griechisch nicht mehr so gut, oder vielleicht war er auch nur zu betrunken. Jedenfalls, was auch immer er gesagt haben mag, für die Griechen klang es wie eine Beleidigung. Es kam zu einer Schlägerei, bei der die Griechen den Kürzeren zogen.«
»Mmm«, wiederholte Zen und betrachtete seine Fingernägel.
»Als die Griechen zu ihrem Schiff zurückkamen und sich herumsprach, was passiert war, machten sich ein paar von ihnen auf, um Rache zu nehmen. Sie stießen auf einen Mann in amerikanischer Uniform und fingen an, ihn herumzuschubsen. Noch bevor sie wussten, wie ihnen geschah, hatte er ein Messer gezogen und zwei von ihnen niedergestochen. Einer unserer Männer kam gerade aus der Bar, wo er Aussagen über den ersten Zwischenfall aufgenommen hatte, und nahm den Angreifer sofort fest.«
Zen gähnte ausgiebig. »Also wirklich, Caputo, ich glaube kaum, dass Sie mich wegen einer solchen Sache belästigen müssen.«
»Hätte ich auch nicht, Sir, wenn nicht Folgendes passiert wär. Wir haben die Amerikaner informiert, dass ein Mitglied ihrer Besatzung verhaftet wurde, und sie haben zwei Offiziere vorbeigeschickt, um ihn zu identifizieren. Und nun wird die Sache heikel. Es stellte sich nämlich heraus, dass dieser Mann, den wir verhaftet haben, keiner von ihren Leuten ist.«
Ein Achselzucken von Zen. »Na und?«
Caputo seufzte. »Hören Sie, Chef, Sie haben doch deutlich zu verstehen gegeben, dass Sie nicht wollen, dass hier was passiert, was Sie kompromittieren und Ihren Feinden in Rom einen Vorwand liefern könnte, Ihnen zu schaden, oder etwa nicht?«
»Mmm?«
»Diese Sache scheint sich zu genau so etwas zu entwickeln, fürchte ich. Einer der griechischen Seeleute wurde schwer verletzt und befindet sich immer noch in kritischem Zustand. Der griechische Konsul hat offiziell Beschwerde eingelegt, und die Amerikaner sind nicht allzu glücklich darüber, dass wir jemanden, der sich als ein Mitglied ihrer Besatzung ausgab, in einen angeblich abgesicherten Bereich gelassen haben. Ich hab heute Morgen schon dreimal den Questore am Telefon beschwichtigen müssen …«
»Verdammt! Was haben Sie ihm erzählt?«
»Ich hab gesagt, Sie wären unterwegs, um persönlich weitere Nachforschungen anzustellen. Aber er klang nicht sehr erfreut. Ich glaube, Sie sollten ihn so bald wie möglich zurückrufen.«
»Ich weiß noch nicht mal seine Nummer.«
Caputo sagte sie ihm. Zen nahm den Hörer ab.
»Bleiben Sie hier«, bat er Caputo, der sich diskret zurückziehen wollte. »Ich brauch vielleicht Unterstützung.«
Obwohl er angeblich unbedingt mit Zen über den Fall reden wollte, ließ der Polizeichef der Provincia di Napoli ihn über zehn Minuten warten, bevor er mit ihm zu sprechen geruhte. Doch als er es schließlich tat, wurde Zen unmissverständlich klar, dass Caputo den Ernst und die Dringlichkeit der Situation bestimmt nicht übertrieben hatte.
»Soweit ich weiß, sind Sie neu hier in der Stadt«, bemerkte der Questore mit einer sanften, ruhigen Stimme, die wirkungsvoller war als jeder laute Versuch der Einschüchterung. »Das ziehen wir natürlich in Betracht. Ich weiß noch, dass ich mich damals gefragt habe, ob es eine weise Entscheidung war, diesen Posten mit Ihnen zu besetzen. Neapel ist eine einzigartige Stadt, die ein Außenstehender in vieler Hinsicht nur schwer oder überhaupt nicht verstehen kann.«
Zen hielt den Hörer fest umklammert und wünschte, er hätte nicht aufgehört zu rauchen.
»Doch dann hab ich mir gesagt, dass es ja schließlich nur darum geht, den Hafenbereich zu kontrollieren, eine relativ einfache und routinemäßige Aufgabe. Ich nahm an, dass ein Mann mit Ihrer angeblichen Erfahrung sehr wohl dazu in der Lage sein müsste, selbst wenn man Ihre mangelnde Kenntnis der Stadt in Betracht zieht. Aber schon wenige Monate nach Ihrer Ankunft bahnt sich nun ein größerer internationaler Zwischenfall an mit allem, was dazugehört. Die Leute müssen ja meinen, sie hätten es hier mit irgendeinem Drecksnest in der Dritten Welt zu tun, wo sich Banden betrunkener Seeleute und einheimischer Schlägertypen Messerstechereien am Kai liefern. Wir haben viel Zeit und Geld dafür verwendet, das Image von Neapel in der Welt zu verbessern, und unsere Bemühungen sind mit der G-7-Konferenz belohnt worden. Jetzt drohen Sie mit Ihrer Nachlässigkeit und Unfähigkeit diese ganze Arbeit wieder zunichtezumachen!«
»Meine Männer können unmöglich überall zugleich sein«, wandte Zen mit matter Stimme ein.
»Diese Schlägerei hat noch keine 15 Meter vom Hauptpassagierterminal stattgefunden«, sagte der Questore. »Wenn Sie nicht mal diesen Bereich ordentlich überwachen lassen können, was können Sie denn dann? Wie dem auch sei, jetzt ist es ohnehin zu spät. Jetzt geht es darum, diese Ermittlungen in kürzester Zeit zu einem angemessenen Abschluss zu bringen, der alle betroffenen Parteien zufriedenstellt und beruhigt. Ich brauche Sie doch wohl nicht daran zu erinnern, dass es sich dabei um zwei unserer wichtigsten NATO-Partner handelt. Was für Fortschritte haben Sie gemacht?«
»Was für Fortschritte wir gemacht haben?«
Zen sah verzweifelt zu Caputo.
»Nun ja, das für die Tat verantwortliche Individuum …«
Caputo hob die Arme und überkreuzte sie an den Handgelenken.
»… ist in Haft.«
Caputo fuhr mit einem Finger über seine geschlossenen Lippen, als ob er an einem Reißverschluss zöge.
»… aber hat sich bis jetzt geweigert zu reden.«
Jetzt lief Caputo im Zimmer hin und her, beschattete mit einer Hand seine Augen und blickte nach allen Seiten.
»Meine Männer sehen sich gründlich am Schauplatz des Verbrechens um …«, fuhr Zen fort.
Nun tat Caputo so, als ob er etwas auf seine linke Hand schriebe.
»… und nehmen die Aussagen von Zeugen auf.«
»Was für Anhaltspunkte haben Sie?«
»Was für Anhaltspunkte wir haben?«
»Müssen Sie denn alles wiederholen, was ich sage? Ja, Anhaltspunkte! Theorien, Ideen, Vermutungen. Irgendetwas, was auch nur ein winziges Licht auf diesen Zwischenfall werfen und was ich dem Präfekten mitteilen könnte, damit er es nach Rom weiterleitet.«
Caputo stellte sich vor den Schreibtisch, hob einen Arm und streckte drei Finger in die Luft.
»Zurzeit verfolgen wir drei Theorien«, antwortete Zen gelassen. »Erstens, dass der Täter …«
Er sah zu Caputo, der o-beinig durch das Zimmer watschelte, die Hände wie Klauen in die Hüften gestützt.
»… ein Cowboy ist«, folgerte Zen.
»Ein was?«
Caputo schüttelte vehement den Kopf. Zen deckte die Sprechmuschel zu.
»Amerikaner!«, zischte Caputo.
»… dass er Amerikaner ist«, erklärte Zen dem Questore.
»Aber die Marinebehörde der Vereinigten Staaten hat doch ausdrücklich erklärt, dass der Mann nicht zu ihnen gehört!«
»Genau!«, entgegnete Zen. »Nach dieser Theorie ist der Verdächtige ein Undercover-Agent der CIA, der den Auftrag hatte, einen der griechischen Seeleute umzubringen, und zwar den Sohn eines einflussreichen kommunistischen Politikers.«
Er sah triumphierend zu Caputo, der begeistert die Daumen in die Luft streckte.