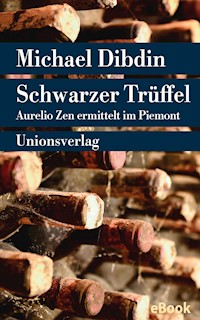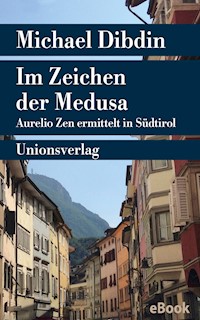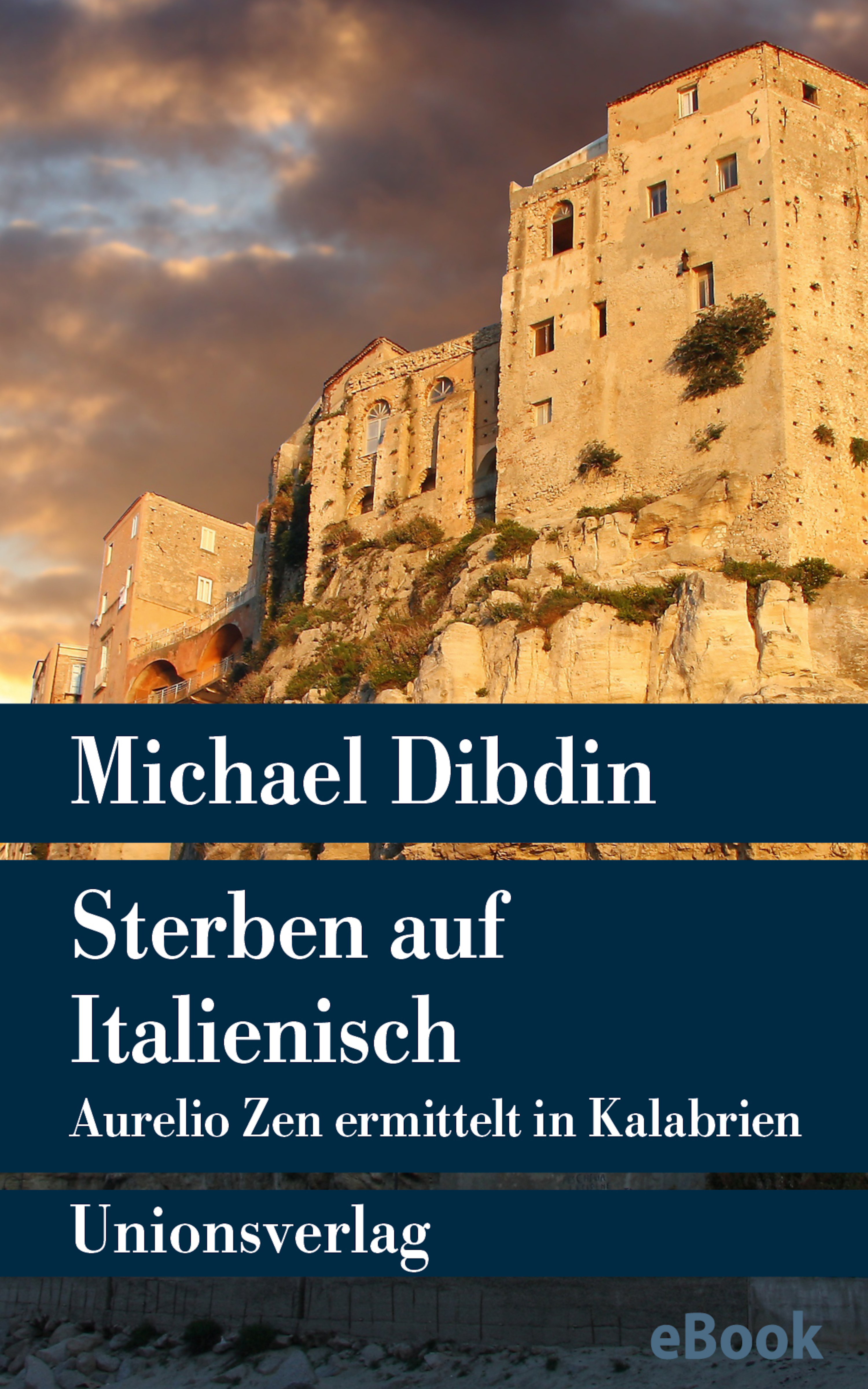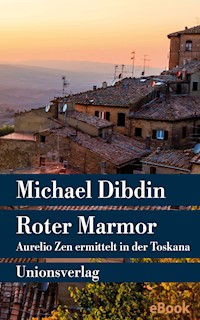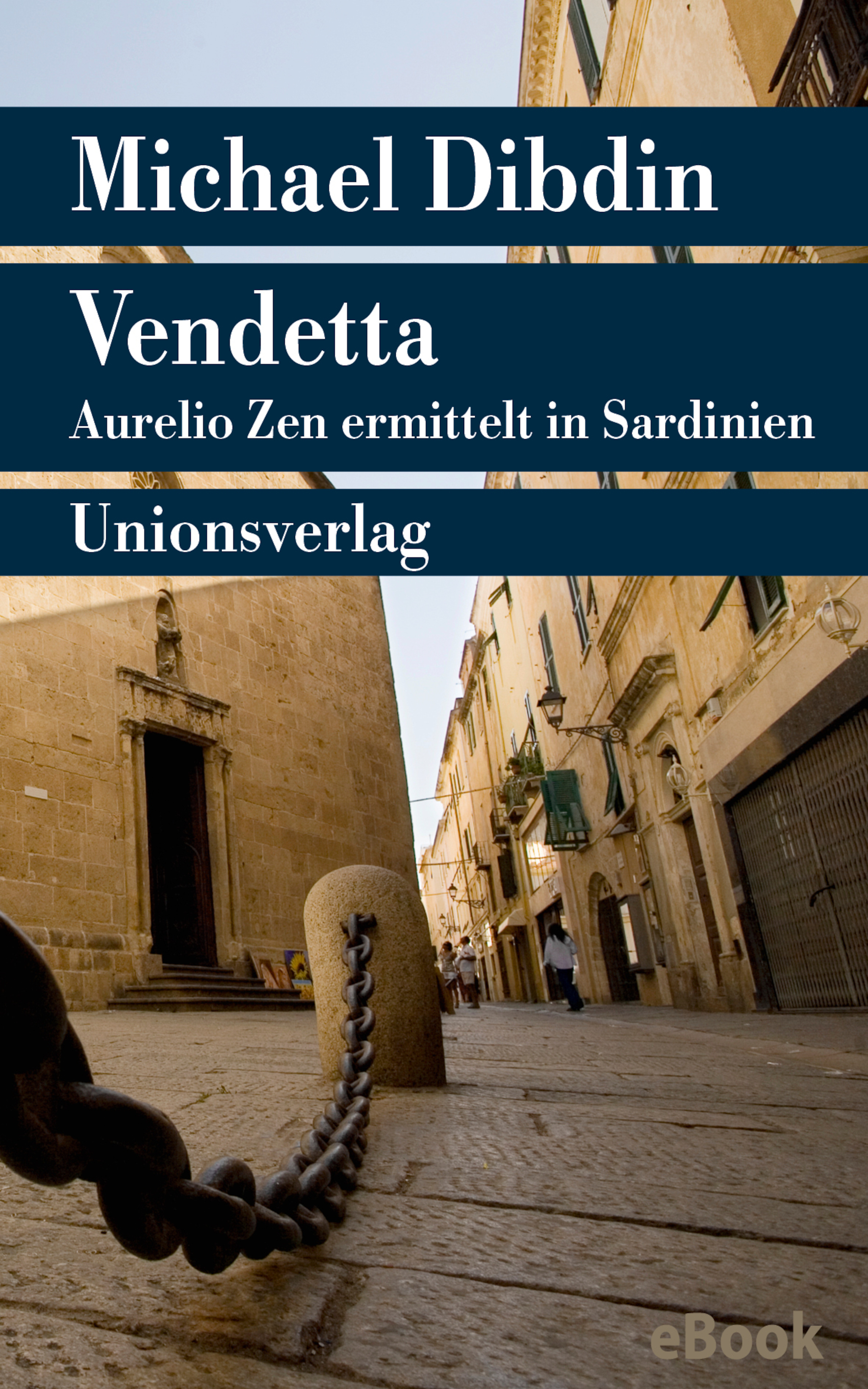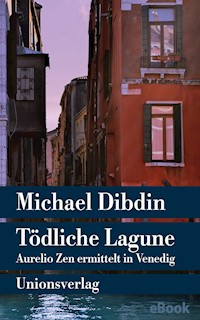
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spezialauftrag für Aurelio Zen: In seiner Geburtsstadt Venedig soll er das Verschwinden eines dort ansässigen reichen Amerikaners untersuchen. Der Kommissar taucht in die geheimnisvolle Stadt seiner Vergangenheit ein und erliegt aufs Neue ihrem morbiden Zauber. Als in der Nähe der Laguneninsel, die dem Amerikaner gehörte, das Skelett einer Leiche gefunden wird, glaubt Aurelio Zen, Zusammmenhänge zu erkennen. Aber im dunstigen Licht Venedigs zeigen die Dinge erst auf den zweiten Blick ihr wahres Gesicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
In seiner Geburtsstadt Venedig soll Kommissar Aurelio Zen das Verschwinden eines dort ansässigen Amerikaners untersuchen. In der Nähe der Laguneninsel, die dem Amerikaner gehörte, wird ein Skelett gefunden und Zen glaubt, Zusammenhänge zu erkennen. Aber im dunstigen Licht Venedigs zeigen die Dinge erst auf den zweiten Blick ihr wahres Gesicht.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Michael Dibdin (1947–2007) studierte englische Literatur in England und Kanada. Vier Jahre lehrte er an der Universität von Perugia. Bekannt wurde er durch seine Figur Aurelio Zen, einen in Italien ermittelnden Polizeikommissar.
Zur Webseite von Michael Dibdin.
Ellen Schlootz arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie hat u. a. Werke von Ian Rankin und David Hosp ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Ellen Schlootz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Michael Dibdin
Tödliche Lagune
Aurelio Zen ermittelt in Venedig
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ellen Schlootz
Aurelio Zen ermittelt (4)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel Dead Lagoon im Verlag Faber and Faber, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 im Goldmann Verlag.
Originaltitel: Dead Lagoon (1994)
© by Michael Dibdin 1994
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Serhii Zhukovskyi
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30893-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 13.06.2022, 13:10h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TÖDLICHE LAGUNE
Gänse flogen in einer gezackten Reihe auf das …Mehr über dieses Buch
Über Michael Dibdin
Über Ellen Schlootz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Michael Dibdin
Zum Thema Italien
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Für meine Tochter Emma
Gänse flogen in einer gezackten Reihe auf das offene Meer hinaus. Sie waren nur als Silhouette gegen die hohen Zirruswolken erkennbar. In Richtung Marghera tauchte die Sonne in eine dichte Smogschicht, die die gestreiften Schornsteine der Raffinerien klein erscheinen ließ. Giacomo fiel auf, dass sich die fasrigen Wolkenschichten am Himmel ausbreiteten wie das Kielwasser eines Motorboots. Das Wetter änderte sich. Morgen würde es stürmisch und kalt sein, eine scharfe Bora aus Nordost würde das Meer an der Lagune aufwühlen.
Aber morgen war ein anderer Tag. Im Augenblick regte sich kein Lüftchen, und das Wasser war glatt wie Öl. Das einzige Geräusch war das Knarren der Riemen in den Dollen und das leise Plätschern der Blätter. Die Leute hielten Giacomo für ein bisschen seltsam, weil er noch mit dem Ruderboot hinausfuhr, um seine Netze auszuwerfen. Außer ein paar Yuppies aus den Clubs in der Stadt ruderte niemand mehr. Doch Giacomo hatte kein Interesse daran, die malerischen Traditionen der Vergangenheit Wiederaufleben zu lassen. Wenn er Riemen einem Außenbordmotor vorzog, hatte er seine Gründe dafür. An einem Abend wie diesem wäre ein Motorengeräusch meilenweit auf dem Wasser zu hören, und Giacomo wollte nicht, dass neugierige Ohren seinen Weg zwischen den Sandbänken und in der Nähe der zahlreichen Buchten bis zu seinem Ziel verfolgten.
Wachsam ließ er den Blick über das Wasser vor ihm schweifen. Die Fahrrinne, der er folgte, war nicht gekennzeichnet, und die Ebbe kam ziemlich schnell. Es wäre besser gewesen, zu einem anderen Zeitpunkt zu fahren, aber Giacomo führte nur die Befehle aus, die er telefonisch erhielt. Morgen, hatte die Stimme gesagt, also hieß das morgen. Außerdem würde er gut für die Strapazen bezahlt. Doch zunächst einmal brauchte er sein ganzes Geschick. Das flache Ruderboot hatte zwar nur einige Zentimeter Tiefgang, doch in diesem trügerischen toten Gewässer konnte man dennoch leicht auf Grund laufen.
Er hob den Kopf und hielt nach dem langen flachen, üppig grünen Riff Ausschau, auf das er sich ungeheuer langsam zubewegte. Im Osten gingen die trostlosen Sümpfe und die Salztonebene der Laguna Morta – dem toten Marschland, das nicht mehr von Ebbe und Flut erreicht wird – nahtlos in die dichter werdende Dunkelheit über. Die Lehrerin auf Burano hatte gesagt, hier sei einst eine prächtige Stadt gewesen mit schönen Palästen, Kirchen und gepflasterten Straßen, doch das sei alles vor Hunderten von Jahren verschlungen worden, weil sich die Lagune verlagert habe.
Giacomo hörte auf zu rudern und richtete sich im Heck des Bootes auf, um sich eine Zigarette anzuzünden. Die Lehrerin war eine gute Seele und bezahlte immer einiges mehr für die Muscheln und Krebse, aber sie hatte das Pech, dass sie auf dem Festland geboren war. Und wie jeder weiß, glauben Leute vom Festland einfach alles. Giacomo stieß eine dicke Rauchwolke aus, die träge über das Wasser auf die wilden Gräser zutrieb, die von der nahen Schlammbank herabhingen. Das dumpfe Dröhnen eines Flugzeugs, das auf dem internationalen Flughafen in Tessera startete, erinnerte ihn an seinen Auftrag. Er tauchte die gekreuzten Riemen erneut ins Wasser, stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht nach vorn und drückte das Sandalo durch das seichte Wasser.
Als Giacomo das Boot auf den flachen Strand laufen ließ, den die zurückgehende Flut freigelegt hatte, war es schon ziemlich dunkel. Er stieg aus und zog das Boot ganz aus dem Wasser. Dabei sank er mit seinen Watstiefeln tief in den Matsch. Über die niedrige Mauer vor ihm, die die Insel umgrenzte, wucherten Unmengen von Kletterpflanzen und Dornengestrüpp, wild wachsende Sträucher und verkümmerte Bäume. In der Mitte führten einige Stufen zu einem zugemauerten Torbogen. Giacomo warf sich eine blaue Segeltuchtasche über die Schulter und ging platschend durch den Morast auf einen Abschnitt der Mauer zu, der völlig von dem üppigen Grün überwuchert war.
Unter dem dichten Gestrüpp war es bereits Nacht. Giacomo nahm eine wasserdichte Taschenlampe aus seiner Tasche und leuchtete die Umgegend ab. Eine Ratte sprang aus einem Loch in der Mauer in das seichte Wasser am Boden. Wo jetzt das Loch war, waren zwei von den flachen ockerfarbenen Steinen aus der dreihundert Jahre alten Mauer herausgebrochen worden. Giacomo konnte sich gut daran erinnern, wie mühsam das gewesen war und dass er fast zwanzig Minuten mit einem Holzhammer auf ein Stemmeisen geschlagen hatte. Damals hatte man für die Ewigkeit gebaut, selbst für Kunden wie diese hier. Weiter oben waren noch mehr Steine herausgemeißelt worden. In diesen Löchern fand Giacomo Halt, als er auf die Mauer kletterte. Er setzte sich darauf. Alles war ruhig. Selbst am helllichten Tag machten die Leute einen weiten Bogen um diese Insel. Und nichts könnte jemanden, der bei klarem Verstand war, nach Einbruch der Dunkelheit dazu bewegen, sich dorthin zu wagen.
Auf der anderen Seite stieg das Gelände deutlich an, fast bis auf eine Höhe mit der Mauer. Giacomo arbeitete sich durch das Gestrüpp. Dabei orientierte er sich an verschiedenen unauffälligen Markierungen, den zerrissenen Fasern eines Zweigs, der an einem Strauch hing, an platt getretenem Gras, der Ranke eines Dornenbuschs, so dick wie der Fangarm eines Tintenfischs, der sauber mit dem Weidemesser eines Fischers abgehackt worden war. Der Boden war glitschig, und die Schritte verursachten ein knirschendes Geräusch, als würde Giacomo über Porzellanscherben laufen.
Ein plötzliches Rascheln ließ ihn stillstehen. Gleichzeitig schwenkte er den Lichtstrahl seiner Taschenlampe wie einen Stab. Auf der Insel wimmelte es von Schlangen, und Giacomo versuchte sich mit mäßigem Erfolg einzureden, dass dies das einzige war, was ihm an diesem Ort angst machte. Er zündete sich noch eine Zigarette an, um seine Nerven zu beruhigen, und kämpfte sich weiter durch das dornige Dickicht, über den knirschenden, rutschigen Boden, bis er die letzte Markierung entdeckt hatte, einen vertrockneten Ast, der quer über einem Dornenbusch lag, als ob er von dem abgestorbenen Baum darüber heruntergefallen wäre. Ein verdrehter Zweig zeigte auf ihn, markierte also den Rückweg. Ein weiterer Zweig, der wie eine Hand gegabelt war, ragte schräg an einer Seite heraus. Als Giacomo diesem Hinweis folgte, entdeckte er rasch den Scherbenhaufen, der weiß im Schein der Taschenlampe schimmerte. Im selben Moment hörte er wieder das Rascheln.
Erst als er die Tasche von der Schulter nahm, fiel ihm ein, dass er den kleinen Spaten vergessen hatte, den er normalerweise mitnahm. Deshalb würde er ganz bestimmt nicht umkehren, soviel war klar. Allerdings hatte er auch nicht die Absicht, das Zeug mit den Händen anzufassen. Er warf seine Zigarette weg, brach ein Stück von dem vertrockneten Ast ab und begann, heftig in dem Haufen herumzustochern, löste hier einen langen Oberschenkelknochen, dort ein sanft schimmerndes Schulterblatt, einen runden Schädel, einen breiten Hüftknochen und ein Becken. Endlich tauchte die matt glänzende Wachstuchhülle auf.
Der Stock brach ab, und Giacomo verdoppelte seine Bemühungen. Hastig riss er ein weiteres Stück von dem Ast ab, und als das ebenfalls durchbrach, legte er das Paket mit Hilfe seiner Stiefel frei. Heftig atmend entfernte er das Wachstuch, und es kamen drei in Silberfolie verpackte und in Plastik eingeschweißte Blöcke zum Vorschein. Sie hatten ungefähr die Größe und die Form eines Schwimmkorks, waren aber viel schwerer – genau ein Kilo wog jeder Block. Behutsam nahm sich Giacomo ein Stück nach dem anderen und steckte sie in die Segeltuchtasche. Dann legte er das Wachstuch darauf und zog die Tasche zu, bevor er sich auf den Rückweg machte.
Der Strahl der Taschenlampe durchdrang flackernd die Dunkelheit auf der Suche nach dem knorrigen Ast, der zeigte, wo es nach Hause ging. Er war nirgends zu sehen.
Mit wachsender Verzweiflung suchte Giacomo das Dickicht ab, bis er schließlich den abgebrochenen Ast entdeckte, der sich in den Dornen verheddert hatte. Er musste heruntergerutscht sein, als sich Giacomo einen Zweig abgebrochen hatte, um ihn als Spaten zu benutzen. Einen Moment lang wäre er fast in Panik geraten. Dann riss er sich zusammen und untersuchte die Sträucher in der Umgebung. Er musste in diese Richtung, ganz bestimmt, rechts an dem niedrigen schiefen Busch vorbei. Ja, das wars. Er erkannte es wieder.
Nach ein paar Metern endete der Pfad – falls es überhaupt einer gewesen war – in einer Masse von Dornbüschen, doppelt so hoch wie er selbst. Er musste sich geirrt haben. Giacomo ging zurück, konnte aber die Lichtung nicht mehr finden, auf der die Pakete versteckt gewesen waren. Dann sah er etwas, das er für eine der Markierungen hielt, die ihn zum Boot zurückführen sollten, und stürzte sich förmlich darauf. Er tauchte durch die Sträucher wie ein Schnellboot durch die Wellen und zerrte an den Büschen, bis er sich hoffnungslos in ihren dornigen Ranken verfangen hatte und in dem undurchdringlichen Dickicht nicht mehr weiterkam.
Instinktiv sah er zum Himmel, doch der dunstige Wolkenschleier, der von Osten herangetrieben worden war, hatte die Sterne verschluckt. Der wilde Dschungel, der sich an Hunderttausenden von menschlichen Skeletten gemästet hatte, bedrängte ihn von allen Seiten und schloss die übrige Welt aus.
Giacomo murmelte inbrünstig ein Gebet. Das hatte er zum letzten Mal getan, als ein ungünstiger Wind und die Ebbe ihn und Filippo an der Küste hinter der nördlichen Mole an der Einfahrt zum Porto di Lido festgehalten hatten. Damals hatte es funktioniert, aber er war nicht so zuversichtlich, ob sich sein Schutzpatron auch diesmal für ihn einsetzen würde. Fischen war eine Sache, seine augenblickliche Mission eine ganz andere. Dennoch half ihm das Gebet, seine Panik zu dämpfen. Er befreite sich aus dem Gestrüpp und arbeitete sich auf der Suche nach einer der Wegmarkierungen durch das Unterholz. Dabei versuchte er nicht daran zu denken, was er unter seinen Stiefeln zermalmte.
Als ein Mann in Weiß ihm den Weg versperrte, spürte Giacomo eine momentane Erleichterung. Er war nicht mehr allein. Dann fiel ihm ein, wo er sich befand, und das Grauen schnürte ihm die Kehle zu, und er musste würgen. Er zwang sich, noch einmal hinzusehen. Die Gestalt war immer noch da. Sie lag ausgestreckt über dem dichten Dornengestrüpp, und der Stoff des Jacketts hob und senkte sich, als würde er vom Wind bewegt. Aber es wehte kein Wind. Dann sah er das Gesicht, beziehungsweise das, was davon übrig war, und die Ratten, die durch die Ärmel ein und aus spazierten. Er registrierte alles mit einem Blick – die halb aufgefressene Masse von Fleisch und Gewebe, den blutigen Brustkorb, den zerfetzten weißen Anzug –, ließ die Tasche fallen und stürmte in Panik und abergläubischer Furcht los. Über die Düne aus menschlichen Knochen stolpernd, brach er durch die dichte Vegetation, die sich wie ein Parasit von diesem üppigen Mahl ernährte, und rannte um sein Leben über die Insel der Toten.
Auf dem Weg vom Bäcker nach Hause kauft sie noch etwas Salat und Obst. Es nieselt immer noch, das Pflaster ist mit einer schmierigen Schicht bedeckt, und pockennarbige Muster zeichnen sich auf dem Wasser ab. Unter einer grünen Markise, die behelfsmäßig zwischen den beiden Masten der Barkasse aufgespannt ist, kauern Sebastiano und sein Sohn über ihrer Ware.
»Contessa! Sehen Sie sich diesen Fenchel an! Frisch aus SantʼErasmo.«
Auch wenn sie weiß, dass er ihr bloß was verkaufen will, fühlt sich Ada dennoch geschmeichelt, weil er sie ohne jede Spur von Ironie oder Unterwürfigkeit mit ›Contessa‹ anredete, wie die Leute es getan hatten, als Titel noch etwas Alltägliches waren und zu gewissen Menschen gehörten wie die Augen- oder Haarfarbe. Deshalb nimmt sie neben Salat, Äpfel und Trauben auch ein paar Knollen von dem überteuerten Fenchel. Während Sebastiano das Obst abwiegt, entdeckt Ada auf der anderen Seite des Kanals eine Gestalt mit wehendem Umhang, die sie mit anzüglich idiotischem Grinsen fixiert.
»Was ist los?«, fragt Sebastiano und schaut von den Holzkisten auf, in denen sich Kartoffeln, Zitronen und Tomaten befinden. Er folgt ihrem starren Blick. In der gegenüberliegenden Gasse ist nichts zu sehen außer einem Baugerüst, dessen Schutzplane im starken Ostwind flattert.
»Ist alles in Ordnung?«, fragt er mit kaum verhüllter Sorge.
Ein Flusskahn mit Plastiksäcken voller Sand und Zement kommt den Kanal hinauf. Auf dem provisorischen Vorderdeck sind eine verbeulte Schubkarre und eine Betonmischmaschine, die auf der Seite liegt, zu sehen. Die fahren wohl zum Pagan-Haus, wie Ada es immer noch nennt, obwohl Maria Pagan schon seit mindestens einem Jahr tot ist. Jetzt hat ein Ausländer das Haus gekauft und gibt ein Vermögen für seine Renovierung aus …
»Bring Contessa Zulian ihre Einkäufe nach Hause«, bellt Sebastiano seinen Sohn an, einen schlaksigen Jungen, der eine Jacke mit der Aufschrift Washington Redskins trägt und seine Baseballkappe mit dem Schild nach hinten aufgesetzt hat. In seinem Ohrläppchen schimmert ein goldener Ohrring. Der Junge verzieht das Gesicht und murmelt etwas vor sich hin. Sebastiano antwortet mit einem gutturalen Laut. Die Wellen von dem vorbeifahrenden Flusskahn klatschen gegen die abgefahrenen Reifen, die als Fender dienen, und zerren an den Tauen der Barkasse, so dass Vater und Sohn ins Schwanken geraten. Ada Zulian erinnert sich, dass sie vor vielen Jahren ein Auto gesehen hat, als ihre Eltern mit ihr zum Lido gefahren waren. Mit einer Handbewegung lehnt sie die angebotene Hilfe ab, erklärt Sebastiano, sie würde nächste Woche bezahlen, und trottet mit leichter Schlagseite nach Backbord davon – in jeder Hand eine prall gefüllte blau-weiß-gestreifte Plastiktüte.
Auf der Steinsäule, die das Brückengeländer hält, hockt eine Möwe mit einem blutigen Stück Leber im Schnabel. Ada passt auf, dass sie ihr nicht in die Augen sieht, weil sie Angst hat, verzaubert zu werden. Als sie auf der obersten Stufe der Brücke angekommen ist, lässt sich die Möwe seitlich von der Säule fallen, breitet die Flügel aus und streicht dicht über die Wasseroberfläche, bevor sie mit trägem Flügelschlag wieder aufsteigt, um sich vom Wind wie ein Fetzen Papier über die Häuser tragen zu lassen.
»Ada!«
Erst will sie sich nicht umdrehen, falls niemand da ist, doch als der Ruf erneut ertönt, erkennt sie Daniele Trevisans Stimme. Er lehnt auf der anderen Seite des Kanals im Fenster.
»Wie gehts?«, fragt er.
Ada Zulian wird plötzlich von der schwindelerregenden Überzeugung überwältigt, dass sich das alles schon einmal abgespielt hat, und sie hat recht. Damals, vor vielen Jahren, vor dem Krieg, vor ihrer Heirat, war sie am Fenster, und Daniele stand auf der Straße und machte ihr Komplimente …
»Ist alles in Ordnung?«, fragt Daniele Trevisan, wie es zuvor schon Sebastiano getan hat.
Ada packt ihre Tüten fester und stapft die Stufen der Brücke hinunter, die ganz schmierig vom Regen sind. Alle sind immer so besorgt um sie! Seit Rosetta damals ganz plötzlich verschwand und Ada bei den Irren auf San Clemente untertauchen musste, sind die Leute unglaublich besorgt. Sie weiß, dass sie für diese Anteilnahme dankbar sein sollte, aber im Grunde geht ihr das Getue auf die Nerven. Was soll sie denn sagen? Sie weiß nur zu gut, dass sie über ihre wahren Probleme nicht reden kann, sonst würden die Leute wissende Blicke austauschen und kichern.
»Überall sind Geister«, murmelt sie.
»Was?«
»Sie sollten etwas dagegen tun.«
Daniele betrachtet sie von seinem hohen Fensterplatz aus genauso starr wie die Möwe.
»Wer?«
Ada zuckt mit den Achseln.
»Die Behörden. Ich habʼ vor, dort anzurufen und mich zu beschweren.«
Daniele winkt ihr seufzend.
»Komm doch rauf, Ada. Setz dich zu mir. Wir trinken eine Tasse Kaffee und plaudern ein bisschen.«
Sie sieht ihn an und schüttelt den Kopf.
»Ich muss nach Hause.«
»Ruf die Polizei nicht an!«, fleht er sie an. »Du willst doch wohl nicht den Leuten erzählen, dass du wieder Gespenster siehst.«
»Auf dem Fußboden war feuchter Dreck«, sagt Ada Zulian, aber das hört er nicht.
»Halt die Polizei da raus!«, insistiert Daniele. »Wenn du mit jemandem reden musst, dann sprich mit mir.«
Ada hebt ihre Tüten hoch und geht nickend und lächelnd weiter. Warum liegt ihm so viel daran, dass sie die Polizei nicht anruft? Für Ada gibt es keinen Zweifel, dass sie es mit etwas Wirklichem zu tun hat. Bei der Sache mit Rosetta hatte es nie etwas Greifbares gegeben. Wie glücklich wäre sie, wenn es so gewesen wäre! Aber sie hat im Innersten immer gewusst, dass das kleine Mädchen, das sie jeden Abend verzweifelt rief, bis ein entnervter Nachbar sie schließlich bei der Polizei denunzierte, in Wirklichkeit nie dagewesen ist. Das zarte und verwundbare Geschöpf, das in einer dunklen Ecke ihres Verstands lauerte, war so wenig körperhaft wie ein Gedanke, und Adas fieberhafte Versuche, sie herbeizurufen, waren nichts anderes als die Schreie eines Schlafwandlers.
Aber das hier ist etwas anderes. Sie hat Daniele zwei Dinge erzählt, doch wie üblich hat er nur das gehört, was er hören wollte und was zu seiner Vorstellung von der verrückten Ada und ihren Gespenstern passt. Die Sache mit dem feuchten Dreck hat er ignoriert. Aber Ada hat den Matsch gesehen. Sie hat ihn berührt und daran gerochen. Sie weiß, dass er echt ist, und sie weiß auch, dass Geister keine Fußabdrücke hinterlassen. Also können diese Gestalten, die in ihrem Haus spuken und sie an den Rand der Verzweiflung treiben, keine Geister sein. Aber was dann?
Zitternd schleppt sie sich am Kanal entlang und biegt in eine enge Gasse, die zum Hintereingang des Palazzo Zulian führt, der früher nur von Händlern und Hausangestellten benutzt wurde. Alles ist auf den Kopf gestellt, seit die Leute vergessen haben, wie man mit Booten umgeht. Niemand kommt und geht mehr auf dem Wasser – nur die Toten.
Als erstes fällt ihr der Stuhl auf, der vornüber gekippt auf dem stumpfen Marmorboden liegt. Er besteht aus dunklem Holz, das so schwer wie Eisen ist. Er ist kunstvoll geschnitzt und Jahrhunderte alt und grotesk. Adas ganzes Leben lang stand er im Flur. Sie würde ihn gern in den Kanal werfen, aber das ist nicht möglich. Sie muss das Familienerbe erhalten. Außerdem könnte sie das Ding gar nicht hochheben. Dennoch hat er sich bewegt, scheinbar von allein. In letzter Zeit war es oft vorgekommen, dass Gegenstände während ihrer Abwesenheit lebendig wurden wie ein Schwarm Vögel und sich in einer anderen Anordnung wieder niederließen. Sie hat vergeblich versucht, ein Schema oder einen Sinn in diesem Phänomen zu erkennen. Die bloße Banalität dieser Vorgänge macht das Ganze so beunruhigend.
Die Treppe, die in den ersten Stock führt, ist ein düsterer Tunnel, der sich von unten in die Eingeweide des riesigen Gebäudes gräbt. Ada knipst den Lichtschalter an, ohne dass etwas geschieht. Die Birne muss kaputt sein wie so viele im Haus. Natürlich gibt es keine Bediensteten mehr, deshalb muss sie sehen, wie sie zurechtkommt, bis Nanni und Vincenzo sie besuchen. Zumindest ihre Neffen halten noch zu ihr trotz der häufigen Meinungsverschiedenheiten. Nicht dass sie besonders herzlich oder freundlich wären, aber zumindest kommen sie ab und zu vom Festland herüber, um nach ihr zu sehen. Das ist schon was heutzutage.
Am oberen Ende der Treppe bleibt sie in dem langen Flur stehen, der von einer Seite des Hauses bis zur anderen reicht. Verstärkt durch das weite leere Gewölbe des Andron im Erdgeschoss erfüllt das Klatschen der kleinen Wellen gegen die schon lange nicht mehr benutzten Stufen zum Wasser die Luft, als ob jemand im Kanal schwimmen würde. Einen Augenblick kommt es Ada so vor, als ob sie noch etwas anderes hören würde, ein Flüstern oder Rascheln in der Nähe. Sicherlich Mäuse. Seit ihre Katze gestorben ist, hat Ada den Kampf gegen die Mäuse aufgegeben. Sie brachte es nicht übers Herz, sich eine neue Katze zu besorgen. Aus ihrem Leben ist ohnehin schon genug verschwunden.
Sie lässt die Tüten auf dem Treppenabsatz stehen und öffnet die Tür zur ersten Zimmerflucht auf der Kanalseite des Gebäudes, die einzigen Zimmer, die noch benutzt werden. Der große Raum ist dunkel, die Fensterläden sind fest verschlossen. Sie hat sie doch aufgemacht, bevor sie wegging. Oder war das gestern? Bei einem Geräusch hinter sich zuckt sie zusammen und dreht sich um, aber es ist nur eine der Plastiktüten, die umgefallen ist. Ein Apfel fällt heraus und rollt auf den Treppenrand zu. Am Fuß der langen Treppe steht ein Skelett und deutet mit einem knochigen Arm auf sie.
Sie läuft in den Salon, schlägt die Tür zu und lehnt sich keuchend dagegen. Ist das Skelett wirklich da oder nicht? Was wäre schlimmer? Es passiert nichts weiter. Kein Geräusch. Dennoch dauert es sehr lange, bis sie sich überwinden kann, die Tür zu öffnen. Erst macht sie die Augen zu. Als sie sie aufreißt, sind der Portego, der Treppenabsatz, die Treppe und der Flur im Erdgeschoss leer.
Ada hebt den Apfel auf, nimmt die Tüten und trägt sie durch das Wohnzimmer in die Küche. Es dringt gerade so viel Licht durch die Fensterläden, dass sie sich zurechtfindet. In der Ferne hört sie die Rufe der Männer, die am Pagan-Haus arbeiten. Sie lässt ihre Einkäufe auf dem Küchentisch liegen, kehrt in den Salon zurück und tastet nach dem Lichtschalter. Ein gleißender Blitz flammt auf, und das Skelett steht vor ihr. Jetzt ist es also im Zimmer. Die klauenartige Hand rast ihr entgegen, und der Schädel grinst abscheulich.
Eine Hand fasst sie an der Schulter. Sie fährt herum. Vor ihr steht ein Kind mit langen blonden Haaren und einem sanften runden Alabastergesicht, das absolute Reinheit und Ruhe ausstrahlt – das Ebenbild von Rosetta. Stöhnend und schluchzend stolpert Ada durch das Zimmer und stößt heftig mit dem skelettartigen Wesen zusammen, ehe sie am Telefon herumfummelt.
Der Zug mit den vielen Eisenbahnwaggons hielt auf dem Bahnsteig, und das Stampfen der Lokomotive erstarb. Der Fahrer kletterte aus dem Führerhaus und steuerte auf die Kantine zu. Er kam an verdunkelten Zügen vorbei, die auf anderen Bahnsteigen bereitstanden, um in einigen Stunden, am frühen Morgen, loszufahren.
Einen Augenblick schien es, als sei der Zug, der gerade angekommen war, ebenfalls leer. Dann ging etwa in der Mitte eine Tür auf. Ein Mann trat auf den Bahnsteig, blieb stehen und schnupperte. Er war groß und ziemlich hager, hatte ein blasses, ernstes Gesicht, das von einer markanten Nase beherrscht wurde. Er trug einen langen Mantel und einen Homburg, unter dem dunkle Haarbüschel hervorlugten, die hier und da silbern durchsetzt waren.
Die leeren Eisenbahnwagen ruckelten leicht, als am anderen Ende eine Lokomotive angekoppelt wurde, die den Zug über die lange Brücke zurück aufs Festland ziehen würde, wo er dann weiter nach Triest fuhr. Der Mann hob einen ramponierten Lederkoffer aus dem Abteil, schlug die Tür zu und setzte sich auf dem Bahnsteig in Bewegung. Der Bahnhof war wie ausgestorben, Café und Zeitungsstand hatten geschlossen. Der Mann ging durch das grelle Licht der Vorhalle hinaus auf die breite Treppe. Dort blieb er erneut stehen und sog prüfend die Luft ein. Als ob er mit dem Ergebnis zufrieden wäre, ging er die Stufen hinunter und wandte sich dann nach links.
Am Fuß der Scalzi-Brücke luden zwei Jugendliche Zeitungs- und Zeitschriftenpakete aus einem Motorboot und stapelten sie neben einem verrammelten Kiosk. Der Mann sprach sie im Dialekt an. Einer der Jungen zückte daraufhin ein Messer und schlitzte ein Paket Zeitungen auf, als ob er einen Fisch ausnähme. Geld wechselte die Hände. Der Mann drehte sich um und überflog die Überschriften: SMOG-ALARM IN MESTRE und GRÜNES LICHT FÜR DIE LAGUNENMETRO.
Er bog wieder links ab und ließ die breite Durchgangsstraße und die geschlossenen Läden hinter sich. Die Gasse, in die er kam, war kaum breit genug, dass er seinen Koffer bequem tragen konnte. Seine Schritte hallten wie Schläge wider. Eine einsame Katze floh vor ihm, aus ihrem Maul hing ein angefressener Fischkopf. Hoch oben in einer Mauer verriet ein verschwommenes Licht einen an Schlaflosigkeit Leidenden oder einen Frühaufsteher. Als der Mann unter der Lampe durchging, die auf Höhe des ersten Stocks an einem schmiedeeisernen Halter hing, holte sein Schatten ihn ein, stürmte an ihm vorbei und zeichnete sich, immer größer werdend, auf den rechteckigen Pflastersteinen ab. An der nächsten Ecke bog er nach rechts in eine Gasse, die sich zu einem keilförmigen offenen Platz verbreiterte, in dessen Mitte ein Brunnen mit einem verrosteten Eisenaufbau stand. Hier verlangsamten sich seine raschen Schritte zum ersten Mal, weil das Pflaster glitschig wurde, als ob es sich in das sumpfige Feld zurückverwandelte, das dort einst gewesen war. Erinnerungen überfielen ihn wie eine aufdringliche Horde bettelnder Kinder.
Die Häuser hier waren dreistöckig –, im Untergeschoss ein Keller mit rechteckigen Gitterfenstern, darüber die Wohnetage mit paarweise angeordneten eleganten Bogenfenstern und schließlich direkt unter dem Dach die niedrigen Schlafzimmer mit quadratischen Fenstern. Die Einheitlichkeit der Fassaden wurde durch ein kompliziertes Netz von Elektro- und Telefonkabeln sowie Wasser- und Gasrohren aufgelöst, außerdem durch metallene Verstärkungen, Lüftungsschächte, Regenrinnen, Wäscheleinen, Laternenpfähle und Blumentopfhalter. Einige Häuser waren frisch gestrichen, in Ocker oder Rostbraun, während bei anderen der Putz abblätterte wie sonnenverbrannte Haut.
Der Mann blieb vor dem heruntergekommensten Haus stehen, das dem Brunnen gegenüber stand. Im Untergeschoss war der Putz fast nicht mehr vorhanden, so dass man das Backsteinmauerwerk sehen konnte. Die Fensterläden im ersten Stock bestanden nur noch aus nacktem Holz, und auf dem verschnörkelten Steinsims sah man braune Schmutzstreifen, für die der Rost des niedrigen Eisengeländers verantwortlich war. Die Türeinfassung bestand aus weißem Stein. Darauf war in einem ovalen Rahmen mit roter Farbe die Hausnummer gemalt. Neben der Tür befand sich eine Klingel in Form einer umgedrehten Brust. Darüber stand auf einem verbogenen Messingstreifen ZEN.
Der Mann nahm einen Schlüssel aus der Tasche und steckte ihn ins Schloss. Die Tür knarrte. Im Flur war es muffig und kalt. Ein gelbliches Licht ging flackernd an und beleuchtete einen engen Korridor mit bröckelndem Putz, stumpfen Mosaikfliesen und einigen Treppenstufen. Der Mann atmete mehrmals hastig ein, drückte die Tür hinter sich zu und stieg die Treppe hinauf. Sie führte in einem Bogen nach links, machte eine ganze Drehung und endete auf einem schmalen Treppenabsatz. Eine weitere Treppe führte zu den Schlafzimmern hinauf. Der Mann stellte seinen Koffer ab und starrte auf die Tür vor sich, die einen Spalt offenstand. Dann stieß er sie abrupt auf und stürmte hinein.
Ohne Mobiliar wirkte das Zimmer angenehm geräumig, doch viel kleiner, als er es in Erinnerung hatte. Wann immer er in Gedanken hierher zurückgekehrt war – wie auch gerade noch, als er auf dem Treppenabsatz zögerte –, hatte er einen riesigen, monumentalen Raum vor sich gesehen. Er hätte fast gelacht, als er jetzt sah, wie unscheinbar dieses Zimmer eigentlich war. Aber er lachte nicht, denn in diesem Moment starb etwas in ihm, und er wusste, dass er eine weitere und vielleicht die wichtigste noch verbliebene Verbindung zu seiner Kindheit verloren hatte.
In der Küche lag ein Stück Papier auf dem Abtropfbrett: Lieber Aurelio, ich habe getan, was ich konnte, das alte Haus sieht ein bisschen schäbig aus, aber was kann man schon erwarten? Zumindest ist es sauber, und ich habe dir in deinem alten Zimmer das Bett gemacht. Wir erwarten dich zum Mittagessen, ganz wie in alten Zeiten! Rosalba. Der Mann legte den linierten Zettel so vorsichtig hin, als ob er zerfallen könnte, und ging dann ins Wohnzimmer zurück, um die Fenster aufzumachen. Er entriegelte die schweren Holzläden, drückte sie gegen die Hauswand und legte die Metallklammern um, die sie festhielten. Die kalte Nachtluft drang ins Zimmer und vertrieb den Geruch von Abwesenheit und Vernachlässigung. Der Mann ließ die Fenster offen, nahm seinen Koffer und ging nach oben.
In dieser Etage standen noch viele der alten Möbel, deshalb wirkte das niedrige Schlafzimmer eng und vollgestopft. Der Kleiderschrank mit den Spiegeltüren, der eine ganze Wand einnahm, täuschte eine Geräumigkeit vor, die von der verbrauchten stickigen Luft Lügen gestraft wurde. Der Mann legte seinen Koffer auf das Bett und drehte sich um, um sich in der Spiegelwand zu betrachten. Er sah müde und abgespannt aus und hatte den Ausdruck von jemandem, der gegen seinen Willen in einem abgelegenen, ungastlichen Hotel gelandet war. Nichts deutete darauf hin, dass von allen Zimmern auf der Welt ihm dieses am vertrautesten war.
Er öffnete auch hier das Fenster und atmete die frische salzige Luft ein. Unten im Kanal bewegte sich das trübe Wasser hin und her. Sonst war alles ruhig. Die Stadt schien ausgestorben zu sein. Für jemanden, der an das Leben in Rom gewöhnt ist, wo der dröhnende Verkehrslärm auf dem hohlen Tufo Tag und Nacht nicht abreißt, war eine so absolute und uneingeschränkte Ruhe genauso beunruhigend, als ob eine lebenswichtige Funktion ausgesetzt hätte. Der Mann trat vom Fenster weg, setzte sich aufs Bett und zog seine Schuhe aus. Dann legte er sich von Müdigkeit überwältigt hin, schloss die Augen vor dem blassen gelben Licht der Lampe – einer Scheußlichkeit aus buntem verschnörkelten Muranoglas.
Ein Plätschern weckte ihn. Er war bis auf die Knochen durchgefroren, steif, erschöpft und verwirrt. Es dauerte lange, bis er sich erinnerte, wo er war, und auch dann war das kein Trost für ihn. Es war alles ein furchtbarer Fehler. Er hätte niemals herkommen dürfen.
Das Geräusch, das ihn geweckt hatte, war immer noch da, ein anhaltender gleichmäßiger Widerhall in dem engen Raum zwischen den Häusern. Er richtete sich im Bett auf, setzte die nackten Füße auf die kalten Fliesen, die die Farbe und den Glanz von Parmesankäse hatten, und tapste zum Fenster. Von der Morgendämmerung noch keine Spur. Der Mann sah auf seine Uhr. Es war erst kurz nach fünf.
Weiter unten am Kanal, in der Nähe der Brücke, beleuchtete eine Straßenlaterne schemenhaft einen Abschnitt der Wasseroberfläche. Etwas bewegte sich dort, ein Boot. Der Mann beobachtete, wie es in den beleuchteten Bereich fuhr und sich als Silhouette abzeichnete. Es handelte sich um ein kleines Schlauchboot, das von zwei massigen, formlosen Gestalten gerudert wurde. Das Boot bog um eine Ecke und verschwand. Es war wieder still. Aurelio Zen rieb sich die Augen, schloss das Fenster und ging wieder ins Bett.
Als er erneut aufwachte, war das Zimmer von einer so gleißenden Helligkeit erfüllt, dass er blinzeln musste, dazu das aggressive Klatschen der kleinen Wellen und der scharfe Geruch, der ihn bereits überrascht hatte, als er aus dem Zug gestiegen war. Er hatte sogar die auffälligsten Merkmale dieser Stadt vergessen, wie den penetranten Geruch nach Meer.
Seit seine Mutter zu ihm nach Rom gezogen war, hatte sich Zen nur selten in seiner Heimatstadt aufgehalten, und wenn er hier gewesen war, hatte er nur nachgesehen, ob das Haus noch stand, oder der Comune notwendige Dokumente abgerungen. Er hatte es bewusst vermieden, die Gründe für sein freiwilliges Exil allzu genau zu hinterfragen, und tat stattdessen sich und anderen gegenüber so, als wäre er aus beruflicher Notwendigkeit weggezogen. Teilweise stimmte das sogar, aber er spürte, dass noch mehr dahintersteckte – schmerzliche und düstere Dinge, die er in einem unzugänglichen Teil seines Gehirns unter »Persönliches« abgelegt hatte.
Doch nun kam allmählich alles zurück. Das penetrante Plätschern musste vom Kielwasser eines Schiffes stammen, das über den Cannaregio-Kanal fuhr. Letzte Nacht war dort kein Verkehr gewesen, deshalb war er auch instinktiv ans Fenster gegangen, als er ein ähnliches Geräusch gehört hatte. Er erinnerte sich an das Schlauchboot, an die vermummten Gestalten. Je länger er über den Vorfall nachdachte, um so merkwürdiger kam er ihm vor. Was sollte jemanden dazu veranlassen, mitten in der Nacht durch die Seitenkanäle der Stadt zu rudern? Vielleicht war er gar nicht aufgewacht? Vielleicht war alles ein Traum gewesen? Jede andere Erklärung schien sinnlos.
Auf dem Hof trieb ein lebhafter Wind seine Spielchen, prallte von den Mauern ab und fegte aus engen Gassen hervor. Trotz eines leichten Dunstschleiers erzeugte die Sonne dunkle Schatten, die mehr Festigkeit zu besitzen schienen als die Gegenstände selbst, denen das schräg einfallende Licht jegliche Substanz nahm. Aurelio Zen schlug die Tür hinter sich zu und machte sich auf den Weg zum Café auf dem Cannaregio-Kai. Rosalba hatte zwar wahre Wunder vollbracht, um das Haus wieder bewohnbar zu machen, aber alle Schränke und die Vorratskammer waren leer. Er hätte sich zumindest ein Päckchen Kaffee mitbringen sollen.
Als er an die Ecke kam, glaubte er zuerst, er hätte die Orientierung verloren. Von dem Café war keine Spur zu sehen, und auch der Friseur und der Eisenwarenhändler waren verschwunden. Zen sah sich verwirrt um. Ja, da auf der anderen Seite des Kanals war der Palazzo und dort die Kirche. Es war die Ecke, daran konnte kein Zweifel bestehen, aber hier war nichts außer einer schmutzigen Glasscheibe mit verblassten Plakaten, auf denen gegen die zwangsweise Vertreibung der rechtmäßigen Mieter protestiert wurde. Eine Werkstatt für Karnevalsmasken hatte die Läden daneben übernommen.
Ein hagerer grauhaariger Mann schlurfte die Gasse herunter. Er trug einen uralten Anzug, einen schmuddeligen Pullover und karierte Pantoffeln. Ein Stück hinter ihm trottete ein räudiger Hund an einer verdreckten Leine.
»Entschuldigen Sie!«, rief Zen. »Wissen Sie, was mit der Bar von Claudio passiert ist?«
Die Augen des Mannes weiteten sich angstvoll.
»Bist du das, Anzolo? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich jemals wiedersehe.«
Zen betrachtete ihn eingehender.
»Daniele?«, flüsterte er. »Ich bin Aurelio, der Sohn von Angelo.«
Der alte Mann starrte ihn nun ebenfalls an. Sein runzeliges Gesicht war unrasiert. Seine Nase war mit roten Äderchen durchzogen. In seinem Unterkiefer steckten noch drei einsame Zähne, die wie die Preistäfelchen der großen silbernen Registrierkasse aufragten, die früher auf Claudios Bar thronte.
»Aurelio?«, murmelte er schließlich. »Der kleine Rowdy, der früher die ganze Nachbarschaft terrorisiert und seiner Mutter das Leben schwergemacht hat? Ich höre immer noch ihre Worte. ›Um Himmels willen, Daniele, gib ihm eine ordentliche Tracht Prügel! Ich werdʼ nicht mehr mit ihm fertig. In diesem Alter brauchen sie einen Mann, der ihnen zeigt, wos langgeht.‹«
Er zog den Hund von einem stinkenden Stück Putz weg, an dem er schnüffelte.
»Wie geht es Giustiniana?«
»Meiner Mutter geht es gut, Daniele.«
»Und was machst du hier?«
»Ich bin dienstlich hier.«
»Dienstlich?«
»Ich bin bei der Polizei.«
Daniele trat einen Schritt zurück.
»Bei der Polizei?«
»Na und?«
»Nichts. Bloß – was du dir früher so alles geleistet hast …«
»Ja?«, fragte Zen.
»Ehrlich gesagt, ich hatte erwartet, dass du auf der anderen Seite des Gesetzes landen würdest, irgend so was.«
Zen lächelte schwach. »Und Claudio?«, fragte er.
»Wer?«
Der alte Mann wirkte so verblüfft, als habe man ihm einen Streich gespielt. Zen deutete auf die verschlossene Tür und das mit Plakaten vollgeklebte Fenster.
»Fort!«, rief Daniele. »Claudio ist zur Brücke runtergezogen, wo sich die Touristen herumtreiben. Hier kann man nichts mehr verdienen. Und was für eine Polizeisache hat dich hergeführt, falls ich als alter Freund der Familie so indiskret fragen darf?«
Zen hatte ein Vaporetto nahen sehen und eilte davon. Daniele Trevisan sah ihm mit einem zweifelnden, leicht boshaften Lächeln nach.
Zunächst sah es so aus, als würde Zen das Boot nicht mehr bekommen, doch zum Glück legte eine andere Fähre, die zum Bahnhof fuhr, als erstes am Landungssteg an und zwang das entgegenkommende Boot, den Motor zu drosseln und auf dem Wasser zu treiben, bis es an der Reihe war. Zen konnte also gemütlich über die Tre-Archi-Brücke schlendern und sich sogar noch eine Zigarette anzünden, bevor er an Bord ging.
Als sie an den modernistischen Sozialbauten am San-Girolamo-Kanal vorbei auf die offene Lagune fuhren, merkte man zum ersten Mal so richtig, wie stark der Wind tatsächlich war. Das Boot kämpfte sich klatschend durch die kurzen, harten Wellen, und Gischtschwaden setzten das Deck und die Fenster der Kabine des Steuermanns unter Wasser. Wegen der Zigarette musste Zen draußen bleiben, und so stand er oben an der Treppe, die in den Aufenthaltsraum führte. Es war Rushhour, und das Boot war gerammelt voll mit Schülern und Pendlern. Sie saßen oder standen teilnahmslos herum, lasen Zeitung, unterhielten sich oder starrten gleichgültig aus dem Fenster. Abgesehen von dem Stampfen und Schlingern, dem Klatschen der Wellen und der kühlen Luft, die nach Salz und nicht nach Abgasen roch, hätte das genauso gut der Bus sein können, mit dem Zen jeden Morgen in Rom zur Arbeit fuhr. Er musterte die Kinder, die sich unter ihren Schulranzen krümmten, fröhlich plauderten oder herumalberten. Für sie war das normal, überlegte er, wie früher auch für ihn. Sie glaubten, es wäre überall so. Sie glaubten, dass sich niemals etwas ändern würde.
An den Fondamenta Nuove stieg Zen um, weil er den Umweg über Murano vermeiden wollte. Er wäre schneller gewesen, wenn er an der nächsten Haltestelle, am Krankenhaus, ausgestiegen und durch die Seitensträßchen zu Fuß zur Questura gegangen wäre. Aber da er reichlich Zeit hatte, fuhr er mit der Circolare Destra an den Schiffswerften des Arsenale vorbei und über den tiefen Kanal mit seinem großartigen Panorama. Der Wind war hier noch deutlicher zu spüren und zerfetzte die Wasseroberfläche in lauter kleine Wellen mit weißen Schaumkronen. Sie schlugen klatschend gegen den Schiffsrumpf und wirbelten eine in allen Regenbogenfarben schillernde, salzige Gischt auf, die sich wie eine Schweißschicht über Zens Gesicht legte.
An der Riva degli Schiavoni stieg er aus, überquerte die breite Promenade, auf der selbst um diese Uhrzeit schon ein reges Treiben herrschte, und verschwand in dem dahinterliegenden Labyrinth dunkler verlassener Gassen. Von diesem Moment an folgte er weitgehend seiner Nase, aber sie erwies sich als guter Wegweiser. Er kam zu einer Brücke, die direkt neben dem dreistöckigen Gebäude, in dem das Polizeipräsidium der Provincia di Venezia untergebracht war, den San-Lorenzo-Kanal überspannte. Zen hielt seinen Ausweis vor die Kamera über der Klingel, und der Türöffner summte laut. Seit den Jahren des Terrorismus waren die Polizeiwachen abgesichert wie koloniale Vorposten auf feindlichem Gebiet. Die Tatsache, dass sich sowohl die Questura als auch die Squadra Mobile nebenan in traditionellen Gebäuden befanden, die typisch für dieses unspektakuläre Stadtviertel waren, ließen diese Maßnahmen noch bizarrer erscheinen.
Der diensthabende Wachmann, der in der Vorhalle hinter einer Panzerglasscheibe saß, wirkte verschlafen und lustlos. Es sei noch niemand da, erklärte er Zen. Diese Behauptung wurde durch die Bildschirmwand hinter ihm unterstützt, auf der eine Anzahl von leeren Räumen, Fluren und Treppen zu sehen waren. Zen ging in die erste Etage und öffnete aufs Geratewohl eine Tür. Das Bild, das sich ihm darbot, war jedem absolut vertraut, der einmal irgendwo in Italien zwischen Aosta und Siracusa bei der Polizei gearbeitet hatte. Die Luft war abgestanden und stickig, verbraucht und wieder aufgewärmt. Die kahlen Wände waren in einem weißlichen Farbton gestrichen, der an Milch erinnerte, die zu lange im Warmen gestanden hatte. An der Decke hing an nicht sehr vertrauenswürdig aussehenden Ketten ein Gehäuse mit zwei Neonröhren, bei dem die Abdeckung fehlte. Der verfügbare Raum war mit Trennwänden in drei Bereiche abgeteilt. Diese Trennwände bestanden aus dickem geriffelten Glas, das man normalerweise mit Duschkabinen verbindet, und waren mit einem vergoldeten Aluminiumrahmen eingefasst. In jedem der drei Bereiche stand in der Mitte ein schwarzer Holzschreibtisch.
Zen ging zu einem der Schreibtische und sah den Inhalt des dreistöckigen Ablagekorbs aus Metall durch, bis er gefunden hatte, was er suchte, einen Packen Computerausdrucke, die oben links zusammengeheftet waren. Auf dem obersten Blatt stand: NOTIZIE DI REATI DENUNCIATI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA sowie die Daten der vergangenen Woche. Auf den nachfolgenden Seiten waren die Vorfälle aufgelistet, die im fraglichen Zeitraum der Polizei gemeldet worden waren. Zen sah die Seiten durch.
Es war eine heikle Angelegenheit. Er wollte keine unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem er einen Fall an sich riss, der bereits jemandem zugeteilt worden war oder an dem ein anderer aus irgendwelchen Gründen besonderes Interesse hatte. Andererseits konnte er sich nicht wahllos irgendein kleines Vergehen herauspicken. Es musste schon etwas daran sein, das rechtfertigte, dass man ihn extra von der elitären Criminalpol in Rom hierhergeschickt hatte, um den Fall zu übernehmen. Während er immer noch über dieses Problem nachgrübelte, stieß er plötzlich auf einen vertrauten Namen.
Er las die Eintragung noch einmal, dann ließ er das Dokument fallen und zündete sich eine Zigarette an. Die Contessa! Großer Gott. Eine Zeitlang verlor er sich in Erinnerungen. Dann sah er wieder auf das Blatt. Vor zwei Wochen hatte Ada Zulian gemeldet, dass Eindringlinge in ihrem Haus gewesen seien, und behauptet, dies sei Teil einer systematischen Verfolgungskampagne, die schon seit einem Monat andauere. Vor einer Woche hatte sie erneut Anzeige erstattet.
Zen sah zum Fenster und nickte bedächtig. Das war genau das Richtige. Zu trivial, um das Interesse von jemandem aus dem hiesigen Personal zu erregen, und die familiäre Verbindung verschaffte ihm eine scheinbare Rechtfertigung für seine Einmischung, falls jemand danach fragen sollte. Er notierte sich Datum und Nummer des Falles in seinem Terminkalender und legte die Papiere in den Metallkorb zurück.
Als sich eine halbe Stunde später endlich jemand in der Personalabteilung am Telefon meldete, ging Zen dorthin, um sich vorzustellen. Der zuständige Sachbearbeiter kramte ein Blatt hervor, das von Rom gefaxt worden war.
»Zen, Aurelio. Criminalpol. Vorübergehende Versetzung wegen …« Er sah mit gerunzelter Stirn auf das Formular. »Komisch. Die haben vergessen, das einzutragen.«
Zen schüttelte den Kopf. »Typisch! Die Leute, die man heutzutage dort beschäftigt, können sich die Hälfte der Zeit nicht mal an ihren eigenen Namen erinnern.« Er nahm sein Notizbuch heraus. »Es geht um jemanden namens Zulian. Irgendwo habʼ ich die genauen Angaben … Ah, da ist es.« Er zeigte dem Angestellten Aktenzeichen und Datum, was dieser auf das Blatt übertrug. »Ich brauche einen Schreibtisch zum Arbeiten«, sagte Zen beiläufig. »Haben Sie irgendwas frei?«
Der Angestellte sah auf eine Übersicht an der Wand.
»Wie lange werden Sie hier sein?«
Zen zuckte mit den Achseln.
»In drei-eins-neun ist bis zum siebzehnten ein Schreibtisch frei. Gatti ist in Urlaub.«
Zimmer 319 war ein kleines Büro auf der Vorderseite des Gebäudes, das auf den Kanal hinausging. Zen beobachtete gerade, wie sich eine Kühlbarkasse an den Polizeibooten vorbeiquetschte, die vor der Questura festgemacht waren, als die Tür aufging und Aldo Valentini hereinkam, dessen Name neben dem des abwesenden Gatti an der Tür stand.
Valentini war ein sanfter, intellektuell aussehender Mann mit Armani-Brille und einem spärlichen blonden Bart, der aussah wie Gras, das unter einer Planke wuchs. Er war offenbar erfreut, Gesellschaft zu haben, und schlug Zen vor, sie sollten zusammen frühstücken gehen. Während sie gegen den Strom der Angestellten, die sich rasch eintragen wollten, damit sie wieder raus konnten, das Gebäude verließen und in die Sonne traten, fragte Valentini nach dem Grund für Zens Versetzung.
»Sie machen wohl Witze!«, sagte er grölend mit dem leicht nasalen Akzent seiner Heimatstadt Ferrara. »Ada Zulian! Eine Frau, die einem nicht mal die richtige Uhrzeit sagen kann …«
Zen machte eine ungeduldige Geste. »Was spielt das für eine Rolle, solange sie die richtigen Leute kennt?«
Aldo Valentini stimmte diesem Einwand mit einem Schulterzucken zu. Er führte Zen zu einer Bar am Ende des Kais. Auf einem roten Neonschild über der Tür stand Bar dei Greci nach der orthodoxen Kirche in der Nähe. Im Lokal war von Griechen nichts zu sehen, wenn auch der Akzent des Barmanns verriet, dass er aus einer Gegend weit südlich von Chioggia stammte.
»Trotzdem, la Zulian!«, stieß Valentini hervor, nachdem sie Kaffee bestellt hatten. »Großer Gott, sie ist in den letzten zwanzig Jahren immer wieder wie ein Jojo rein in die Klapsmühle, raus aus der Klapsmühle. Ihre Beschwerde ist hauptsächlich deshalb auf meinem Schreibtisch gelandet, weil sonst niemand sie anfassen wollte, nicht mal mit der Kneifzange.«
Er unterbrach seinen Redefluss, um sich von dem Teller, der auf der Bar stand, Gebäck zu nehmen.
»Wir haben das ganze Haus von oben bis unten durchsucht«, fuhr er fort. Sein Schnurrbart war von dem Puderzucker des Kuchens ganz weiß. »Wir haben sogar einen Mann vor der Haustür postiert. Niemand kam oder ging, aber die Frau behauptete immer noch, sie würde verfolgt. Das ist ein eindeutiger Fall von Hysterie – sie will nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.«
Zen biss ein Stück von einem lockeren, mit Creme gefüllten Croissant ab.
»Sie haben bestimmt recht. Es sind immer die hoffnungslosen Fälle, bei denen man eine zweite Meinung hinzuzieht. Ich werde einfach nach Schema F verfahren und mich dann Ihren Schlussfolgerungen anschließen. Es ist absolute Zeitverschwendung, aber was solls? Es gibt Schlimmeres, als ein paar Tage hier zu verbringen.« Er spülte das Gebäck mit einem Schluck Kaffee herunter. »Was läuft denn hier so?«
»Die übliche Scheiße. In Mestre und Marghera ist einiges los, besonders in puncto Drogen, aber das Stückchen Festland, das in unsere Kompetenz fällt, ist nicht groß genug, als dass viel zusammenkäme. Was die Stadt selbst angeht, das kann man vergessen. Die Verbrecher sind heutzutage genau wie alle anderen. Wenn man nicht mit dem Auto vorfahren kann, haben sie kein Interesse.«
Zen nickte bedächtig. »Was ist mit diesem Entführungsfall, der vor einigen Monaten überall in den Zeitungen stand? Irgendein Amerikaner?«
»Sie meinen diese Durridge-Geschichte?«
Zen zündete sich eine Zigarette an. »Das muss doch ein bisschen Schwung in den Laden hier gebracht haben.«
»Hätte es, wenn man uns rangelassen hätte«, entgegnete Valentini kurz angebunden.
»Wie meinen Sie das?«
»Die Carabinieri waren als erste da, und als wir uns um Zusammenarbeit bemühten, wurde uns erklärt, die Akten wären bereits versiegelt nach Rom geschickt worden.« Er zuckte mit den Schultern. »Weiß der Himmel, was dahintersteckte. Früher hätten wir einige Beziehungen spielen lassen können, doch heutzutage …«
Er deutete auf die Überschrift in der Zeitung, die auf der Theke lag. DER ALTE FUCHS KÄMPFT UM SEIN POLITISCHES ÜBERLEBEN stand über dem Foto eines Politikers. Zen nahm die Zeitung in die Hand und überflog den Artikel, in dem es um Zahlungen ging, die führende Industrielle auf Schweizer Nummernkonten geleistet hätten, angeblich um die fragliche Partei zu finanzieren. Der Karikaturist der Zeitung spielte mit dem Slogan herum, den die Partei im letzten Wahlkampf eingesetzt hatte: »Eine fairere Alternative.« In einem zusätzlichen Artikel bejubelte ein Sprecher der regionalistischen Lega Nord diese Entwicklung als »tödlichen Schlag gegen die Clique von Gaunern, die dieses Land jahrzehntelang ausbluten ließen« und forderte ein neues Wahlrecht, das die politische Landkarte radikal verändern würde.
»Es ist das totale Chaos«, bemerkte Valentini säuerlich. »Man kann überhaupt nichts mehr erledigen. Keiner kennt die Regeln.«
Als er eine Berührung am Arm spürte, drehte sich Zen um. Eine junge blonde Frau in Skianorak und Jeans stand da und starrte ihn an. Sie lächelte dümmlich und stach mit einem Finger in die Luft. Einen Augenblick glaubte Zen, sie müsse verrückt sein oder zu irgendeiner religiösen Sekte gehören. Dann sah er das Rechteck aus Pappe, das von der Decke hing und sich langsam im Luftzug über seinem Kopf drehte. Auf beiden Seiten war eine brennende Zigarette in einem roten Kreis abgebildet, der dick durchgestrichen war.
»Jetzt sagen Sie bloß, man darf hier auch nicht mehr rauchen!«, rief er ungläubig aus, worauf Valentini verlegen mit den Achseln zuckte.
»Der Stadtrat hat eine Verordnung erlassen, wonach Gaststätten verpflichtet sind, Nichtraucher-Zonen einzurichten. Ist eigentlich alles nur Schau, um die Touristen glücklich zu machen. Normalerweise achtet in einem Lokal wie diesem kein Mensch darauf, aber ab und zu besteht irgendein Arschloch darauf, dass man sich streng an die Buchstaben des Gesetzes hält.«
Er schob dem Kassierer ein paar Scheine zu, dann gingen sie nach draußen. Die Sonne war kräftiger und wärmer geworden. Zen blieb stehen, um sich einige Plakate anzusehen, die an der Wand klebten. Sie waren von der gleichen Machart wie die, die er auf der Scheibe des geschlossenen Cafés in Cannaregio gesehen hatte, doch die hier waren viel neuer. Oben war eine Abbildung des Löwen von San Marco, drohend aufgerichtet und mit trotzigem Ausdruck. Darunter stand in schwarzen Großbuchstaben: NUOVA REPUBBLICA VENETA, und der Text kündigte für den morgigen Abend eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Campo Santa Margherita an.
»Totales Chaos«, wiederholte Aldo Valentini, während er vor Zen her zur Questura zurückschlenderte. »Tag für Tag erfährt man, dass ein weiterer großer Name auf der Liste der Verdächtigen auftaucht, jemand, von dem man geschworen hätte, er sei absolut unantastbar. Die Vorwürfe reichen von Korruption bis hin zu Verbindungen zur Mafia. Mit dem Ergebnis, dass sich niemand mehr traut, einem Freund einen Gefallen zu tun. Es wäre mein sehnlichster Wunsch, dass dieses Land ein Paradies würde, was moralische Integrität angeht, aber wie, zum Teufel, sollen wir bis dahin über die Runden kommen?«
Zen nickte. Solche Gespräche führte er seit Monaten mindestens einmal am Tag. Inzwischen kannte er seinen Text auswendig.
»Es ist wie in Russland«, erklärte er. »Das alte System mag zwar furchtbar gewesen sein, aber zumindest hat es funktioniert.«
»Mein Schwager ist gerade in der Nähe von Rovigo in ein neues Haus eingezogen«, fuhr Valentini fort. »Die Leute von der Telefongesellschaft erklärten ihm, er müsse sechs Wochen auf einen Telefonanschluss warten. Also setzte er sich mit dem Techniker in Verbindung und bot ihm eine Bustarella an, Sie wissen schon. Nichts Übermäßiges, die üblichen Fünfzigtausend oder so, damit er ihn oben auf die Liste setzt.«
»Ganz normal«, murmelte Zen.
»Ganz normal. Wissen Sie, was der Kerl zu ihm gesagt hat? ›Kommt überhaupt nicht in Frage, Dottore. Dafür ist mir mein Job zu kostbar.‹ Können Sie sich das vorstellen? ›Dafür ist mir mein Job zu kostbar.‹«
»Widerlich.«
»Wie, zum Teufel, soll man bei dieser Einstellung irgendwas erledigt kriegen? Das kann einen regelrecht krank machen.«
Er warf seine Zigarette in den Kanal. Eine Möwe schnappte halbherzig danach und landete auf dem Dollbord des äußersten Polizeiboots.
In ihrem Büro stand ein Mann am Fenster, eingerahmt von den Sonnenstrahlen. Als Zen und Valentini eintraten, drehte er sich um.
»Also?« Er kam auf sie zu und sah Zen missbilligend an.
»Wer ist das?«, fragte er misstrauisch.
Valentini machte sie miteinander bekannt. »Aurelio Zen, Enzo Gavagnin. Enzo ist der Chef des Drogendezernats.«
Enzo Gavagnin hatte ein weibisches Gesicht und den stämmigen muskulösen Körper eines Gondoliere.
»Sind Sie versetzt worden?«
Zen schüttelte den Kopf. »Ich arbeite beim Ministerium«, sagte er. »Ich bin vorübergehend abkommandiert.«
Enzo Gavagnin sah Valentini an. »Ein Abgesandter aus Rom, was?«, murmelte er auf eine Art, die witzig und pointiert zugleich war. »Ich hoffe, du hast keins von unseren Geheimnissen verraten, Aldo.«
»Ich wusste gar nicht, dass wir welche haben«, antwortete Valentini locker. »Wie dem auch sei, jeder, der die weite Reise macht, um mir den Fall Ada Zulian abzunehmen, ist für mich ein Freund.«
Gavagnin lachte laut. »Das kann ich verstehen! Aber lassen wir das. Ich bin wegen dieses Einbruchs auf Burano gekommen.«
»Die Sfriso-Geschichte?«
»Wenn du deine Arbeitsbelastung noch weiter reduzieren willst, hast du Glück gehabt. Ich habʼ nämlich festgestellt, dass da möglicherweise ein Zusammenhang mit einem Fall besteht, an dem wir schon länger arbeiten …«
Valentini sah ihn zweifelnd an: »Ich weiß nicht, Enzo. Wenn ich an einem Morgen gleich zwei Fälle loswerde, könnten die Leute anfangen, Fragen zu stellen.«
Gavagnin nahm Valentini am Arm und zog ihn beiseite. »Es ist nur wegen eines möglichen Interessenkonflikts. Wir wollen doch wohl keine laufende Ermittlung gefährden, deshalb ist es in jeder Hinsicht besser, wenn …«
Die beiden verschwanden hinter der gläsernen Trennwand, die Valentinis Schreibtisch umgab, und wurden zu verschwommenen unscharfen Bildern. Zen ging in seine Ecke und nahm das Telefonbuch aus der Schreibtischschublade. Er sah unter Paulon, M. nach und wählte die Nummer.
»Ja?«
Die Antwort war so abrupt, dass sie fast unverschämt klang.
»Marco?«
»Wer ist da?«
»Aurelio.«
Es entstand eine kurze Pause.
»Aurelio! Wie gehts dir? Ich habʼ erst vor kurzem etwas über dich in der Zeitung gelesen. Diese Sache in der Peterskirche. Früher bin ich mit ihm angeln gegangen, dachte ich, und jetzt verkehrt er mit Erzbischöfen und so was! Fand ich richtig aufregend. Bist du in der Stadt?«
»Ja. Können wir uns treffen?«
»Selbstverständlich!«
»Ich brauche einen Rat, vielleicht auch Hilfe.«
»Nun ja, ich muss den ganzen Morgen ausliefern, aber … Kennst du die Osteria am San-Girolamo-Kanal, gegenüber der Kirche?«
Enzo Gavagnin kam aus Valentinis Ecke, nachdem er offenbar alles besprochen hatte. Im Vorbeigehen warf er Zen einen wissenden Blick zu.
»Wie heißt sie?«, fragte Zen.
»Verdammt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich esse dort zwar seit zwanzig Jahren an jedem Wochentag zu Mittag, aber mich hat nie interessiert, wie der Laden heißt. Alle nennen ihn ›Das Loch in der Wand‹. Auf dem Fenster steht irgendwas in roter Farbe. Gegenüber der Kirche. Worum gehts überhaupt?«
»Erkläre ich dir später. Danke, Marco.«
Er stand auf und knöpfte seinen Mantel zu. Die Vorbereitungen waren erledigt. Es wurde Zeit, dass er so tat, als würde er seiner Aufgabe nachgehen.
Als es klingelt, ist ihr erster Gedanke, dass es sich um eine weitere Gemeinheit handelt, wieder um einen dieser grausamen Streiche, mit denen man ihr Durchhaltevermögen und ihren labilen Geisteszustand auf die Probe stellen will. Heutzutage gibt es keine Besucher mehr im Palazzo Zulian, außer wenn ihre Neffen am Wochenende von Verona kommen – regelmäßig wie die Gezeiten. Aber heute ist Dienstag, und Nanni und Vincenzo arbeiten, was immer sie auch tun …
Es klingelt noch einmal. Damit schwindet die denkbare Möglichkeit, dass sich das Ganze nur in ihrem Kopf abgespielt hat. Was zweimal passiert, ist real, denkt Ada, während sie durch den Flur in das Zimmer auf der anderen Seite schleicht, das auf die Gasse hinausgeht. Dort kann man nämlich in einem eckigen Spiegel, der an einer Stütze draußen vor dem Fenster befestigt ist, die Haustür sehen. Auf diese Weise kann man feststellen, wer klingelt, ohne selbst gesehen zu werden, und entscheiden, ob man den Besucher empfangen will. Doch Ada zieht den Kopf sofort zurück, denn im Spiegel sieht sie ein Gesicht, das geradewegs zu ihr heraufschaut.
»Contessa!«
Eine fremde Stimme. Keiner von ihren Peinigern oder wenn, dann ein neuer. Sie riskiert einen weiteren Blick. Die hagere Gestalt mit schwarzem Hut und Mantel steht immer noch da und starrt zu dem verräterischen Spiegel hinauf. Es hat keinen Zweck, sich zu verstecken. Wenn sie ihn sehen kann, kann er sie auch sehen. Das ist doch logisch, sagt sich Ada Zulian, während sie widerwillig zur Tür zurück und die Treppe hinuntergeht.
Der Fremde ist groß und schlank, hat ein scharfgeschnittenes Gesicht und klare graue Augen. Sein Ausdruck ist ernst, beinah düster, doch sein Verhalten ist höflich und respektvoll. Er spricht den Dialekt mühelos und exakt mit einem echten Cannaregio-Akzent – dem reinsten in der ganzen Stadt, wie Ada immer behauptet hat. Er gibt ihr eine mit Plastik überzogene beschriebene Karte mit einem Foto von sich. Angesichts des in Großbuchstaben getippten Namens runzelt sie die Stirn.
»Zen?«, sagt sie gedehnt. Sie mustert ihn erneut, diesmal noch kritischer.
»Das ist richtig, Contessa«, sagt der Mann nickend. »Der Sohn von Angelo.«
Ada schnieft laut. »Von Giustiniana meinst du wohl. Dein Vater hatte nur eins damit zu tun, entschuldige. Das muss man sich mal vorstellen. Geht einfach nach Russland und lässt sich da umbringen! Und seine Frau ist hier ganz allein! Mein Silvestro ist wenigstens gefallen, als er unsere Gebiete in Dalmatien verteidigte. Was haben wir mit Russland zu tun, um Himmels willen? Komm rein, komm rein. Mir wird kalt, wenn ich nur daran denke.«
Während Ada die Tür wieder abschließt und verriegelt, sieht sich ihr Besucher in dem trüb und schemenhaft beleuchteten Andron um. Der Putz an den Wänden fühlt sich kalt und klamm an und gibt unter der Berührung leicht nach wie ein nasser Schwamm. Ein geheimnisvolles Lächeln macht sich auf dem Gesicht des Mannes breit, während er die unangenehm feuchten Gerüche in sich aufnimmt und auf das Plätschern des Wassers lauscht, das vom anderen Ende des Flurs eindringt.
»Sie hat dich immer hergebracht, wenn sie arbeiten ging«, fährt Ada fort, während sie vor ihm die Treppe hinaufsteigt. »Und als sie merkte, dass es mir nichts ausmachte, ließ sie dich auch hier, wenn sie was anderes zu erledigen hatte. Natürlich wirst du dich nicht daran erinnern, du warst noch ein kleines Kind.«
Der Mann schweigt. Mit Mühe erreicht Ada den weitläufigen Portego und winkt Zen in den Salon.
»Also, was führt dich her? Deine Mutter ruft mich nie mehr an, aber das tut auch sonst keiner mehr. Nicht nach dem Problem, das ich mit Rosetta hatte. Die Leute scheinen zu meinen, das sei ansteckend!«
»Aber wie ich gehört habe, haben Sie in letzter Zeit noch einige andere Probleme«, bemerkt der Mann vorsichtig.
Ada Zulian sieht ihn an. »Vielleicht ja, vielleicht nein«, antwortet sie bissig. »Was geht dich das an, Aurelio Battista?«
»Nun, da Sie die Polizei informiert haben …«
»Die Polizei? Was hast du mit der Polizei zu tun?«
»Ich arbeite da.«
Adas Gelächter zerreißt die Stille. Der Mann wirkt betroffen.
»Was ist so komisch?«, fragt er.
»Bei der Polizei? Aber du warst doch so ein schüchterner kleiner Kerl! So ernsthaft und ängstlich, so leicht zu erschrecken! Deshalb bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen.«
»Welche Idee?«
»Dich wie Rosetta anzuziehen! Damals hatte ich noch all ihre Kleider, ihre kleinen Blusen und Strümpfe, alles. Als ich nach San Clemente ging, haben sie mir alles weggenommen und es verbrannt. Aber damals glaubte ich noch, sie würde eines Tages zurückkommen. Wirklich, meine ich. Einfach hereinspazieren, so plötzlich und unerklärlich, wie sie verschwunden war. Ich wollte alles für sie bereit haben, nur für den Fall. Weißt du, ich hätte keine Fragen gestellt. Ich hätte sie wieder aufgenommen und so getan, als ob nichts passiert wäre …«
Plötzlich wendet sie den Blick ab, als ob sie in einer Ecke eine Bewegung gesehen hätte. Nur an einem Fenster sind die Läden nicht geschlossen, und durch die zahlreichen Spiegel in allen Größen und Formen, deren vergoldete Rahmen aus dem gleichen Holz wie die Möbel sind, wirkt die düstere Weite des Salons noch größer und verwinkelter.