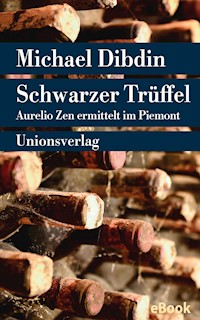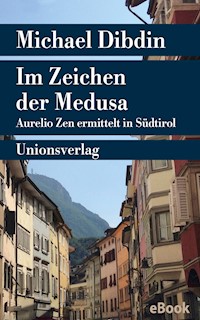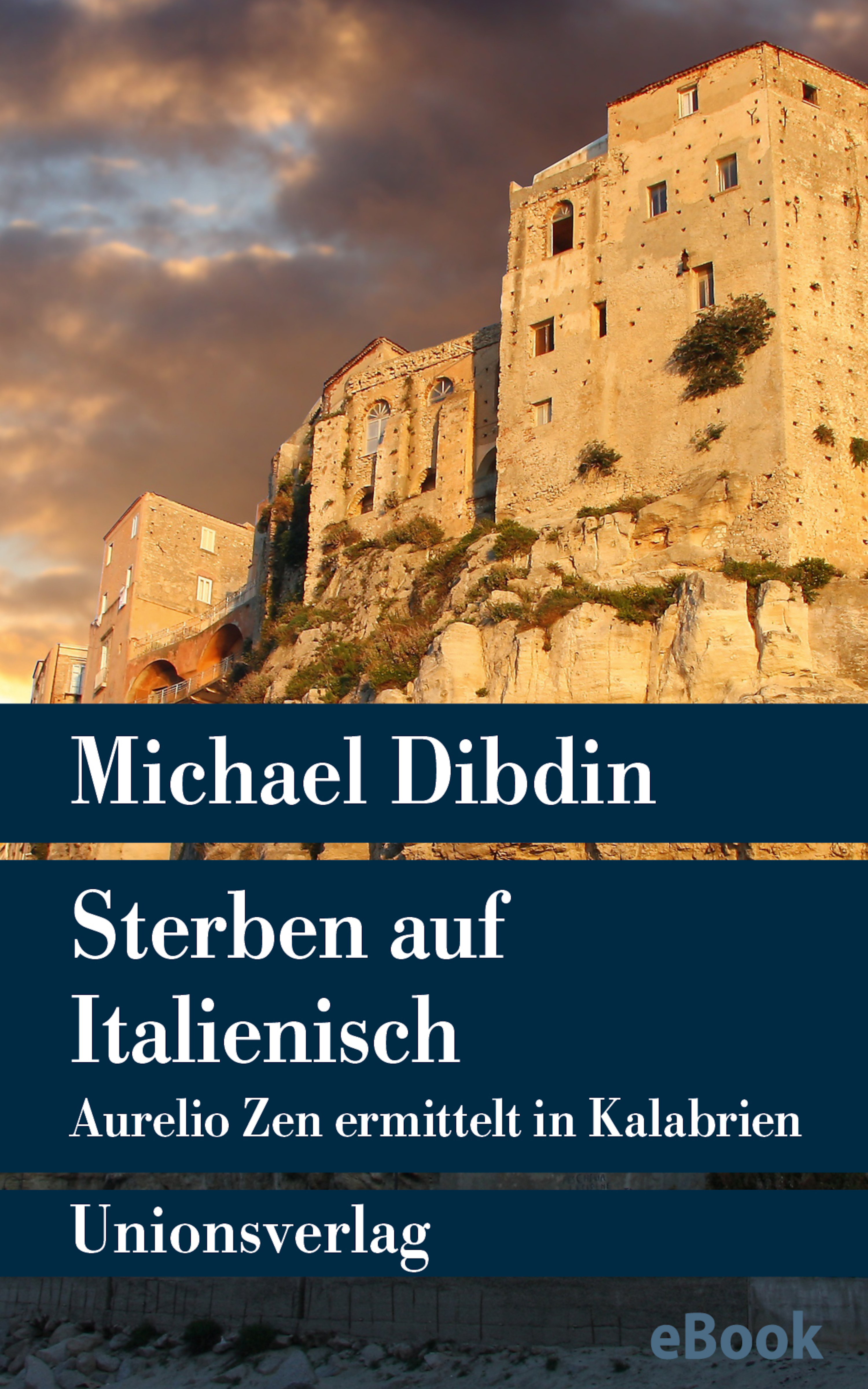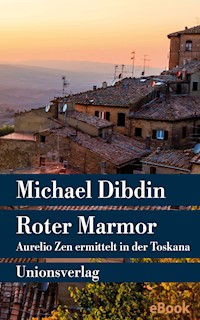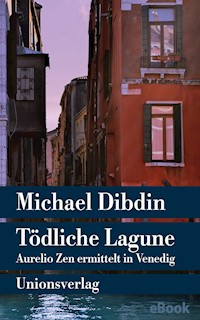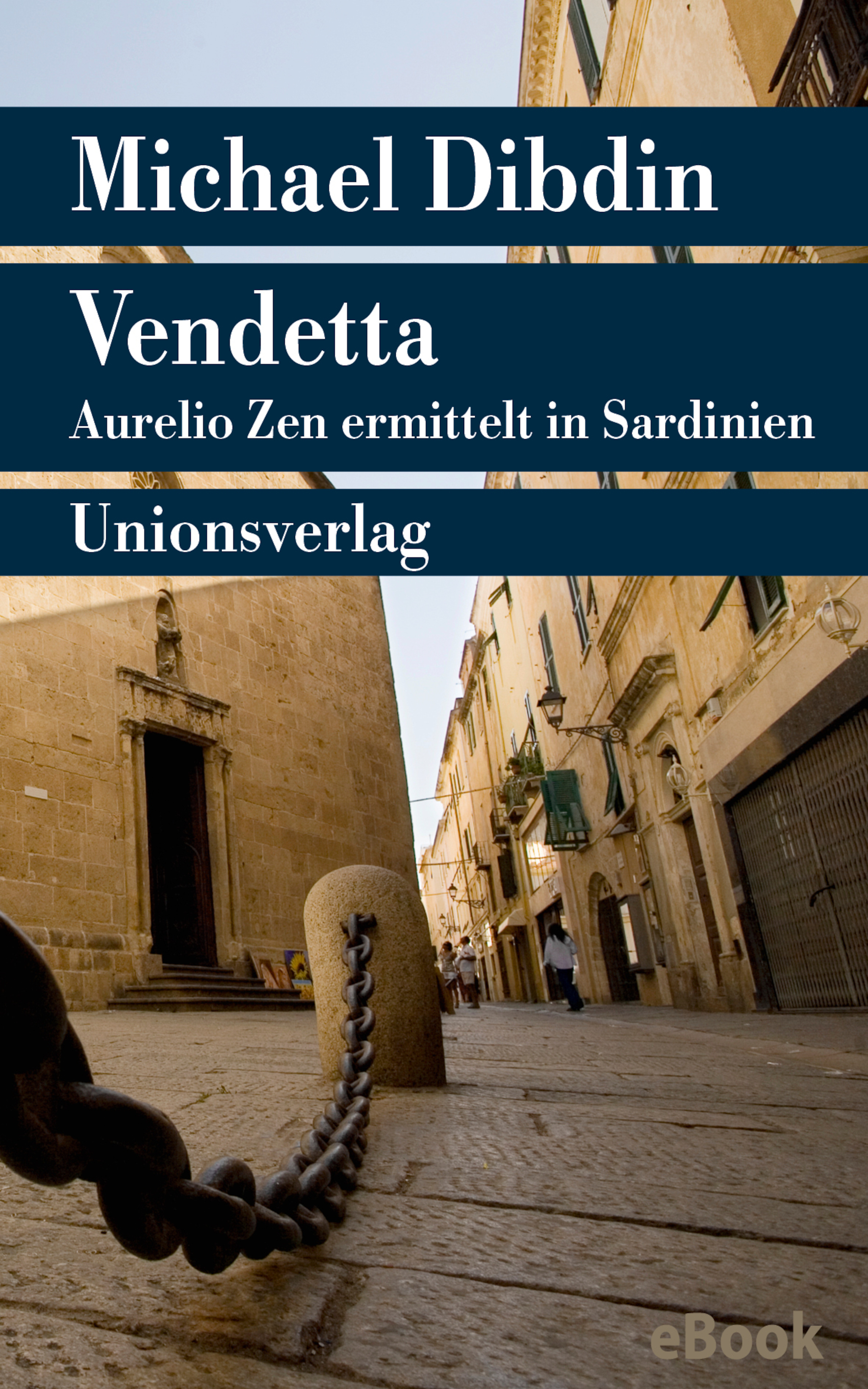11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rom, Sankt Peterskirche: An einem grauen Novembernachmittag stürzt Prinz Ludovico Ruspanti in den Tod. War es Selbstmord? Polizeikommissar Aurelio Zen glaubt nicht daran. Des Prinzen Himmelfahrt entwickelt sich zu einem außergewöhnlichen Fall für den römischen Kommissar. Als er versucht, in die dunklen Geheimnisse des Vatikans einzudringen, sieht er sich einer scheinbar unüberwindbaren Mauer des Schweigens gegenüber. Denn Zeuge für Zeuge verstummt für immer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Rom, Sankt Peterskirche: An einem grauen Novembernachmittag stürzt Prinz Ludovico Ruspanti in den Tod. Des Prinzen Himmelfahrt wird ein Sonderfall für Kommissar Aurelio Zen. Als er versucht, in die dunklen Geheimnisse des Vatikans einzudringen, sieht er sich einer Mauer des Schweigens gegenüber. Denn Zeuge für Zeuge verstummt für immer.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Michael Dibdin (1947–2007) studierte englische Literatur in England und Kanada. Vier Jahre lehrte er an der Universität von Perugia. Bekannt wurde er durch seine Figur Aurelio Zen, einen in Italien ermittelnden Polizeikommissar.
Zur Webseite von Michael Dibdin.
Ellen Schlootz arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie hat u. a. Werke von Ian Rankin und David Hosp ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Ellen Schlootz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Michael Dibdin
Himmelfahrt
Aurelio Zen ermittelt in Rom
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ellen Schlootz
Aurelio Zen ermittelt (3)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel Cabal im Verlag Faber and Faber, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 im Goldmann Verlag, München.
Originaltitel: Cabal (1992)
© by Michael Dibdin 1992
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Matyas Rehak
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30886-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 14:07h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
HIMMELFAHRT
1 – »… quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et …2 – Rein äußerlich war der Eindruck, den das Innenministerium …3 – Wenn Zen die Nacht zu Hause verbracht hätte …4 – Sie schlenderten Hand in Hand, mit ineinandergeschlungenen Fingern …5 – Seit seiner Versetzung von Neapel in die Hauptstadt …6 – Auf der Piazza vor der römischen Stazione Termini …7 – Zens Hotel lag neben dem Bahnhof, ein dreißig …Mehr über dieses Buch
Über Michael Dibdin
Über Ellen Schlootz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Michael Dibdin
Zum Thema Italien
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Religion
Für John Sheringham
Ich dagegen glaube, dass die ganze Geschichte, gestern wie heute, voller heuchlerischer Possen war, bei denen jeder Mitwirkende eine Doppelrolle spielte, wo wahre Informationen für falsch und falsche Informationen für wahr gehalten wurden: kurz gesagt, voll von dem grauenhaften Unsinn, von dem wir Italiener in den letzten paar Jahren so viele Beispiele gesehen haben.
Leonardo Sciascia
1
»… quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.«
Durch das Lautsprechersystem und die volltönende Akustik der großen Basilika verstärkt, hallte die Stimme des Priesters, der die Messe las, mit übermenschlicher Autorität wider, anscheinend ohne jede Beziehung zu der winzigen Gestalt, die sich wie ein Knödeltenor auf einer Provinzbühne gegen die Brust schlug. Die etwa fünfzig Gläubigen, die an diesem trostlosen Abend Ende November zusammengekommen waren, waren alle bereits in fortgeschrittenem Alter und überwiegend weiblich. Apsis und Kapelle der Cattedra, für sich schon weiträumiger als die meisten Kirchen insgesamt, waren von uniformierten Wächtern für den Gottesdienst abgesperrt worden, doch in anderen Bereichen der Peterskirche spazierten Touristen und Pilger weiterhin allein oder in Gruppen herum und kosteten, ganz benommen von all der geistlichen und weltlichen Pracht, die allenthalben auf sie einstürmte, apathisch den bitteren Geschmack der eigenen Bedeutungslosigkeit aus.
Für einige von ihnen war das Läuten der Glocke, die Orgelklänge und die Prozession des rot gewandeten Priesters und der Ministranten eine willkommene Abwechslung von all der erdrückenden Größe, fast so, als ob die Nachmittagsmesse eine Art Schauspiel wäre, von der Kirche inszeniert als Versuch, diese kühle Monstrosität zum Leben zu erwecken, ein Son-et-Lumière-Spektakel, das die Erinnerung an die religiöse Funktion, die die Messe ursprünglich hatte, heraufbeschwören sollte. Neugierig wie kleine Kinder drängelten sie sich hinter den Seilen, die die Apsis abteilten, und gafften auf Berninis schamlos bombastische Lichtstrahlen und die großartigen Grabmäler der Päpste auf beiden Seiten. Eine Weile nahmen die rhythmischen Kadenzen der lateinischen Liturgie ihre Aufmerksamkeit gefangen, doch als dann aus der Apokalypse des Johannes gelesen wurde, gingen viele Leute weg. Die, die blieben, waren unruhig und zappelig, flüsterten miteinander oder blätterten raschelnd in ihren Reiseführern.
Ein Mann, der ein wenig abseits von der Menge stand, schenkte dem Gottesdienst ganz offensichtlich keinerlei Aufmerksamkeit. Er trug eine Wildlederjacke und ein geblümtes Hemd, das so weit aufgeknöpft war, dass man die schwere Goldkette sehen konnte, die auf seiner üppig behaarten Brust prangte. Seine kräftigen Arme hatte er verschränkt, wodurch ein Ärmel seines Jacketts hochgerutscht war und den Blick auf die goldene Rolex Oyster an seinem linken Handgelenk freigab. Sein großes, rundes und leicht nach innen gewölbtes Gesicht war wie eine Satellitenschüssel nach oben gerichtet, die ein mit dem bloßen Auge nicht erkennbares Himmelsobjekt verfolgt, hoch oben in der dunklen Tiefe der unbeleuchteten Kuppel. Nicht weit von ihm, am Fuß einer der massiven Spiralsäulen, die den kunstvollen bronzenen Baldachin über dem päpstlichen Altar tragen, war eine Frau ebenfalls in das sich oben abspielende Schauspiel vertieft. Mit ihrem grauen Tweedmantel, der klassischen schwarzen Wolljacke, dem wadenlangen Samtrock und dem weißen Seidentuch, das ihre Haare bedeckte, wirkte sie wie eine Designer-Version der alten Mütterchen, die den größten Teil der versammelten Gemeinde bildeten. Doch ihr leuchtend roter Lippenstift, der nur bedingt zu ihren eiskalten blauen Augen passte, signalisierte eine ganz andere Botschaft.
Die auf die Lesung folgende Predigt klang weniger wie ein gelehrter Diskurs als wie ein spontaner Frustrationsausbruch seitens des Priesters, der sich über das magere Erscheinen ärgerte. Früher, so klagte er, war die Kirche das Zentrum der Gemeinde, eine besondere Stätte, wo die Menschen zusammenkamen, um die Gegenwart Gottes zu spüren. Und wie war das heute? Die Geschäfte, Diskotheken, Nachtclubs, Kneipen und Fast-Food-Läden mussten die Leute sogar schon wegen Überfüllung wegschicken, während die Kirchen leerer denn je waren. Der touristische Durchgangsverkehr hatte sich inzwischen weitgehend zerstreut, aber diese Art von Argumentation lief offenbar Gefahr, auch noch den harten Kern der Gemeinde zu vergraulen, da sie den Leuten ihren Status als anachronistische Randgruppe bewusst machte, als Vertreter einer überholten Denkweise. Husten, Scharren und allgemeine Unaufmerksamkeit machten sich breit.
Für eine kurze Abwechslung sorgte eine Nonne mit vorstehenden Zähnen und Brille, die atemlos und hektisch angehastet kam und einen großen Strauß Blumen umklammert hielt. Sie entschuldigte sich bei den Wächtern, die sie mit einem Schulterzucken durch die Absperrung winkten. Nachdem sie den Strauß auf der Balustrade um die riesige Statue der heiligen Veronika abgelegt hatte, nahm die Nonne auf einer der hinteren Bänke Platz, während der Priester gerade das Credo anstimmte. Ein Sicherheitsbeamter in Zivil, der das Ganze vom Rande der Versammlung beobachtet hatte, ging hinüber, hob die Blumen auf und inspizierte sie argwöhnisch, als ob sie möglicherweise explodieren könnten.
»Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos …«
Zuerst klang es wie eine elektronische Rückkopplung aus den Lautsprechern, dann wie das Kreischen eines tieffliegenden Flugzeugs. Einige der herausgehenden Touristen schauten in die bedrohlich über ihnen schwebende Kuppel hinauf, wie es der Mann mit der Wildlederjacke und der goldenen Kette und die Frau mit dem Tweedmantel und dem weißen Kopftuch die ganze Zeit über getan hatten. Dort jedenfalls schien das unheimliche Geräusch herzukommen, eine Mischung aus Winseln und Knurren, das sich in der Basilika ausbreitete wie bunte Farbe in einem Becken voll Wasser. Dann erspähte jemand die Erscheinung hoch oben und fing an zu schreien. Der Priester geriet ins Stocken, und selbst die Gemeinde drehte sich um, um zu sehen, was da vor sich ging. Es herrschte absolute Stille, während alle zusahen, wie das schwarze Etwas aus der dunklen Höhe auf sie herabstürzte.
Der Anblick war eine Art Rorschachtest für die geheimen Ängste und Fantasien eines jeden. Eine an Arthritis leidende Schneiderin, die über einer Karosseriewerkstatt im Borgo Pio wohnte, glaubte, der lang ersehnte Engel sei endlich gekommen, um sie von ihren körperlichen Qualen zu erlösen. Ein Apotheker im Ruhestand aus Potenza dagegen, der erst zum zweiten Mal in seinem Leben die Hauptstadt besuchte, erinnerte sich an das Erdbeben, das erst kürzlich seine eigene Stadt verwüstet hatte, und meinte, ein großes Stück aus der Kuppel herabfallen zu sehen, als erstes Zeichen für den allgemeinen Zusammenbruch. Andere dachten konfus an Spinnen und Fledermäuse, ein Kunststück von Superman oder eine Zirkusnummer. Nur einer der Beobachter wusste genau, was da vor sich ging, weil er das alles schon erlebt hatte. Giovanni Grimaldi ließ den Blumenstrauß der Nonne auf den Marmorfußboden fallen, wo er auseinanderfiel, und griff nach seinem Funksprechgerät.
Spätere Berechnungen ergaben, dass zwischen der ersten Wahrnehmung und dem endgültigen Aufprall kaum mehr als vier Sekunden vergangen sein konnten. Denjenigen, die ungläubig und mit wachsendem Entsetzen zusahen, war es allerdings so vorgekommen, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Man hätte durchaus meinen können, dass die Gestalt durch eine Materie fiel, die dichter war als Luft, so langsam schien sie herunterzukommen. Sie drehte sich träge um die eigene Achse, wobei die lang anhaltende Klage sie wie ein wallendes Gewand umhüllte. Rumpf und Glieder vollführten gemächlich eine Sarabande, die abrupt endete, als der Körper mit annähernd 120 Stundenkilometern mit dem Kopf zuerst auf dem Marmorboden aufschlug.
Niemand bewegte sich. Der feucht glänzende Haufen aus Blut und Bindegewebe sank mit einem leise furzenden Geräusch sanft in sich zusammen. Priester und Gemeinde, Touristen und Wächter, alle standen so still und starr wie Figuren in einer aus Gips geformten Darstellung von Christi Geburt. In den hinteren Ecken und Winkeln des weiträumigen Gebäudes verebbte das letzte Echo des lang gezogenen Schreis. Dann nahmen, schrill wie eine Trompete, erst eine, dann viele Stimmen das Geräusch wieder auf, schrien hysterisch, heulten, schluchzten und keuchten.
Giovanni Grimaldi ging auf den Körper zu. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, wie in einem bösen Traum, da die Menge sich immer wieder vor ihm schloss und ihn nicht durchließ. Endlich gelangte er in den inneren Kreis, in den sich niemand mehr vorwagte, rutschte prompt aus und fiel hin, wobei sein Funksprechgerät mit lautem Geklapper neben ihm zu liegen kam. Instinktiv wich die Menge zurück, voller Furcht über den erneuten Beweis für die böse Macht, die in diesen mörderischen Boden gefahren war. Das Geschrei wurde noch doppelt so laut, weil die Menschen in den hinteren Reihen umgeworfen und überrannt wurden. Während die Wächter versuchten, die Menge unter Kontrolle zu bringen, stand Grimaldi auf. An seinem blauen Anzug klebte das Blut, auf dem er ausgerutscht war. Auf den Marmorplatten war es hingegen kaum zu sehen, ein paar leichte Spritzer, die sich perfekt mit den scharlachroten Adern unter der auf Hochglanz polierten Oberfläche vermischten.
Er hob sein Funksprechgerät wieder auf und drückte die Ruftaste. Während sich die Zentrale wie üblich mit dem Antworten Zeit ließ, schaute Grimaldi um sich und versuchte, den Mann mit der Wildlederjacke und die Frau im Tweedmantel zu finden, doch sie waren nicht mehr da.
»Ja?«, rief ihm eine von lautem Knistern begleitete Stimme verärgert ins Ohr.
»Hier ist Grimaldi. Wir haben einen Springer in der Basilika.«
»Davor oder danach?«
»Danach.«
Er schaltete das Funksprechgerät aus. Da gab es nichts weiter zu sagen. Selbstmorde waren in der Peterskirche nichts Ungewöhnliches, teilweise aufgrund der magischen Anziehungskraft, die hohe Gebäude generell auf Leute mit derartigen Ambitionen haben, mehr aber noch aufgrund des weitverbreiteten Glaubens, dass diejenigen, die auf dem Grab des Apostels sterben, direkt in den Himmel kämen und den üblichen Papierkrieg und Ärger hinsichtlich der Zulassungsquoten umgehen könnten. Die Kirche hatte wiederholt und ausführlich gegen diesen primitiven Aberglauben gepredigt, doch vergeblich. Der Teil der inneren Galerie unterhalb der Kuppel, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, war zwar mit einer zwei Meter hohen Sicherheitsabsperrung aus Maschendraht versehen worden, aber wenn Leute sich ernstlich genug umbringen wollen, kann man sie einfach nicht daran hindern.
Dennoch war dieser Sprung hier einmalig, zumindest nach Grimaldis Erfahrung. Soweit er wusste, hatte es noch nie jemand geschafft, sich während einer Messe umzubringen. In dieser Zeit ist die Kuppel nämlich nicht zugänglich.
Grimaldis Mitteilung löste eine gut eingespielte Routine aus. Zunächst wurde die Basilika geräumt. Augenzeugen, die einen Schock erlitten hatten, wurden über die Piazza zur Erste-Hilfe-Station des Vatikans gebracht. Auf dem Weg dorthin mussten sie kurz stehen bleiben, um einen Krankenwagen aus dem nahe gelegenen Santo-Spirito-Krankenhaus vorbeizulassen. Wenn es Leben zu retten galt, wie beispielsweise damals, als Papst Wojtyla angeschossen wurde, hielt sich die Kirche lieber an den hohen Standard ihres eigenen Policlinico Gemelli. Doch wenn es darum ging, Leichen abzutransportieren, dann waren die Einrichtungen des italienischen Staates gut genug.
Der Krankenwagen fuhr langsam auf das Tor neben dem Glockenbogen zu, wo ihn Schweizergarden, die entsprechende Anweisungen erhalten hatten, zu den kleinen, dunklen Höfen an der Ostseite der Peterskirche durchwinkten. Kurz hinter der enormen Wölbung des Querschiffs hielt ein uniformierter Angehöriger der Vigilanza, der Sicherheitstruppe des Vatikans, das Fahrzeug an. Die Sanitäter stiegen aus, öffneten die hinteren Türen und zogen eine Bahre heraus. Dann folgten sie dem Wachmann durch eine Tür in einen kahlen, ansteigenden Gang, der durch die massiven, tiefer liegenden Wände der Basilika gegraben worden war. Sie gingen durch zwei kleine Vorzimmer, dann durch eine Tür, die sich hinter den winkenden Gerippen von Berninis Grabmal für Alexander VII. verbarg, und von dort in die Basilika selbst.
In dem Bereich zwischen Apsis und päpstlichem Altar stand ein Putztrupp in blauen Overalls mit Mopp und Eimern bereit, die physischen Spuren dieser Schandtat zu beseitigen, nachdem der Leichnam entfernt worden war. Danach würde man einen Bischof kommen lassen, um den entsprechenden geistlichen Akt durchzuführen, einen Ritus, der den entweihten Ort wieder weihen würde. Die Sanitäter stellten ihre Bahre ab und fingen an, den grünen Plastiksack auseinanderzufalten, in den sie die Überreste einpacken wollten. An dieser Stelle wandte sich Giovanni Grimaldi zur Seite, weil sein Magen revoltierte und sich aufbäumte wie ein Fisch im Netz. Gerade weil er sich Anblicke wie diesen ersparen wollte, war er in den Dienst des Vatikans getreten.
Als Sohn eines Fischers aus Otranto hatte Grimaldi seine berufliche Laufbahn bei den Carabinieri begonnen, und da er intelligenter als der Durchschnitt war, wurde er sehr rasch für Ermittlungstätigkeiten eingesetzt. Vier Jahre hatte er es dort ausgehalten, wobei er heroisch gegen ein Gefühl des Ekels ankämpfte, von dem er wusste, dass es ihn letztlich unterkriegen würde. Jedes Mal, wenn er den Schauplatz eines Gewaltverbrechens besichtigen musste, zogen sich seine Gedärme zusammen, sein Atem ging röchelnd wie bei einem Asthmatiker, seine Haut war schweißüberströmt, und sein Herz raste. Tagelang danach konnte er nicht richtig schlafen, und wenn er doch einmal einschlief, hatte er so fürchterliche Träume, dass er wünschte, er wäre wach geblieben.
Seinen Kollegen schien es nichts auszumachen, am Morgen die Überreste von vier stadtbekannten Ganoven aus einem ausgebrannten Auto rauszukratzen und sich dann zum Mittagessen ein saftiges Stück Grillbraten schmecken zu lassen. Grimaldi besaß diese Fähigkeit, Beruf und Privatleben zu trennen, nicht. Die Erfahrung hatte sogar körperlich ihre Spuren hinterlassen. Sein Rücken war gebeugt, den Kopf hielt er stets gesenkt und das Gesicht abgewandt, seine Augen hatten den misstrauischen und vorsichtigen Blick von misshandelten Kindern. Sein Haar hatte begonnen, mit beunruhigender Geschwindigkeit auszufallen, und in seinem Gesicht bildeten sich tiefe Falten, bis er schließlich älter aussah als sein eigener Vater, der noch immer Nacht für Nacht mit einer Gruppe illegaler algerischer Einwanderer in See stach und dem alles scheißegal war.
Das übliche Schicksal ehemaliger Carabinieri ist es, eine Stelle in einer der zahlreichen privaten Bankwachmannschaften anzunehmen. Doch dank eines Lokalpolitikers, der für ihn ein Wort bei einem Bischof einlegte, der die Angelegenheit gegenüber einem Monsignore aus der Kurie erwähnte, dem ein gewisser Erzbischof im Palazzo del Governatorato gewogen war, kam Giovanni nach Rom und wurde ein Mitglied der Vigilanza. Aufgrund seiner Erfahrung und seiner Fähigkeiten wurde er schon bald in eine spezielle Ermittlungseinheit versetzt, die unmittelbar dem Kardinalstaatssekretär unterstand. Abgesehen davon, dass sie die Bagatellverbrechen untersuchte, die auf vatikanischem Gebiet verübt wurden – zumeist kleinere Diebstähle –, führte diese Gruppe angeblich auch eine Reihe verdeckter Operationen aus, die den Angestellten der Kurie immer reichlich Stoff für Klatsch und Tratsch lieferten. Seine Kinder besuchten ihn jetzt nur noch in den Ferien und seine Frau in seinen Träumen, denn sie war ein Jahr, nachdem er sich in der Hauptstadt niedergelassen hatte, an Krebs erkrankt. Die Kinder wohnten jetzt bei Grimaldis Schwester in Bari, während er ziemlich isoliert in einem Haus, das der Kirche gehörte, in der Nähe des Vatikans lebte und versuchte, so gut es ging, für seine abwesende Familie zu sorgen und etwas für die Zukunft auf die Seite zu legen.
Gegen seinen Willen sah Grimaldi hin, als die Sanitäter den Toten in den Plastiksack packten. Mit unpersönlicher Neugier, so als ob er einen Film sähe, stellte er fest, dass der blaue Anzug, mit dem der zerschmetterte Körper bekleidet war, von höchster Qualität war und dass einer der eleganten, schwarzen Schnürschuhe fehlte. Er sah sich noch einmal den Anzug an. Er kam ihm merkwürdig bekannt vor. Sein Atem ging plötzlich ganz keuchend. Nein, dachte er, bloß das nicht. Bitte nicht.
Die Sanitäter hatten bereits angefangen, den Körper zu einer Art Paket zu verschnüren. »Einen Augenblick«, sagte Grimaldi zu ihnen. »Wir müssen erst wissen, wer er war.«
»Das wird alles im Krankenhaus erledigt«, antwortete einer der Männer wegwerfend, ohne überhaupt aufzublicken.
»Das Opfer muss identifiziert werden, bevor der Leichnam den Vertretern der italienischen Behörden übergeben werden kann«, zitierte Grimaldi pedantisch.
Der Sanitäter blickte gequält auf, als ob er es mit einem Schwachsinnigen zu tun hätte. »Der ganze Schreibkram wird im Leichenschauhaus erledigt. Wir haben eine strikte Arbeitsteilung.«
Grimaldi setzte seinen Fuß auf die Plastikfolie nur wenige Zentimeter von der Hand des Mannes entfernt. »Also für euch mag das hier ja bloß ein anderes Ende von Trastevere sein, aber als ihr durch den Bogen dort drüben gefahren seid, an unseren Schweizer Freunden in ihren schicken Kostümen vorbei, habt ihr Italien verlassen und befindet euch jetzt auf fremdem Gebiet. Und wie jeder andere ausländische Staat hat auch dieser seine eigenen Bestimmungen und Regeln, und im vorliegenden Fall verlangen diese Regeln, dass diese Leiche, bevor sie den Vertretern des italienischen Staates – das seid ihr – übergeben werden kann, von einem Beamten der Vatikanstadt – das bedeutet in diesem Fall von mir – ausreichend identifiziert wird. Machen wir uns also an die Arbeit. Gebt mir alles, was in seinen Taschen ist.«
Der Sanitäter gab mit einem tiefen Seufzen zu verstehen, dass er sich notgedrungen angesichts der Macht, aber nicht angesichts des Rechts füge, und fing an, die Kleidung des Toten zu durchsuchen. Die Hosentaschen und die Außentaschen der Jacken waren leer, doch die mit einem Reißverschluss zugezogene linke Innentasche enthielt einen großen, anscheinend neuen Metallschlüssel und eine abgewetzte Brieftasche mit Personalausweis und Führerschein. Der Sicherheitsbeamte warf einen Blick auf die Dokumente, dann drehte er abrupt den anderen den Rücken zu und stellte sein Funksprechgerät wieder ein.
»Hier ist Grimaldi«, sagte er mit vor Aufregung heiserer Stimme. »Sag dem Chef, er soll sofort rüberkommen! Und am besten benachrichtigst du auch gleich Seine Exzellenz.«
Aurelio Zen hingegen würde dieser Freitag immer als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem die Lichter ausgingen.
Sein erster Gedanke war, dass es sich um eine persönliche Dunkelheit handelte, wie sie vor ein paar Monaten über den armen Romizi hereingebrochen war. »Na los, Carlo, versuch doch zumindest, so auszusehen, als ob du arbeiten würdest!«, hatte einer der Beamten spöttisch beim Anblick des Umbriers bemerkt, der an seinem Schreibtisch erstarrt war, eine graue, schwitzende Fleischmasse. Romizi war immer eine Zielscheibe des Spotts innerhalb von Criminalpol gewesen. Erst an diesem Morgen hatte Giorgio De Angelis eine neue angebliche Anekdote über ihren unsäglichen Kollegen zum Besten gegeben. »Romizi wird zu einer Konferenz nach Paris geschickt. Er ruft im Reisebüro an. ›Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie lange man bis Paris braucht?‹ ›Einen Augenblick‹, sagt der Angestellte und greift nach seinem Fahrplan. ›Vielen Dank‹, sagt Carlo und hängt ein.«
Doch was mit Romizi passiert war, war ganz und gar nicht komisch. »Ein Blutgerinnsel im Gehirn«, hatte der Arzt erklärt, als Zen seinen Kollegen im San-Giovanni-Krankenhaus besuchte. Auf die Frage nach seiner Prognose hatte er nur seufzend den Kopf geschüttelt. Romizis Frau Anna und seine Schwester Francesca kümmerten sich um ihn. Zen kannte Anna von der Fotografie auf Carlos Schreibtisch, das sie als junge Mutter mit ihren kleinen Zwillingssöhnen auf dem Schoß zeigte. Aus dieser jungen Frau mit den frischen, leicht pausbäckigen Gesichtszügen war nun eine typische Südländerin geworden, verbissen, unerschrocken und geduldig. Zen sagte die üblichen Floskeln und zog sich, sobald er dies mit Anstand tun konnte, wieder zurück. So unmittelbar mit der Tatsache konfrontiert zu werden, dass unser Leben letztlich auf einem sehr anfälligen Fundament beruht, erschreckte und deprimierte ihn. Es schien nicht weiter erstaunlich, dass es ganz einfach ohne Vorwarnung zusammenbrechen konnte. Im Gegenteil, es war ein Wunder, dass es überhaupt funktionierte. Mit wachsender Panik achtete er auf das Schlagen seines Herzens, spürte das Blut durch seine Adern kreisen und stellte sich vor, wie die einzelnen Organe ihre rätselhaften und geheimnisvollen Funktionen ausübten. Es war, als wäre man in einem Flugzeug gefangen, das von einem Bordcomputer gesteuert wurde. Man konnte nichts weiter tun als dasitzen und abwarten, bis das Benzin ausging oder eines der unglaublich komplexen und empfindlichen Systeme, von denen das eigene Leben abhing, plötzlich versagte.
Genau das, glaubte er, sei geschehen, als die Dunkelheit ihn unvermittelt einhüllte. Er war gerade zu Fuß unterwegs, auf dem Weg zu einer Adresse im Herzen der Altstadt. Derselbe ungemütliche Novemberabend, der zahlreiche Gläubige aus der Peterskirche ferngehalten hatte, hielt auch hier die Leute in ihren Häusern fest. Auf beiden Seiten der Straße parkten kleine Fiats Stoßstange an Stoßstange wie riesige Kakerlaken, doch abgesehen von ein paar Jugendlichen auf Motorrollern war niemand unterwegs. Zen suchte sich seinen Weg in dem labyrinthartigen historischen Stadtkern mithilfe von persönlichen Orientierungspunkten, ein bemaltes Fenster hier, dort ein Stück abgebröckelter Putz, dann jenes rostige Eisengitter, das die Männer daran hindern sollte, in die Ecke zu pinkeln. Soeben hatte er das mächtige Gebäude der Chiesa Nuova erspäht, als es, wie auch alles andere, abrupt verschwand.
In einer anderen Situation hätte das Jammern, Stöhnen und Fluchen, das in der Dunkelheit aus allen Ecken ertönte, ausgesprochen entnervend sein können. Doch in diesem Fall war es ein willkommenes Zeichen dafür, dass das, was auch immer gerade passiert war, nicht nur Zen betraf. Also war es kein Schlaganfall, sondern ein allgemeiner Stromausfall, der soundsovielte, den die Stadt in diesem Jahr erlebte. Und was er hörte, waren nicht die Stimmen rastloser Toter, die wie Feuchtigkeit aus den alten Gemäuern um ihn herum hervorkrochen und den hinweggerafften Zen als einen der Ihren begrüßten, sondern die Stimmen der aufgebrachten Anwohner, die gerade gekocht, ferngesehen oder gelesen hatten, als das Licht ausging.
Als ihm das klar wurde, war die Dunkelheit bereits von schimmernden Lichtern durchbrochen. In einer Werkstatt im Erdgeschoss tauchte ein Möbelrestaurator auf, der sich über eine Kerze beugte, die er soeben angezündet hatte, und schützend eine hohle Hand um das kleine Flämmchen legte. Der gewölbte Portikus eines Renaissance-Palastes wurde von einer o-beinigen Gestalt mit einer Öllampe ausgeleuchtet, die groteske Schattenbilder über die getünchten Decken und Wände warf. Aus einem Fenster über Zens Kopf schien der Strahl einer Taschenlampe und zerschnitt die Dunkelheit wie eine Messerklinge.
»Mario?«, fragte eine Frauenstimme.
»Ich bin nicht Mario«, rief Zen zurück.
»Umso besser für Sie!«
Wie ein Schiff, das nachts an einer unbekannten Küste entlangfährt, orientierte sich Zen von einem Licht zum nächsten und versuchte, im Kopf seinen Plan von dieser Gegend zu rekonstruieren. An der Ecke holte er sein Feuerzeug heraus. Mit dessen schwacher Flamme konnte er zwar eine Steintafel erkennen, die ziemlich weit oben an der Mauer angebracht war, aber nicht den dort eingravierten Straßennamen. Zen tastete sich weiter an den Häusern entlang vor und blieb immer wieder stehen, um mithilfe seines Feuerzeugs die Hausnummer zu entziffern. Die Flamme erlosch allmählich, weil der Brennstoff zur Neige ging. In ihrem ersterbenden Geflacker konnte er soeben noch einen Namen auf der Liste neben der Türsprechanlage lesen. Er drückte einen der Knöpfe, doch es tat sich nichts, weil es keinen Strom gab. In dem Moment ging sein Feuerzeug aus, und seine Versuche, es wieder anzumachen, brachten nichts als ein paar Funken.
Er nahm seinen Schlüsselbund heraus und tastete die einzelnen Schlüssel nach Form und Reihenfolge ab. Als er den richtigen gefunden hatte, streckte er beide Hände aus und befühlte wie ein Blinder die Oberfläche der Tür, bis er das Schlüsselloch entdeckt hatte. Er steckte den Schlüssel hinein, drehte ihn um und öffnete damit die unsichtbare Tür, hinter der eine andere Dunkelheit lag, undurchdringlich und still, mit dem Geruch von Feuchtigkeit und Schimmel. Eine Hand am Geländer, begann er, mit dem Fuß immer nach der nächsten Stufe suchend, sich die Treppe hinaufzutasten. In der Dunkelheit kam ihm das Haus größer vor, als er es in Erinnerung hatte, wie sein Zuhause in Venedig in seinen Kindheitserinnerungen. Während er die steile Treppe in die oberste Etage hinaufstieg, hörte er eine Männerstimme monoton daherreden, gerade noch unterhalb der Verständlichkeitsschwelle. Zen überquerte vorsichtig den Treppenabsatz, tastete nach der Tür und klopfte. Die Stimme dahinter fuhr unbeirrt fort. Er klopfte noch einmal, diesmal lauter.
»Ja?«, rief eine Frau.
»Ich bins.«
Einen Augenblick später öffnete sich die Tür, und eine große, schlanke Gestalt wurde als Silhouette vor dem Hintergrund von Kerzenlicht erkennbar. »Hallo, Liebling!« Sie fielen sich in die Arme. »Wie bist du reingekommen? Ich habe die Klingel nicht gehört.«
»Die funktioniert nicht. Aber zum Glück hat jemand die Tür aufgelassen.« Sie sollte nicht wissen, dass er Haus- und Wohnungsschlüssel hatte.
»… von der Galerie in der Kuppel. Der vatikanischen Nachrichtenagentur zufolge ereignete sich die Tragödie kurz nach 17.15 Uhr während der heiligen Messe in der …«
Tania bedeckte Zens Gesicht mit leichten raschen Küssen wie ein Vögelchen und zog ihn in die Wohnung. Im Wohnzimmer sah es aus und roch es wie in einer Kapelle. Dicke, marmorierte Kerzen überfluteten den unteren Bereich des Zimmers mit ihrer feierlichen Helligkeit und ihrem kirchlichen Aroma, während die Decke praktisch völlig im Dunkeln verschwand und höher, als sie eigentlich war, zu sein schien.
»… wo er praktisch als Gefangener gelebt hat, seit ein Gericht in Mailand einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte im Zusammenhang mit …«
Tania löste sich gerade lange genug aus seiner Umarmung, um ihr kleines batteriebetriebenes Radio auszuschalten.
Zen zog tief die Luft ein. »Bienenwachs.«
»Um die Ecke ist ein Großhandel für Devotionalien.« Sie schob ihre Hände unter seinen Mantel und drückte ihn an sich. Ihre Küsse waren jetzt fester und feuchter. Er machte sich los, um ihr über Schläfen und Wangen zu streichen, wobei er sanft den zarten Umrissen ihres Ohrs folgte und ihr tief in die Augen sah, die von einem warmen Braunton waren. Er rückte noch ein Stückchen weiter von ihr ab und strich mit den Fingern über das ungewöhnliche Kleidungsstück, das sie trug, eine Art eng anliegendes Trikot aus einem Stoff, der sich wie Samt oder Wildleder anfühlte und aussah, als wäre eine Farbenfabrik in die Luft geflogen.
»Das kenn ich ja noch gar nicht.«
»Es ist neu«, sagte sie leichthin. »Ein Falco.«
»Ein was?«
»Falco, dieser starke, junge Designer. Hast du noch nie von ihm gehört?«
Zen zuckte die Schultern. »Was ich über Mode weiß, passt auf eine Postkarte.«
»Und es wäre immer noch Platz für ›Schade, dass du nicht hier bist‹ und die Adresse«, fügte Tania lächelnd hinzu.
Zen lachte mit. Eins ist mir allerdings schon klar, dachte er, jede Jacke, bei der der Name eines »starken jungen Designers« auf dem Revers prangt, muss teuer sein. Woher hat sie das Geld für solche Sachen? Oder war es überhaupt ihr Geld? Vielleicht hat sie das Teil geschenkt bekommen. Er schob diesen Gedanken beiseite, zog eine kleine Plastiktüte aus der Tasche, holte eine hübsch verpackte Schachtel heraus und überreichte sie ihr.
»Oh, Aurelio!«
»Es ist nur Parfum.« Während sie den kleinen Flakon auspackte, fügte er leicht bösartig hinzu: »Ich würde mich nicht trauen, dir was zum Anziehen zu kaufen.«
Sie reagierte nicht darauf. »Heute Abend benutze ich es lieber nicht«, sagte sie.
»Warum nicht?«
»Dann riechen deine Sachen danach, und sie weiß, dass du ihr untreu warst.« Sie sahen sich lächelnd an. »Sie« war Zens Mutter.
»Ich könnte sie natürlich ausziehen«, sagte er.
»Hm, das ist eine gute Idee.«
Sie waren jetzt schon seit fast einem Jahr zusammen, und Zen wusste immer noch nicht so recht, wie er ihre Beziehung einschätzen sollte. Gewiss war alles ganz anders, als er es sich damals in seiner Anfangszeit beim Innenministerium vorgestellt hatte, als Tania Biacis noch das beruhigend unerreichbare Objekt seiner Fantasien war. Sie hatte ihn an die große Madonnenstatue in der Apsis des Doms auf der Insel Torcello erinnert, jedoch gewandelt von einem Sinnbild des Leidens zu einem Sinnbild fröhlicher Rebellion, wie eine aus dem Kloster ausgerissene Nonne.
Seine Fantasievorstellung war zutreffender gewesen, als er geahnt hatte, denn das Scheitern ihrer Ehe mit Mauro Bevilacqua, einem verdrießlichen Bankangestellten aus dem tiefen Süden, hatte Tania Biacis in eine Persönlichkeit verwandelt, die ganz anders war als die geschwätzige, konventionelle und ziemlich oberflächliche Frau, in die Zen sich wider besseres Wissen verliebt hatte. Nachdem sie überstürzt geheiratet und das ausgiebig bereut hatte, wollte Tania nun, Anfang dreißig, alles nachholen, was sie damals versäumt hatte. Sie hatte angefangen zu rauchen und sogar zu trinken, Angewohnheiten, die Zen bei Frauen missbilligte. Niemals kochte sie für ihn, geschweige denn, dass sie ihm mal einen Knopf annähte oder ein Hemd bügelte, als ob sie bewusst all die Tricks ablehnte, mit denen die typischen Mammas ihr Opfer ködern. Sie gingen in Restaurants und Bars, ließen sich kaum einen Film oder ein Konzert entgehen, waren auch noch zu später Stunde auf den Straßen und Piazzas unterwegs, und dann gingen sie nach Hause ins Bett.
Bekanntlich kommt natürlich immer alles anders als erwartet. Zen war aber so sehr daran gewöhnt, dass alles nur noch schlimmer wurde oder zumindest hinter den Erwartungen zurückblieb, dass er immer noch nicht fassen konnte, was tatsächlich passiert war. Tania liebte ihn, damit fing es an. Das war etwas, das er ganz bestimmt nicht erwartet hatte. Er hatte sich damit abgefunden, dass er im Grunde nicht liebenswert war, und es fiel ihm schwer – ja war für ihn fast schmerzhaft –, diese Vorstellung aufzugeben. Sie war so bequem gewesen, wie ein Paar ausgetretene Schuhe. Doch damit war nun Schluss. Tania liebte ihn, und da führte kein Weg dran vorbei.
Sie liebte ihn, aber sie wollte nicht mit ihm zusammenwohnen. Diese Tatsache war genauso unumstößlich wie die erste, aber beide zusammen waren für Zen nicht zu vereinbaren. Wie konnte man jemanden so leidenschaftlich lieben und dann doch einen gewissen Abstand wahren wollen? Das machte keinen Sinn, besonders nicht bei einer Frau. Aber so war es nun mal. Er hatte Tania gebeten, zu ihm zu ziehen, und sie hatte abgelehnt. »Ich habe acht Jahre meines Lebens mit einem Mann verbracht, Aurelio. Ich habe sehr früh geheiratet. Ich habe nie etwas anderes kennengelernt. Jetzt, wo ich endlich frei bin, möchte ich mich nicht schon wieder in eine Abhängigkeit begeben, auch nicht mit dir.« Und das war ebenso unerwartet und unabänderlich wie ihre Liebe. Er konnte es entweder akzeptieren oder das Ganze bleiben lassen.
Natürlich hatte er es akzeptiert. Und noch mehr, er hatte Ränke geschmiedet und sich ins Zeug gelegt, um ihr die erwünschte Unabhängigkeit zu gewähren und dann vor ihr zu verbergen, dass alles nur Schein war und in Wirklichkeit von ihm finanziert wurde. Wenn in Italien die Scheidungsrate immer noch relativ niedrig war, so hatte das weniger mit dem ohnehin schwindenden Einfluss der Kirche zu tun als mit den harten Fakten des Wohnungsmarktes. Die Mieten waren einfach zu hoch für die meisten Singles. Als Zens Ehe in die Brüche ging, waren er und seine Frau gezwungen gewesen, noch fast ein ganzes Jahr zusammenzuleben, bis Luisella bei einer ihrer Cousinen einziehen konnte. Tanias Bürojob beim Innenministerium war ein nettes Zubrot für den bevilacquaschen Haushalt gewesen, reichte aber bei Weitem nicht aus, um ihr die Unabhängigkeit zu ermöglichen, die sie anstrebte.
Also war Zen in die Bresche gesprungen. Die erste Bleibe, die er auftat, war ein Zimmer in einem Hotel in der Nähe des Bahnhofs, das von der Polizei für eine Überwachungsoperation im Rahmen einer Drogenfahndung angemietet worden war. In Wirklichkeit war der Verdächtige bereits vor einigen Monaten bei einer Schießerei mit einer rivalisierenden Bande getötet worden. Der zuständige Beamte hatte das allerdings nicht gemeldet, sondern das Zimmer an brasilianische Transvestiten untervermietet. Als illegale Einwanderer hatten diese Viados keine Möglichkeit, sich zu beschweren. Das galt auch für Zens Informanten, einen ehemaligen Kollegen aus der Questura, weil der betreffende Beamte einer seiner Vorgesetzten war, doch Zen hatte keinerlei Rücksichten dieser Art zu nehmen. Er nahm sich den Mann vor, und mit einer Mischung aus versteckten Drohungen und ein paar kernigen Worten von Mann zu Mann brachte er ihn so weit, dass er erklärte, Zens »Bekannte« könne das Zimmer für ein paar Monate haben.
Doch als sie sich zur Schlüsselübergabe in dem Hotel trafen, wurde Zen klar, auf was er sich da eingelassen hatte. Abgesehen von den Transvestiten und den Dealern war das Zimmer dreckig, laut und stank. Es war undenkbar, Tania auch nur vorzuschlagen, dort einzuziehen, geschweige denn, sie dort zu besuchen, umgeben von den Geräuschen und Gerüchen von käuflichem Sex. Unglücklicherweise hatten sie bereits die gute Nachricht gefeiert, also musste er eine Alternative finden, und zwar schnell.
Die Lösung ergab sich durch einen ausländischen Bekannten von Ellen, Zens ehemaliger Freundin, der eine Wohnung mitten im Herzen der Altstadt gemietet hatte. Sie war als Büro vermietet worden, um die Equa Canone, die Mietpreisbindung, zu umgehen, und der Vermieter nutzte das aus, um nach dem ersten Jahr eine zwanzigprozentige Erhöhung zu fordern. Der Amerikaner fand kurz darauf eine Wohnung, die ihm sogar noch besser gefiel, doch um seinem ehemaligen Vermieter eins auszuwischen, machte er den Vorschlag, Tania könne als sein »Gast« in seine alte Wohnung einziehen. Auf diese Weise zwang er den Eigentümer zu einem langwierigen und kostspieligen Rechtsstreit, wenn er eine Räumungsklage gegen ihn anstrengen wollte. Die Miete war natürlich weiterhin fällig, und da Zen damit geprahlt hatte, er könne Tania ganz umsonst ein Zimmer besorgen, erzählte er ihr, dass der Amerikaner einige Monate fort sei und jemanden suche, der auf die Wohnung aufpasste, und zahlte die Rechnung.
Im Schlafzimmer zog Tania ihre Kleider mit einer unbefangenen Leichtigkeit aus, die Zen immer wieder in Erstaunen setzte. Die meisten Frauen, die er kannte, zogen sich lieber unbeobachtet oder in einer intimen Umarmung aus. Doch Tania legte Jeans, Strumpfhose und Slip ab wie ein Kind, das schwimmen geht, wobei ihre schönen, langen Beine gut zur Geltung kamen. Dann zog sie die Bettdecke zurück und legte sich halb zugedeckt hin, während Zen immer noch dabei war, seine Jacke auszuziehen. Ihre Offenheit machte es auch für ihn einfacher. Seine Zweifel und Ängste fielen zusammen mit seinen Kleidern von ihm ab. Als er zwischen die kühlen Laken schlüpfte und Tanias warmes, weiches Fleisch spürte, überlegte er, dass sich einiges Positive für den menschlichen Körper anführen lasse, trotz allem.
»Was ist das?«, fragte Tania einige Zeit später und hob ihren Kopf über die Bettdecke. Zen hob ebenfalls den Kopf und lauschte. In die stille Dunkelheit des Schlafzimmers war ein elektronisches Geräusch eingedrungen, gedämpft, aber dennoch deutlich hörbar, das in regelmäßigen Abständen unaufhörlich ertönte. »Klingt wie ein Wecker.« Tania stützte sich auf einen Ellbogen. »Ich hab noch so einen altmodischen, der klingelt.« Sie lagen nebeneinander, sodass sich die Härchen auf ihren Unterarmen gerade berührten. Das Geräusch hielt erbarmungslos an. Schließlich richtete Tania sich wie eine Katze auf, krümmte den Rücken und kroch ans Fußende. »Es scheint aus deiner Jacke zu kommen, Aurelio.«
Zen zog sich die Bettdecke über den Kopf und stieß laut eine Reihe von Verwünschungen im venezianischen Dialekt aus.
»Ihre Situation hier ist im Grunde – ich möchte sagen, zwangsläufig – anomal. Sie sollen zwei Herren dienen, ein Unterfangen, das nicht nur voller Gefahren und Widersprüche ist, sondern das auch, wie Sie sich vielleicht erinnern, ausdrücklich von der Heiligen Schrift verdammt wird.« Juan Ramón Sánchez-Valdés, Erzbischof in partibus infidelium und stellvertretender Kardinalstaatssekretär, gewährte Zen ein schelmisches Lächeln. »Man könnte allerdings auch mit gleichem Recht behaupten«, fuhr er fort, »dass genau das Gegenteil der Fall ist, und dass Sie, weit entfernt davon, zwei Herren zu dienen, in Wirklichkeit niemandem dienen. Als Beamter der Republik Italien haben Sie keinerlei locus standi jenseits der Grenzen dieses Staates. Noch sind Sie formal befugt, als Vertreter der Vatikanstadt oder des Heiligen Stuhls zu agieren.«
Zen hob eine Hand an den Mund und ließ sein Kinn auf dem umgebogenen Daumen ruhen. Er schnupperte an seinen Fingern, die noch immer den Geruch von Tanias Vagina ausströmten. »Und doch bin ich hier.«
»Ja, Sie sind hier«, gab der Erzbischof zu. »Trotz aller gegenteiligen Anzeichen.«
Und das ist auch mein Glück, dachte Zen säuerlich. Wie alle Criminalpol-Beamten musste er turnusmäßig einen Nachtdienst übernehmen und sich in Bereitschaft halten, falls er gebraucht wurde. Das war allerdings noch nie passiert, und deshalb hatte Zen zunächst nicht erkannt, dass sich der elektronische Funkrufempfänger eingeschaltet hatte, während er und Tania im Bett lagen. Er rutschte auf seinem eleganten, aber unbequemen Sessel hin und her. Ein nicht zustande gekommener Koitus bereitete ihm Schmerzen in den Hoden, ein Gefühl, das ihm während der Pubertät wohlvertraut gewesen war, doch später nur noch eine Erinnerung war. Tania hatte zwar gesagt, sie würde aufbleiben, doch man musste erst mal abwarten, wann er in die Wohnung zurückkehren konnte – oder ob überhaupt.
Auf seinen Anruf hin war ihm gesagt worden, er solle sich beim Kommandoposten der Polizia della Stato auf dem Petersplatz melden. Die Telefonistin, mit der er sprach, las nur eine diktierte Mitteilung vor und konnte keine näheren Angaben machen. Das Taxi setzte ihn an der Ecke des Platzes ab, und er umrundete den Bogen von Berninis großartiger Kolonnade. Als Teil der Vatikanstadt liegt der Petersplatz theoretisch außerhalb der Zuständigkeit der italienischen Polizei, doch in der Praxis weiß die überlastete Vigilanza deren Hilfe beim Patrouillieren des Platzes sehr wohl zu schätzen. Bei der Polizei galt das allerdings als absoluter Kleinkram, da man es hier in erster Linie mit Taschendieben und »Grabschern« zu tun hatte, mit Männern, die sich bei päpstlichen Auftritten unter die Menge mischten mit dem Ziel, möglichst viele verzückte weibliche Wesen zu berühren. Dagegen wurden die Kontakte zwischen den vatikanischen Sicherheitskräften und DIGOS, dem Antiterrordezernat der Polizei, die im Gefolge des Attentats auf Papst Johannes Paul II. aufgebaut worden waren, nur auf höchster Ebene geführt.
Der diensthabende Wachmann wählte eine Nummer im Vatikan und kündigte Zens Besuch an. Dann wartete er ein paar Minuten auf den Rückruf, bevor er Zen zu einem Paar riesiger Bronzetüren ganz in der Nähe begleitete, wo zwei Schweizergarden in ihren zeremoniellen Uniformen auf ihre Hellebarden gestützt standen. Zwischen ihnen stand ein dünner Mann mit einem raubvogelartigen Gesicht, der eine schwarze Soutane und eine Nickelbrille trug und sich als Monsignore Enrico Lamboglia vorstellte. Er kontrollierte Zens Ausweis, schickte den Wachmann weg und führte seinen Besucher einen endlos scheinenden Flur entlang, dann nach rechts eine Treppe hinauf und durch galerieartige Gänge zu einem Konferenzsaal auf der dritten Etage des Vatikanpalastes, wo er vor den Erzbischof Juan Ramón Sánchez-Valdés geführt wurde.
Der stellvertretende Kardinalstaatssekretär war klein und untersetzt und hatte ein Gesicht, das für seinen Schädel zu groß zu sein schien und deshalb an den Rändern zu einer hochgewölbten Stirn, Hängebacken und Doppelkinn übergequollen war. Seine blassgrünen, aus dem zum Rand des Gesichts fliehenden Fleisch vorstehenden Augen waren groß und auffällig und gaben ihm den Ausdruck empörten Staunens. Er trug eine billige graue Hose, einen dunkelgrünen Pullover mit Lederflicken an den Ellbogen und ein Hemd mit offenem Kragen. Die lässige Kleidung beeinträchtigte jedoch keineswegs die Ehrfurcht gebietende Ausstrahlung von Autorität und Kompetenz, mit der er sich in seinem roten Samtsessel zurücklehnte, den rechten Arm auf einen antiken Tisch gestützt, dessen hochglanzpolierte Oberfläche bis auf ein weißes Telefon leer war. Der Geistliche mit dem Raubvogelgesicht, der Zen hierher begleitet hatte, stand in geringem Abstand auf einer Seite hinter dem Sessel des Erzbischofs. Sein Kopf war gesenkt und seine Hände wie im Gebet über der Brust gefaltet. Auf der anderen Seite des Orientteppichs, der in der Mitte des Raumes auf dem glänzenden Marmorboden lag, saß Zen auf einem langen Sofa, das eine ganze Wand einnahm. Ihm gegenüber hingen drei dunkle Gemälde, auf denen Wunder und Martyrien dargestellt waren. An der Rückwand des Raumes war ein bis zum Boden reichendes Fenster, das mit Spitzengardinen behangen und von schweren roten Samtvorhängen eingerahmt war.
»Doch wir wollen die schwierige Frage Ihres Status beiseitelassen und uns dem vorliegenden Problem zuwenden.«
Mehrere Jahrzehnte in der Kurie hatten fast sämtliche Spuren von Sánchez-Valdés’ lateinamerikanischem Spanisch verwischt. Er fixierte Zen mit einem leicht verschwommenen hypnotischen Blick. »Wie Sie vermutlich gehört haben, hat sich heute Nachmittag ein Selbstmord in St. Peter ereignet. Jemand hat sich von der Galerie im Innern der Kuppel gestürzt. So etwas kommt häufiger vor, und normalerweise braucht sich dieses Ressort nicht damit zu befassen. Diesmal jedoch ist das Opfer nicht irgendein sitzengelassenes Hausmädchen oder ein bankrotter Ladenbesitzer, sondern Prinz Ludovico Ruspanti.« Der Erzbischof warf Zen einen vielsagenden Blick zu, worauf dieser eine Augenbraue hochzog.
»Natürlich stellen die Ruspantis nicht mehr eine solche Macht dar wie vor ein paar Hundert Jahren«, fuhr Sánchez-Valdés fort, »oder selbst als der alte Prinz, Filippo, noch lebte. Dennoch, der Name gilt noch immer etwas, und keine Familie, erst recht keine angesehene, hat gern einen felo de se in ihren eigenen Reihen. Deshalb ist damit zu rechnen, dass die übrigen Mitglieder des Clans ihren nicht unerheblichen Einfluss darauf verwenden werden, mit vereinten Kräften die Selbstmordthese infrage zu stellen. Sie haben bereits eine Erklärung herausgegeben, in der sie behaupten, dass Ruspanti an Höhenangst litt, und dass es deshalb unwahrscheinlich sei, dass er, selbst wenn er seinem Leben ein Ende hätte setzen wollen, es auf diese Weise getan hätte.«
Der rechte Mittelfinger von Sánchez-Valdés, der mit einem schweren silbernen Ring geschmückt war, klopfte emphatisch auf die Tischplatte. »Und zu allem Überfluss ist, wie Sie sicher wissen, Ruspantis Name in letzter Zeit im Zusammenhang mit diesen Behauptungen über Währungsbetrug in den Nachrichten genannt worden. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe diese Geschichte nie richtig verstanden, aber ich weiß genug darüber, wie die Presse arbeitet, um mir die bösartigen Behauptungen, die eine solche Angelegenheit ohnehin auslösen wird, vorzustellen. Wir können mit Gewissheit davon ausgehen, dass man mehr oder weniger offen unterstellen wird, Ruspantis Tod hätte sich aus der Sicht gewisser Leute, die natürlich namenlos bleiben müssen, kaum bequemer oder zu einem günstigeren Zeitpunkt ereignen können, et cetera, et cetera. Verstehen Sie, was ich meine?«
Zen nickte. Sánchez-Valdés schüttelte seufzend den Kopf. »Es ist nun mal so, Dottore, dass aus diversen Gründen, auf die wir jetzt nicht näher eingehen können, dieser kleine Stadtstaat, dessen einziger Zweck darin besteht, die geistliche Arbeit des Heiligen Vaters zu unterstützen, für die allgemeine Öffentlichkeit ein Gegenstand ungeheurer morbider Faszination ist. Die Leute scheinen zu glauben, dass wir ein Relikt aus dem Mittelalter sind, das bis ins 20. Jahrhundert überlebt hat, voller Geheimnisse, Intrigen und Schandtaten, finster und farbenfroh zugleich. Da ein solcher Vatikan in Wirklichkeit nicht existiert, erfinden sie ihn einfach. Das Ergebnis haben Sie gesehen, als der arme Luciani starb, nachdem er nur dreißig Tage Papst gewesen war. Zugegeben, es ist auf sehr unglückliche Weise bekanntgegeben worden. Jeder war so schockiert über das, was geschehen war, dass es unvermeidlich zu Verzögerungen und widersprüchlichen Meldungen kam. Mit dem Ergebnis, dass wir immer noch den abscheulichsten und unverschämtesten Gerüchten ausgesetzt sind, die behaupten, Johannes Paul I. sei von Mitgliedern seines Haushalts vergiftet oder erwürgt worden, und man habe das Verbrechen vertuscht.
Nun ist ein Prinz zwar kein Papst, und Ludovico Ruspanti kein Albino Luciani. Trotzdem haben wir unsere Lektion auf bittere Weise gelernt. Diesmal sind wir entschlossen, nichts dem Zufall zu überlassen. Deshalb haben wir Sie gebeten, uns als Experte zur Seite zu stehen. Da Ruspanti auf vatikanischem Boden gestorben ist, sind wir rein rechtlich nicht verpflichtet, einen Außenstehenden hinzuzuziehen. Unter den gegebenen Umständen und um niemandem Anlass zu Zweifeln zu geben, haben wir uns allerdings entschlossen, von uns aus einen unabhängigen Ermittler zu bitten, die Tatsachen zu überprüfen und zu bestätigen, dass dieses tragische Ereignis nicht von verdächtigen Umständen begleitet ist.«
Zen sah auf seine Uhr. »Das ist nicht nötig, Eure Exzellenz.«
Sánchez-Valdés zog die Stirn in Falten. »Wie bitte?«
Zen beugte sich vertraulich vor. »Ich stamme aus Venedig, wie Papa Luciani. Wenn die Kirche sagt, dass dieser Mann Selbstmord begangen hat, dann genügt mir das.«
Der Erzbischof warf Monsignore Lamboglia einen kurzen Blick zu. Er lachte unsicher. »Nun!«
Zen strahlte ihn mit einem aufmunternden Lächeln an. »Erzählen Sie der Presse, was Sie wollen. Ich werde es bestätigen.«
Der Erzbischof lachte erneut. »Das ist gut zu hören, mein Sohn. Wirklich sehr gut. Wenn es nur mehr Leute wie Sie gäbe! Aber leider ist die Kirche heutzutage von Feinden umringt. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Und obwohl ich Ihren bedingungslosen Gehorsam begrüße, fürchte ich, dass wir mehr brauchen als ein Blatt Papier mit dem Stempel nihil obstat.«
Sánchez-Valdés erhob sich und baute sich vor Zen auf. »Ich werde Sie mit einem unserer Sicherheitsbeamten bekannt machen«, fuhr er mit ruhiger Stimme fort. »Er war dabei, als es passierte, und wird Ihnen alles sagen können, was Sie wissen wollen. Danach sind Sie sich selbst überlassen. Prüfen, ermitteln, verhören Sie, tun Sie alles, was Sie für notwendig halten. Sie brauchen mit mir und mit meinen Kollegen keine Rücksprache mehr zu nehmen.«
Er starrte Zen gespannt an. »Es ist sogar dringend erforderlich, dass Sie das nicht tun.«
Zen sah ihm in die Augen. »Damit ich meinen unabhängigen Status bewahre, meinen Sie?«
Der Erzbischof nickte lächelnd. »Ganz genau. Jeder Verdacht einer Absprache zwischen uns würde die Wirkung beeinträchtigen, die wir erreichen wollen. Tun Sie, was Sie für richtig halten, was auch immer getan werden muss, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ihre Vorgesetzten haben mir versichert, dass Sie ein äußerst fähiger und erfahrener Beamter sind.«
Er wandte sich an Monsignore Lamboglia. »Holen Sie Grimaldi rein.«
An der Wand des Vorzimmers, in dem man Giovanni Grimaldi fast zwei Stunden hatte warten lassen, hing ein großes düsteres Gemälde. Es stellte eine Anzahl bewaffneter Gestalten dar, die im Vordergrund etwas äußerst Unangenehmes mit einem nackten männlichen Wesen machten, während eine Gruppe älterer Bürger mit Heiligenschein mit dem Ausdruck selbstgefälliger Distanz von einer vorbeifliegenden Wolke aus zusah. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass der Märtyrer in spe von paarweise ins Joch gespannten Büffeln auseinandergerissen wurde. Grimaldi zuckte mitfühlend zusammen. Er konnte sehr gut nachempfinden, wie sich das arme Schwein fühlte.
Seine erste Reaktion auf das, was passiert war, war reine Panik gewesen. Man hatte ihn mit einer Aufgabe betraut, die, wie man mehrfach betonte, äußerst heikel und wichtig war. Das war für ihn eine Chance, sich ein für alle Mal zu bewähren, sich als verantwortungsbewusster und zuverlässiger Mitarbeiter zu erweisen. Und er hatte sie vermasselt. Hätte er sich doch bloß nicht von dem Mann mit der goldenen Kette, der auffälligen Uhr und dem näselnden Akzent ablenken lassen, der anscheinend von der Touristengruppe Comunione e Liberazione getrennt worden war, die vor ein paar Minuten ihren Rundgang gemacht hatte. Der Mann hatte Grimaldi angesprochen, als dieser am Geländer des äußeren Balkons auf der Spitze der Peterskirche stand und so tat, als sei er in die fantastische Aussicht vertieft. Wo denn die Spanische Treppe und welches der Aventinische Hügel sei, und ob man von dort aus das Kolosseum sehen konnte. Grimaldi wusste, er hatte Wichtigeres zu tun, als den Fremdenführer zu spielen, aber er war einfach zu stolz darauf, dass er Rom und all seine Sehenswürdigkeiten so gut kannte. Es hatte ihn gereizt, mit lässigen, selbstsicheren Gesten auf die Hauptattraktionen der Ewigen Stadt hinzuweisen, als ob er das alles geerbt hätte.
Außerdem hatte er sein Beschattungsobjekt voll im Auge. Der Mann stand ein Stück weiter am Geländer des Balkons und machte sich an die Klassefrau mit dem weißen Seidentuch heran, die ganz allein auf dem Balkon gestanden hatte, als sie heraufkamen. Grimaldi konnte ihm das nicht verdenken. Er hätte vielleicht selbst einen Versuch gemacht, wenn er nicht im Dienst gewesen wäre. Nicht dass er eine Chance gehabt hätte. Es sah jedoch so aus, als ob der Prinz ihr gefallen könnte. Sie standen sehr dicht beieinander, und ihre Unterhaltung wirkte ungewöhnlich lebhaft für zwei Leute, die sich gerade erst kennengelernt hatten. Währenddessen hatte er diesen Mann aus dem Norden mit seinen dämlichen Fragen am Hals. »Und ist das der Quirinal-Palast?«, quengelte er und deutete auf die Engelsburg.
Als Grimaldi das nächste Mal zur anderen Seite des Balkons schaute, waren der Prinz und seine neue Errungenschaft verschwunden. Er ließ den wissbegierigen Touristen mitten im Satz stehen und polterte die Metallleiter zu der steilen Treppe hinunter, die in unwahrscheinlichen Biegungen und Windungen wie ein Gang in einem Albtraum auf das Dach der Basilika führte. Die Kuppel war ein einziges Gewirr solcher Gänge und Treppen, die meisten waren jedoch abgesperrt. Und die, die für das Publikum zugänglich waren, waren deutlich ausgeschildert, damit sich die Besucher zügig und reibungslos zurechtfinden konnten. Man konnte sich dort nirgendwo verlaufen oder verstecken. Nur wenige Minuten, nachdem er den Balkon verlassen hatte, stand Grimaldi unten im Mittelschiff der Peterskirche und wusste, dass ihm der Mann entwischt war.