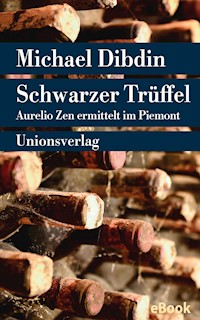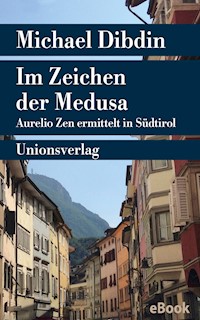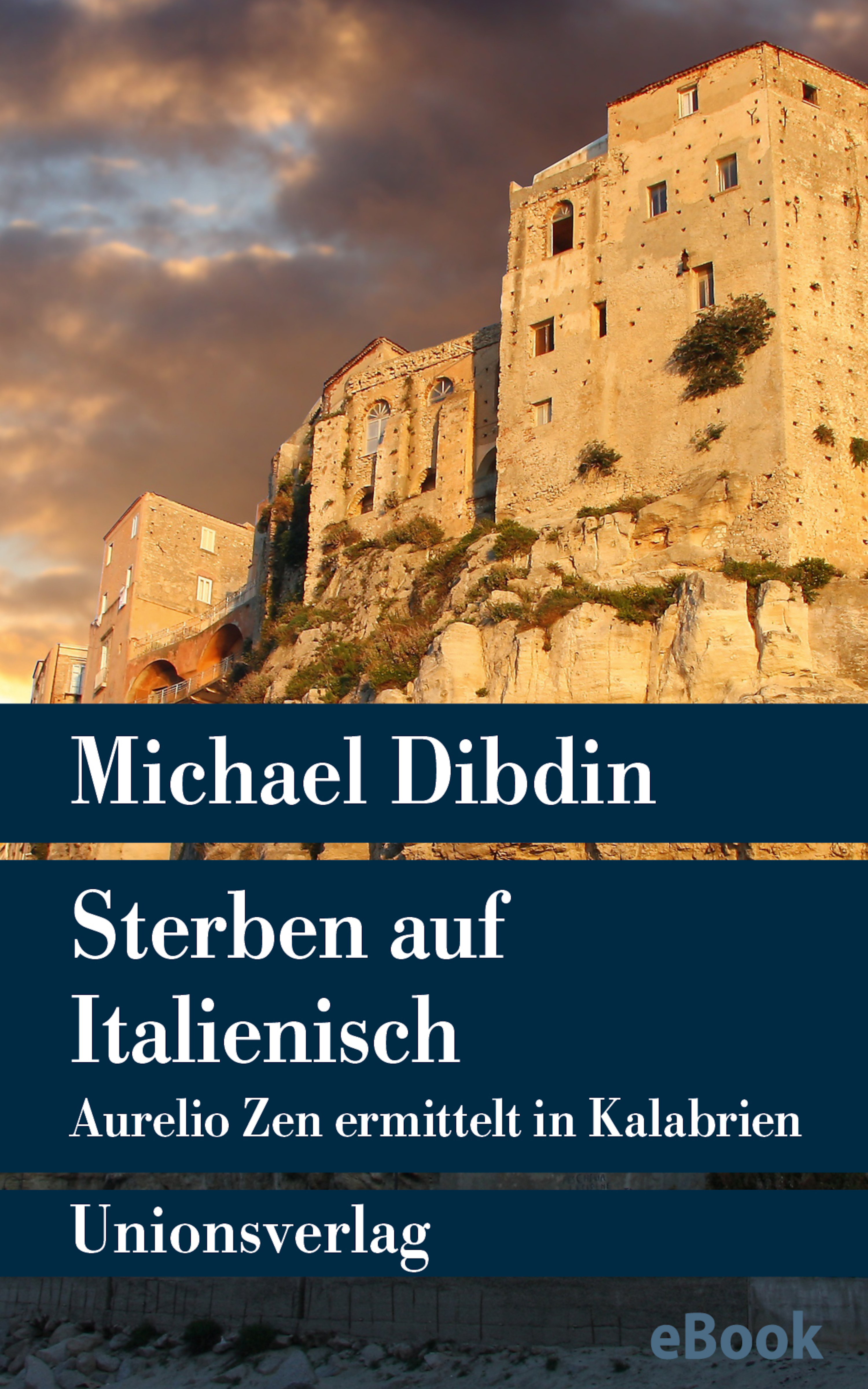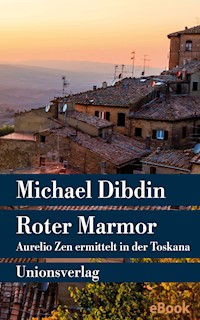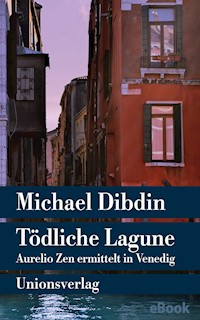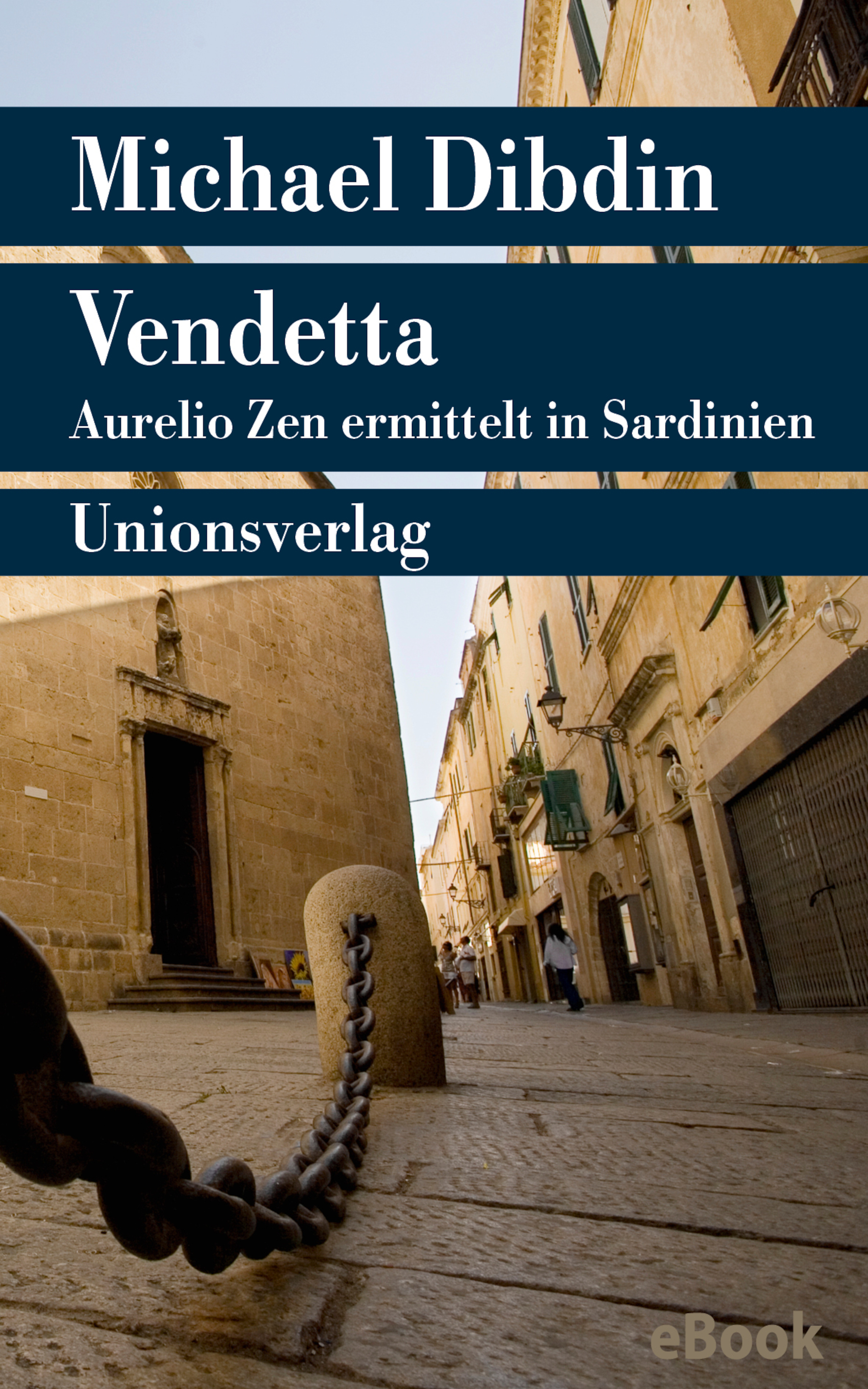
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kommissar Aurelio Zen steht vor einem Rätsel: ein vierfacher Mord in der festungsartig ausgebauten Villa eines reichen Sarden, in die eigentlich niemand unbemerkt eindringen kann. Ein Ding der Unmöglichkeit? Nicht nur die Leichen bezeugen das Gegenteil. Die Bluttat ist verewigt, da es zu den Gepflogenheiten des Hausherrn Oscar Burolo gehörte, sein Leben auf Video aufzuzeichnen – jetzt dokumentiert die Anlage seinen Tod. Als Aurelio Zen mit den Ermittlungen in Sardinien beginnt, findet er sich in einer brutalen, abweisenden Welt wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Kommissar Aurelio Zen steht vor einem Rätsel: ein vierfacher Mord in der festungsartig ausgebauten Villa eines reichen Sarden, in die eigentlich niemand unbemerkt eindringen kann. Die Bluttat ist verewigt, da es zu den Gepflogenheiten des Hausherrn Oscar Burolo gehörte, sein Leben auf Video aufzuzeichnen – jetzt dokumentiert die Anlage seinen Tod.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Michael Dibdin (1947–2007) studierte englische Literatur in England und Kanada. Vier Jahre lehrte er an der Universität von Perugia. Bekannt wurde er durch seine Figur Aurelio Zen, einen in Italien ermittelnden Polizeikommissar.
Zur Webseite von Michael Dibdin.
Ellen Schlootz arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie hat u. a. Werke von Ian Rankin und David Hosp ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Ellen Schlootz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Michael Dibdin
Vendetta
Aurelio Zen ermittelt in Sardinien
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ellen Schlootz
Aurelio Zen ermittelt (2)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1990 unter dem Titel Vendetta im Verlag Faber and Faber, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 im Goldmann Verlag, München.
Originaltitel: Vendetta (1990)
© by Michael Dibdin 1990
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: seraficus
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30885-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 13.06.2022, 14:43h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
VENDETTA
RomMittwoch, 01.50–02.45Mittwoch, 07.20–12.30Mittwoch, 20.25–22.05Donnerstag, 07.55–13.20Donnerstag, 13.40–16.55Donnerstag, 17.20–19.10Freitag, 11.15–14.20SardinienSamstag, 05.05–12.50Samstag, 20.10–22.25Sonntag, 07.00–11.20Sonntag, 11.20–13.25RomFreitag, 11.20–20.45Mehr über dieses Buch
Über Michael Dibdin
Über Ellen Schlootz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Michael Dibdin
Zum Thema Italien
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Rom
Mittwoch, 01.50–02.45
Aurelio Zen lag wie ein gelangweilter Gott auf dem Sofa und erweckte die Toten zum Leben. Mit einem Fingerdruck ließ er sie wieder auferstehen. Eins nach dem anderen regten sich die formlosen, blutdurchtränkten Bündel, schüttelten sich, krochen ein bisschen herum und richteten sich dann auf, bis sie wieder auf den Füßen standen. Ihren Gesichtern nach zu urteilen, schien ihnen diese im ganz wörtlichen Sinne stattfindende Auferstehung überraschend zu kommen, oder vielleicht war es auch nur der Anblick der anderen Körper, der sie so sehr schockierte, die grauenhaften Verletzungen und Entstellungen und die Blutspritzer und -lachen, die überall zu sehen waren. Doch sowie Zen mit seinem wundersamen Eingreifen fortfuhr, wurde auch das in Ordnung gebracht, die klaffenden Risse in Körper und Kleidung heilten von alleine, das Blut wischte sich von selbst auf, und im Nu glich die Szene wieder jener ganz normalen Dinner-Party, die sie gewesen war, bevor das Unmögliche geschah. Von den vier Personen schien keine zu bemerken, was an diesem illusorischen Leben nach dem Tod so verblüffend war, nämlich dass alles rückwärts ablief.
»Er wars.«
Zens Mutter stand in der Tür, ihr Nachthemd hatte sich um ihren ausgemergelten Körper gewickelt.
»Was gibts, Mamma?«
Sie deutete auf den Fernsehschirm, auf dem man jetzt einen strahlend weißen Sandstrand sah, der von sanft geschwungenen Felsen eingerahmt war. Ein Mann schwamm rückwärts durch die flachen Wellen. Er tauchte lässig aus dem Wasser auf, landete elegant auf einem der Felsen und schlenderte rückwärts zu den Liegestühlen im Schatten, wo die anderen saßen und Rauch aus der Luft sogen und in ihre Zigaretten bliesen.
»Der mit der Badehose. Er hats getan. Er war in seine Frau verliebt, deshalb hat er ihn getötet. Er war noch in einem anderen Film, letzte Woche auf Kanal 5. Man hielt ihn für einen Spion, aber das war sein Zwillingsbruder. Er spielte alle beide. Die machen das mit Spiegeln.«
Mutter und Sohn warfen sich einen Blick quer durch den Raum zu, der von dem elektronisch konservierten Sonnenlicht eines Sommers, der nun seit mehr als drei Monaten vergangen war, beleuchtet wurde. Es war fast zwei Uhr morgens, und selbst in den Straßen von Rom herrschte Stille. Zen drückte die Pause-Taste an der Fernbedienung und brachte damit das Video zum Stillstand. »Warum bist du auf, Mamma?«, fragte er und bemühte sich, sich seine Verärgerung nicht anmerken zu lassen. Dies war ein Verstoß gegen die Regeln. Wenn sich seine Mutter am Abend erst einmal in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, blieb sie auch dort. Das gehörte zu den ungeschriebenen Gesetzen, die ihr Zusammenleben aus seiner Sicht gerade eben erträglich machten.
»Ich dachte, ich hätte etwas gehört.«
Sie sahen sich weiterhin an. Die Frau, die Zen das Leben geschenkt hatte, hätte jetzt genauso gut das Kind sein können, das er nie gehabt hatte, das von einem Albtraum aufgewacht war und nun getröstet werden wollte. Er stand auf und ging zu ihr hin. »Es tut mir leid, Mamma. Aber ich habe den Ton ganz leise gestellt …«
»Ich meine nicht das Fernsehen.«
Er sah ihr forschend in die verschlafenen und verwirrt dreinblickenden Augen. »Was denn?«
Sie zuckte verdrießlich mit den Schultern. »Eine Art Kratzen.«
»Kratzen? Wie meinst du das?«
»Wie das Boot vom alten Umberto.«
Zen war oft verblüfft über die Anspielungen seiner Mutter auf eine Vergangenheit, die für sie unermesslich realer war, als es die Gegenwart je sein würde. Er selbst hatte Umberto so gut wie vergessen, den stattlichen und würdevollen Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts in der Nähe der San-Geremia-Brücke. Er benutzte das Boot, um Obst und Gemüse vom Rialto-Markt zu holen, und um Kartons, Kisten, Flaschen und Gläser in die Keller seines Hauses oder von dort wegzutransportieren. Diese Keller hatte sich der zehnjährige Zen immer wie Aladins Höhle vorgestellt, vollgestopft mit exotischen Köstlichkeiten. Wenn er es nicht brauchte, war das Boot an einem Pfahl in dem kleinen Kanal gegenüber dem Haus der Zens festgemacht. Der Pfahl war mit einem Stück Blech verkleidet, um das Holz zu schützen, und jedes Mal, wenn ein Vaporetto den Cannaregio heruntergefahren kam, erreichte dessen Kielwasser kurze Zeit später Umbertos Boot und ließ dessen obere Planke gegen das Blech reiben, wodurch ein metallisch kratzendes Geräusch entstand.
»Wahrscheinlich hast du mich hier rumgehen hören«, sagte Zen. »Jetzt geh zurück ins Bett, bevor du dich erkältest.«
»Es kam nicht von hier. Es kam von der anderen Seite. Vom Kanal. Genau wie das verdammte Boot.«
Zen nahm ihren Arm, der sich beängstigend gebrechlich anfühlte. Durch den Krieg zur Witwe geworden, hatte seine Mutter sich um seinetwillen ganz allein durchs Leben geschlagen, Geschäftsleuten und Bürokraten Zugeständnisse abgerungen, in schlecht bezahlten Jobs geschuftet, um ihre Rente aufzubessern, gekocht, geputzt, genäht, gestopft und sich immer irgendwie beholfen und durch ihren unermüdlichen Einsatz einen sicheren Ort geschaffen, an dem ihr Sohn aufwachsen konnte. Kein Wunder, dachte er, dass diese Plackerei sie vollkommen ausgelaugt hatte, sodass von ihr nur noch ein unscheinbares Wesen übrig geblieben war, das Angst vor Geräuschen und vor der Dunkelheit hatte und sich für nichts mehr interessierte außer den Fernsehserien, die sie sich ansah und deren Handlungen und Figuren sich allmählich in ihrem Kopf verwirrten. Wie sie ihre Mutterrolle ausgeführt hatte, war vergleichbar mit Jobs in der Industrie, aus denen die Arbeiter krank und gebrochen entlassen werden, mit dem einen Unterschied, dass Mütter niemanden auf Schadenersatz verklagen können.
Zen führte sie zurück in das modrig riechende Schlafzimmer, das im hinteren Teil der Wohnung lag. Es war vollgestopft mit Möbeln, die sie aus ihrem Zuhause in Venedig mitgebracht hatte. Die einzelnen Stücke waren kunstvoll aus einem Holz gearbeitet, das so hart, dunkel und schwer wie Eisen war. Jeder Zentimeter Wand war zugestellt, wodurch sogar die Feuertreppe und der größte Teil des Fensters, das sie ohnehin immer fest zugezogen hatte, blockiert waren.
»Bleibst du noch auf und siehst dir den Film zu Ende an?«, fragte sie, als er sie zudeckte.
»Ja, Mamma, mach dir keine Sorgen. Ich bin da drinnen. Wenn du etwas hörst, bin das nur ich.«
»Das kam nicht von da drinnen! Jedenfalls hab ich dir ja schon gesagt, wers war. Der Dünne mit der Badehose.«
»Ich weiß, Mamma«, murmelte er müde. »Das denken alle.«
Er ging zurück ins Wohnzimmer, als es gerade zwei Uhr von den Kirchen im Vatikan schlug. Zen blieb stehen und sah sich die vertrauten Gesichter an, die auf dem flimmernden Bildschirm zur Unbeweglichkeit verdammt waren. Sie waren nicht nur ihm vertraut, sondern jedem, der in diesem Herbst ferngesehen oder Zeitung gelesen hatte. Seit Monaten wurden die Nachrichten beherrscht von den dramatischen Ereignissen und den noch sensationelleren Verwicklungen um die »Burolo-Affäre«.
In gewisser Weise war es ganz verständlich, dass Zens Mutter die beteiligten Personen mit der Besetzung eines Films verwechselt hatte, den sie gesehen hatte. Was Zen sich da ansah, war tatsächlich ein Film, aber ein ganz besonderer Film, der nur ihm als einem Beamten der Criminalpol beim Innenministerium zur Verfügung stand, und zwar im Zusammenhang mit einem Bericht, den er vorlegen und worin er den Fall bis zum gegenwärtigen Stand zusammenfassen sollte. Eigentlich war es ihm nicht erlaubt, den Film mit nach Hause zu nehmen, doch das Ministerium stellte keine Videogeräte für seine Angestellten zur Verfügung, auch nicht für die im Rang eines Vice-Questore. Wie sollte er das denn machen, hatte Zen gefragt, als ihm noch nicht klar war, was ein Videofilm eigentlich war, es Bild für Bild gegen das Licht halten?
Er setzte sich wieder auf das Sofa, griff nach der Fernbedienung, drückte auf die Play-Taste und ließ die verschwommenen Figuren wieder lachen, plaudern und sich ganz einfach vor der Kamera produzieren. Natürlich wussten sie, dass die Kamera da war. Oscar Burolo hatte kein Geheimnis aus seiner Manie gemacht, die Highlights seines Lebens aufzuzeichnen. Ganz im Gegenteil, jeder, der den Unternehmer in seinem sardischen Refugium besuchte, war beeindruckt von dem unterirdischen Kellergewölbe, in dem sich Hunderte von Videobändern befanden, ebenso Computerdisketten, alles sorgfältig abgelegt und registriert. Wie alle guten Bibliotheken wuchs auch Oscars Sammlung ständig. Kurz vor seinem Tod war sogar ein ganz neuer Regalabschnitt eingebaut worden, um die Neuzugänge unterzubringen.
»Siehst du dir die überhaupt jemals an?«, wurde er gelegentlich von einem Gast gefragt.
»Ich brauche sie mir nicht anzusehen«, antwortete Oscar darauf mit einem merkwürdigen Lächeln. »Es reicht mir zu wissen, dass sie da sind.«
Falls den sechs Leuten, die es sich dort am Wasser gut gehen ließen, die Vorstellung, dass ihr Geplänkel für die Nachwelt festgehalten wurde, in irgendeiner Weise unangenehm gewesen sein sollte, ließen sie sich das nicht im Geringsten anmerken. Eine Einladung in die Villa Burolo war so begehrt, dass sich niemand wegen der Bedingungen herumstreiten würde. Denn abgesehen von der Erfahrung an sich war es etwas, womit man anschließend monatelang bei Dinnerpartys angeben konnte. »Sie wollen sagen, dass Sie tatsächlich dort waren?«, fragten die Leute dann gewöhnlich, und ihr Neid war so augenscheinlich wie ein schlecht sitzender Slip. »Sagen Sie, stimmt es, dass er Löwen und Tiger frei auf dem Grundstück herumlaufen lässt und dass man nur mit dem Hubschrauber hineinkommen kann?« In dem sicheren Wissen, dass ihm wahrscheinlich niemand widersprechen würde, konnte Oscar Burolos Ex-Gast frei entscheiden, ob er die Tatsachen verzerren (»… und ich schwöre Ihnen, ich, der ich da war und es mit eigenen Augen gesehen habe, Burolo hat mehr als dreißig Bedienstete – oder eher Sklaven –, die er mit Cash dem Präsidenten eines bestimmten afrikanischen Staates abgekauft hat …«) oder – in etwas anspruchsvollerer Gesellschaft – nur andeuten sollte, dass in Wahrheit alles noch viel seltsamer sei als die diversen reißerischen und ordinären Geschichten, die im Umlauf waren.
Rein oberflächlich betrachtet war gerade dieses Ausmaß an Interesse das Merkwürdigste an der ganzen Geschichte. Denn was könnte schon banaler sein, als dass ein reicher Italiener sich eine Villa in Sardinien kauft. Bei »Sardinien« denkt man natürlich an die Costa Smeralda an der Nordküste der Insel, die Aga Khan für einen Spottpreis von einheimischen Bauern gekauft und in ein Ferienparadies für die Superreichen verwandelt hatte, einen Mini-Staat, der jedes Jahr im Sommer für zwei Monate zum Leben erwachte. Seine Bürger kamen aus allen Teilen der Welt und aus allen Sparten: Filmstars, Industrielle, Scheichs, Politiker, Kriminelle, Popsänger und Banker. Ihre kosmopolitische Enklave wurde von einer äußerst tatkräftigen Privatpolizei geschützt, doch die innere Ordnung war bemerkenswert demokratisch und egalitär. Es gab keinerlei religiöse, politische oder rassistische Diskriminierung. Das Einzige, was verlangt wurde, war Geld, haufenweise.
Als Gründer und Besitzer eines Bauunternehmens, dessen rasanter Erfolg schon fast unheimlich war, erfüllte Oscar Burolo zweifellos diese Voraussetzung. Doch anstatt sich brav wie alle anderen in die Costa einzukaufen, tat er etwas Unerhörtes, etwas so Bizarres und Merkwürdiges, dass einige Leute im Nachhinein behaupteten, sie hätten von Anfang an gewusst, dass das Ganze unter einem ungünstigen Stern stände. Oscar machte ein verlassenes Bauernhaus auf halber Höhe an der fast unbewohnten Ostküste der Insel zu seinem sardischen Refugium, und das noch nicht einmal am Meer, Gott bewahre, sondern mehrere Kilometer landeinwärts!
Italiener haben nicht sehr viel für exzentrisches Verhalten übrig, und diese Art von Spinnerei hätte sehr gut nichts weiter als Spott und Verachtung hervorrufen können. Doch es war ein Zeichen für die großkotzige Art, mit der Oscar seine Launen in die Tat umsetzte, dass genau das Gegenteil der Fall war. Sämtliche Reserven von Burolo Costruzioni wurden auf dieses armselige Bauernhaus verwandt, das rasch bis zur Unkenntlichkeit verändert wurde. So wurden nach und nach alle Argumente gegen Oscars Entscheidung als engstirnig und unhaltbar entlarvt.
Dem Sicherheitsaspekt, so wichtig in einer Gegend, die für Entführungen berüchtigt ist, wurde Rechnung getragen, indem man die Spitzenfirma des Landes beauftragte, die Villa einbruchssicher zu machen, koste es, was es wolle. Da er normalerweise immer Abstriche machen musste, um die Sicherheitsmaßnahmen kostengünstig zu halten, war der Berater hocherfreut, endlich einmal die Gelegenheit zu haben, ein System ohne jegliche Kompromisse entwerfen zu können. »Wenn es jemals jemand schafft, in dieses Grundstück einzudringen, dann fange ich an, an Geister zu glauben«, hatte er seinem Auftraggeber versichert, als die Arbeiten beendet waren. Nachdem er sich so seinen Seelenfrieden mit harter Münze erkauft hatte, fügte Oscar dem Ganzen eine persönliche Note hinzu, indem er ein Paar reichlich mottenzerfressener Löwen einem bankrotten Safaripark außerhalb von Cagliari abkaufte und sie auf dem Grundstück frei herumlaufen ließ. Er ging davon aus, dass das genügend Wirbel verursachen würde, um ebenso wie all die High-Tech-Maßnahmen Eindringlinge abzuschrecken.
Doch selbst Oscar konnte nichts an der Tatsache ändern, dass die Villa fast 200 Kilometer vom nächsten Flughafen und von den glitzernden Nachtlokalen der Costa Smeralda entfernt war, und zwar eine 200 km lange, nur notdürftig instand gehaltene Folterstrecke, auf der keine elektronischen Zäune ihn vor Entführern schützen konnten. War das kein großer Nachteil? Das könnte es schon sein, entgegnete Oscar, für jemanden, der bei Personentransport immer noch ausschließlich an Autos dachte. Doch die Entfernung zwischen Olbia und der Costa war nur halb so weit, wenn man es wie die Krähen machte, und wenn die spezielle Krähe dann auch noch 220 Kilometer pro Stunde zurücklegen konnte … Um die Diskussion zu beenden, packte Oscar seine Gäste üblicherweise in die »Krähe« – einen Agusta-Hubschrauber – und flog sie persönlich nach Palau oder Porto Cervo zum Aperitif.
Und was das Schwimmen betraf, da Oscar nicht wie ein gewöhnlicher Sterblicher ans Meer fahren wollte, musste das Meer halt zu ihm kommen. Zu diesem Zweck ließ er ein großes, unregelmäßiges Loch von den Ausmaßen eines kleinen Sees aus der verdorrten roten Erde hinter dem Bauernhof ausschachten. Das wurde dann mit Beton ausgegossen, mit Wasser gefüllt und durch einen Sandstrand mit sanft geschwungenen Felsen verziert, alles aus dem Küstenvorland herausgesprengt und mit Bulldozern herbeigeschafft, einschließlich der Muscheln und anderem Kleinzeug. Gerade die Muscheln gediehen prächtig, denn eine der größten Überraschungen für Burolos Gäste, wenn sie sich zu ihrem ersten Bad aufmachten, war, dass das Wasser salzig war. »Frisch aus dem Mittelmeer«, pflegte Oscar dann stolz zu erklären, »durch ein 5437 Meter langes Rohr mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern hier hochgepumpt, alle Verunreinigungen herausgefiltert, von sechs asynchronen Wellensimulatoren bewegt und ständig überwacht, damit der Salzgehalt konstant bleibt.« Oscar benutzte gern Wörter wie »asynchron« und »Salzgehalt« und ließ gerne Zahlenkolonnen aufmarschieren. Das machte die Wirkung perfekt, die die Villa bereits anfing, auf seinen Zuhörer zu haben. Aber er wusste genau, wann er aufhören musste, und an diesem Punkt schlug er seinem Gast gewöhnlich auf den Rücken – oder, wenn es eine Frau war, legte er seine Hand vertraulich auf das Ende ihrer Wirbelsäule, gerade oberhalb ihres Hinterns – und sagte: »Also was fehlt, außer ’ner Menge Fische, Krabben und Hummer? Ich meine, die haben wir natürlich auch, aber die wissen hier genau, wo sie hingehören – nämlich auf den Teller!«
Zen hielt das Video erneut an, weil auf der Straße Schritte zu hören waren. Eine Autotür schlug zu. Doch anstatt des erwarteten Geräuschs eines startenden und wegfahrenden Wagens kehrten die Schritte dahin zurück, wo sie hergekommen waren, und verstummten ganz in der Nähe.
Er ging ans Fenster und zog die Jalousie hoch. Die hölzernen Läden hinter der Scheibe waren geschlossen, doch wenn er zwischen den schräg gestellten Leisten hindurchguckte, konnte er Bruchstücke von dem erkennen, was sich da draußen abspielte. Beide Straßenseiten waren mit Autos zugestellt, die auf der Straße selbst, auf beiden Seiten der Bäume, die die Straße säumten, und überall auf dem Gehweg parkten. Etwas entfernt vom Haus stand eine rote Limousine, abseits von den übrigen Autos und dem Haus zugewandt. Es schien niemand drin zu sitzen.
Plötzlich wurde alles dunkel, weil die Straßenlaterne direkt unter Zens Fenster ausging. Irgendwas an der automatischen Schaltung war nicht in Ordnung, sodass die Lampe ständig ihr eigenes Licht für die Morgendämmerung hielt und sich deshalb ausschaltete. Nach einiger Zeit fing sie dann wieder schwach an zu leuchten, wurde allmählich immer heller, bis sich der gleiche Zyklus wiederholte.
Zen ließ die Jalousie wieder runter und ging zum Sofa zurück. Als sein Blick auf den großen Spiegel über dem Kamin fiel, blieb er stehen, als ob die Person, die er dort sah, möglicherweise den Schlüssel zu dem in Händen hielt, was ihn irritierte. Die vorstehenden Knochen und die etwas straffe Haut, besonders um die Augen herum, gaben seinem Gesicht ein leicht exotisches Aussehen, was wahrscheinlich auf slawisches oder gar semitisches Blut irgendwann in der venezianischen Vergangenheit seiner Familie zurückzuführen war. Es war ein Gesicht, das nichts verriet, aber immer so aussah, als ob es etwas zum Ausdruck bringen wollte, was dann doch nicht kam. Seinem Gesicht hatte Zen seinen Ruf als Vernehmungsbeamter zu verdanken, denn es war eine perfekte Leinwand, auf die der andere seine eigenen Zweifel, Ängste und Befürchtungen projizieren konnte. Während andere Polizisten, wenn sie mit Kriminellen zu tun hatten, je nach Situation Zuckerbrot oder Peitsche benutzten, drängte sich Zens Kandidaten der Eindruck auf, dass sie mit einem Mann konfrontiert waren, der kaum zu existieren schien und ihnen doch ihre tiefsten Geheimnisse entgegenhielt. Sie konnten selbst ihre flüchtigsten Emotionen von diesen vollkommen leeren Zügen ablesen und wussten, sie waren verloren.
Wie alle Möbelstücke in der Wohnung war auch der Spiegel alt, aber nicht wertvoll, und die Versilberung war an einigen Stellen matt geworden. Eine besonders große abgenutzte Stelle verdeckte sehr viel von Zens Brust und erinnerte ihn an die letzten furchtbaren Szenen aus dem Video, das er sich gerade angesehen hatte: wie Oscar Burolo unter den Gewehrschüssen taumelte, die aus dem Nichts gekommen waren, die den ausgeklügelten elektronischen Schutzwall seines Grundstücks durchbrochen hatten, als ob er nicht existierte.
Mit einem Schaudern trat Zen einen Schritt zur Seite und rückte so den unheimlichen blinden Fleck von sich weg. Der Fall Burolo hatte etwas an sich, was ihn von allen anderen Fällen, mit denen er jemals zu tun gehabt hatte, unterschied. Es hatte Fälle gegeben, die ihn beruflich dermaßen vereinnahmten, dass sie sein ganzes Leben beherrschten, bis er nicht mehr richtig schlafen oder überhaupt an etwas anderes denken konnte. Aber dieser Fall war noch beunruhigender. Es war so, als ob die Aura von Geheimnis und Schrecken, die diese Morde umgab, auf ihn selbst übergriffe, als ob auch ihm von der gesichtslosen Macht, die in der Villa Burolo gewütet hatte, Gefahr drohe. Das war natürlich absurd. Der Fall war abgeschlossen, es war jemand verhaftet worden, und Zens Beschäftigung damit war nur vorübergehend, aus zweiter Hand sozusagen und oberflächlich. Trotzdem blieb dieses Gefühl von Bedrohung, und das Geräusch von Schritten reichte aus, um ihn ans Fenster stürzen zu lassen, und ein Auto, das auf halber Höhe vor seinem Haus geparkt war, schien eine Gefahr darzustellen.
Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass es Zeit war, ins Bett zu gehen, das heißt eigentlich überfällig war. Er ging zurück zum Sofa, nahm sein zerknittertes Päckchen Nazionali-Zigaretten, überlegte kurz, ob er vor dem Schlafengehen noch eine rauchen sollte, entschied sich dagegen und zündete sich dann doch eine an. Er gähnte und sah auf seine Armbanduhr. Viertel nach zwei. Kein Wunder, dass er sich so seltsam fühlte. Durch die Nebel der Schlaflosigkeit schien alles so unwirklich und fließend wie in einem Traum. Er griff zur Fernbedienung, drückte die Play-Taste und versuchte, sich noch einmal auf den Bildschirm zu konzentrieren.
Eins musste man Oscar schon lassen! Natürlich hatte man die Kamera an einer günstigen Stelle aufgebaut, aber es war wirklich kaum zu glauben, dass dieser Strand, diese Felsen und diese kleinen, plätschernden Wellen keine natürliche Küste waren, sondern ein Swimmingpool, der fünf Kilometer landeinwärts lag. Was die Gruppe anging, die im Schatten eines riesigen, grün-blau gestreiften Sonnenschirms um einen Tisch saß und sich bei eisgekühlten Drinks mit Kartenspielen und Rätselmagazinen amüsierte, so war sie ziemlich typisch für die Art von Leuten, die man an einem beliebigen Tag im Juli oder August dieses Sommers in der Villa hätte antreffen können. Abgesehen von Oscar und seiner Frau gab es nur vier Gäste, denn Burolo war peinlich darauf bedacht, den Nimbus der Villa zu bewahren, indem er die Zahl seiner Gäste klein hielt und damit bei ihnen das Gefühl verstärkte, zum inner circle zu gehören. Seine Entschuldigung dafür war, dass sein Haushalt nicht in der Lage sei, große Gesellschaften auszurichten. Trotz der großartigen Geschichten über eine dort lebende Sklavengemeinschaft beschränkte sich Oscars Personal in Wirklichkeit auf einen älteren Hausmeister und dessen Frau, sowie einen jungen Mann, der mit den Löwen gekommen war und sich außerdem um den Garten kümmerte. Oscar betonte immer wieder, er sei ein Selfmademan und lege keinen Wert darauf, seinen Reichtum auf protzige Art zur Schau zu stellen. »Ich bin nur ein einfacher Baumeister, nichts weiter«, erklärte er oft. In Wahrheit war es jedoch so, dass er festgestellt hatte, dass man kleine Gruppen leichter dominieren und manipulieren konnte als große. Das Video machte das sehr deutlich. In jeder Szene, ob drinnen oder draußen, stand stets der Gastgeber selbst im Mittelpunkt. Wie er dort mit seinen silbrigen Shorts und dem nicht dazu passenden pink und blau gestreiften Seidenhemd an dem von ihm geschaffenen Strand lag, sein Kopf so übertrieben groß, als ob er aus der Feder eines Karikaturisten stammte, sah Oscar wie das uneheliche Kind des Michelin-Mannes und einer übergewichtigen Gorilla-Frau aus. Einer seiner erfolglosen Rivalen hatte mal gesagt, dass jeder, der noch Zweifel an der Evolutionstheorie hatte, offenbar nie Oscar Burolo begegnet war. Doch auf Oscars Kosten Witze zu machen, war reine Zeitverschwendung. Er griff die Geschichte sofort auf, erzählte sie selbst mit großem Vergnügen weiter und beendete sie mit der Bemerkung: »Aus diesem Grund habe ich überlebt, während Roberto den Löffel abgegeben hat, sieht ihm ganz ähnlich, diesem Dinosaurier!« Das war Oscar, der überschäumende und durch nichts zu erschütternde Oscar! Nichts konnte ihm etwas anhaben, oder zumindest schien das so.
Die Aura, die Burolo verbreitete, war so stark, dass man sich nur mit Mühe der übrigen Anwesenden bewusst wurde. Der etwas finstere Mann mit den sich lichtenden grauen Haaren und dem keilförmigen Gesicht, der links neben Oscar saß, war ein sizilianischer Architekt mit Namen Vianello, der mit Burolo Costruzioni an den Plänen für ein neues Elektrizitätswerk bei Rieti gearbeitet hatte. Leider war ihr Angebot aus technischen Gründen abgelehnt worden – etwas, das noch nie vorgekommen war –, und eine andere Firma hatte den Zuschlag erhalten. Dottor Vianello trug einen makellosen cremefarbenen Baumwollanzug und lächelte leicht angestrengt, was vermutlich damit zu tun hatte, dass er sich anhören musste, wie Oscars Frau von einem gescheiterten Einkaufstrip nach Olbia erzählte. Rita Burolo war früher eine außergewöhnlich attraktive Frau gewesen, und das Gefühl von Macht, das ihr das gegeben hatte, war immer noch da, auch wenn ihre Reize deutlich nachließen. Ihre törichten Reden hatten so lange absolute Aufmerksamkeit gefunden, dass Rita schließlich selbst glaubte, sie hätte den Leuten mehr zu bieten als ihre Beine und ihre Brüste, was ein Trost war, jetzt, wo Letztere nicht mehr ganz erstklassiges Material waren. Ihr gegenüber saß die Frau des sizilianischen Architekten, ein zartes, elfenhaftes Wesen mit ängstlichen Augen und einem leichten Schnurrbart. Maria Pia Vianello beobachtete mit einer Art andächtigen Entzückens das Schauspiel, das ihre Gastgeberin da ablieferte, wie ein Schulmädchen, das für seine Lehrerin schwärmt. Sie würde ganz bestimmt nie versuchen, eine Gruppe in dieser Weise zu dominieren.
Trotz dieser oberflächlichen Verschiedenheiten hatten die Vianellos und die Burolos jedoch grundsätzlich viel gemeinsam. Sie waren nicht mehr jung, aber reich genug, um das Alter noch ein paar Jahre in Schach zu halten. Die Männer waren wichtige und gewichtige Geschäftsleute. Sie erinnerten an jene Spielzeugfigürchen, die man nicht umstoßen kann, weil sie ein Bleigewicht enthalten, während die Frauen die mürrische Gereiztheit von Leuten ausstrahlten, denen jeder Luxus gewährt wurde bis auf Freiheit und Verantwortung. Das dritte Paar in der Runde war allerdings anders.
Zen ließ das Band noch einmal kurz zurücklaufen und holte die Schwimmer wieder aus dem Wasser. Dann hielt er das Bild an und betrachtete den Mann, der die Nachrichten der letzten drei Monate beherrscht hatte. Mit seinen scharfen, frettchenhaften Zügen und seinem schmächtigen Körper, zusammen mit dem fettigen Haar und einem übereifrigen Lächeln, sah Renato Favelloni wie ein Kleinstadt-Playboy aus, mal aufsässig, mal kriecherisch, immer davon überzeugt, für die Welt im Allgemeinen und die Frauen im Besonderen ein Geschenk des Himmels zu sein, gleichzeitig aber zu jeder schmutzigen Arbeit bereit, wenn es seiner Karriere diente. Zunächst war es Zen nahezu unbegreiflich erschienen, wie solch ein Mann der Drahtzieher bei den Absprachen hatte sein können, die angeblich zwischen Oscar Burolo und einem prominenten Politiker stattgefunden hatten, der in der Presse immer als »l’Onorevole« bezeichnet wurde, eine Formulierung, die Oscar angeblich in seinem geheimen Memorandum über ihre Beziehung benutzt hatte. Erst allmählich war Zen klar geworden, dass es gerade Favellonis offensichtliche Schmierigkeit war, die ihn zum Vermittler prädestinierte. Selbst bei den allerzynischsten Fällen von Korruption und Manipulation gibt es Abstufungen. Dadurch, dass Favelloni selbst die verabscheuungswürdigste Stufe verkörperte, konnten sich seine Klienten vergleichsweise relativ anständig fühlen.
Seine Frau war wie Renato selbst gut zehn Jahre jünger als die übrigen Anwesenden und genau die umwerfende Rassefrau, die Rita Burolo im gleichen Alter gewesen sein musste. Das konnte Oscars Frau nicht sonderlich für Nadia Favelloni eingenommen haben, ebenso wenig die Angewohnheit der jüngeren Frau, halb nackt herumzulaufen. Da sie inzwischen in dem Alter war, in dem die Kleidung der Frauen eher der Kaschierung als der Zurschaustellung dient, hüllte sich Signora Burolo diskret in ein wallendes Umhängetuch aus einem Material, das sehr viel weniger durchsichtig war, als es auf den ersten Blick wirkte.
Ein Gefühl von Ekel überkam Zen plötzlich bei dem Gedanken an das, was jetzt gleich mit diesem verwöhnten, verhüllten Fleisch passieren würde. Eitelkeit, Lust, Eifersucht, Langeweile, Biestigkeit, Schönheit, Witz – was spielte das alles für eine Rolle? Während die dem Tode geweihten Gesichter kokett in die Kamera blickten und sich fragten, wie sie wohl rüberkamen, hatte Zen das Bedürfnis, sie anzubrüllen: »Haut ab! Verschwindet sofort aus diesem Haus!«
Genau das hatten die Favellonis natürlich getan, und das war einer der Gründe, weshalb in Italien jeder, angefangen vom Richter, der den Fall untersuchte, bis zum Stammtischpolitiker mit Zens Mutter darin übereinstimmte, dass Renato Favelloni »es war«. Nachdem dieser schleimige Schieber und seine barbusige Frau gegangen waren, hatten sich die beiden älteren Paare zu einem ruhigen Dinner in das Esszimmer der Villa zurückgezogen mit seinem grob gefliesten Boden und dem riesigen, auf Böcken stehenden Tisch, der einst das Refektorium eines Franziskanerklosters geschmückt hatte. Als man mit dem Essen fertig war und Kaffee und Cognac serviert worden waren, hatte Oscar die Kamera wieder eingeschaltet, um die anschließende Unterhaltung aufzuzeichnen, die er wie immer mit seiner dröhnenden, emphatischen Stimme beherrschte und durch Schläge seiner haarigen Faust auf die Tischplatte akzentuierte.
Abgesehen von einem leisen metallischen Geräusch, dessen Quelle und Bedeutung umstritten waren, war das erste Zeichen dafür, dass gleich etwas passieren würde, in den nervösen Augen von Signora Vianello zu sehen. Die Frau des Architekten saß neben dem Gastgeber, der gerade eine etwas schlüpfrige Geschichte zum Besten gab. Dabei ging es um einen bekannten Fernsehmoderator und eine Stripperin, die jetzt als Abgeordnete im Parlament saß und in dessen Talkshow aufgetreten war, und darum, was die beiden angeblich in der Werbepause getrieben hatten. Maria Pia Vianello hatte mit einem vagen, verschwommenen Lächeln zugehört, als ob sie sich nicht sicher sei, ob sie sich den Anschein geben sollte zu verstehen. Dann wurde ihr Blick durch etwas auf der anderen Seite des Zimmers abgelenkt, etwas, das derartige Überlegungen belanglos machte. Ganz unvermittelt verschwand das vage Lächeln, und sie saß mit leerem Gesichtsausdruck da.
Sonst hatte niemand etwas bemerkt. Das einzige Geräusch im Raum war Oscars Stimme. Was immer Signora Vianello gesehen hatte, es schien sich zu bewegen, und sie folgte ihm mit den Augen durch das Zimmer, bis auch Oscar es sah. Er brach mitten im Satz ab, warf seine Serviette auf den Tisch und stand auf. »Was willst du?«
Man hörte keine Antwort, ja überhaupt kein Geräusch. Oscars Frau und Dottor Vianello, die mit dem Rücken zur Kamera saßen, sahen sich um. Rita Burolo stieß einen panischen Schrei aus. Vianellos Gesichtsausdruck blieb unverändert, außer dass er vielleicht ein wenig härter wurde.
»Was willst du?«, wiederholte Burolo mit einem irritierten und zornigen Stirnrunzeln. Ganz unvermittelt stieß er seinen Stuhl zur Seite und ging auf den Eindringling zu, wobei er gebieterisch nach unten sah, als ob er ein ungezogenes Kind einschüchtern wollte. Man konnte ja sagen, was man wollte, dachte Zen, aber der Mann hatte Mumm. Oder war er ganz einfach tollkühn und versuchte, vor seinen Gästen sein wagemutiges Image bis zum bitteren Ende aufrechtzuerhalten? Auf jeden Fall trat erst im allerletzten Moment Angst in Oscars Augen, als er instinktiv die Arme hochriss, um sein Gesicht zu schützen.
Eine brutale Geräuschexplosion kam durch den Lautsprecher. Von dieser Explosion im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergerissen, verschwanden Oscars Hände. Stattdessen erschienen bei ihm überall auf Gesicht und Hals hellrote Flecken wie bei einer plötzlich ausbrechenden Infektion. Er taumelte zur Seite und hielt seine Armstümpfe hoch. Irgendwie gelang es ihm, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und sich umzudrehen. In diesem Moment bekam er jedoch die zweite Ladung ab, die ihm den halben Brustkorb wegriss und ihn gegen die Kante des Esstischs schleuderte. Dort brach er als blutiges Bündel zu Füßen seiner Frau zusammen.
Rita Burolo hastete verzweifelt von der Leiche fort, während Vianello unter den Tisch tauchte und plötzlich eine Pistole in der Hand hielt. Das schnappende Geräusch einer Schrotflinte, die repetiert wird, mischte sich mit einem zweimaligen, leichten, kurzen Knallen aus der Pistole des Architekten. Dann war noch zweimal ein ohrenbetäubender Knall zu hören. Die erste Schrotsalve ging unter den Tisch, zersplitterte das Holz, zertrümmerte Teller und Gläser und verletzte Signora Vianello ganz übel an den Beinen. Ihr Mann war nur noch eine albtraumhafte Gestalt, die wie ein gequältes Tier auf dem Boden herumkroch. Die zweite Ladung erwischte Rita Burolo, die verzweifelt versuchte, aus dem Fenster zu klettern, das auf die Terrasse hinausging. Da sie weiter von der Waffe entfernt war als die anderen, waren die Verletzungen, die sie erlitt, mehr verstreut und bedeckten sie so fein und gleichmäßig wie Sprühregen eine Windschutzscheibe. Mit einem Verzweiflungsschrei stürzte sie aus dem Fenster und fiel auf den mit Steinplatten belegten Terrassenboden, wo sie langsam verblutete.
Trotz ihrer stark verletzten Beine gelang es Maria Pia Vianello irgendwie, sich aufzurichten. Obwohl sie selbst so klein war, erweckte auch sie den Eindruck, als ob sie auf den Eindringling herabblickte. »Einen Augenblick, bitte«, murmelte sie synchron zu dem trockenen, klinischen Geräusch, mit dem die Schrotflinte wieder geladen wurde. »Ich fürchte, ich bin noch nicht so weit. Es tut mir leid.«
Der Schuss kam aus ganz kurzem Abstand und zerfetzte sie so fürchterlich, dass an einigen Stellen Darmschlingen aus ihrem Unterleib heraustraten. Dann wurde sie von der zweiten Ladung herumgerissen. Sie griff kurz nach der Wand, dann fiel sie zu einem zerfledderten Bündel zusammen und hinterließ ein komplexes Muster von dunklen Streifen auf dem weiß getünchten Putz.
Es hatte weniger als zwanzig Sekunden gedauert, den Raum in ein Schlachtfeld zu verwandeln. In weiteren fünfzehn Sekunden würde der Hausmeister da sein, der von der Zweizimmer-Bedienstetenwohnung herbeigeeilt kam, wo er sich mit seiner Frau eine Unterhaltungssendung im Fernsehen angesehen hatte. Bis dahin war abgesehen von dem Wein, der aus einer zerbrochenen Flasche an der Tischkante tropfte, und einem Rascheln, das durch das krampfartige Zucken im Arm des sterbenden Vianello ausgelöst wurde, kein Laut zu hören. »Wenn es jemals jemand schafft, in dieses Grundstück einzudringen, dann fange ich an, an Geister zu glauben«, hatte der Sicherheitsberater Oscar Burolos versichert. Dennoch, jemand oder etwas war hineingekommen, hatte alle Anwesenden abgeschlachtet und war dann spurlos verschwunden, das alles in weniger als einer Minute und ohne jegliches Geräusch. Selbst am helllichten Tag und in Gesellschaft anderer Leute war es schwer, diese fast übernatürliche Dimension der Morde zu ignorieren. Doch in der unheimlichen Stille der Nacht und so ganz allein schien es unmöglich, an eine rationale Erklärung zu glauben.
Die Stille von dem laufenden Videoband wurde durch ein leises kratzendes Geräusch unterbrochen. Zen spürte, wie er eine Gänsehaut bekam und seine Kopfhaut zu kribbeln anfing. Er griff nach der Fernbedienung und hielt das Video an. Das Geräusch war immer noch da, ein leises, anhaltendes Kratzen. »Wie das Boot vom alten Umberto«, hatte seine Mutter gesagt.
Zen ging lautlos durch den Flur, öffnete die Tür zum Schlafzimmer seiner Mutter und sah hinein.
»Hörst du das?«, murmelte eine Stimme aus der Dunkelheit.
»Ja, Mamma.«
»Das ist gut. Ich dachte schon, ich würde mir das einbilden. Weißt du, manchmal bin ich nicht ganz richtig im Kopf.«
Er starrte zu dem im Dunkel verborgenen Bett hin. Das war das erste Mal, dass sie so etwas zugegeben hatte. Sie waren beide eine Zeit lang still, aber das Geräusch kehrte nicht wieder.
»Wo kommt das her?«
»Aus dem Kleiderschrank.«
»Aus welchem Kleiderschrank?«
In dem Zimmer standen insgesamt drei Stück, alle voller Kleider, die niemand mehr tragen würde, sorgfältig vor Motten geschützt durch großzügige Dosen Naphthalin, weshalb es in dem Raum immer wie bei einer Beerdigung roch.
»Dem großen«, antwortete seine Mutter.
Der größte Kleiderschrank nahm das mittlere Drittel der Wand ein, die zum Innenhof des Gebäudes lag. Seine Aufstellung hatte Zen damals einige Kopfschmerzen bereitet, weil er den Zugang zur Feuertreppe blockierte. Doch der Kleiderschrank war so groß, dass er nirgendwo anders hinpasste.
Zen ging zu dem Bett und strich die Steppdecke und die Laken glatt. Dann tätschelte er die Hand, die unter den Decken hervorkam. Ihre vom Alter gezeichneten Muskeln und Adern schimmerten auf beunruhigende Weise durch die pergamentartige Haut. »Das war nur eine Ratte, Mamma.«
Die beste Möglichkeit, ihre diffusen, kindlichen Ängste zu zerstreuen, war, ihre Gedanken auf etwas konkret Unangenehmes zu lenken, worüber sie sich aufregen konnte.
»Aber es hörte sich an wie Metall.«
»Die Fußleisten sind mit Zink abgesetzt«, erläuterte er aus dem Stegreif. »Damit sie sich nicht durchbeißen können. Ich werde morgen früh mit Giuseppe sprechen, und dann lassen wir den Kammerjäger kommen. Versuch jetzt, ein bisschen zu schlafen.«
Als er wieder im Wohnzimmer war, stellte er den Fernseher aus und ließ das Videoband zurücklaufen. Dabei versuchte er seine vage Beklommenheit zu zerstreuen, indem er an den Bericht dachte, den er am nächsten Tag schreiben musste. Es lag an der späten Stunde, dass alles jetzt so seltsam und bedrohlich schien, es war die Zeit, wo – wie sein Onkel ihm erzählt hatte – ein Haus nicht mehr den Leuten gehört, die zufällig gerade darin wohnen, sondern all denen, die ihnen durch die Jahrhunderte vorangegangen sind. Morgen früh würde alles wieder seine gewohnten Proportionen annehmen, und die unheimlichen Aspekte des Falls Burolo würden nur noch wie die Ausgeburten einer überreizten Fantasie erscheinen. Die eigentliche Frage war, ob man sie überhaupt erwähnen sollte. Nun war es keineswegs so, dass er etwas verbergen wollte oder musste. In diesem Fall hätte er auch gar nicht gewusst, wo er hätte anfangen sollen, da er keine Ahnung hatte, für wen der Bericht bestimmt war. Das Problem bestand darin, dass man gewisse Aspekte des Falls Burolo nur schwer erwähnen konnte, ohne sich selbst dem Vorwurf auszusetzen, ein leichtgläubiger Trottel zu sein. Das galt beispielsweise für die Aussage der siebenjährigen Tochter von Oscar Burolos Anwalt, die Ende Juli in der Villa zu Besuch gewesen war. Um ihr eine Freude zu machen, durfte sie mit den Erwachsenen zu Abend essen, und in der ganzen Aufregung hatte sie etwas vom Kaffee ihres Vaters stibitzt, mit dem Ergebnis, dass sie nicht schlafen konnte. Es war eine helle Sommernacht, und schließlich verließ das Kind sein Zimmer und machte sich auf den Weg, um das Haus zu erkunden. Sie sagte später aus, sie habe in einem der Zimmer im älteren Teil der Villa eine Gestalt herumschleichen sehen. »Zuerst habe ich mich gefreut«, sagte sie. »Ich dachte, es wäre ein Kind, und ich fühlte mich einsam und suchte jemanden zum Spielen. Aber dann fiel mir ein, dass keine Kinder in der Villa waren. Da habe ich Angst bekommen und bin in mein Zimmer zurückgelaufen.«
Wenn er solche Dinge mit einbezog, könnte er sich leicht zum Gespött der ganzen Abteilung machen, wenn er sie allerdings wegließ, setzte er sich eventuell dem Vorwurf aus, Beweismaterial zu unterschlagen. Glücklicherweise gehörte es nicht zu Zens Aufgabe, Schlussfolgerungen zu ziehen oder seine Meinung zu sagen. Was erwartet wurde, war ein knapper Bericht, der die verschiedenen Ermittlungsansätze beschrieb, die von der Polizei und den Carabinieri durchgeführt worden waren, und das Beweismaterial gegen die einzelnen Verdächtigen darlegte. Mit anderen Worten, eine reine Schreibarbeit, für die er keine besondere Eignung besaß außer der Fähigkeit, bei offiziellen Dokumenten zwischen den Zeilen lesen zu können, die Weizenkörner dessen, was nicht gesagt wurde, aus dem riesigen Spreuhaufen dessen, was gesagt wurde, herauszupicken. Sich das Video anzusehen, war der letzte Schritt bei dieser ganzen Angelegenheit. Jetzt musste er sich nur noch hinsetzen und das Ding runterschreiben, und das würde er gleich am nächsten Morgen tun, solange er alles noch frisch in Erinnerung hatte. Bis zum Nachmittag würde die Burolo-Affäre für ihn keine größere Bedeutung mehr haben als für die breite Öffentlichkeit.
Erneut waren unten auf der Straße Schritte zu hören. Ein paar Minuten später wurde die Stille plötzlich unterbrochen, als ein Auto angelassen wurde und mit quietschenden Reifen davonjagte. Bis Zen am Fenster war, hatte es längst den Bereich der Straße verlassen, der durch die geschlossenen Läden sichtbar war. Das Motorengeräusch wurde allmählich leiser und war dann nur noch als entferntes Echo in dem Gewirr der Straßenschluchten zu hören. Die Straßenlaterne befand sich gerade in der zunehmenden Phase, und während das Licht allmählich heller wurde, konnte Zen erkennen, dass das rote Auto, das weiter unten auf der Straße geparkt hatte, nicht mehr da war. Er schloss die Jalousie und fragte sich, weshalb ihn die Tatsache, ob das Auto nun da stand oder nicht, etwas angehen sollte. Weil er darauf keine Antwort wusste, beschloss er, dass es Zeit sei, ins Bett zu gehen.
Es ist fast vorbei. Alles verschwindet, die Zweifel, die Ängste, die Sorgen, das Chaos, selbst der Schmerz. Alles zieht sich wie von selbst zurück. Es gibt nichts mehr, was ich tun muss, nichts mehr, was getan werden müsste.
Als ich ihn dort stehen sah mit dem Gewehr in der Hand, war es, als ob ich mich selbst im Spiegel sähe. Er hatte meine Rolle übernommen, wie er da aus dem Nichts auftauchte, unversöhnlich, selbstsicher, ohne überrascht zu sein. Er hörte sich ungeduldig an, verspottete mich mit einem seltsamen Namen und drohte mir. »Es hat keinen Sinn, sich zu verstecken«, sagte er. »Bringen wir es hinter uns.« Wie gewohnt, tat ich, was man mir sagte.
Er schrie vor Zorn und Fassungslosigkeit. Was auch immer er erwartet hatte, das jedenfalls nicht. Dann wurde ich von etwas überwältigt, es schlug mich zu Boden, riss mich auseinander. Ich hätte mich nicht wehren können, auch wenn ich es gewollt hätte. Es war nicht wie beim ersten Mal, als der Mann unter dem Tisch mich mit seiner Pistole verwundete. Er hat mir nur Schmerzen zugefügt. Das hier war anders. Ich wusste sofort, dass ich den Tod in mir trug.
Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Ich fühle mich schon ganz leicht und körperlos, als ob ich mich auflöste. Die Dunkelheit kommt näher, sie ballt sich zusammen, um mich einzuhüllen, mich in ihre endlosen Falten zu wickeln. Alles fließt. Das feste Gestein gibt unter meiner Berührung nach, der Boden unter mir gerät in Bewegung, als ob der Fluss in seinen Lauf zurückgekehrt wäre, unerforschte Höhlen explodieren wie Feuerwerk, während ich voranschreite. Ich bin verloren, ich, die ich diesen Ort besser kenne als meinen eigenen Körper!
Mittwoch, 07.20–12.30
Als Zen die Wohnungstür hinter sich zuzog, quietschte sie wie immer in den Angeln, was sofort von einem Echo eine Etage höher beantwortet wurde. Einer der Mieter dort hielt einen Vogel, der offenbar meinte, bei Zens Wohnungstür handele es sich um einen gefiederten Kollegen, und ihren klagenden Ruf stets mit einem aufmunternden Zwitschern beantwortete.
Zen polterte die Treppe hinunter, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, und ließ den uralten Aufzug mit seinem schmiedeeisernen Käfig links liegen. Gott sei Dank für die Arbeit, dachte er, da die ihm einen unanfechtbaren Grund gab, seiner dunklen, vollgestopften Wohnung und der alten Frau zu entfliehen, die davon in einer Weise Besitz ergriffen hatte, dass er sich wieder wie ein Kind vorkam, ohne Rechte und ohne eigenständiges Leben. Was würde passieren, wenn er diese willkommene Möglichkeit, seine Tage auszufüllen, nicht mehr hätte? Die Regierung hatte in letzter Zeit mehrmals lautstark verkündet, dass es notwendig sei, den aufgeblähten öffentlichen Dienst zu verkleinern. Dazu bot sich die frühzeitige Pensionierung von älteren Beamten an. Doch glücklicherweise würde es beim bloßen Gerede darüber bleiben. Für eine Regierung, die aus einer Koalition von fünf Parteien bestand, von denen jede ihre Interessen vertreten und ihre Wähler glücklich machen musste, war es praktisch unmöglich, Gesetze zu erlassen, die auch nur bei irgendjemandem ein wenig unbeliebt sein könnten, geschweige denn, die bürokratische Hydra in Angriff zu nehmen, die fast einem Drittel der arbeitenden Bevölkerung eine gesicherte Stelle garantierte. Dennoch würde er eines Tages in den Ruhestand gehen müssen. Dieser Gedanke suchte ihn immer wieder heim wie die Aussicht auf eine chronische Krankheit. Wie würde er den Tag herumkriegen? Was würde er tun? Sein Leben war in eine Sackgasse geraten.
Giuseppe, der Hausmeister, warf vom Fenster seiner Wohnung im Zwischengeschoss aus ein aufmerksames Auge auf das Kommen und Gehen der Leute. Zen nahm sich nicht die Zeit, ihm etwas von den kratzenden Geräuschen zu sagen, die er in der vergangenen Nacht gehört zu haben glaubte. Bei Tageslicht schien das Ganze so unwirklich wie ein Traum.
Die Straßen waren in das milde Licht der Novembersonne getaucht, und es herrschte geräuschvolle Betriebsamkeit. Gruppen lärmender Schulkinder zogen vorüber und stellten den Teil ihrer Persönlichkeit zur Schau, der während der nächsten fünf Stunden lebendig begraben sein würde. Das metallische Getöse von Rollläden kündigte an, dass die Geschäfte in der Gegend gerade aufmachten. Ein abgehacktes Hämmern und das Pfeifen eines Lackiergerätes kam aus den offenen Fenstern der ebenerdigen Werkstätten, wo Handwerker geheimnisvolle Operationen an Metern und Abermetern nach Maß geschnittener Holzplanken vollzogen. Doch der Verkehr beherrschte alles: das gleichförmige Summen der neuen Autos, das individuelle Lärmen der alten, das raue Tuckern der Dieselmotoren, das zornige Knattern der Motorroller und dreirädrigen Lieferwagen, das dumpfe Brummen der Busse, das kettensägenartige Kreischen eines Trail-Bikes ohne Auspuff, das Quietschen der Bremsen und der schrille Missklang streitender Hupen.
Der Händler an der Ecke legte gerade letzte Hand an die Zeitungen und Zeitschriften, die in einer komplizierten, überlappenden Anordnung um seinen Stand herum drapiert waren. Wie gewohnt kaufte Zen dort seine Zeitung, aber er warf noch nicht einmal einen Blick auf die Schlagzeilen. Er fühlte sich gut, gelassen und sorglos, befreit von jener schwarzen Magie, die während der vergangenen Nacht auf eigenartige Weise von seiner Seele Besitz ergriffen hatte. Er würde später noch genügend Zeit haben, um von Katastrophen und Skandalen zu lesen, die absolut nichts mit ihm zu tun hatten.
Gegenüber dem Zeitungsstand lag an der Ecke des nächsten Häuserblocks das Café, in das Zen immer ging, hauptsächlich deshalb, weil es die immer mehr um sich greifende Unsitte nicht mitmachte, entrahmte Milch für den Cappuccino zu verwenden, die statt der dicken Schaumkrone nur ein paar fade Bläschen produzierte. Der Barmann, der mit einem prächtigen Schnurrbart als Ausgleich für seinen kahlen Schädel protzte, begrüßte Zen mit respektvoller Herzlichkeit und wandte sich dann unaufgefordert um, um ihm seinen Kaffee zu machen.
»Barbaren!«, rief ein gedrungener Mann im Tweedanzug und sah von der Zeitung auf, die er vor sich auf der Bar ausgebreitet hatte. »Die sind ja total verrückt! Was hat das für einen Sinn? Was wollen die damit erreichen?«
Zen nahm sich ein duftendes Brioche, bevor er sich an den mit Kakao besprenkelten Schaum auf dem Cappuccino heranmachte, den Ernesto vor ihn hinstellte. Erst nachdem sie sich mehrere Jahre lang jeden Morgen in dieser Bar getroffen hatten, hatte Zen – dank eines entzündeten Backenzahns, der dringend behandelt werden musste – festgestellt, dass es sich bei dem aufgebrachten Zeitungsleser um den Zahnarzt handelte, dessen Name auf einem der beiden Messingschilder stand, die Giuseppe jeden Morgen gewissenhaft polierte. Er war froh, dass er der Versuchung widerstanden hatte, in die Zeitung zu gucken. Zweifellos gab es wieder eine neue dramatische Enthüllung in der Burolo-Affäre. Es verging kaum ein Tag ohne. Doch während solche Dinge für den Zahnarzt eine Art Unterhaltung waren, ein Vorwand, seine moralische Entrüstung zum Ausdruck zu bringen, bedeuteten sie für Zen Arbeit, und die begann für ihn erst in einer halben Stunde. Müßig dachte er darüber nach, was wohl die anderen Männer in der Bar sagen würden, wenn sie wüssten, dass er ein Videoband bei sich hatte, auf dem die Burolo-Morde in allen schaurigen Einzelheiten zu sehen waren.
Bei diesem Gedanken stellte er seine Kaffeetasse ab und klopfte leicht auf seine Manteltasche, um sich zu vergewissern, dass die Videokassette noch da war. Das wäre ein Fehler, den er sich auf keinen Fall erlauben durfte. Es hatte bereits eine undichte Stelle gegeben, als Standfotos aus dem Band, das Burolo aufgenommen hatte und auf dem Liebesszenen zwischen seiner Frau und dem jungen Löwenhüter zu sehen waren, in einem billigen Skandalblättchen veröffentlicht worden waren. Solch eine Zeitschrift oder einer von den skrupelloseren privaten Fernsehsendern wäre sicher bereit, ein kleines Vermögen für ein Video mit den Morden selbst zu zahlen. Das verschwundene Band könnte in so einem Fall sofort bis zu Zen zurückverfolgt werden, der es aus dem Archiv entliehen hatte. Jeder würde annehmen, dass Zen das Band verkauft hätte, und die gegenteiligen Beteuerungen seitens der Zeitschrift oder des Fernsehsenders – falls die sich überhaupt diese Mühe machen sollten – würden als Teil des Deals abgetan werden. Vincenzo Fabri wartete seit Monaten auf so eine Gelegenheit. Er würde sie nicht ungenutzt verstreichen lassen!
Zen war inzwischen klar, dass er seit seiner unerwarteten Beförderung aus seiner bisherigen untergeordneten Tätigkeit in eine höhere Position bei der Criminalpol, der Vorzeigeabteilung des Ministeriums, so ziemlich alles falsch gemacht hatte. Das hing mit der weitverbreiteten, aber falschen Vorstellung von der Arbeit dieser Gruppe zusammen. Die Presse, die sich vom Zauberwort der Eliteeinheit hinreißen ließ, stellte sie als ein Team von hoch qualifizierten »Supercops« dar, die über die Halbinsel fegten und die Fälle knackten, die sich für die Provinzbeamten als zu schwierig erwiesen hatten. Zen hatte sich seitdem oftmals reuevoll gesagt, dass er es besser hätte wissen müssen. Gerade ihm hätte klar sein müssen, dass es bei der Polizeiarbeit nie auf individuelle Fähigkeiten ankam. Es ging einzig und allein darum, gewisse Maßnahmen durchzuziehen. Gelegentlich führten diese dazu, dass Verbrechen geklärt wurden, aber das war nur ein Nebenprodukt des eigentlichen Zwecks, der darin bestand, die Machtverteilung innerhalb der Institution selbst zu erhalten beziehungsweise wieder in Ordnung zu bringen. Das Ergebnis war ein ständiges Hin und Her, eine unaufhörliche frenetische Aktivität, die man für sinnvolle Arbeit hätte halten können.
Dennoch war das ein Fehler, den Zen niemals hätte machen dürfen und der ihm teuer zu stehen kam. Wenn er nach Bari oder Bergamo oder sonst wohin geschickt wurde, hatte er sich stets voller Energie auf die jeweiligen Fälle gestürzt, die er bearbeiten sollte, hatte prüfende Fragen gestellt, Kritik ausgeteilt, die Untersuchung neu organisiert und überhaupt versucht, die Dinge so weit wie möglich in Bewegung zu bringen. Er hatte die kühne Vorstellung gehabt, dass er auf diese Weise am schnellsten zu Ergebnissen käme, und sich nicht klargemacht, dass die vom Ministerium erwünschten Ergebnisse sich automatisch aus der Tatsache ergaben, dass man ihn geschickt hatte. Er brauchte keinen Finger zu rühren, ganz im Gegenteil, es war sogar wichtig, dass er das nicht tat. Weit entfernt davon, der »007 aus dem Ministerium« zu sein, den die Presse so gern porträtierte, waren die Mitarbeiter von Criminalpol eher vergleichbar mit Schulräten oder Flughafeninspektoren. Ihre Besuche gaben dem Ministerium die Chance, ein relativ zuverlässiges Bild davon zu bekommen, was so vor sich ging, die Provinzbehörden daran zu erinnern, dass alle Macht letztlich in Rom lag, und den betroffenen Pressuregroups zu signalisieren, dass etwas unternommen wurde. Niemand wollte, dass Zen den Fall, dem seine Mission eigentlich galt, auch tatsächlich löste. Weder die örtliche Polizei, die sich dann die Frage gefallen lassen müsste, warum sie nicht ohne Hilfe zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sei, noch das Ministerium, für das jede Lösung lediglich eine Reihe weiterer Probleme bedeutete. Das Einzige, was er tun musste, um es allen recht zu machen, war, nach Schema F vorzugehen.
Als ihm das endlich klar wurde, hatte Zen es sich unglücklicherweise mit den meisten seiner neuen Kollegen bereits verdorben. Zugegebenermaßen hatte er mit einem ziemlich starken Handicap angefangen, was mit der Art seiner Ernennung zusammenhing. Die war nämlich von einem der Verdächtigen im Entführungsfall Miletti eingefädelt worden, in dem Zen in Perugia ermittelt hatte. Zens anschließende Beförderung hatten natürlich viele Leute als eine Art Bestechung angesehen, und damit war der Ärger vorprogrammiert. Doch das wäre ihm vielleicht irgendwann verziehen worden, wenn der Neuling nicht in taktloser Weise seine Energie zur Schau gestellt hätte; dazu hatte er noch das Pech, sich einen der redegewandtesten und beliebtesten Männer der Belegschaft zum Feind zu machen. Vincenzo Fabri hatte bei zahlreichen Gelegenheiten bereits vergeblich versucht, seine Beförderung durch politischen Druck durchzusetzen, und er konnte es Zen nicht verzeihen, dass diesem etwas gelungen war, wo er selbst versagt hatte. Fabri war zu einer Art Brennpunkt für die Abneigung geworden, die Zen hervorgerufen hatte, und er schürte diese Stimmung durch zahlreiche witzige und bösartige Anekdoten, die Zen immer erst dann zu Ohren kamen, wenn der Schaden bereits angerichtet war. Und weil Fabris Groll vollkommen irrational war, war Zen sicher, dass er umso beständiger sein würde.
Er knüllte seine Papierserviette zu einer Kugel zusammen, warf sie in den Mülleimer und ging zur Kasse, die sich in der Ecke zwischen den beiden Eingängen des Cafés befand. Die Zeitung, in der der Zahnarzt gelesen hatte, lag noch aufgeschlagen auf der Bar, und Zen konnte die reißerische Schlagzeile: »DIE ROTEN BRIGADEN KEHREN ZURÜCK« einfach nicht übersehen. Als er den darunter stehenden Artikel überflog, erfuhr er, dass am vergangenen Abend ein Richter in seiner Wohnung in Mailand niedergeschossen worden war.
Darauf hatten sich also die rhetorischen Fragen des Zahnarztes bezogen. Ja, wirklich, was hatte das alles für einen Sinn? In früheren Zeiten schienen solche hirnlosen terroristischen Akte, so schockierend sie auch waren, zumindest heroische Gesten von unbestreitbarer Bedeutung darzustellen. Aber diese Zeiten waren lange vorbei, und Wiederauflagen waren nicht nur moralisch genauso abscheulich wie die Originale, sondern außerdem noch antiquiert und sozusagen aus zweiter Hand.
Während er zur Bushaltestelle ging, las Zen in seiner eigenen Zeitung über die Schießerei. Der ermordete Richter, ein gewisser Bertolini, war niedergeschossen worden, als er von der Arbeit nach Hause kam. Sein Chauffeur, der ebenfalls getötet wurde, hatte auf die Angreifer geschossen und wahrscheinlich einen von ihnen verwundet. Bertolini war keine besonders herausragende Persönlichkeit, auch hatte er anscheinend mit den Prozessen gegen die Aktivisten der Roten Brigaden nichts zu tun. Es entstand der Eindruck, dass er ausgesucht worden war, weil er ein leichtes Ziel darstellte, was an sich schon ein beschämender Kommentar über den Machtverfall der Terroristen war, verglichen mit den Zeiten, wo sie offenbar zuschlagen konnten, wo sie wollten.
Zens Augen schweiften zu den kleineren Schlagzeilen weiter unten auf der Seite. »WEGEN EHEBRUCH LEBENDIG VERBRANNT« lautete eine von ihnen. Die Geschichte schilderte, wie ein Ehemann in Genua seine Frau mit einem anderen Mann erwischt, beide mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Er faltete die Zeitung abrupt zusammen und schob sie unter seinen Arm. In dieser Hinsicht brauchte er sich allerdings keine Sorgen zu machen. Da konnte er wirklich froh sein!