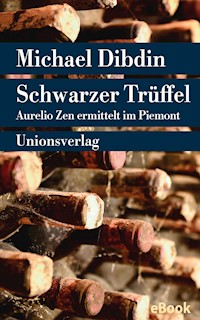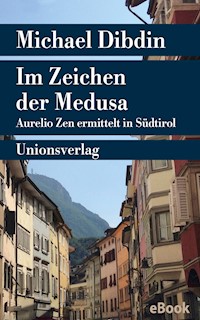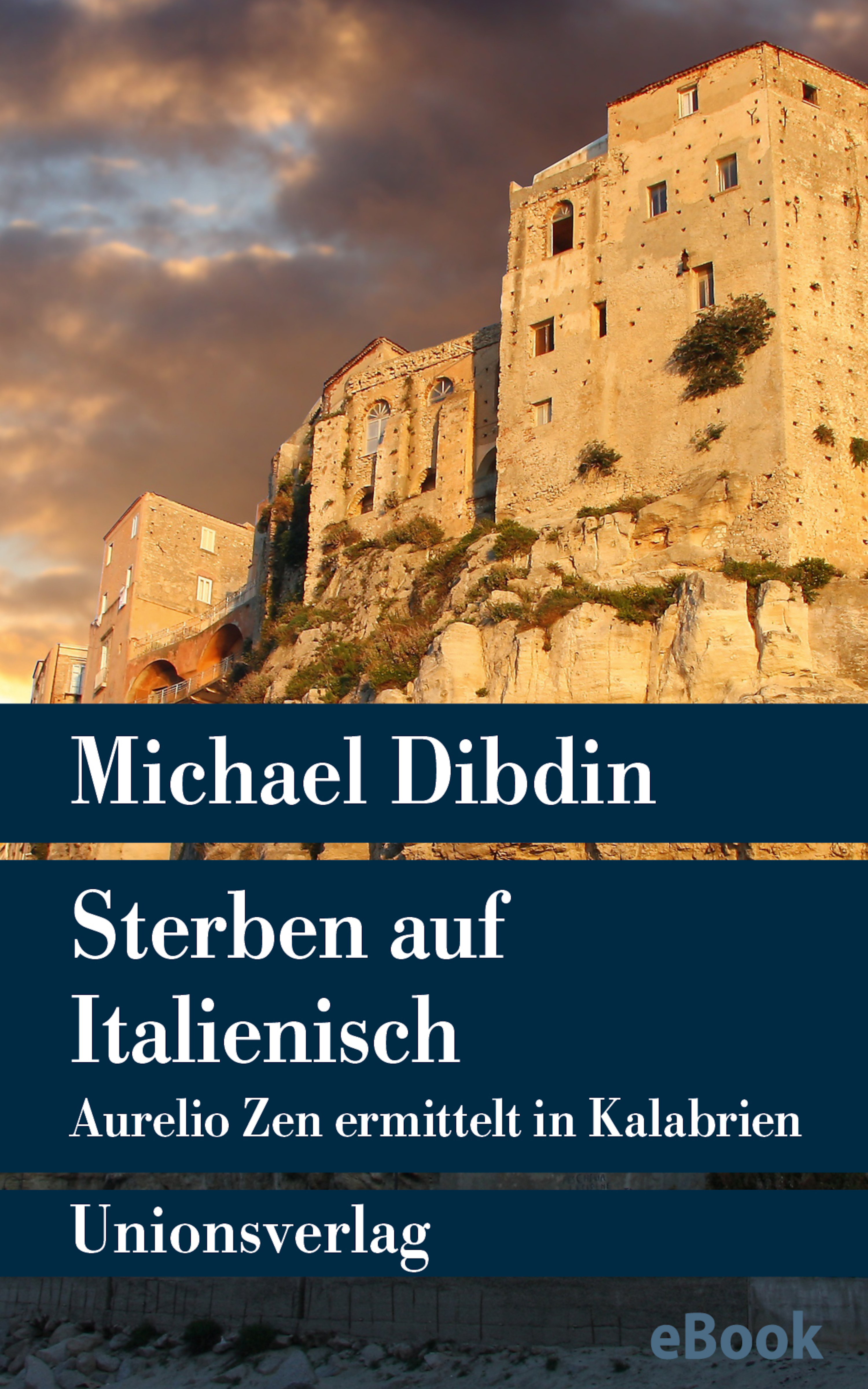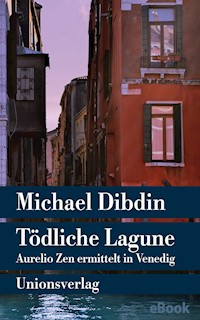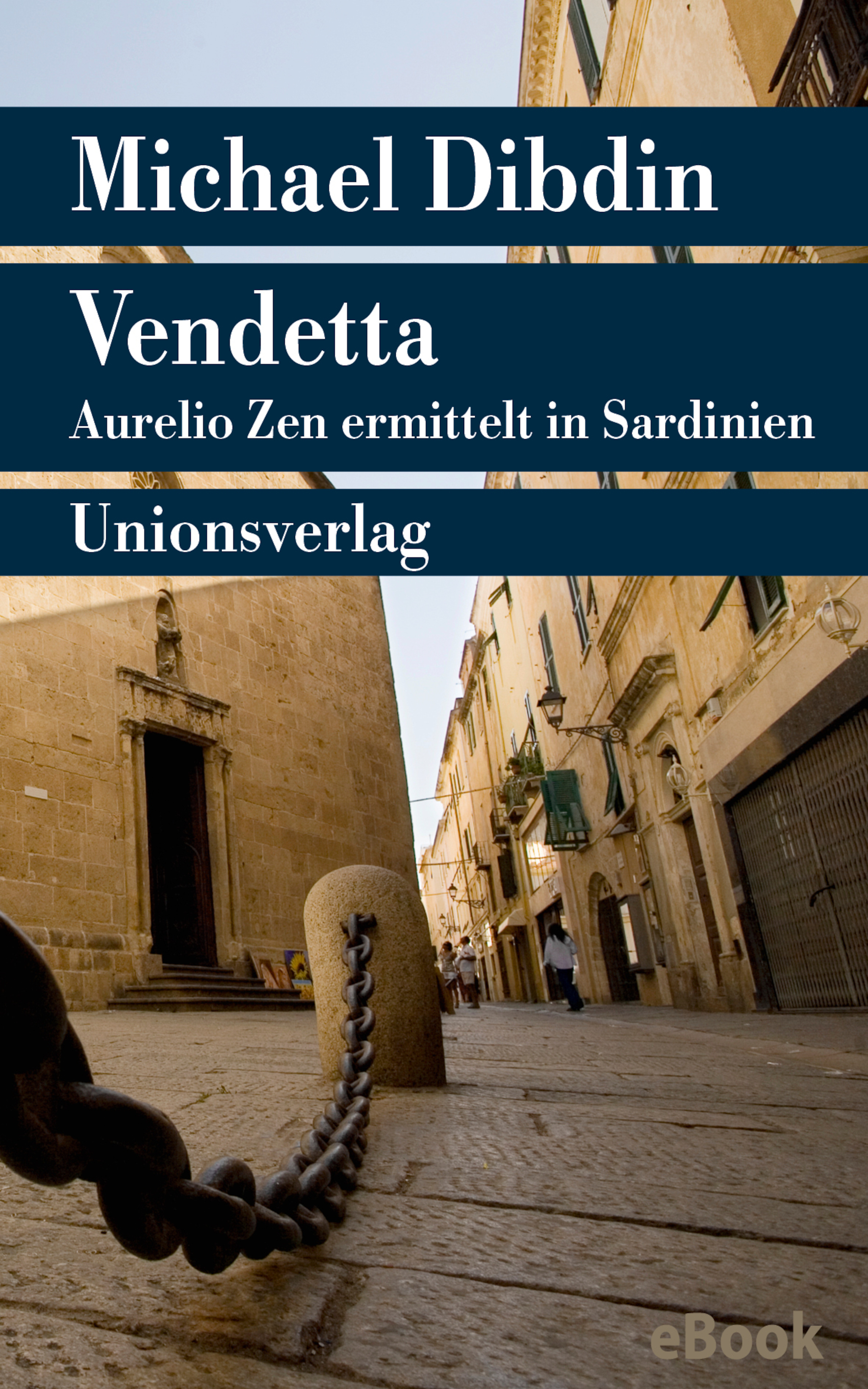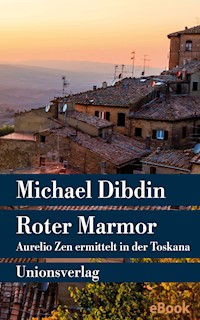
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem verschlafenen Badeort an der toskanischen Küste versucht sich Polizeikommissar Aurelio Zen von den Folgen eines Bombenanschlags zu erholen, den er nur knapp überlebt hat. Gleichzeitig bereitet er sich auf einen Prozess in den USA vor, bei dem er als Kronzeuge gegen die Mafia aussagen soll. Als in seinem Bekanntenkreis mehrere Menschen ermordet werden, scheint der Fall klar: Die ehrenwerte Gesellschaft hat die Jagd auf den unbequemen Commissario eröffnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Am Badestrand der Toskana versucht sich Aurelio Zen von den Folgen eines Bombenanschlags zu erholen, den er nur knapp überlebt hat. Doch als in seinem Liegestuhl ein Fremder irrtümlich ermordet wird, ist klar: Die ehrenwerte Gesellschaft hat die Jagd auf den Commissario eröffnet.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Michael Dibdin (1947–2007) studierte englische Literatur in England und Kanada. Vier Jahre lehrte er an der Universität von Perugia. Bekannt wurde er durch seine Figur Aurelio Zen, einen in Italien ermittelnden Polizeikommissar.
Zur Webseite von Michael Dibdin.
Ellen Schlootz arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie hat u. a. Werke von Ian Rankin und David Hosp ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Ellen Schlootz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Michael Dibdin
Roter Marmor
Aurelio Zen ermittelt in der Toskana
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ellen Schlootz
Aurelio Zen ermittelt (8)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2002 im Verlag Faber and Faber, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 im Goldmann Verlag, München.
Originaltitel: And Then You Die (2002)
© by Michael Dibdin 2002
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Audrey Omelyanchuk
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30888-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 15:28h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ROTER MARMOR
VersiliaIslandaRomaLuccaMehr über dieses Buch
Über Michael Dibdin
Über Ellen Schlootz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Michael Dibdin
Zum Thema Italien
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Für Luca Merlini
Versilia
Alle Welt glaubte, Aurelio Zen sei tot. Massimo Rutelli unter dem nächsten Sonnenschirm, ein paar erstrebenswerte Meter näher am Meer, war tatsächlich tot.
Die beiden Männer waren auch in beinah jeder anderen Hinsicht verschieden. Zen trug ein kurzärmeliges Baumwollhemd, eine leichte Hose und Ledersandalen und saß zurückgelehnt in seinem Liegestuhl im Schatten des Strandschirms, die Krempe eines Panamahuts über die Augen gezogen. Massimo Rutelli war nackt bis auf eine winzige schwarze Badehose und ein orangefarbenes Handtuch, das locker über den oberen Teil seines Rückens drapiert war. Er lag bäuchlings auf einer der mit grünem Segeltuch bespannten Liegen, die den Sonnenanbetern zur Verfügung standen, seine Hände ruhten auf dem perfekt glatt gezogenen Sand. Doch der Hauptunterschied zwischen den beiden war, einer war tot, und der andere träumte.
Es war ein Traum, den Zen seit vielen Monaten immer wieder träumte. Er wusste nicht genau, wie lange schon. Seine Erinnerungen an die Zeit nach dem »Incidente« waren lückenhaft, verworren und unzuverlässig wie die Erinnerungen aus seiner Kindheit. Der Traum selbst enthielt immer drei feste Elemente – eine Brücke, eine unmittelbar bevorstehende Katastrophe und ein Happy End –, doch die spezifischen Details, Örtlichkeiten und Spezialeffekte variierten von Mal zu Mal.
So konnte die Brücke beispielsweise so schmal sein wie ein Abwasserkanal aus Beton unter einer Autobahn oder eine riesige Konstruktion, die so lang war, dass man von der Mitte aus keins der beiden Brückenenden sehen konnte. Einmal war es eine Holzbrücke über einem reißenden Fluss gewesen. Ein Zug mit einer Dampflokomotive fuhr über die Brücke, während die in Brand gesetzte Zündschnur auf der Unterseite der Bohlen Funken sprühend auf das Bündel Dynamitstangen zuraste. Doch die Schnur war zu spät angezündet worden. Die Waggons erreichten unversehrt die andere Seite, bevor die Planken auf spektakuläre Weise in die Luft flogen und wie Tausende von Streichhölzern wieder herunterfielen.
Ein andermal war es eine primitive Hängebrücke über einem Abgrund gewesen, dessen ungeheure Tiefe unter dicken Nebelschwaden verborgen lag. In diesem Fall hatte die Bedrohung in einem Schwarm glänzender schwarzer Käfer bestanden, die mit ihren rasiermesserscharfen Mundwerkzeugen an den Seilen knabberten. Erst als der letzte Strang zu reißen drohte, war zu erkennen, dass die Haltetaue nicht aus Hanf waren, sondern aus Stahl, gegen den der Insektenschwarm machtlos war.
Diesmal hatte sich der erfinderische Traumregisseur schon wieder ein neues Szenario ausgedacht. Seit den Sechzigerjahren war davon die Rede, eine Brücke über die Straße von Messina zu bauen als Ersatz für den langsamen und unzureichenden Fährbetrieb, der die einzige Verbindung zwischen Sizilien und dem Festland darstellte. Mit über drei Kilometern wäre sie, wenn sie je fertiggestellt würde, eine der längsten Brücken der Welt, doch nicht irgendwelche technischen Probleme mit der Konstruktion hatten das Projekt bisher verhindert, sondern wirtschaftliche und politische.
Die geschätzten Kosten waren so gewaltig, dass man sie üblicherweise nur in Dollar veranschlagte, selbst als es noch Lire gab – von 4,5 Milliarden Dollar war die Rede –, da der entsprechende Betrag in Lire sich in einer Größenordnung bewegte, die nur noch für Astrophysiker verständlich wäre. Während der langen Zeit, in der die Christdemokraten das Land regierten, hatte niemand einen Zweifel daran gehabt, in wessen Händen dieses Geld landen würde, ganz zu schweigen von den unvermeidlichen Verteuerungen und Nachbesserungen für unvorhergesehene Probleme, durch die sich der ursprünglich geschätzte Betrag vermutlich mindestens verdoppeln würde. Nicht fertiggestellte Autobahnen, auf eiligst entwässerten Sumpfgebieten errichtete Kraftwerke sowie Hüttenwerke, die Hunderte von Kilometern vom nächsten Eisenerzlager entfernt gebaut wurden, waren zu jener Zeit an der Tagesordnung, doch selbst die abgebrühtesten Politiker wollten sich nicht dabei ertappen lassen, wie sie ihren Freunden und Förderern beinah ein Prozent des nationalen Bruttosozialprodukts zukommen ließen. Und so war die Brücke nie gebaut worden.
In Aurelio Zens Traum existierte sie allerdings, und er befand sich mitten darauf, fuhr mit hoher Geschwindigkeit von Sizilien zurück zum sicheren Festland. Die Brücke war jedoch nicht jene elegante Hängekonstruktion, die die Ingenieure tatsächlich entworfen hatten, sondern ein altes, verrostetes Gebilde mit schmiedeeisernen Trägern, ursprünglich für den Schienenverkehr geplant, nun aber mit einer behelfsmäßigen Fahrbahn aus Holzplanken versehen. Das Auto, in dem Zen saß, war ebenfalls antiquiert, ein riesiges Kabrio aus der Vorkriegszeit mit grotesk gewölbten Kotflügeln, das von einem grimmig aussehenden uniformierten Chauffeur mit Pilotenbrille gefahren wurde. »Das ist eine gefährliche Straße«, murmelte er melodramatisch. Zen nahm davon keine Notiz. Er genoss das strahlende Sonnenlicht, den belebenden Wind und freute sich an den leisen Rufen der Wassermelonenverkäufer unten am Strand.
Sie fuhren so schnell, dass sie das riesige Loch in den Planken vor ihnen erst sahen, als es eigentlich schon zu spät war. Es war keine Zeit mehr zu bremsen, also beschleunigte der Fahrer, und das Auto flog über das Loch. Es landete mit den Vorderrädern auf der äußersten Kante der anderen Seite, während die Hinterräder über dem Abgrund schwebten. Zen und der Fahrer kletterten genau in dem Moment aus dem Wagen, als dieser nach hinten kippte und über den Rand der Planken in die Tiefe stürzte. Erst jetzt wurde Zen bewusst, dass die ganze Zeit eine dritte Person im Auto gewesen war, ein junger Mann, der auf der Rückbank gesessen hatte. Er war gut gekleidet, mit Anzug und Krawatte, und wirkte vollkommen ruhig. Das einzig Merkwürdige war, dass er kein Hemd anhatte und seine Füße nackt waren.
Doch Zen hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn sobald das Auto verschwunden war, taten sich immer mehr Risse und Löcher in der Fahrbahn auf. Die Brücke war so konstruiert, dass sie einem Erdbeben standhalten würde, das stärker war als das, welches 1908 Messina dem Erdboden gleichgemacht hatte. Dieses neuerliche Erdbeben musste also noch viel gewaltiger gewesen sein. Ganze Abschnitte fielen ins Wasser hinunter, bis nur noch das kurze Stück übrig war, auf dem Zen hockte, und auch das zitterte und bebte nun unter seinen Füßen. Die Grundregel dieser Träume war jedoch, dass der Held immer unversehrt davonkam. Offenbar waren dem Regisseur diesmal allerdings die Ideen ausgegangen, wie er ihn retten könnte, deshalb brach er die Episode abrupt ab. Die Leinwand verdunkelte sich, und Aurelio Zen wachte auf.
Er schob die Krempe seines Hutes nach oben und schaute sich um. Natürlich war alles wie immer. Das machte ja gerade den Charme von Versilia aus und war der Hauptgrund, weshalb die Leute Jahr für Jahr wiederkehrten. Nie gab es irgendwelche Überraschungen. Nie passierte etwas Unvorhersehbares. Und genau das war es, was Francos Gäste wünschten. Sie waren nicht am Neuen und Exotischen, am Fremden oder Andersartigen interessiert. Sie wollten immer haargenau dasselbe, das sie schon seit Jahren vorfanden, wenn nicht schon seit Jahrzehnten und in einigen Fällen sogar über mehrere Generationen hinweg. So lange konnte es nämlich dauern, bis man einen Platz in der ersten Reihe des Bagno bekam. Die waren genauso begehrt wie die entsprechenden Plätze in der Mailänder Scala, die viele von Francos Gästen im Winter regelmäßig besuchten. Zens Stammplatz lag noch so gerade im vorderen Drittel des Strandbads, und er hatte ihn nur deshalb bekommen, weil der rechtmäßige Besitzer ein Freund verschiedener Personen war, die ein professionelles Interesse daran hatten, Zen am Leben zu erhalten und so lange zu verstecken, bis sie ihn brauchten. Ohne deren Beziehungen hätte er noch nicht mal einen Platz direkt vor den Toiletten bekommen.
Allerdings hatte er den Platz ja offenbar nicht lange halten können, dachte er leicht verbittert und blickte nach links. Der Mann war immer noch da, lag arrogant ausgebreitet, mit dem Gesicht nach unten, auf der Liege, die eigentlich Zen gehörte. Die knappe Badehose brachte seinen strammen Hintern überdeutlich zur Geltung. Befriedigt stellte Zen fest, dass die untere Körperhälfte des Mannes jetzt voll der Sonne ausgesetzt war. Die blasse Haut seiner Beine nahm bereits eine gefährlich rötliche Farbe an. Geschieht dem Kerl ganz recht, dachte er und schob seinen Stuhl ein Stück weiter zurück in den Schatten. Obwohl ihn die streng hierarchische Hackordnung hier am Strand überhaupt nicht interessierte, war er mittlerweile doch schon lange genug Stammgast, dass ihn diese unerwartete und unwillkommene Unregelmäßigkeit irgendwie ärgerte. Schließlich war es ja der Sinn von Versilia, dass solche Dinge eigentlich nicht vorkamen.
Die ganze Szenerie um ihn herum erschien ihm so flach und symbolhaft wie ein Bühnenbild im Theater; in beunruhigender Weise hatten sich die drei Dimensionen auf zwei reduziert. Oben der azurblaue Himmel, der mit durchscheinenden weißen Dunstschleiern überzogen war. Unten diese grenzenlose Friedlichkeit, die Legionen von Ombrellini, die mit ihren kräftigen Farben wie Staatsflaggen unmissverständlich den Besitzanspruch über das jeweilige Stück Strand geltend machten. Die vorne am Meer waren alle grün, ebenso wie die Stühle und Liegen, doch dahinter kamen eng geschlossene Reihen in diversen Rot-, Gelb- und Blautönen. Die weißen Stangen der Schirme bildeten das einzige vertikale Element in der Szenerie. Sie unterteilten den scheinbar endlosen Strand in überschaubare Räume und Wohnungen, denen nur Wände und Decken fehlten.
Auf der Horizontalen waren die Unterteilungen noch deutlicher erkennbar. Jedes Strandbad besaß einen eigenen hölzernen Steg, der die Parzelle in zwei Hälften teilte. Auf jeder Seite waren zwei Reihen von Plätzen, in deren Mitte ein Sonnenschirm stand, der in exakt zweieinhalb Metern Abstand von seinen Nachbarn platziert war. Am Ende des Stegs, jetzt bei Ebbe ein paar Meter weiter weg, war das Meer, doch außer den Kindern interessierte das kaum jemanden. Das Meer war bloß ein notwendiger Vorwand für alles andere: die genüssliche Trägheit, die absolute Faulheit, das bewusst lässige Verhalten und die in unterschiedlichem Ausmaß zur Schau gestellte Nacktheit. Was die Leute wohl in erster Linie anzog, war der Sand, der von Franco und seinen beiden Söhnen jeden Morgen gründlich gereinigt und glatt gezogen wurde. Jeden Tag wurde er so stark von der Sonne aufgeheizt, dass es für Leute mit empfindlichen Fußsohlen um die Mittagszeit unerlässlich war, Sandalen zu tragen. Während des späten Nachmittags und frühen Abends strahlte er die Hitze wieder ab, und im Einklang mit dem wolkenlosen Himmel veränderte die dichte Fläche hellbrauner Körnchen ihr Aussehen. Das Vorrücken der Schatten von den Sonnenschirmen zeigte das Fortschreiten eines weiteren perfekten und absolut vorhersagbaren Strandtags an.
Natürlich gab es auch Leute zu beobachten. Ja, für einen Wochentag war das Bagno erstaunlich voll. Doch Zen hatte mit all den komplizierten, sich überschneidenden Cliquen, Clans und Großfamilien nichts zu tun. Deshalb war das menschliche Element für ihn von geringerem Interesse und weniger wichtig als die Umgebung, bloße Statisten, die eben zur Szenerie gehörten. Die meisten von ihnen waren weiblich und größtenteils mittleren Alters. Es gab allerdings auch ein paar junge Mütter mit Kindern. Die wenigen anwesenden Männer machten den Eindruck, als kämen sie sich überflüssig vor, und saßen in der Regel ein wenig abseits von der übrigen Familie. Rechts von Zen, fast am oberen Rand des Strands, unterhielt sich ein junges Paar sporadisch, während die junge Frau sorgfältig die Pickel auf dem Rücken ihres Freundes ausdrückte. Doch die meisten Leute in ihrem Alter arbeiteten entweder oder waren weiter unten am Strand in Viareggio, wo richtig was los war. In Versilia dagegen wurden die meisten Bikinis von Frauen getragen, die anscheinend nicht merkten oder denen es egal war, dass sie einen Punkt im Leben erreicht hatten, wo Männer sie in Gedanken lieber an- als auszogen.
Die Ausnahme von dieser Regel war Gemma, falls sie tatsächlich so hieß. Es gab zwar keinen Grund zu der Annahme, dass dem nicht so war, doch seit dem »Incidente« lebte Zen in einer Welt, in der die Namen von Leuten, sofern sie sich die Mühe machten, überhaupt einen zu nennen, bestenfalls dazu da waren, bestimmte Konventionen zu erfüllen. Es waren Höflichkeitsfloskeln, die den sozialen Umgang erleichtern sollten und für sich betrachtet keinerlei Bedeutung oder Substanz hatten.
Allerdings gehörte Gemma natürlich nicht zu jener, sondern zur wirklichen Welt, deren Umrisse Zen vage von der Brücke aus erkennen konnte, die er Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche langsam und unter Schmerzen überquerte. Diese Welt wurde allmählich klarer, war aber immer noch ein ganzes Stück entfernt. Eines der wunderbarsten Dinge an Gemma war, dass sie von alledem nichts wusste. Abgesehen von Verkäufern und Taxifahrern war sie der einzige Mensch, zu dem Zen seit dem »Zwischenfall« Kontakt hatte, der nichts darüber wusste. Dies hatte ihren kurzen und beiläufigen Begegnungen einen zusätzlichen Charme und eine gewisse Spannung verliehen. Zen benutzte sie, wie er merkte, als Versuchskaninchen, um festzustellen, ob er wieder für normal durchgehen könne. Bisher waren die Ergebnisse durchaus ermutigend gewesen.
Er hatte zu Gemma hinübergeschaut, sobald er aufgewacht war. Das war natürlich eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Wie alle anderen am Strand, mit Ausnahme des unverschämten Neuen links von Zen, war sie genau da, wo sie auch sein sollte, genau da, wo er wusste, dass er sie finden würde. Sie lag ausgestreckt auf ihrem Liegestuhl, ihre langen, feingliedrigen Füße hingen über das Ende, und der rechte zuckte ab und zu wie der Schwanz einer Kuh, die von Fliegen geplagt wird. Ihr Gesicht war von ihm abgewandt, doch er wusste, dass sie nicht schlief. Sie machte ein Nickerchen, was etwas völlig anderes war. Sie hatten einmal eine pseudoernsthafte Diskussion über diesen feinen Unterschied geführt. Das war bisher das einzige Mal, dass sie in ihrem Umgang über das rein Konventionelle hinausgegangen waren.
Gemma hatte den Ombrellino direkt gegenüber von Zen auf der anderen Seite des Stegs, was es ihnen ermöglichte, einander zur Kenntnis zu nehmen. Bei Franco verlief das soziale Leben nämlich streng hierarchisch. Die Leute in den ersten Reihen, die alte Aristokratie des Etablissements, »kannten« sich nur untereinander, wenn auch der eine oder andere sich gelegentlich herabließ, einem Freund oder guten Bekannten zuzunicken oder mit ihm ein Wort zu wechseln, der weiter hinten in den gesichtslosen Reihen saß, zwischen Parvenus und Plebs. Das konnte sogar jemand sein, der einen höheren Rang in jener Welt bekleidete, die dort aufhörte, wo der Sand begann. Doch im Allgemeinen war ein freundschaftlicher Umgang nur mit denen gestattet, die direkt neben einem oder unmittelbar auf der anderen Seite des Stegs saßen. Das hatte Gemma und Zen in die Lage versetzt, Blicke zu tauschen, sich zuzunicken und schließlich zu grüßen. Da sie etwa im gleichen Alter und offenkundig ohne Partner waren, war das letztlich unvermeidlich gewesen. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie beide den Strand mieden, wenn am Wochenende die Menschenmassen anrückten, war zwischen ihnen eine lockere, unverbindliche Beziehung entstanden.
Nach einer Weile begann Gemma sich zu regen, richtete sich dann träge auf und blickte um sich. Sie war eine schlanke, langbeinige Frau mit kleinen Brüsten und erstaunlich groß. Sie bemerkte, dass Zen sie beobachtete, winkte oder lächelte aber nicht. Stattdessen faltete sie die Zeitschrift zusammen, die sie gelesen hatte, nahm die Leinentasche, in der sie ihre Strandutensilien hatte, zog ihre Gummisandalen an und kam über den Holzsteg zu seinem Platz. »Signor Pier Giorgio«, sagte sie. »Sie sind ja wach.«
Zen setzte eine abwehrende Miene auf. »Ich tu nur so«, sagte er.
Gemma blickte zu dem Eindringling hinüber, der Zens Platz besetzt hatte, und machte eine fragende Geste. Zen signalisierte zurück, dass er keine Ahnung hätte.
»Ich wollte mir gerade einen Kaffee holen«, sagte Gemma. »Möchten Sie auch einen?«
»Das wäre sehr nett.«
»Espresso?«
»Ja bitte.«
Ohne ein weiteres Wort oder eine Geste drehte Gemma sich um und ging den Strand hinauf zu dem niedrigen Schuppen und den schattigen Tischen, wo Franco Kaffee, alkoholfreie Getränke, Bier, kleine Snacks und Eis verkaufte. Ob sie wohl nähen kann?, dachte Zen. Seit seine Mutter tot war, fiel seine Kleidung fast auseinander. Er könnte die Sachen natürlich zu einer Schneiderin bringen, doch für eine solche Arbeit zu bezahlen kam ihm vor, als würde er für Sex bezahlen. Es hatte dann so gar nichts Liebevolles mehr.
Er hielt erschrocken inne. Das war mal wieder typisch dafür, wie sich seine Gedanken in letzter Zeit plötzlich selbstständig machten. Was auch immer zwischen ihm und Gemma passieren mochte, es würde niemals über eine klassische Strandromanze hinausgehen, rief er sich nachdrücklich ins Gedächtnis, irgendwo zwischen Flirt und Bett. Nicht mehr. Er musste wieder anfangen, klar zu denken. Er musste ins wirkliche Leben zurückkehren, wieder arbeiten. Aber das lag nicht in seiner Hand. Er befand sich in einem Schwebezustand, saß mitten auf der Brücke fest, war weder hüben noch drüben. Er schloss die Augen wieder.
Das Nächste, das er wahrnahm, war der Schrei einer Frau. Gemma stand ungefähr auf halbem Weg zwischen ihrem Platz und dem Komplex aus Umkleidekabinen, Duschen und Bar. Sie hielt in jeder Hand eine Kaffeetasse und starrte an sich herunter. Hinter ihr raste ein junger Mann in Jeans und T-Shirt Richtung Straße. Zen stand auf, doch Gemma war bereits von Leuten umringt, die näher bei ihr gesessen hatten. Er hörte laute, aufgeregte Stimmen, die Abscheu und Empörung ausdrückten. Wenige Sekunden später machte sich Gemma von der teilnahmsvollen Schar los, murmelte irgendwas von wegen, sie müsse sich umziehen, und kehrte zur Bar zurück. Zen folgte ihr.
Unter dem Strohmattendach der Bar war es angenehm kühl und schattig. Gemma war nirgends zu sehen. Zen schlenderte zur Theke, wo Franco seine Gegenwart mit einem kaum sichtbaren Nicken zur Kenntnis nahm. Er hatte zwar die Regelung akzeptiert, die sein langjähriger Gast Girolamo Rutelli verfügt hatte, und gestattete diesem Fremden Zugang zu den Einrichtungen, die seit ewigen Zeiten Jahr für Jahr von der Familie gemietet wurden, doch er ließ es sich nicht nehmen, Zen immer wieder daran zu erinnern, dass er lediglich Ehrenmitglied des Clubs war, der Gast eines Mitglieds, den man korrekt, aber ohne übermäßige Herzlichkeit behandelte.
Wäre Zen ein wenig mitteilsamer gewesen, hätte sich das möglicherweise geändert, doch das war absolut nicht in seinem Sinne. Seine »offizielle« Geschichte war äußerst dürftig und konnte nur so lange funktionieren, wie sich niemand die Mühe machte, etwas gründlicher nachzuhaken. Eines war Zen bereits klar geworden, abgesehen davon, dass Franco versuchte, die dreimonatige Sommersaison zu seiner privaten Goldgrube zu machen, bestand seine Lebensaufgabe darin, als Auffangbecken, Filter und Kanal für jeden lokalen Klatsch zu dienen. Radio Franco war immer auf Sendung, und wenn Zen sich über die vage und durch nichts gestützte Geschichte hätte ausfragen lassen, mit der er seinen Aufenthalt in Versilia erklärt hatte, hätte man ihn im Handumdrehen als den Betrüger entlarvt, der er ja auch war. Andererseits wäre es ebenso wenig ratsam gewesen, auf Francos scheinbar beiläufige Fragen nicht zu antworten. Zen hatte die Strategie gewählt, sich auf Distanz zu halten und Franco nicht als den lieben Onkel für jedermann zu behandeln, der er gerne sein wollte, sondern einfach als den Besitzer des Bagno, den man für seine Dienstleistungen bezahlte, an dem man aber keinerlei persönliches Interesse hatte.
Er setzte sich an einen der Metalltische im Barbereich, bestellte aber nichts. Nach wenigen Minuten kam Gemma komplett angezogen aus ihrer Umkleidekabine. Ihre Blicke begegneten sich, und Zen winkte sie zu sich herüber. »Was ist passiert?«, fragte er.
Gemma warf den Kopf zurück. »Ach, bloß ein kleines Missgeschick. Ich ging gerade mit dem Kaffee zu unseren Plätzen zurück, da rannte mich dieser Idiot fast über den Haufen. Ich wurde von oben bis unten mit Kaffee begossen. Es hat ziemlich wehgetan, und natürlich war mein Badeanzug voller Flecken. Ich hab ihn ausgewaschen, aber ich hasse es, nasse Sachen anzuhaben, deshalb fahr ich jetzt nach Hause.«
»War das der junge Mann, der weggerannt ist?«
»Wer? Ja, genau. Das Komische war, dass er vorher dagestanden und Sie angestarrt hat.«
»Mich?«
»Ja. Sie saßen mit geschlossenen Augen da, und dieser junge Mann stand auf dem Steg und starrte Sie an, als ob Sie irgendein Star oder so was wären. Dann fuhr er plötzlich herum und rannte mitten in mich und meinen Kaffee hinein.«
Die letzten Worte schienen Zen in die Gegenwart zurückzuholen. Er blickte zur Bar und bestellte bei Franco zwei Kaffee. Der Bagno-Besitzer machte ein finsteres Gesicht und brüllte etwas nach hinten zu seiner Frau.
»Wie sah er aus, dieser Mann?«, fragte Zen Gemma.
Sie zuckte die Schultern. »Wie alle in diesem Alter.«
»Wie alt?«
»Um die dreißig, würd ich schätzen.«
»Ist Ihnen irgendwas an ihm aufgefallen?«
»Ich hab ihn nur ganz kurz gesehen, dann war ich voller kochend heißem Kaffee und hatte andere Sorgen.«
Sie dachte einen Augenblick nach. »Auf seinem T-Shirt stand irgendwas«, sagte sie schließlich.
»Was?«
»Hab ich mir nicht gemerkt. Irgendein Slogan auf Englisch. Was spielt das überhaupt für eine Rolle?«
Francos Frau brachte ihnen den Kaffee. Zen lächelte. »Eigentlich keine, solange Ihnen nichts weiter passiert ist. Es ist bloß merkwürdig. Normalerweise geschieht hier nie etwas Ungewöhnliches, und das ist heute schon das zweite Mal.«
»Was war denn das erste?«
»Der Mann, der mir meinen Platz weggenommen hat.«
Gemma nickte. »Sie hätten Franco rufen sollen, damit er ihn woanders hinsetzt.«
»Ich wollte keine Szene machen. Wozu auch? Die Brunellis kommen eh nie während der Woche, also hab ich mich einfach auf deren Platz gesetzt.«
Gemma trank ihren Kaffee aus. »Ich mach mich jetzt auf den Weg«, sagte sie.
Zen stand ebenfalls auf.
»Sie haben nicht zufällig Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen?«, hörte er sich sagen.
Sie musterte ihn forschend. »Essen gehen? Aber warum?«
Er machte eine verlegene Geste. »Warum nicht?«
Darüber musste sie anscheinend erst nachdenken. »Warum nicht?«, wiederholte sie schließlich.
»Prima. Gegen acht bei Augustos. Kennen Sie das?«
»Natürlich, das kennt doch jeder. Haben Sie denn einen Tisch reserviert?«
Zen schüttelte den Kopf.
»Dann kommen wir niemals rein«, sagte Gemma entschieden. »Die sind Wochen im Voraus ausgebucht.«
»Ich besorg uns einen Tisch. Vertrauen Sie mir.«
Gemma sah ihn wieder auf diese merkwürdig forschende Art an. »Na schön«, sagte sie. »Ich vertraue Ihnen.«
Sie schenkte ihm ein vages Lächeln und ging dann über den Steg an der Seite des Gebäudes Richtung Parkplatz. Zen kehrt zum Strand zurück.
Er bemerkte die Polizisten sofort. Sie waren zu dritt, zwei Männer und eine Frau. Alle drei waren jung und wirkten sehr sportlich in den gestärkten himmelblauen Shorts und Sommerhemden der städtischen Polizei. Sie hatten sich gleichmäßig über den Strand verteilt, vom Wasser bis zu den Umkleidekabinen, bewegten sich langsam voran und überprüften alles und jeden in ihrem jeweiligen Abschnitt.
Als Zen wieder an seinen Platz kam, hatte die Beamtin gerade Francos Steg erreicht. Zen ging zu ihr hinüber. »Entschuldigen Sie«, sagte er freundlich lächelnd, aber mit einem unverkennbaren Unterton von Autorität. »Ich bin selbst bei der Polizei. Unten in Rom. Criminalpol. Ist irgendwas nicht in Ordnung?«
Die Frau sah ihn kaum an und schüttelte den Kopf. »Reine Routinekontrolle«, sagte sie. »Wir hatten allerdings mehrere Meldungen über einen Mann, der sich als fliegender Händler ausgab, als Vucumprà. Haben Sie so jemanden gesehen?«
»Was soll das heißen, sich dafür ›ausgab‹?«
»Wenn sich sein Ärmel hochschob, konnte man sehen, dass die Haut vom Ellbogen an weiß war. Er sah auch überhaupt nicht afrikanisch aus. Das wurde uns zumindest gesagt.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Außenseiter in dieses Geschäft einsteigen will«, bemerkte Zen.
»Nein, aber vielleicht hatte er es auf andere Dinge abgesehen. Die Leute trauen den Marokkanern. Nun ja, eigentlich sind die meisten Sudanesen, aber das Entscheidende ist, dass die sich untereinander sehr wirkungsvoll überwachen. Entweder sie verkaufen was, oder sie verkaufen nichts, aber sie stehlen nicht. Das Gleiche gilt für die chinesischen Masseure und Wahrsager. Doch in letzter Zeit sind mehrere Diebstähle am Strand gemeldet worden, Handtaschen und Kameras verschwanden, während die Leute gerade nicht an ihrem Platz waren. Und wenn irgendein Weißer sich als Immigrant zurechtgemacht hat, könnte er ungeschoren davonkommen. Hier gibt es viele Albaner und Zigeuner, und die können ganz schön erfinderisch sein. Normalerweise brechen sie in Häuser ein, manchmal sogar während die Bewohner schlafen, aber das hier könnte eine neue Masche sein.«
Sie sah nach ihren beiden Kollegen, die mittlerweile einen Vorsprung hatten, und verabschiedete sich mit einem Nicken von Zen. Der packte seine Habseligkeiten zusammen und machte sich nachdenklich auf den Heimweg. Das war nun schon die dritte Anomalie an diesem Nachmittag, dachte er. Erst der Fremde, der ihm seinen Platz weggenommen hatte, dann der junge Mann, der ihn angestarrt und anschließend Gemma fast umgerannt hatte, und nun jemand, der sich als afrikanischer Händler ausgab. Überall sonst hätte so etwas zu den kleinen Mysterien eines ganz gewöhnlichen Tages gezählt, in dieser ruhigen, vorhersagbaren Strandwelt war das möglicherweise eine Geschichte für die erste Seite der Tageszeitung. Vielleicht gibt es ja ein Muster, dachte Zen und lächelte verdrießlich über so viel Wunschdenken.
Dieser Zwangsurlaub machte ihn langsam fast wahnsinnig, stellte er fest. Was er brauchte, war seine Arbeit, doch eine Rückkehr dorthin war ausgeschlossen. Die da oben hatten andere Pläne mit ihm, und dazu gehörte, wie man ihm vorsichtig klargemacht hatte, eine frühe und wohlverdiente Pensionierung. »Wir werden die Regeln ein wenig beugen müssen«, hatte ihm einer der offiziellen Besucher an seinem Krankenbett erklärt. »Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, ist das ja wohl das Mindeste, was Sie verdient haben.«
Er ging wieder an der Bar vorbei, nickte Franco zu und wurde dafür mit einem unwirschen Heben des Kinns bedacht. Dann trat er hinaus in das gleißende Sonnenlicht. Wie immer überraschte ihn der Anblick der zerklüfteten Berge, die im Osten den Horizont beherrschten und deren glänzend weiße Oberfläche sie in der Julihitze höher erscheinen ließ, als sie eigentlich waren. Was da schimmerte, war natürlich kein Schnee, sondern Marmor.
Mit knirschenden Schritten ging er über den Kiesparkplatz und überquerte die Lungomare, die von Carrara nach Viareggio verlief. Eine Strecke von fast dreißig Kilometern, die die diversen Dörfer und Fischerhäfen miteinander verband, die mittlerweile einen einzigen Badestrand bildeten und lediglich ihren Namen sowie Rudimente ihres ursprünglichen Zentrums behalten hatten. Nur wenige Gebäude waren älter als hundert Jahre, die weitaus meisten noch nicht mal halb so alt. Bevor der Strandboom nach dem Krieg einsetzte, hatten in dem flachen Sumpfgebiet nur einige hochherrschaftliche Villen gestanden, die zwischen der Pineta, dem Band wilder Pinien, hervorlugten, das einst die Küste bis nach Rom gesäumt hatte.
Die Hauptstraße war erstaunlich breit, doch da praktisch kein Verkehr herrschte, hatte sie wie die ganze Gegend etwas leicht Unwirkliches an sich. Dieser Eindruck verstärkte sich noch in den Seitensträßchen dahinter, da hier motorisierte Fahrzeuge gerade eben geduldet wurden und sich im Kriechtempo fortbewegten. Fußgänger und Radfahrer tummelten sich völlig sorglos in den schmalen Gassen, ohne je auch nur einen vorsichtigen Blick nach hinten zu werfen, um zu sehen, ob da etwas kam. Alles war sauber, gepflegt und sicher, eine privilegierte Enklave, in der die Chaostheorie, die normalerweise das städtische Leben in Italien beherrschte, auf den Kopf gestellt wurde. Zen hatte das zunächst als sehr angenehm empfunden, genau das Richtige nach seiner langen Rekonvaleszenz, doch nun ging es ihm allmählich auf die Nerven. Es gab keine Ecken und Kanten, nichts, woran man sich reiben konnte. Mitunter musste er gegen den Drang ankämpfen, sich schlecht zu benehmen, bloß um ein bisschen Unruhe zu stiften.
Aber das kam nicht infrage, genauso wie es ausgeschlossen war, nicht jeden Tag an den Strand zu gehen. In Wirklichkeit hätte Zen die Sonne lieber so weit wie möglich gemieden, und außerdem hasste er es, stundenlang herumzusitzen und nichts zu tun. Doch er hatte die Anweisung, sich anzupassen, und nach Versilia zu kommen und nicht an den Strand zu gehen wäre ein Verstoß gegen die allgemeinen Regeln gewesen und hätte neugieriges Interesse und Kommentare hervorgerufen. Also verbrachte er täglich seine vier bis fünf Stunden am Strand, so als würde er ins Büro gehen, und spazierte dann friedlich nach Hause, unterdrückte das Verlangen, Leute anzurempeln, beleidigende Andeutungen fallen zu lassen und sarkastische Bemerkungen zu machen. Es war anstrengend, aber er hatte klare Anweisungen.
Abreisen konnte er ebenfalls nicht. Seine Richtlinien waren auch in dieser Hinsicht ganz eindeutig. Er sollte bleiben, wo er war, bis man Kontakt mit ihm aufnahm. Außerdem hätte er gar nicht gewusst, wo er hinsollte. Seit dem Tod seiner Mutter war er nicht mehr in Rom gewesen und hatte auch kein Bedürfnis danach. Eine weitere enttäuschende Rückkehr nach Venedig zu riskieren kam erst recht nicht infrage. Der bloße Gedanke an jede der beiden Alternativen machte ihm klar, wie sehr er mit der Vergangenheit verhaftet war und wie düster seine Zukunftsaussichten aussahen. Letzteres war noch deprimierender und anscheinend unlösbar, also versuchte er an andere Dinge zu denken oder – noch besser – überhaupt nicht nachzudenken. Weiter brauchte er doch gar nichts zu tun, sagte er sich zum zigsten Mal, einfach aufhören nachzudenken und dieses angenehme, geruhsame und geistlose Dasein zu genießen, von dem die meisten Menschen nur träumen konnten. Was war bloß los mit ihm? Warum war ihm nie etwas gut genug?
Er ging bei dem kleinen Alimentari vorbei, wo er seine täglichen Einkäufe erledigte. Seine Einladung an Gemma war nur teilweise von dem Wunsch motiviert gewesen, sie besser kennenzulernen. Seit seiner Ankunft hier hatte er von dem gelebt, was der Laden gerade als Tagesgericht anbot oder was er sonst wo ergattern oder sich selbst zubereiten konnte, ein sehr eingeschränkter Speisezettel, der größtenteils aus Tütensuppen, Fertiggerichten aus der Tiefkühltruhe, Sandwiches und Takeaway-Pizzas bestand. Allein essen zu gehen wäre eine weitere Anomalie gewesen, die die Bedingungen seines Vertrags nicht zuließen. Dass ein Mann mittleren Alters allein einkaufen ging, war schon ungewöhnlich genug, aber schließlich musste er ja etwas essen.
Er deckte sich mit Kaffee, Milch, Brot und ein paar Eiern ein. Die Kassiererin sah ihn auf die gleiche Weise an wie Franco, als würde sie ihn irgendwie kennen, könnte ihn aber nicht einordnen. Ein solcher Blick von einem anderen Augenpaar könnte immer noch seinen Tod bedeuten, spekulierte er müßig. Im Grunde kümmerte ihn das nicht sonderlich. Die Mafia mochte es zwar nicht geschafft haben, ihn körperlich umzubringen, aber irgendetwas in ihm war gestorben, etwas, ohne das das Leben nicht mehr so richtig lebenswert schien. Ihm war einfach alles gleichgültig, das war die eigentliche und anhaltende Folge des »Incidente«, und es sah auch nicht so aus, als könnte sich während seines langen und öden Zwangsruhestands daran etwas ändern. Es war ein dumpfer Schmerz, den keine Therapie, keine körperliche Bewegung, keine Hobbys je in der Lage wären zu vertreiben.
Gegenüber dem Lebensmittelladen parkte ein weißer Lieferwagen am Straßenrand, aus dem ein Händler frisches Gemüse, Obst und Eier an eine Schar von Hausfrauen verkaufte. Diese nörgelten vehement an Qualität, Auswahl und Preisen der Ware herum, ein tagtägliches Ritual, das alle brauchten, um ihre Würde und Selbstachtung zu wahren. Die Frauen wussten, wenn sie nicht zu einem der Supermärkte an der Autobahn im Landesinneren fahren wollten, waren sie auf das angewiesen, was Mario zu bieten hatte. Fast so, wie sie darauf angewiesen waren, sich mit ihren Ehemännern, Kindern, Verwandten, Häusern und ihrem Schicksal insgesamt abzufinden. Ihr einziger Ausgleich war das Recht, lautstark und ausgiebig über die unbefriedigende Situation meckern zu dürfen, und das nutzten sie genüsslich aus. Mario, der begriffen hatte, dass dies zum Geschäft gehörte, stimmte lebhaft und begeistert in die diversen Minidramen mit ein und spielte seine Rolle perfekt.
Zen war inzwischen zurück auf die schattige Straßenseite geschlendert und registrierte die Szene am Wagen des Gemüsehändlers, bemerkte eine Gruppe junger Leute auf Motorrollern, mehrere Frauen, die sich voller Entzücken über das Baby einer Nachbarin beugten, und einen Mann, der gegen einen Telefonmast aus Beton lehnte, ein Eis aß und die Passanten beobachtete. Er trug ein T-Shirt mit einem Slogan auf Englisch. Zen ging zwei Blocks weiter bis zum Ende des Ladenviertels und bog dann nach links in eine Straße, die noch aus der Zeit stammte, bevor man angefangen hatte, nach Planquadrat zu bauen. Sie führte in sanftem Bogen an schmiedeeisernen Toren vorbei und an verwitterten Mauern, die von Grünpflanzen überwuchert waren. Die Villa, in der man ihn untergebracht hatte, lag ungefähr auf halber Strecke der gewundenen Straße, die an einem verfallenen Torbogen endete, durch den man in einen der letzten verbliebenen Abschnitte der ursprünglichen Pineta gelangte. Es herrschte praktisch kein Verkehr, und kein Laut störte die Stille bis auf das ständige Geräusch der Fernseher und das gelegentliche Kläffen eines kleinen neurotischen Hundes von einem der Nachbarn.
Als er an sein Tor gelangte, schloss er es aus irgendeinem Grund nicht sofort auf, sondern warf erst einen Blick nach hinten. Es war niemand zu sehen. Sie wissen also bereits, wo du wohnst, sagte eine Stimme in seinem Kopf. »Halt die Klappe!«, murmelte Zen deutlich vernehmbar. Diese berufsbedingte Paranoia war ja genauso schlimm wie die Eitelkeit mancher Frau am Strand, die sich nicht damit abfinden konnte, dass das sexuelle Kapital, von dem sie die letzten dreißig Jahre gelebt hatte, deutlich im Kurs gesunken war. »Wir sind beide Männer von gestern«, hatte er Don Gaspare Limina in Sizilien erklärt, und er hatte recht gehabt. Warum konnte er nicht akzeptieren, dass er nicht mehr im Rennen war und es auch nie wieder sein würde? In diesem konkreten Fall war es der Mafia zwar nicht gelungen, ihn zu töten, dank eines glücklichen Zufalls und ihrer eigenen Unfähigkeit, doch trotzdem war er so gut wie tot.
Die Kieseinfahrt hinter dem Tor führte zu einer Treppe an der Seite des Hauses. Diese mündete im ersten Stock in einen Balkon, der die westliche Fassade entlanglief. Zen ging an den mit Läden verschlossenen Fenstern vorbei und öffnete die Tür, die in sein Reich führte. Er trug seine Einkäufe in die Küche gleich links neben der Wohnungstür und räumte alles ordentlich weg. Dann ging er in den großen Salotto, der den größten Teil der Wohnung einnahm, und ließ sich in einen Sessel sinken, wobei er leicht das Gesicht verzog. Die Schmerzen, mit denen er so lange gelebt hatte, hatten zwar deutlich nachgelassen, doch immer mal wieder wurde er mit einem unangenehmen Reißen oder Stechen bestraft, wenn er sich zu sehr in die falsche Richtung gestreckt hatte, in einer falschen Position geschlafen oder sich auf beinah jede nur denkbare Art überanstrengt hatte. Die Ärzte, die er einmal pro Woche im Krankenhaus in Pietrasanta konsultierte, hatten ihm versichert, dass es keine bleibenden Schäden geben würde und dass alle »subjektiven Beschwerden« rein oberflächlich und vorübergehender Natur seien, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Er glaubte ihnen. Allerdings waren seine jetzigen Schmerzen auch anders als die furchtbaren, auf eine offenkundige Ursache zurückzuführenden Qualen, die er in den Monaten unmittelbar nach der Explosion gelitten hatte. Es handelte sich eher um die üblichen altersbedingten Beschwerden und Wehwehchen, um verräterische Zeichen, dass der Körper allmählich das Ende seines nützlichen Daseins erreichte. Das machte diese Schmerzen irgendwie noch unerträglicher.