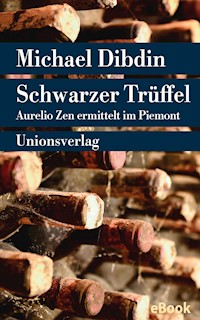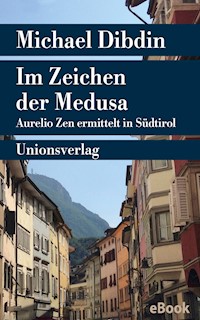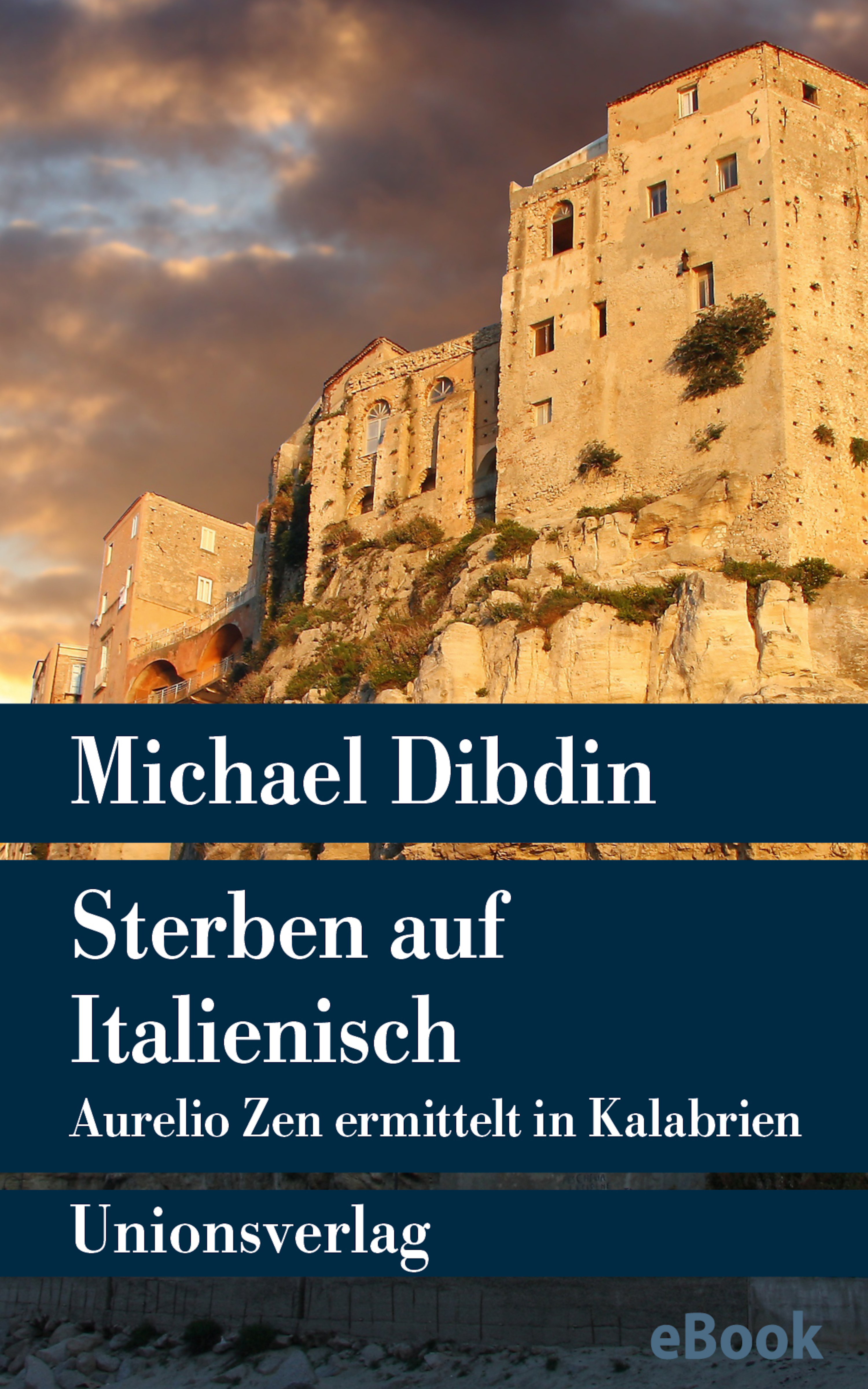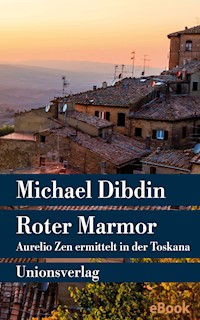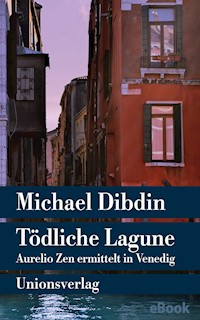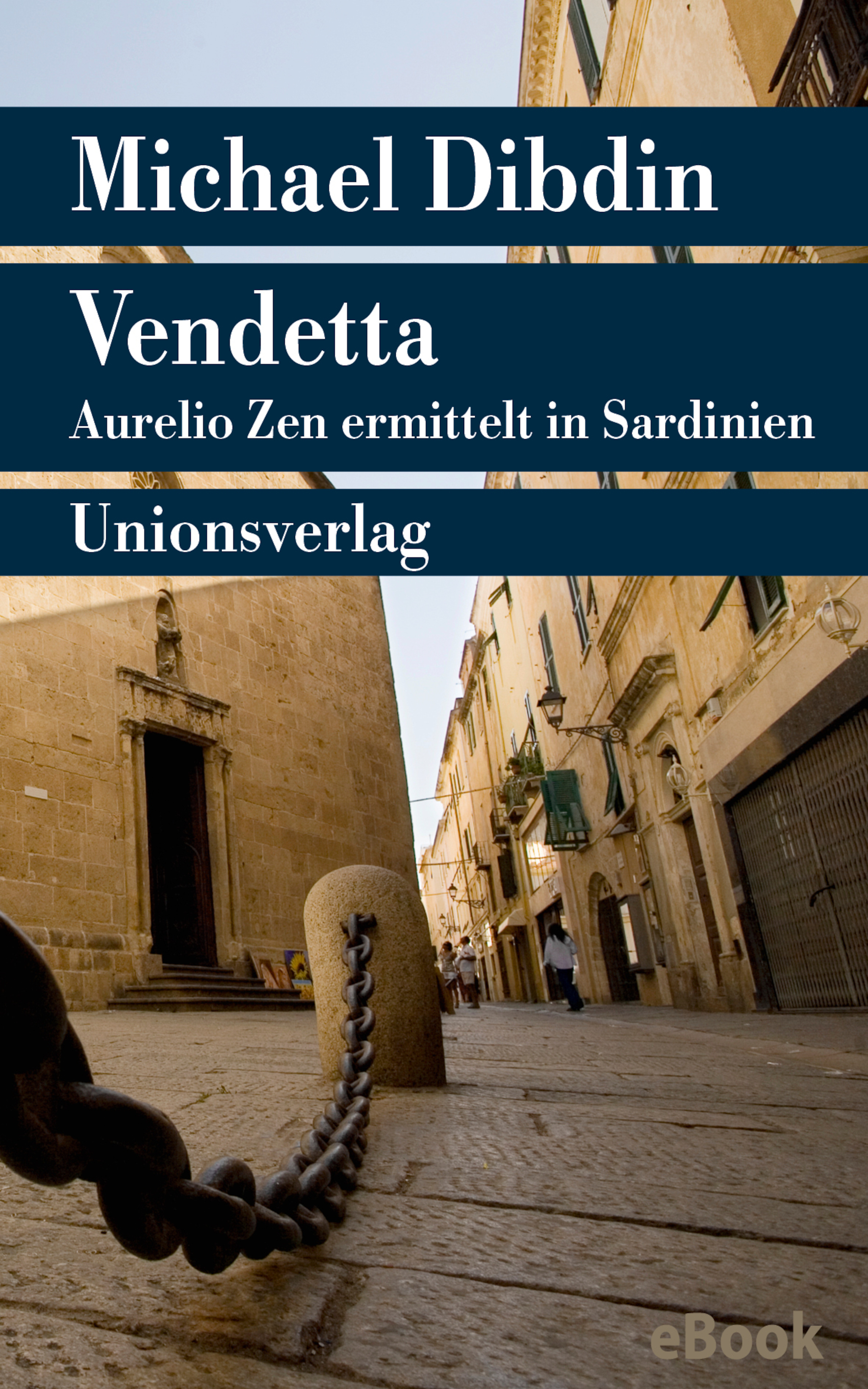11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Polizeikommissar Aurelio Zen geht keinem Konflikt aus dem Weg. Das macht ihm nicht nur Freunde, und sein Spezialauftrag in Perugia entpuppt sich prompt als eine Art Strafversetzung: Bei der Entführung von Ruggero Miletti, dem Haupt einer der mächtigsten Familien Italiens, kann es eigentlich nur Verlierer geben. Alles scheint sich gegen den Neuankömmling aus Rom verschworen zu haben. Doch im Kampf gegen Korruption und Mafia entwickelt Aurelio Zen seine wahren Qualitäten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Kommissar Aurelio Zen reist für einen Spezialauftrag nach Perugia: Ruggero Miletti, das Haupt einer der mächtigsten Familien Italiens, wurde entführt. Alles scheint sich gegen den Neuankömmling aus Rom verschworen zu haben. Doch im Kampf gegen Korruption und Mafia entwickelt Aurelio Zen seine wahren Qualitäten.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Michael Dibdin (1947–2007) studierte englische Literatur in England und Kanada. Vier Jahre lehrte er an der Universität von Perugia. Bekannt wurde er durch seine Figur Aurelio Zen, einen in Italien ermittelnden Polizeikommissar.
Zur Webseite von Michael Dibdin.
Ellen Schlootz arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie hat u. a. Werke von Ian Rankin und David Hosp ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Ellen Schlootz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Michael Dibdin
Entführung auf Italienisch
Aurelio Zen ermittelt in Perugia
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ellen Schlootz
Aurelio Zen ermittelt (1)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1988 unter dem Titel Ratking im Verlag Faber and Faber, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 im Goldmann Verlag, München.
Originaltitel: Ratking (1988)
© by Michael Dibdin 1988
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Arghman
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30891-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 15:05h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ENTFÜHRUNG AUF ITALIENISCH
1 – Nein, das kann ich nicht glauben! Das ist …2 – Sämtliche in der Questura von Perugia vorhandenen Hilfsmittel …3 – Als sich das Auto immer stärker in die …4 – An diesem Nachmittag ging Aurelio Zen Boot fahren5 – Lächeln! Alle lächelten und klatschten Beifall! Der pausbäckige …6 – Vierundzwanzig Stunden später saß er draußen auf dem …7 – Er lag in dem Zimmer in Venedig …8 – Am nächsten Morgen hatte sich alles verändert …9 – Gegen Ende des Krieges waren eines Tages fünf …10 – Gianluigi Santucci saß am Kopf des Esstisches und …11 – Im letzten Augenblick hätte sie es sich fast …12 – In Rom regnete es. Man sagt, Venedig sei …Mehr über dieses Buch
Über Michael Dibdin
Über Ellen Schlootz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Michael Dibdin
Zum Thema Italien
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Hallo?«
»Hallo? Wer spricht da?«
»Wer ist da?«
»Ich möchte Senator Rossi sprechen.«
»Am Apparat.«
»Oh, Sie sind es, Senator. Verzeihen Sie! An diesem blöden Telefon kann man nie hören, wer dran ist, einer klingt wie der andere. Hier ist Antonio Crepi.«
»Commendatore! Welch eine Freude! Sind Sie hier in Rom?«
»In Rom? Um Himmels willen. Nein. Ich bin in Perugia. Zu Hause, in meiner Villa. Sie erinnern sich doch noch?«
»Aber ja doch, selbstverständlich.«
»Als mein ältester Sohn geheiratet hat.«
»Genau. Ein unvergesslicher Anlass. Ein wunderbares Paar. Wie geht es den beiden?«
»Ich kriege nicht allzu viel von ihnen zu sehen. Corrado ist nach Mailand gezogen, und Annalisa hat eine Affäre mit irgendeinem Fußballspieler, das hat man mir jedenfalls erzählt. Unsere Wege kreuzen sich nicht sehr oft.«
»Oh, wie schade.«
»Solche Dinge passieren eben heutzutage! Das ist mir mittlerweile wirklich scheißegal. In unserem Alter ist es absurd, sich noch irgendetwas vorzumachen. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Solange ich meine Rebstöcke und meine Olivenbäume habe und ein oder zwei Freunde, mit denen ich reden kann. Leute, die ich verstehe und die mich verstehen. Sie wissen, was ich meine?«
»Ja doch, selbstverständlich. Ich sage immer, Freundschaft ist das Allerwichtigste im Leben. Das ist gar keine Frage.«
»Ich bin froh, dass Sie das sagen. Ich habe Sie nämlich angerufen, um Sie um Hilfe für einen Freund zu bitten. Einen gemeinsamen Freund. Ich spreche von Ruggiero Miletti.«
»Oh. Eine tragische Geschichte.«
»Wissen Sie, wie lange das nun schon geht?«
»Schockierend.«
»Seit fast viereinhalb Monaten. 137 qualvolle Tage und Nächte für die Familie Miletti und für all ihre Freunde. Ganz zu schweigen von Ruggiero selbst.«
»Entsetzlich.«
»Ein Mann so alt wie Sie und ich, Senator, in irgendeiner Hütte in den Bergen in Ketten gelegt, bei diesem bitterkalten Wetter, und einer Bande von herzlosen Schurken ausgeliefert!«
»Grauenhaft. Skandalös. Wenn man nur irgendwie helfen könnte …«
»Aber Sie können helfen! Sie müssen helfen!«
»Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, Commendatore! Ich bin nur allzu bereit dazu, glauben Sie mir. Aber wir müssen realistisch sein. Entführungen sind die Geißel unserer heutigen Gesellschaft, eine Seuche und eine Gefahr, angesichts derer wir alle gleichermaßen verwundbar, machtlos ebenso wie …«
»Unsinn! Entschuldigen Sie, aber wenn einem von Euch Politikern etwas passiert, wird das ganze Land in eine Art Belagerungszustand versetzt! Dann ist keine Mühe zu groß, werden keine Kosten gescheut. Aber wenn es um einen gewöhnlichen, anständigen, gesetzestreuen Bürger wie unseren Freund Ruggiero geht, wird das noch nicht einmal zur Kenntnis genommen. Man geht zur Tagesordnung über. ›Es ist seine Schuld. Warum hat er keine besseren Sicherheitsvorkehrungen getroffen?‹«
»Commendatore, wir wollen doch nicht dem Irrtum verfallen, uns weiszumachen, dass irgendein Verantwortlicher es wagen könnte zu leugnen, wie ernst …«
»Heben Sie sich diesen Kram für die Presse auf, Senator. Im Moment sprechen Sie mit Antonio Crepi! Versuchen Sie nicht, mir zu erzählen, wir wären immer noch gleichgestellt. Wenn Sie entführt würden, was Gott bewahre, würden für Sie die Spitzeneinheiten, die besten Männer eingesetzt. Nun, genau das wünsche ich für Ruggiero.«
»O ja, natürlich. Selbstverständlich!«
»Den Leuten hier in Perugia möchte ich keinen Vorwurf machen. Aber – wir wollen mal ganz ehrlich sein – wenn sie wirklich gut wären, wären sie nicht hier, oder? Dann wären sie in Rom und würden auf euch Politiker aufpassen.«
»Man sollte die Wirksamkeit der Maßnahmen, an die Sie da denken, vielleicht nicht überschätzen, Commendatore.«
»Hören Sie mal, wenn Sie Schmerzen im Brustkorb haben, gehen Sie doch zu einem Spezialisten, oder?«
»Unsere Spezialisten konnten selbst Aldo Moro nicht retten.«
»Ersparen Sie mir das Gerede, Senator! Wir haben weiß Gott genug geredet. Nun möchte ich Taten sehen, deshalb habe ich angerufen. Ich möchte, dass ein Topmann dort hingeschickt wird, der das ganze Unternehmen auf Zack bringt. Ein neues Gesicht, jemand, der die Sache anders anpackt. Sie können das im Handumdrehen in die Wege leiten, bei Ihren Kontakten.«
»Nun ja …«
»Oder ist das zu viel verlangt?«
»Es ist nicht …«
»Meinen Sie nicht, Ruggiero verdient, dass das Beste für ihn getan wird?«
»Selbstverständlich.«
»Senator, ich hätte mir nicht die Mühe gemacht, Sie anzurufen, wenn ich der Meinung wäre, Sie seien ein Mensch mit kurzem Gedächtnis. Davon laufen weiß Gott genug herum! Aber nein, sagte ich mir, Rossi ist nicht so. Er hat nicht vergessen, was die Familie Miletti für ihn getan hat. Senator, ich bitte Sie, denken Sie in dieser Stunde an sie. Denken Sie daran, was sie durchmachen. Bedenken Sie, was es für die Milettis bedeuten wird zu wissen, dass dank Ihrer Bemühungen einer der besten Polizisten Italiens nach Perugia geschickt wurde, um die Suche nach ihrem geliebten Vater voranzutreiben! Und dann bedenken Sie, dass Sie das alles mit einem einzigen Telefongespräch in die Wege leiten können, so einfach, wie ein Taxi bestellen.«
»Sie überschätzen meine Macht.«
»Das hoffe ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich habe Sie immer für einen Freund und Verbündeten gehalten, und es würde mich sehr traurig stimmen, wenn ich das Gefühl hätte, nicht mehr auf Ihre Hilfe zählen zu können. Und Sie auf meine, Senator, und auf die der Familie Miletti und ihrer vielen Freunde.«
»Um Himmels willen, Commendatore! Wovon reden Sie? Wir wollen uns doch nicht dazu hinreißen lassen, irrtümlicherweise anzunehmen, dass …«
»Ausgezeichnet. Dann gibt es nichts mehr zu sagen. Wann kann ich mit einer Nachricht rechnen?«
»Nun, in einer Situation wie dieser wäre es vielleicht vernünftig, keine kurzfristigen Termine zu setzen. Dennoch, im Großen und Ganzen möchte ich keineswegs die Möglichkeit ausschließen, dass ich in der Lage wäre …«
»Ich möchte im Laufe des Nachmittags Bescheid wissen.«
»Ach ja, ich verstehe.«
»Oder haben Sie vielleicht wichtigere Dinge zu tun?«
»Hören Sie, Crepi, es hat keinen Sinn, ein Wunder zu erwarten, das sollten Sie wissen. Verzeihen Sie, dass ich das sage.«
»Ich verlange kein Wunder, Senator. Ich verlange Gerechtigkeit. Oder bedarf es dazu in diesem Land eines Wunders?«
»Lapucci.«
»Habe ich Sie geweckt, Giorgio?«
»Wer ist da?«
»Gianpiero Rossi.«
»Oh, guten Morgen, Senator! Nein, ich habe gerade im anderen Büro gearbeitet. Natürlich glaubt uns das niemand, aber hier in der Zentrale wird tatsächlich gearbeitet.«
»Hören Sie, Giorgio, ich habe da ein kleines Problem, bei dem Sie mir vielleicht helfen können.«
»Betrachten Sie es als erledigt.«
»Sie haben von der Miletti-Entführung gehört?«
»Der Reifenkönig von Modena?«
»Modena! Wie kommen Sie denn auf Modena? Würde es mich einen Dreck scheren, wenn er aus Modena wäre? Miletti, Miletti! Radios, Fernseher!«
»Ach natürlich. Verzeihen Sie mir. Aus Perugia.«
»Genau. Und das ist mein Problem. Einige Leute dort, Freunde der Familie, haben das Gefühl, dass nicht genug getan wird. Sie wissen, jeder erwartet besondere Aufmerksamkeit. Und dabei handelt es sich um Leute, denen man nur schwer was abschlagen kann. Können Sie mir folgen?«
»Vollkommen.«
»Wie man so sagt, die Armen beten um Wunder, die Reichen glauben, dass sie ein Recht darauf haben. Nun, ich möchte nichts rechtfertigen, was man nicht rechtfertigen kann und auch nicht soll. Ich beschönige nicht, und ich verurteile nicht. Tatsache ist jedoch, dass ich mich in einer schwierigen Situation befinde. Verstehen Sie, was ich meine?«
»Selbstverständlich. Doch was genau verlangen diese Leute? Wenn Sie mir diese Frage erlauben.«
»Sie wollen einen Namen.«
»Einen Namen? Wessen Namen?«
»Das überlasse ich ganz Ihnen. Es muss natürlich jemand sein, der vorzeigbar ist, damit ich nicht wie ein Idiot dastehe. Wenn er einen guten Namen hat, um so besser.«
»Und was soll derjenige tun?«
»Nun, dorthin gehen und die Sache in Ordnung bringen.«
»Nach Perugia gehen?«
»Natürlich nach Perugia.«
»Ein Polizeibeamter?«
»Genau. Können Sie mir helfen?«
»Nun, ich muss gestehen, das ist ein besonders ungünstiger Augenblick, Senator. Seit der Kabinettsumbildung sind die Beziehungen der Partei zum Ministerium …«
»Wenn Sie so lange dabei sind wie ich, Giorgio, werden Sie wissen, dass der Augenblick immer besonders ungünstig ist. Aus diesem Grund habe ich Sie angerufen und nicht einige andere Leute, deren Namen mir in den Sinn kamen. Also, können Sie mir helfen?«
»Nun, trotz der Veränderungen, von denen ich gerade sprach, haben wir natürlich diverse Kontakte. Ich denke da an jemand bestimmten, der vielleicht in der Lage wäre …«
»Die Einzelheiten interessieren mich nicht, Giorgio. Ich möchte lediglich wissen, ob Sie mir helfen können. Oder soll ich jemand anders anrufen? Vielleicht können Sie jemanden empfehlen?«
»Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, Senator. Ich werde alles, was in meinen Kräften steht, für Sie tun. Morgen um diese Zeit werden Sie …«
»Morgen um diese Zeit werde ich in Turin sein. Erledigen Sie es noch heute Nachmittag. Ich bin bis sieben Uhr hier.«
»In Ordnung.«
»Ausgezeichnet. Ich wusste, es war richtig, Sie anzurufen. Ich habe ein Gespür für diese Dinge. Giorgio ist der Mann, der am richtigen Hebel sitzt, habe ich mir gedacht. Tausend Dank. Ich warte auf Ihren Anruf.«
»Ja?«
»Enrico?«
»Wer ist da?«
»Giorgio Lapucci.«
»O Gott, ich dachte, es wäre seine Königliche Hoheit. Entschuldige, ich muss mir nur eine andere Hose anziehen.«
»Was soll diese Panik?«
»Er ist bei einer Konferenz in Straßburg und ruft mich andauernd an und verlangt einen vollständigen Bericht über den Stand der Dinge hier. Das gehört zu seinem neuen Führungsstil, über den man überall lesen konnte. Das hält uns auf Trapp, sagt er. Wie dem auch sei, was kann ich für dich tun?«
»Ich nehme an, die Leitung ist sicher?«
»Giorgio, du sprichst mit dem Innenministerium. Alles, was hier an Abhöraktionen läuft, das machen wir.«
»Natürlich.«
»Also, was gibts?«
»Nun, es ist die alte Geschichte, fürchte ich. Einer schiebt sein Problem auf den anderen, und der lädt es bei mir ab.«
»Und jetzt möchtest du das Ganze bei mir loswerden.«
»Sind Freunde nicht dafür da? Doch es sollte nicht allzu schwierig sein. Es geht darum, einen höheren Polizeibeamten vorübergehend nach Perugia zu versetzen, um einen Entführungsfall zu übernehmen.«
»Das ist alles?«
»Das ist alles.«
»Kein Problem. Das kann ich bei den routinemäßigen Versetzungen unterbringen und auf Abteilungsebene durchboxen. Das Zeug guckt sich sowieso nie einer an. Das einzige Problem könnte darin bestehen, jemanden zu finden. Wann sollen wir darüber reden?«
»Jetzt.«
»Scheiße. Sieh mal, ich muss ein bisschen darüber nachdenken. Ich rufe dich zurück.«
»Aber heute noch.«
»Ich werde mein möglichstes tun.«
»Das weiß ich zu schätzen, Enrico. Und bestell Nicola recht herzliche Grüße von mir.«
»Und du Emanuela. Hör mal, warum treffen wir uns nicht wieder mal alle zusammen?«
»Ja, das sollten wir tun. Ganz bestimmt.«
»Personalabteilung.«
»Mancini. Ich brauche jemanden, den wir in einem Entführungsfall nach Perugia schicken können. Wen schlagen Sie vor?«
»Niemand.«
»Wie meinen Sie das, niemand?«
»Ich meine, dass keiner verfügbar ist.«
»Was ist mit Fabri?«
»In Genua, wegen dieses Banküberfalls.«
»De Angelis?«
»Sardinien. Dort gab es allein in der vergangenen Woche drei Entführungen, falls Sie die Zeitungen nicht gelesen haben. An diesem Wochenende haben wir den Besuch des französischen Staatspräsidenten, plus eine englische Fußballmannschaft, Gott steh uns bei.
Sehen Sie, was los ist? Wenn nicht, kann ich Ihnen noch mehr aufzählen.«
»Beruhigen Sie sich, Ciliani. Ich weiß, dass die Lage schwierig ist. Aber es gibt immer jemanden. Man muss nur überlegen.«
»Es gibt niemanden außer Romizi, und der geht in Urlaub.«
»Dann sagen Sie ihm eben, er muss ihn verschieben.«
»Verzeihen Sie, Dottore, aber das müssen Sie ihm sagen! Er hat einen Flug nach Amerika gebucht.«
»Was will der in Amerika?«
»Woher soll ich das wissen? Hat da vielleicht Verwandte oder so.«
»Und wie sieht es mit Leuten außerhalb von Criminalpol aus?«
»Sie sagten doch, es wäre wichtig.«
»Wir könnten da immer noch ein Auge zudrücken. Gibt es nicht einen, der eine gewisse Erfahrung hat? Konnte den Anblick von Blut nicht ertragen und hat um einen Bürojob gebeten, irgendwas in der Art. Denken Sie scharf nach, Ciliani! Ich meine, hier geht es doch nur um eine Geste, nicht um einen guten Chef für die verdammte Squadra Mobile.«
»Das hilft mir auch nicht weiter.«
»Was ist mit … wie war doch gleich der Name, den wir zur Hausarbeit abgestellt haben?«
»Zuccaroni?«
»Nein, der andere.«
»Zen?«
»Genau der.«
»Aber der ist doch …«
»Was?«
»Nun, wissen Sie, ich dachte, es sei irgendwie problematisch, ihn einzusetzen.«
»Tatsächlich? Davon habe ich nichts gehört.«
»Ich meine nichts Offizielles.«
»Nun, solange das nicht offiziell ist, sehe ich kein Problem. Und außerdem eine Entführung! War er auf dem Gebiet nicht eine Art Spezialist? Das könnte gar nicht besser sein.«
»Wenn Sie das sagen, Dottore.«
»Es ist ausgezeichnet. In jeder Hinsicht ideal. Das Einzige, was das Ganze noch zunichtemachen könnte, wäre eine Verzögerung. Und deshalb werde ich es in Ihre Hände legen, Ciliani. Ich möchte Zen und die relevanten Akten innerhalb der nächsten Stunde in meinem Büro sehen. Haben Sie das verstanden?«
»Hm.«
»Caccamo?«
»Hm.«
»Ciliani. Hast du Zen gesehen?«
»Hast dus in seinem Büro versucht?«
»Nein, ich bin zu blöde, darauf zu kommen. Natürlich hab ichs in seinem Scheißbüro versucht.«
»Warte mal, ist er nicht irgendwo unterwegs? Treviso?«
»Triest. Er sollte heute Morgen zurück sein.«
»Habe ich dir jemals von diesem Mädchen aus Triest erzählt, das ich kennengelernt habe, als ich unten in Ostia am Strand Dienst machte? Sie sonnte sich vollkommen nackt hinter einer Düne, und als ich …«
»Verpiss dich, Caccamo. Du lieber Himmel, das hat mir gerade noch gefehlt. Wo steckt dieser Scheißkerl von Zen?«
1
Nein, das kann ich nicht glauben! Das ist unmöglich!«
»Es ist zwar unmöglich, aber es ist trotzdem passiert. Kurz gesagt, es ist ein Wunder!«
»Nur noch ein paar Hundert Meter bis zum Bahnhof, und die halten an! Das geht zu weit!«
»Nicht weit genug, würde ich sagen!«
»Lasst uns um Himmels willen aus diesem verdammten Zug raus!«
»›Und er bewegt sich nicht‹, hätte Galileo wahrscheinlich gesagt. Nun gut, seien wir geduldig.«
»Geduldig! Verzeihen Sie, aber meiner bescheidenen Meinung nach braucht dieses Land gerade ein paar Leute, die nicht länger geduldig sein wollen! Leute, die sich weigern, diese Stümperei und Unfähigkeit, die wir tagtäglich erleben, geduldig zu ertragen! Ja, genau das meine ich!«
»Man sagt, es sei besser, voller Hoffnung zu reisen, als anzukommen. Das sollte die staatliche Eisenbahn zu ihrem Motto machen.«
»Sie machen darüber Witze, Signore, aber meiner bescheidenen Meinung nach gibt es da nichts zu spaßen. Im Gegenteil, das ist eine Angelegenheit von allerhöchster Bedeutung, symptomatisch für all die schlimmen Missstände in unserem armen Land. Was erwartet man von einem Zug? Dass er einigermaßen schnell fährt und einigermaßen pünktlich ist. Ist das zu viel? Bedarf es dazu göttlicher Mithilfe? In keinem anderen Land der Welt. Und hier war das früher auch nicht so.«
»Sie können jederzeit in die Schweiz ziehen, wenn Sie das so sehen.«
»Doch was geschieht heute? Der Eisenbahnbetrieb ist wie alles andere eine Katastrophe. Und was macht die Regierung dagegen? Sie gibt ihren Freunden von der Bauindustrie Milliarden von Lire, um eine neue Eisenbahnlinie zwischen Rom und Florenz zu bauen. Und das Ergebnis? Die Züge sind langsamer als vor dem Krieg! Es ist unglaublich! Eine nationale Schande!«
Der neben der Tür sitzende junge Mann, römisch bis in die eleganten Fingerspitzen, lächelte sarkastisch.
»Ach ja, natürlich, alles war besser vor dem Krieg«, murmelte er. »Das kennen wir doch.«
»Verzeihen Sie, aber Sie kennen überhaupt nichts«, antwortete der energische, untersetzte Mann mit dem silbrigen Haarschopf und dem Veroneser Akzent. »Wenn ich mich nicht sehr täusche, waren Sie damals noch nicht einmal geboren!«
Er wandte sich zu dem dritten Insassen des Abteils, der am Fenster saß, ein distinguiert aussehender Mann von ungefähr fünfzig mit einem blassen Gesicht, dessen herausragender Zug eine Nase war, so exakt dreieckig wie der Klüver eines Segelbootes. Er hatte etwas leicht Exotisches an sich, als ob er Grieche oder gar Levantiner wäre. Sein Ausdruck war zynisch, weltmännisch und unnahbar, und ein abwesendes Lächeln spielte um seine Lippen. Das Bemerkenswerteste jedoch waren seine Augen. Sie waren grau mit einem blauen Schimmer und von einer leicht düsteren Unbewegtheit, die den Veroneser erschaudern ließ. Der da ist ein eiskalter Typ, dachte er.
»Was sagen Sie dazu, Signore?«, fragte er. »Meinen Sie nicht auch, das ist eine Schande, eine nationale Schande?«
»Der Zug wurde in Mestre aufgehalten«, bemerkte der Fremde so ernsthaft und bewusst höflich, dass es schon fast spöttisch klang. »Das hat natürlich den Fahrplan durcheinandergebracht. Es musste zu weiteren Verzögerungen kommen.«
»Ich weiß, dass der Zug in Mestre aufgehalten wurde!«, entgegnete der Veroneser in scharfem Ton. »Sie brauchen mir nicht zu sagen, dass der Zug in Mestre aufgehalten wurde. Und warum, darf ich fragen, wurde der Zug in Mestre aufgehalten? Wegen eines wilden Streiks der örtlichen Sektion einer der Eisenbahnergewerkschaften. Wilder Streik! Als ob wir nicht schon genug öffentliche Streiks hätten, sind wir auch noch der Gnade so einer lokalen Bande von Arbeitern ausgeliefert, denen irgendwas nicht passt, und die das gesamte Transportsystem des Landes in ein totales Chaos stürzen können, selbstverständlich ohne die geringste Angst vor irgendwelchen Sanktionen.«
Der junge Römer schlug mit dem zusammengerollten Exemplar eines Nachrichtenmagazins auf Hochglanzpapier gegen sein Hosenbein. »Natürlich ist das ärgerlich«, bemerkte er. »Aber wir sollten doch die Unannehmlichkeiten nicht übertreiben. Im Übrigen gibt es Schlimmeres als Chaos.«
»Und was wäre das?«
»Zu viel Ordnung.«
Der Veroneser machte eine verächtlich abweisende Geste. »Zu viel Ordnung! Dass ich nicht lache! In diesem Land wäre selbst zu viel Ordnung noch nicht genug. Es ist immer dasselbe. Die Züge haben Verspätung? Baut eine neue Eisenbahnlinie! Der Süden ist arm? Macht eine neue Fabrik auf! Die Jugendlichen sind Analphabeten und Verbrecher? Stellt mehr Lehrer ein! Es gibt zu viele Beamte? Schickt sie früher mit einer hohen Pension in den Ruhestand! Die Kriminalitätsrate steigt unaufhaltsam? Erlasst neue Gesetze! Aber erwartet um Gottes willen nicht von uns, dass wir die Eisenbahnen und Fabriken, die wir haben, leistungsfähiger machen, die Lehrer und Bürokraten auffordern, anständig zu arbeiten und die Leute dazu veranlassen, die bestehenden Gesetze zu achten. O nein! Denn das würde nach Diktatur und Tyrannei riechen, und das können wir nicht zulassen.«
»Das ist nicht der Punkt!« Der junge Römer hatte nun endlich seine ironisch distanzierte Haltung aufgegeben. »Was Sie wollen, Signore, Ihre berühmte ›Ordnung‹, das ist etwas Unitalienisches, Nichtmediterranes. Das ist eine Idee des Nordens, und dort sollte sie auch bleiben. Sie hat hier keinen Platz. Nun gut, wir haben ein paar Probleme. Überall auf der Welt gibt es Probleme! Sie brauchen nur in die Zeitung zu schauen oder fernzusehen. Glauben Sie, das hier ist das einzige Land, wo das Leben nicht perfekt ist?«
»Das hat nichts mit Perfektion zu tun! Und was Ihren wunderschönen mediterranen Mythos betrifft, Signore, so erlauben Sie mir zu sagen …«
Der Mann am Fenster schaute nach draußen auf die kahle Mauer des Campo-Verano-Friedhofs, die neben dem Gleis verlief. Weder diese weitere Verzögerung noch die dadurch ausgelöste Diskussion schien der heiteren Gelassenheit, mit der er am Morgen aufgewacht war und die ihn seitdem erfüllte, etwas anhaben zu können. Vielleicht war sie durch die Unterbrechung der Routine ausgelöst worden, durch den Schock, nicht zurück in Rom zu sein, sondern 560 Kilometer weiter nördlich, unerklärlicherweise aufgehalten in Mestre. Für einen Augenblick war es gewesen, als sei die Realität selbst zusammengebrochen wie ein Filmprojektor, und gleich würden alle ihr Geld zurückverlangen. Nach einem blinden Gerangel mit seinen Kleidern in der dunklen Enge seines Schlafwagenabteils ging er hinaus in die neblig-trübe Morgenluft, die durchdrungen war vom salzigen Gestank der Lagune und dem beißenden Dunst von Erdöl und Chemikalien der Schwerindustrie, die um ihn herum dröhnte. Er schlenderte den Bahnsteig entlang zur Bar, wo er sich zwischen eine Gruppe von Eisenbahnern schob, einen Espresso mit einem Schuss Grappa bestellte und erfuhr, dass bis auf Weiteres keine Züge aus Mestre herausfahren würden, wegen eines Streits über die Belegschaftsstärken.
Ich könnte verschwinden, hatte er gedacht. Ich hätte verschwinden können, dachte er jetzt, indem ich einfach in einen der orangefarbenen Busse gestiegen wäre, die am Bahnhof vorbeifuhren, mit den erleuchteten Schildern, auf denen die magische Buchstabenkombination Venezia stand. Doch er hatte es nicht getan, und er hatte recht gehabt. Die merkwürdige Hochstimmung, in der er sich befand, verleitete dazu, sich treiben zu lassen und leicht wie ein flaches Einmannboot über die Meeresarme und Kanäle der Lagune zu gleiten, deren melancholische Topografie er als Junge erforscht hatte. In seinem Alter waren derartige Gefühle selten, man musste behutsam damit umgehen und durfte nicht erwarten, dass sie sich angesichts seiner verworrenen Beziehung zu seiner Heimatstadt behaupten könnten. Seine Belohnung bestand darin, dass sich diese Stimmung völlig unerwartet als dauerhaft erwies. Weder die Verzögerung in Mestre noch die nachfolgenden Stopps in Bologna und Florenz konnten ihr etwas anhaben, und trotz des Wetters – grau und für Ende März ungewöhnlich kalt – fand er sogar die Rückkehr in die Hauptstadt weniger deprimierend als sonst. Er würde Rom niemals lieben lernen, sich niemals wohlfühlen unter dem Gewicht jahrhundertelanger Macht und Korruption in diesem toten Zentrum Italiens, Symbol und Quelle seiner Stagnation. Doch wie könnte er sich auch jemals in dieser gewichtigsten aller Städte zu Hause fühlen, wo er doch in ihrer leibhaftigen Antithese geboren und aufgewachsen ist, einer Stadt, die so leicht ist, dass sie zu schweben scheint? Trotz allem, wenn er gezwungen wäre, zwischen dem alten Veroneser und dem jungen Römer Stellung zu beziehen, gäbe es nur eine Möglichkeit. Er hatte keineswegs den Wunsch, in irgendeinem erbärmlichen Land im Norden zu leben, wo alles wie ein Uhrwerk funktionierte. Als ob es das wäre, was im Leben zählt. Nein, was zählte, waren beispielsweise diese beiden Jungs draußen auf dem Gang, typische harte Burschen aus der römischen Arbeiterklasse in Jeans und Lederjacke, die in die Abteile der ersten Klasse starrten, während sie den Gang entlangschlenderten, mit jener natürlichen Unverschämtheit, der keine noch so schlimme Armut etwas anhaben kann, als ob ihnen der ganze Zug gehörte. Das Land mochte zwar seine Probleme haben, aber solange es solch glühende Energie, einen so unwiderstehlichen Schwung und ein solches Flair hervorzubringen vermochte …
Innerhalb einer Sekunde war die Tür wieder geschlossen, und der größere von beiden stand drinnen, in der einen Hand eine Sporttasche aus Kunststoff, in der anderen eine automatische Pistole. Ein flüchtiges Lächeln huschte über sein Gesicht. »Keine Sorge, ich bin kein Terrorist!«
Die Tasche landete auf dem Boden, zu ihren Füßen.
»Alles, was gut ist, hier rein! Brieftaschen, Uhren, Ringe, Feuerzeuge, Medaillons, Anhänger, Armreifen, Ohrringe, Seidenschlüpfer, was Sie gerade haben. Ausländische Währungen nur in größeren Banknoten, alle gängigen Kreditkarten werden angenommen. Nun los, macht schon!«
Die Mündung der Automatik richtete sich nacheinander auf jeden der drei Reisenden.
»Du verdammtes Stück Scheiße.«
Es war kaum hörbar, ein Bruchstück von aufgestautem Hass, das sich entlud. Die Pistole schwang zu dem silberhaarigen Mann herum.
»Was hast du gesagt, Opa?«
Der grauhaarige Mann am Fenster räusperte sich auffällig. »Bitte schießen Sie nicht auf mich«, sagte er. »Ich hole nur meine Brieftasche raus.«
Die Pistole drehte sich von dem Veroneser weg. Die Hand des anderen Mannes tauchte hervor; sie hielt eine große, braune Lederbrieftasche, aus der der Mann eine Plastikkarte herauszog.
»Was ist das?«, fuhr ihn der junge Mann an.
»Damit können Sie nichts anfangen.«
»Lassen Sie mich mal sehen! Und ihr zwei da, macht mal voran, verdammte Scheiße noch mal, oder wollt ihr einen Schuss ins Knie?«
Teures Leder und wertvolle Metalle landeten nach und nach auf dem Boden der Kunststofftasche. Der junge Mann warf einen Blick auf die Plastikkarte und lachte kurz auf. »Polizeikommissar? Äh, ’schuldigung, Dottore, das wusste ich nicht. Es ist okay, ihr könnt euren Kram behalten. Vielleicht können Sie mir eines Tages einen Gefallen tun.«
»Sie sind Polizeibeamter?«, fragte der Veroneser, während der Zug unter heftigem Ruckeln langsam anrollte.
Die Tür ging auf, und der andere junge Mann gestikulierte eindringlich zu seinem Kumpel hin. »Verdammte Scheiße, bist du immer noch nicht fertig? Lass uns um Himmels willen abhauen!«
»Nun machen Sie schon was!«, kreischte der silberhaarige Herr, während die beiden ihre Tasche an sich rissen und verschwanden. »Wenn Sie Polizist sind, dann tun Sie doch was! Halten Sie sie auf! Verfolgen Sie sie! Erschießen Sie sie! Sitzen Sie doch nicht einfach hier herum!«
Der Zug fuhr jetzt langsam am San-Lorenzo-Güterbahnhof vorbei. Nebenan knallte eine Wagentür. Der Polizeibeamte öffnete das Fenster und schaute nach draußen. Dort rasten sie davon, quer über die Gleise, um im Gewirr der Straßen zu verschwinden.
Der Veroneser war außer sich vor Zorn. »Sie wollen mir also nicht antworten, was? Das lasse ich mir nicht gefallen! Ich bestehe auf einer Antwort! Da kommen Sie nicht so leicht raus, das sage ich Ihnen! Gott im Himmel, schämen Sie sich denn überhaupt nicht, Commissario? Sie schauen seelenruhig zu, wie unschuldige Bürger vor Ihrer Nase ausgeraubt werden, während Sie sich hinter Ihrer Amtsgewalt verstecken und sich nicht die Bohne darum kümmern! Madonna! Ich meine, jeder weiß, dass die Polizei heutzutage nur ein schlechter Witz ist und uns zum Gespött aller anderen Länder in Europa macht. Das ist schon klar. Aber, lieber Gott, selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht erwartet, einen solchen eklatanten Fall von Pflichtversäumnis mitzuerleben. Nun? Sehr gut. Ausgezeichnet. Das lasse ich nicht auf sich beruhen. Ich bin nicht irgendjemand, mit dem man einfach so umspringen kann, müssen Sie wissen. Würden Sie mir freundlicherweise Ihren Namen und Ihren Dienstgrad nennen.«
Der Zug fuhr um die Kurve an der Porta Maggiore, und weiter vorne war nun der Bahnhof zu sehen.
»Also, Ihr Name?«, beharrte der silberhaarige Mann.
»Zen.«
»Zen? Sie sind aus Venedig?«
»Na und?«
»Aber ich komme doch aus Verona! Und wenn ich mir vorstelle, dass Sie uns so vor diesen Südländern blamiert haben!«
»Wen bezeichnen Sie hier als Südländer?«
Der junge Römer war aufgesprungen.
»Aha, plötzlich schämen Sie sich dieses Namens, was? Vor ein paar Minuten war das noch Ihr größter Stolz!«
»Ich schäme mich wegen gar nichts, Signore! Aber wenn ein Ausdruck als bewusste Beleidigung gebraucht wird von jemand, dessen Arroganz nur noch von seiner ungeheuerlichen Ignoranz der wahren Bedeutung der italienischen Kultur übertroffen wird …«
»Kultur! Was wissen Sie schon von Kultur? Machen Sie sich nicht lächerlich, indem Sie große Worte in den Mund nehmen, die Sie nicht verstehen.«
Während der Wagen über mehrere Reihen von Gleisen ruckelte und langsam am Bahnsteig entlang einlief, verließ Zen das Abteil und quetschte sich durch eine Schlange von Menschen, die auf dem Gang warteten.
»Habens wohl sehr eilig, was?«, bemerkte eine verdrießlich aussehende Frau. »Manche Leute müssen immer die Ersten sein, da haben die anderen halt Pech gehabt.«
Der Bahnsteig war überfüllt mit Reisenden, die seit Stunden warteten. Als der Zug zum Stehen kam, fielen sie wie Sturmtruppen ein, wild entschlossen, einen Sitzplatz für die lange Strecke bis nach Neapel oder noch weiter zu ergattern. Zen kämpfte sich bis in die Bahnhofshalle durch. Alle Telefone waren besetzt. An dem Apparat unmittelbar vor ihm wiederholte eine müde aussehende, ärmlich gekleidete Frau immer wieder »Ich weiß … ich weiß … ich weiß …« in einer durchdringenden, unmodulierten Stimme mit ländlichem Akzent.
Zen wedelte mit seinem Ausweis vor ihrem Gesicht. »Polizei. Das ist ein Notfall. Ich brauche dieses Telefon.«
Er nahm der Frau widerstandslos den Hörer aus der Hand und wählte 113. »Hier ist Kommissar Aurelio Zen. Nein, Zen. Z, E, N. Kein O. Gut. Dem Innenministerium unterstellt. Ich rufe von der Stazione Termini an. Hier hat es einen Überfall auf einen Zug gegeben. Sie sind in Richtung Via Prenestina davongerannt. Schicken Sie einen Wagen los, und dann gebe ich Ihnen die Beschreibung durch. Fertig? Der eine war ungefähr zwanzig, Größe um die einssechzig. Kurze, dunkle Haare, Militärschnitt, leistet also wahrscheinlich seinen Dienst ab, dunkelgrüne Lederjacke mit doppelten Reißverschlussaufschlägen, verwaschene Jeans, dunkelbraune Stiefel. Der andere war etwas größer, seine Haare länger und heller, Schnurrbart, große Nase, braune Lederjacke, neue Jeans, rot-weiß-blaue Turnschuhe, er trug eine grüne Sporttasche aus Kunststoff mit der weißen Aufschrift: ›Banca Populare di Frosinone‹. Er hat eine kleine Automatik, also seien Sie vorsichtig. Haben Sie das? In Ordnung, ich hinterlege einen vollständigen Bericht bei der Bahnpolizei.«
Er hängte ein. Die Frau starrte ihn mit einem Ausdruck verhaltener Faszination an.
»War das ein Ortsgespräch?«, fragte er.
Die Faszination verwandelte sich in Angst.
»Was?«
»Haben Sie mit jemandem in Rom gesprochen?«
»Nein, nein! Salerno! Ich bin aus Salerno.«
Und sie fing an, in ihrer Tasche nach ihrem Ausweis zu kramen, ihrem einzigen armseligen Talisman gegen die dunklen Mächte des Staates.
Zen durchforstete sein Kleingeld, bis er eine weitere Telefonmarke gefunden hatte. »Da. Jetzt können Sie neu wählen.«
Die Frau starrte ihn misstrauisch an. Er legte die Marke neben das Telefon und wandte sich zum Gehen.
»Es war meine Schwester«, sagte sie plötzlich und packte ihn am Arm. »Sie arbeitet für den Papst. Im Vatikan! Sie putzt da. Die Bezahlung ist lausig, aber es ist doch was, für den Papst zu arbeiten, oder? Aber ihr Mann lässt mich nicht mehr ins Haus wegen einer Geschichte, die mein Bruder über diesen Dreckskerl rausgekriegt hat. Also rufe ich sie immer an, wenn ich hierher komme, um meinen Enkel zu besuchen. Sie hat kein Telefon, wissen Sie, also rufe ich vom Bahnhof aus an. Das sind knauserige Hunde, diese Priester. Aber es ist immer noch besser, als Anchovis zu verpacken, wenigstens stinken die Finger nicht dabei. Aber sagen Sie mal, darf dieser Verbrecher das? Mir verbieten, meine eigene Schwester zu sehen? Gibt es kein Gesetz dagegen?«
Indem er irgendetwas von einem Notfall nuschelte, entzog sich Zen dem Griff der Frau und durchquerte die Bahnhofshalle in Richtung auf das entfernte Neonschild mit der Aufschrift: ›Polizia Ferroviaria‹.
»Willkommen daheim«, murmelte er vor sich hin. Seine Stimmung vom frühen Morgen schien so fern und bedeutungslos wie eine Kindheitserinnerung.
Die schwere Eingangstür fiel mit einem endgültigen Schlag hinter ihm zu, sperrte ihn ein und die übrige Welt aus. Als er den Schalter betätigte, beendete die einzige Birne, die die Eingangshalle erleuchtet hatte, mit einem verschwenderischen Aufblitzen ihre bleiche Existenz und ließ ihn im Dunkeln stehen, so als sei er gerade aus der Schule zurück. Nachdem er seiner Mutter einen Kuss gegeben hatte, war er meistens draußen auf dem Hof Fußball spielen gegangen. Erstaunlicherweise schien es ihm jetzt, als hörte er entfernt das Geräusch von plätscherndem Wasser. Dann verschwand es, und eine dozierende Stimme begann, sich über die Ökologie des Po-Deltas auszulassen. Dieses sanfte Plätschern, das das permanente Rauschen des Verkehrs überdeckte, kam natürlich nicht aus den stillen Kanälen seiner Kindheit, sondern aus dem Fernseher.
Er tappte blind den Gang entlang, an Bildern und Möbeln vorbei, die schon so lange ein Teil seines Lebens waren, dass er sich ihrer Existenz nicht mehr bewusst war. Als er sich der Tür mit dem Glaseinsatz näherte, wurde das Geräusch aus dem Fernseher lauter. Und als er das Wohnzimmer betreten hatte, war es ohrenbetäubend. In der trüben Mischung aus Fernsehstrahlen und durch die Fensterläden sickerndem Zwielicht konnte er die zerbrechliche Gestalt seiner Mutter erkennen, die mit kindlicher Intensität auf den flimmernden Bildschirm starrte.
»Aurelio! Du bist zurück!«
»Ja, Mama.«
Er beugte sich über sie, und sie umarmten sich.
»Wie war es in Fiume? Hast du dich gut amüsiert?«
»Ja, Mama.«
Er machte sich nicht mehr die Mühe, sie zu verbessern, selbst wenn ihre Fehler ihn nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich in die Irre führten, in eine Stadt, die bereits seit mehr als dreißig Jahren aufgehört hatte zu existieren. »Und wie gehts dir, Mama? Wie ist es dir ergangen?«
»Ganz gut. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Maria Grazia ist ein Schatz. Das Einzige, was mir gefehlt hat, warst du. Aber ich habe es dir ja gleich gesagt, als du zur Polizei gingst. Du hast keine Ahnung, wie es da zugeht, habe ich gesagt. Mal schicken sie dich hierhin, mal schicken sie dich dorthin, und wenn du dich gerade eingelebt hast, dann schicken sie dich wieder woanders hin, bis du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht. Und wenn ich mir vorstelle, dass du einen schönen Posten bei der Eisenbahn hättest haben können, wie dein Vater, einen schönen Aufsichtsposten, genauso sicher wie bei der Polizei und ohne dieses ewige Herumreisen. Und wir hätten niemals hier runter in den Süden ziehen müssen!«
Sie verstummte, als Maria Grazia aus der Küche hereineilte. Doch sie hatten Dialekt gesprochen, und die Haushälterin hatte sie nicht verstanden. »Willkommen daheim, Dottore!«, rief sie. »Man hat den ganzen Tag versucht, Sie zu erreichen. Ich habe gesagt, Sie wären noch nicht zurück, aber …«
In diesem Augenblick klingelte das Telefon im Flur. Das wird dieser alte Faschist aus dem Zug sein, dachte Zen. Solche Typen haben immer Freunde. Aber »den ganzen Tag«? Maria Grazia hatte sicher übertrieben.
»Zen?«
»Am Apparat.«
»Hier ist Enrico Mancini.«
Allmächtiger Gott! Der Veroneser war direkt bis zur höchsten Stelle vorgedrungen. Zen umfasste zornig den Hörer. »Hören Sie, der kleine Scheißkerl hatte eine Pistole, und er stand zu weit von mir weg, um ihn anzuspringen. Was hätte ich also machen sollen, möchte ich gerne wissen? Mich erschießen lassen, damit der Commendatore seine lumpige Uhr behalten kann?«
Es knackte in der Leitung.
»Wovon reden Sie eigentlich?«
»Ich rede von dem Zug.«
»Ich weiß von keinem Zug. Ich rufe an, um mit Ihnen über Ihre Versetzung nach Perugia zu sprechen.«
»Was? Foggia?«
Die Verbindung war sehr schlecht, mit starken atmosphärischen Störungen und gelegentlichen Ausfällen. Zum hundertsten Mal fragte sich Zen, ob er immer noch abgehört würde, und zum hundertsten Mal sagte er sich, dass das keinen Sinn mehr hätte, jetzt nicht mehr. Es war nicht mehr wichtig. Diese Art von Verfolgungswahn war nur verdrehte Eitelkeit.
»Perugia! Perugia in Umbrien! Sie reisen morgen ab.«
Was um alles in der Welt ging hier vor? Warum sollte sich jemand wie Enrico Mancini für Zens stumpfsinnige Arbeit interessieren?
»Nach Perugia? Aber meine nächste Fahrt sollte nach Lecce gehen, und das nicht vor …«
»Vergessen Sie das erst mal. Sie sollen wieder Ermittlungsaufgaben übernehmen, Zen. Haben Sie von dem Fall Miletti gehört? Ich werde alle Unterlagen besorgen, die ich kriegen kann, und sie Ihnen morgen früh mit dem Wagen vorbeischicken. Doch im Großen und Ganzen klingt der Fall ziemlich eindeutig. Jedenfalls sind Sie ab morgen dafür verantwortlich.«
»Verantwortlich wofür?«
»Für die Ermittlungen im Fall Miletti! Sind Sie taub?«
»In Perugia?«
»Genau. Sie sind vorübergehend dorthin beordert.«
»Sind Sie da ganz sicher?«
»Wie bitte?« Mancinis Stimme hatte einen eisigen Klang.
»Ich meine, ich hatte angenommen, wissen Sie …«
»Nun?«
»Nun ich dachte, ich sei für immer von allen Ermittlungsaufgaben suspendiert.«
»Das ist das Erste, was ich höre. Wie dem auch sei, derartige Entscheidungen können unter besonderen Umständen immer wieder revidiert werden. Der Questore von Perugia hat um Hilfe gebeten, und es steht uns sonst niemand zur Verfügung. So einfach ist das.«
»Es ist also offiziell.«
»Natürlich ist das offiziell! Machen Sie sich darüber keine Sorgen, Zen. Konzentrieren Sie sich ganz auf die vorliegende Aufgabe. Es ist wichtig, dass wir bald Ergebnisse sehen, verstehen Sie? Wir verlassen uns ganz auf Sie.«
Lange, nachdem Mancini eingehängt hatte, stand Zen noch immer neben dem Telefon, den Kopf gegen die Wand gestützt. Schließlich nahm er den Hörer wieder ab und wählte. Er ließ es eine Zeit lang klingeln. Als er gerade auflegen wollte, meldete sie sich. »Ja?«
»Ich bins.«
»Aurelio! Ich habe nicht erwartet, vor heute Abend von dir zu hören. Wie ist es gelaufen, wo auch immer du diesmal warst?«
»Warum hast du es so lange klingeln lassen?«
Sie war mittlerweile an seine Launen gewöhnt. »Mein Liebhaber ist bei mir. Nein, wenn du es genau wissen willst, ich war im Bad. Ich wollte zuerst nicht drangehen, aber dann dachte ich, dass du es vielleicht wärst.«
Er grunzte, und für einen Moment herrschte Schweigen.
»Hör mal, es ist was passiert. Ich muss morgen schon wieder weg und weiß nicht, wann ich zurück sein werde. Können wir uns treffen?«
»Sehr gerne. Sollen wir irgendwo hingehen?«
»Ja gut. Zu Ottavio?«
»Fein.«
Zen hängte ein und schaute sich im Flur um. Er sah sich den Möbeln gegenüber, die seine Kindheit beherrscht hatten und nun zurückgekehrt waren, um sein Erwachsenendasein heimzusuchen. Alles in dieser Wohnung war aus seinem Elternhaus in Venedig hierher gebracht worden, als sich seine Mutter vor sechs Jahren endgültig bereit erklärt hatte, von dort wegzuziehen. Viele Jahre lang hatte sie sich dagegen gewehrt, selbst als schon längst klargeworden war, dass sie nicht mehr alleine zurechtkam.
»Rom? Niemals!«, schrie sie. »Ich käme mir vor wie ein Fisch auf dem Trockenen.«
Und ihr Keuchen und Schaudern ließ diese abgedroschene Phrase lebendig und schmerzvoll erklingen. Doch schließlich war sie gezwungen nachzugeben. Ihr einziger Sohn konnte nicht zu ihr ziehen. Seit der Moro-Affäre war seine Karriere festgefahren, am Ende, und die Jahre voll öder Routine, die ihm bis zur Pensionierung bevorstanden, konnten nur noch durch Worte beschönigt werden. Und es war niemand anders da, außer ein paar entfernten Verwandten, die in einer Gegend lebten, die jetzt zu Jugoslawien gehörte. Also war sie schließlich nach Rom gezogen und dem von ihr befürchteten Schicksal durch das einfache Mittel entronnen, dass sie all ihre Habe mitbrachte und Zens Wohnung in ein Aquarium verwandelte, aus dem sie nie auftauchte.
Zwar wurde sie auf diese Weise vor dem Ersticken bewahrt, doch auf Zen hatte das Ganze genau die umgekehrte Wirkung. Er hatte seine Wohnung, die in einer tristen, aber pompösen Straße genau nördlich vom Vatikan gelegen war, nie besonders gemocht, aber in Rom musste man nehmen, was man kriegen konnte. Was er an diesem Ort schätzen gelernt hatte, war die Anonymität, in der man hier leben konnte; es war, als wohnte man im Hotel. Doch mit der Ankunft seiner Mutter hatte sich alles geändert; die vom Vermieter zur Verfügung gestellte, spärliche Einrichtung wurde von Gegenständen überschwemmt, die mit trüben Erinnerungen und unklaren Bedeutungen beladen waren. Manchmal glaubte Zen, ersticken zu müssen. Dann schweiften seine Gedanken zu dem Haus in Venedig, das nun leer stand, in den Räumen nichts weiter als perlendes Licht, die Spiegelungen des Wassers und die Schreie von Kindern und Möwen. Er hatte geschworen, dass er sich eines Tages dorthin zurückziehen würde. In der Zwischenzeit war er oft so intensiv in Gedanken dort, dass es ihn nicht im geringsten verwundert hätte zu hören, die Leute glaubten, in dem Haus spuke es.
Aus der Küche ertönte das Klappern von Töpfen, untermalt von Maria Grazias Stimme, die abwechselnd den alten Herd beschimpfte, ein stumpfes Messer anspornte, ein paar Takte aus dem großen Frühjahrshit sang und die Madonna anrief, mit anzusehen, welche Qualen sie wegen der Qualität des Gemüses, das der Händler nebenan anbot, zu ertragen habe. Er würde hier erst etwas essen müssen, bevor er sich davonschlich, um Ellen zu treffen. Seine Mutter hatte in einer Woche Geburtstag, fiel ihm ein. Er würde sehr wahrscheinlich noch unterwegs sein. Auf jeden Fall musste er ihr mitteilen, dass man neue Pläne mit ihm hatte, und er würde sich wieder anhören müssen, wie leicht er einen so schönen Posten bei der Eisenbahn hätte bekommen können wie sein Vater. War ihr wirklich nicht bewusst, dass sie ihm das jedes Mal erzählte, wenn er zurückkam? Oder machte sie sich im Gegenteil auf seine Kosten lustig? Das war das Problem bei alten Leuten, man konnte sich nie sicher sein. Aber es war auch das Problem, mit jemand zusammenzuleben, den man mehr als jeden anderen auf der Welt liebte, mit dem man nun jedoch nicht mehr gemeinsam hatte als Fleisch und Blut.
»Aber ich verstehe das nicht. Du bist doch überhaupt kein richtiger Polizist. Du arbeitest doch für das Ministerium, oder? In der Verwaltung. Das hast du mir jedenfalls erzählt.«
Was Ellen damit sagen wollte, war klar; sie hätte sich niemals mit ihm eingelassen, wenn sie geglaubt hätte, er sei ein »richtiger« Polizist.
»Das stimmt auch. Seitdem ich dich kenne, war das meine Aufgabe. Die Runde bei den Polizeipräsidien in der Provinz machen und überprüfen, wie viele Büroklammern verbraucht werden, lauter solche Dinge. Inspektionsaufgaben, allgemein unter dem Namen Hausarbeit bekannt und ungefähr ebenso ruhmreich. Was dabei noch am ehesten an echte Polizeiarbeit herankam, war die große Gaunerei mit den gestohlenen Klorollen, die ich in der Questura in Campobasso aufdeckte.«
Ellen lächelte nicht. »Und davor?«
»Nun, davor war es anders.«
»Du warst ein richtiger Bulle? Ein Polizeibeamter?«
»Ja.«
Sie sah ihn so schockiert an, dass er nicht erkennen konnte, was sie möglicherweise sonst noch empfand. »Wo war das?«, fragte sie schließlich.
»Oh, an verschiedenen Orten. Hier zum Beispiel.«
»Du hast in der Questura gearbeitet, hier in Rom?«
»Das stimmt.«
»Du lieber Gott. In welcher Abteilung?«
Sie sah ihn durchdringend an.
»Nicht in der politischen Abteilung, falls es das ist, was dich beunruhigt.«
Natürlich war es das. Ellens ausländischer Bekanntenkreis betrachtete es als ziemlich merkwürdig, dass sie ein Verhältnis mit einem Beamten aus dem Innenministerium hatte. Ebenso waren die Freunde Zens eindeutig überfragt, wenn sie seine Liaison mit dieser geschiedenen Amerikanerin einschätzen sollten, einer typischen Straniera mit ihrem hellen, kleinen Apartment in Trastevere, vollgestopft mit Kunstgegenständen und Büchern in vier Sprachen, und ihrem falsch geparkten Fiat 500 vor der Tür. Die Antwort war jeweils gewesen, dass, was immer es auch war, es für beide funktionierte. Das schien die einzige unvermeidliche Antwort zu sein. Doch nun, ohne die geringste Vorwarnung, sah sich Ellen mit der Möglichkeit konfrontiert, dass ihr Beamter ein ehemals aktiver Angehöriger von La Politica war, einer von denen, die demonstrierende Studenten und streikende Arbeiter zusammenschlugen und Verdächtige aus dem Fenster stießen, während sie gleichzeitig die Neofaschisten schützten, die für das willkürliche Bombardieren von öffentlichen Plätzen, Cafeterien und Zügen verantwortlich waren.
»Ich habe dich gefragt, was du getan hast«, insistierte sie, »nicht, was du nicht getan hast.«
Sie verhielt sich nun wie einer von jenen harten und brutalen Bullen, für den sie Zen jetzt möglicherweise hielt, einer von denen, die Druck auf Verdächtige ausüben, um sie zu einer Aussage zu bewegen.
»Ich war in der Sektion, die für Entführungen zuständig ist.«
Bei diesen Worten entspannten sich ihr Züge ein wenig. Entführungen also. Nun, das war in Ordnung, oder? Ein netter, unproblematischer Bereich der Polizeiarbeit. Blieb nur noch die Frage, warum er ihn zugunsten der unrühmlichen Rolle des Ministeriumsschnüfflers aufgegeben hatte, der die eine Hälfte seiner Zeit damit zubrachte, ermüdende Fahrten in langweilige Provinzhauptstädte zu unternehmen, wo sich alle Betroffenen ganz unverblümt über seine Anwesenheit ärgerten, und die andere Hälfte damit, in seinem fensterlosen Büro in Viminale unlesbare und mit Sicherheit auch ungelesene Berichte zu tippen. Doch bevor Ellen die Chance hatte, ihn danach zu fragen, erschien Ottavio persönlich an ihrem Tisch, und man wandte sich dem Thema Essen zu.
Ottavio ließ sich in schmerzvollem Ton darüber aus, dass die Leute seiner Meinung nach heutzutage nicht genug äßen. Sie dächten nur noch an ihre Figur, eine egoistische und kurzsichtige Einstellung, die unmittelbar zur Verarmung der Gastronomen und zum Niedergang der uns bekannten Zivilisation führe. Was die Goten, Hunnen und Türken nicht geschafft hätten, das gelang jetzt allmählich einer Verschwörung von Ernährungswissenschaftlern, die das Land mit all dem Gerede über Cholesterin, Kalorien und die schädliche Wirkung von Salz in die Knie zwangen. Wo sollte das noch hinführen?
Solcherart waren seine allgemeinen Kümmernisse. Doch sein besonderer Zorn galt Zen, der dem Kellner gesagt hatte, dass er nach der riesigen Schüssel Spaghetti alla Carbonara, zu der er sich zusätzlich zu der von Maria Grazia zu Hause bereiteten Gemüsesuppe gezwungen hatte, nichts mehr haben wollte.
»Was wollen Sie damit bezwecken?«, fragte Ottavio empört. »Mein Geschäft ruinieren? Hören Sie, das Lamm ist heute fabelhaft. Und wenn ich sage fabelhaft, dann ist das noch nicht einmal die halbe Wahrheit. Junge, zarte Tiere, so entzückend und schön, dass es eine Sünde war, sie zu töten. Doch wo sie nun schon tot sind, wäre es eine noch viel größere Sünde, sie nicht zu essen.«
Zen ließ sich überreden, vor allem um Ottavio loszuwerden, der nun weiterging, um die gute Kunde an anderen Tischen zu verbreiten.
»Und wie ist es dir ergangen?«, fragte Zen Ellen, nachdem er weg war.
Aber sie ging nicht darauf ein. »Warum hast du mir das nicht früher erzählt?«
»Ich dachte nicht, dass es dich interessiert. Außerdem gehört es nun schon längst der Vergangenheit an.«
»Und wann ist das alles passiert, damals?«
»Oh, ich glaube, es muss ungefähr … ja, jetzt ist es ungefähr vier oder fünf Jahre her. Mehr oder weniger.«
Sicher hatte er die Unbestimmtheit auf groteske Weise übertrieben. Doch anscheinend war sie mit dieser Auskunft zufrieden.
»Und nun setzen sie dich plötzlich wieder für diese Art von Arbeit ein? Das muss ziemlich überraschend kommen.«
»Das ist wohl wahr.«
Es gab keinen Grund, das zu verheimlichen.
»Du hast also 1979 aufgehört?«
»Genaugenommen ein Jahr vorher.«
»Und du hast dich auf einen Bürojob versetzen lassen?«
»Mehr oder weniger.«
Er wartete voller Spannung auf das, was nun folgen würde, doch es kam nicht. Na schön. Wenn Ellen nicht begriff, wie unwahrscheinlich es war, dass in dieser spezifischen Sektion der römischen Polizei ausgerechnet 1978 jemand die Erlaubnis bekommen hätte, sich auf einen Bürojob versetzen zu lassen, dann würde er sie ganz bestimmt nicht darauf hinweisen.
»Was hat dich dazu veranlasst?«
»Ach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hatte ich die Schnauze voll von der Arbeit.«
Das Essen wurde von Ottavios jüngstem Sohn aufgetragen, einem flinken, kleinen Windhund, der im Alter von vierzehn sein professionelles Gebaren bereits so perfektioniert hatte, dass es ihm gelang, zu verstehen zu geben, er sei mit einer Aufgabe von unschätzbarer Wichtigkeit für die Menschen betraut, die er trotz widrigster Umstände unter fast unmöglichen Bedingungen ausführe, und dass er, obwohl ein Denkmal draußen auf der Piazza kaum angemessen zum Ausdruck bringen könne, was die Gesellschaft ihm schulde, noch nicht mal ein anständiges Trinkgeld erwarte.
Einige Minuten lang aßen sie schweigend.
»Also, was hast du getrieben?«, beharrte Zen. »Wie gehen die Geschäfte?«
»Ziemlich ruhig. Am Dienstag findet allerdings eine große Auktion statt.«
Ellen verdiente ihren Lebensunterhalt als Agentin für einen New Yorker Antiquitätenhändler. Auf diese Weise war es ihr gelungen, aus einem Hobby Geld zu machen, und zwar aus einem Hobby, für das sie ihn vergeblich zu interessieren versucht hatte. Zen war bedient mit alten Möbeln!
»Wie lange wird das Ganze dauern?«
»Nicht lange, hoffe ich.«
»Kennst du Perugia?«
Perugia, überlegte er. Pralinen, Etrusker, dieser dicke Maler, Radios und Plattenspieler, die Ausländeruniversität, Sportkleidung. »Umbrien, das grüne Herz Italiens«, lautete die Fremdenverkehrswerbung. Was war dann Latium, hatte er sich gefragt, die reizbare Leber?
»Kann sein, dass ich mal mit der Schule da war, vor vielen Jahren.«
»Aber noch nie beruflich?«
»Keine Chance! Wir sind zu zweit bei der Hausarbeit. Doch man schätzt Zuccaroni mehr als mich, also kriegt er immer die bequemen Jobs, nicht weit von zu Hause entfernt.«
»Wird es schwierig sein?«
Er schob seinen Teller von sich und füllte ihre Gläser wieder mit dem flachen, faden Weißwein. »Das kann man nicht im Voraus wissen. Eine Menge hängt von dem Richter ab, der die Untersuchung leitet. Manche von ihnen wollen alle Entscheidungen selber treffen. Andere wollen nur das Verdienst für sich in Anspruch nehmen.«
Sie war jetzt ebenfalls mit dem Essen fertig, und endlich konnten sie rauchen. Er zog ein Päckchen Nazionali heraus. Ellen gab wie immer ihren eigenen Zigaretten den Vorzug. »Kann ich dich besuchen kommen?«, fragte sie mit einem warmen Lächeln.
»Das wäre wunderbar.«
Sie nickte. »Keine Mutter.«
Er erkannte plötzlich, in welche Richtung das Gespräch abdriftete.
»Findest du nicht, dass das lächerlich ist, in unserem Alter?«, fuhr Ellen fort. »Sie muss wissen, was los ist.«
»Ich nehme an, das weiß sie. Doch für sie bin ich immer noch mit Luisella verheiratet. Wenn ich die Nacht mit dir verbringe, dann ist das Ehebruch. Da ich ein Mann bin, spielt das keine Rolle, aber man spricht nicht darüber.«
»Für mich spielt das schon eine Rolle.« Ihr Ton war härter geworden. »Mir gefällt es nicht, wenn deine Mutter mich als deine Geliebte betrachtet.«
»Nicht? Ich genieße das regelrecht. Auf diese Weise fühle ich mich jung und ohne Verantwortung.«
Die Bemerkung war mit Absicht provozierend gemeint, denn er hatte seit Langem beschlossen, sich kein zweites Mal zur Ehe überreden zu lassen.
»Tatsächlich?«, entgegnete sie. »Nun, ich fühle mich dadurch eher alt und verunsichert. Und wütend! Weshalb sollte ich mein Leben von deiner Mutter beherrschen lassen? Und warum musst du das eigentlich tun? Was ist bloß mit den italienischen Männern los, dass sie sich ihr Leben lang von ihren Mamas terrorisieren lassen? Warum gebt ihr ihnen soviel Macht?«
»Vielleicht haben wir im Laufe der Jahrhunderte herausgefunden, dass sie die Einzigen sind, denen wir diese Macht anvertrauen können.«
»Oh, ich verstehe. Mir kannst du also nicht vertrauen? Vielen Dank.«
Ihm schien das vollkommen einleuchtend zu sein. Warum wurde sie bloß so wütend?
»Nicht dass meine Mutter eine Heilige wäre«, erklärte er. »Aber Mütter sind nun mal so. Sie können nicht anders, das ist biologisch.«
»Hervorragend! Jetzt hast du uns beide beleidigt.«
»Ganz im Gegenteil, ich habe euch beiden ein Kompliment gemacht. Meiner Mutter, weil sie so ist, wie sie ist, und dir, weil du vollkommen anders bist. Und vor allen Dingen, weil du so viel Verständnis zeigst in einer Situation, die für uns beide schwierig ist, die aber nicht ewig so bleiben wird.«
Von dieser Andeutung entwaffnet, wandte sie ihren Blick ab, und Zen benutzte die Gelegenheit, Ottavio zu signalisieren, er möge die Rechnung bringen.
Die Luft draußen war angenehm kühl und frisch nach dem kleinen, stickigen Restaurant. Sie gingen schweigend in Richtung Viale Trastevere, dem dröhnenden Straßenverkehr entgegen. Auf der Piazza Sonnino wurde ein Bürogebäude nach einem Brand renoviert, und der von den Bauarbeitern errichtete Bretterzaun hatte die kriegerischen Farben rivalisierender politischer Gruppen angezogen. Der fünfzackige Stern der Roten Brigaden stach am meisten ins Auge, doch es gab auch Parolen vom Bewaffneten Kampf (»Es gibt kein Entkommen – wir erwischen euch alle!«), den Anarchisten (»Wenn Wahlen etwas veränderten, würde man sie verbieten«) und der neofaschistischen Neuen Ordnung (»Ehret unsere im Kampf gefallenen Gefährten – sie leben in unseren Herzen weiter!«).
Zen schien dieses Aufeinanderprallen von Slogans auf unheimliche Weise zutreffend. Denn falls es bei den Ereignissen von 1978 ein geheimes Zentrum gegeben hatte, und ein Teil ihres Grauens bestand darin, dass er das nie sicher wissen würde, dann war das in gewissem Sinne hier gewesen, bei der Endstation des Busses 97C und dem San-Gallicano-Krankenhaus auf der anderen Straßenseite. Wenn es ein unaussprechliches Geheimnis gegeben hatte, dann war einer der beiden Männer, die das erraten hatten, hier gestorben. Und seit diesem Augenblick, ob bei Tag oder in der Nacht, ganz gleich was er gerade tat oder dachte, war Zen voller Unbehagen bewusst gewesen, dass er der andere war.
2
Sämtliche in der Questura von Perugia vorhandenen Hilfsmittel stehen selbstverständlich zu Ihrer Verfügung. Meine Männer können es gar nicht erwarten, Ihren Befehl zu erhalten und in Aktion zu treten. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, und die Aussicht, unter Ihrer Leitung zu arbeiten, hat uns alle sehr beflügelt. Wer hätte noch nie von Ihren großartigen Erfolgen bei der Affäre Fortuzzi und der Affäre Castellano gehört, um nur zwei Namen zu nennen? Und wer könnte daran zweifeln, dass Ihnen ein ebenso spektakulärer Triumph hier auf umbrischem Boden gelingen wird? Unser zutiefst empfundener Dank wird Ihnen zuteilwerden, weil Sie sich als erfolgreich erweisen werden, wo andere, weniger vom Schicksal begünstigt und weniger verdienstvoll, gescheitert sind. Die Stadt Perugia verbindet, historisch gesehen, eine lange Beziehung mit der Hauptstadt, für die Ihr Einsatz hier ein konkretes Symbol ist. Meine Männer werden sich gewiss mir anschließen und Sie willkommen heißen.«
Schwacher Applaus war aus der Gruppe höherer Beamter zu vernehmen, die in dem geräumigen Büro des Questore im oberen Stockwerk zusammengekommen waren. Das Büro war unaufdringlich modern eingerichtet, mit Regalen voller juristischer Bücher und Topfpflanzen. Aurelio stand inmitten von alledem wie eine Siamkatze, die man in einen Käfig voll streunender Hunde geworfen hatte; angespannt und herausfordernd zugleich weigerte er sich, in die Augen der Männer zu blicken, die ihn mehr oder weniger unverhohlen spöttisch anstarrten. Sie wussten, was er durchmachte, das arme Schwein. Und sie wussten auch, dass er absolut nichts dagegen machen konnte.
Salvatore Iovino, ihr Vorgesetzter, ein korpulenter und temperamentvoller Fünfzigjähriger aus Catania, hatte eine meisterhafte Vorstellung gegeben. So übertrieben und nichtssagend, so voll unaufrichtiger Wärme und versteckter Spitzen seine Rede auch war, enthielt sie dennoch keinen berechtigten Grund zur Klage. Er hatte von Zens »Ruf« gesprochen, allerdings ohne dessen plötzlichen Abzug aus der Questura in Rom im Jahre 1978 zu erwähnen, der Anlass zu den wildesten Gerüchten und Mutmaßungen innerhalb der gesamten Polizei gegeben hatte. Die beiden Fälle, die er erwähnt hatte, gingen in die Mitte der Siebzigerjahre zurück und unterstrichen Zens mangelnde Berufserfahrung in jüngster Zeit. Iovino hatte die Versetzung als »Einsatz« bezeichnet, wodurch er betonte, dass sie ihm vom Ministerium aufgezwungen war, und er hatte sie ein Symbol für die historische Beziehung zwischen Rom und Perugia genannt, eine Beziehung, die in zweitausend Jahren zutiefst verabscheuter Vorherrschaft bestand.
»Ich danke Ihnen«, murmelte Zen und verbeugte sich mit einer zugleich stolzen und melancholischen Geste der Erwiderung.
»Und nun«, fuhr der Questore fort, »erlauben Sie mir, Ihnen Vicequestore Fabrizio Priorelli vorzustellen.«
Iovinos konziliante Sprechweise hatte Zen in keiner Weise auf die offene Feindseligkeit vorbereitet, mit der er sich von Priorelli gemustert fühlte. Der Questore sprach nach einer geschickt bemessenen Pause weiter, während der das Schweigen im Raum fast mit Händen zu greifen war.
»Bis heute hat er den Fall Miletti für uns bearbeitet.«
Iovino lachte kaum hörbar.
»Um ganz offen zu sein, dies ist eines der vielen Probleme, das uns Ihre unerwartete Ankunft bereitet hat. Es ist eine Frage des Protokolls. Da Fabrizio rangmäßig über Ihnen steht, kann ich ihn schlecht zu Ihrem Untergebenen machen. Sollten Sie ihn jedoch um Rat fragen wollen, steht er Ihnen, so hat er mir versichert, trotz seiner zahlreichen anderen Verpflichtungen jederzeit zur Verfügung.«
Noch einmal brachte Zen seine Dankbarkeit murmelnd zum Ausdruck.
»Okay, Jungs, Mittagessen!«, rief der Questore forsch. »Ich denke, das könnt ihr jetzt gebrauchen, was?«
Während die Beamten nacheinander den Raum verließen, nahm Iovino den Telefonhörer hoch und brüllte: »Chiodini? Kommen Sie rauf zu mir!« Dann drehte er sich ostentativ zum Fenster und starrte so lange hinaus, bis ein Klopfen an der Tür zu hören war und ein kräftiger Mann mit einem gelangweilten, brutalen Gesicht eintrat; in diesem Augenblick schien sich der Questore plötzlich wieder Zens Existenz bewusst zu werden.
»Ich werde Sie Chiodinis sicheren Händen anvertrauen, Dottore. Und denken Sie daran, wann immer Sie irgendetwas brauchen, sagen Sie es nur.«
»Danke.«
Während sie die Treppe hinuntergingen, begutachtete Zen seinen Geleitschutz: kurz geschorene Haare, die einen muskulös aussehenden Kopf bedeckten, Blumenkohlohren, so gut wie keinen Hals, Schultern und Bizeps bildeten einen unbeweglichen Block, die »sicheren« Hände schwangen wuchtig vor und zurück. Chiodini wäre einer von denen, die man losschicken würde, wenn altmodische Verhörmethoden erwünscht waren.
Auf dem Absatz zum dritten Stock wies der Mann mit seinem Daumen abrupt nach rechts. »Hier entlang, drei-fünf-eins«, rief er, ohne sich umzudrehen oder seinen Schritt zu verlangsamen.
Zen konnte sich gerade noch bremsen, ein weiteres »Danke« von sich zu geben.
Ja, man hatte alles vollkommen im Griff, das war keine Frage. Iovinos Ansprache war ein brillantes Kabinettstück gewesen, das sich sämtliche Schwerpunkte in Zens Position zunutze machte. Doch Worte sind nicht alles, und der Questore hatte keineswegs versäumt, seinen Standpunkt auch mit anderen Mitteln zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel durch den Kontrast zwischen der bombastischen Formalität, mit der er den roten Teppich ausgerollt und die große Trommel geschlagen hatte, und der nachlässigen Geste, mit der er Zen den »sicheren Händen« eines drittklassigen Spezialisten übergeben hatte. Die Botschaft war klar. Man würde Zen das Blaue vom Himmel versprechen, aber wenn er eine Tasse Kaffee wollte, würde er sie sich selber holen müssen.