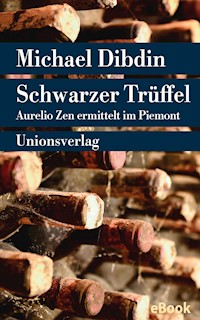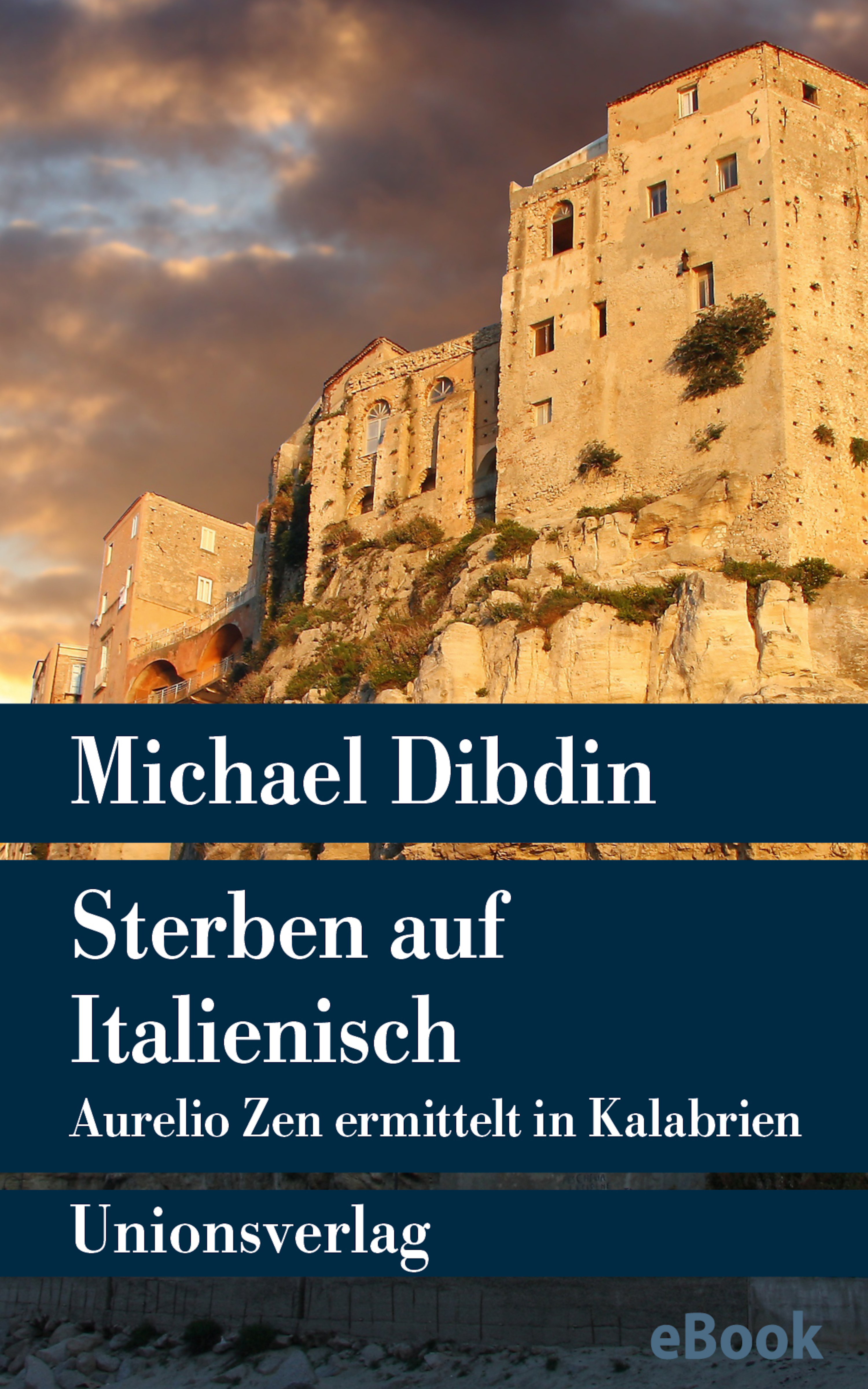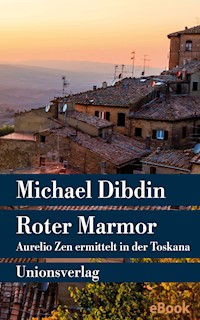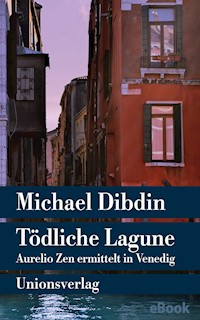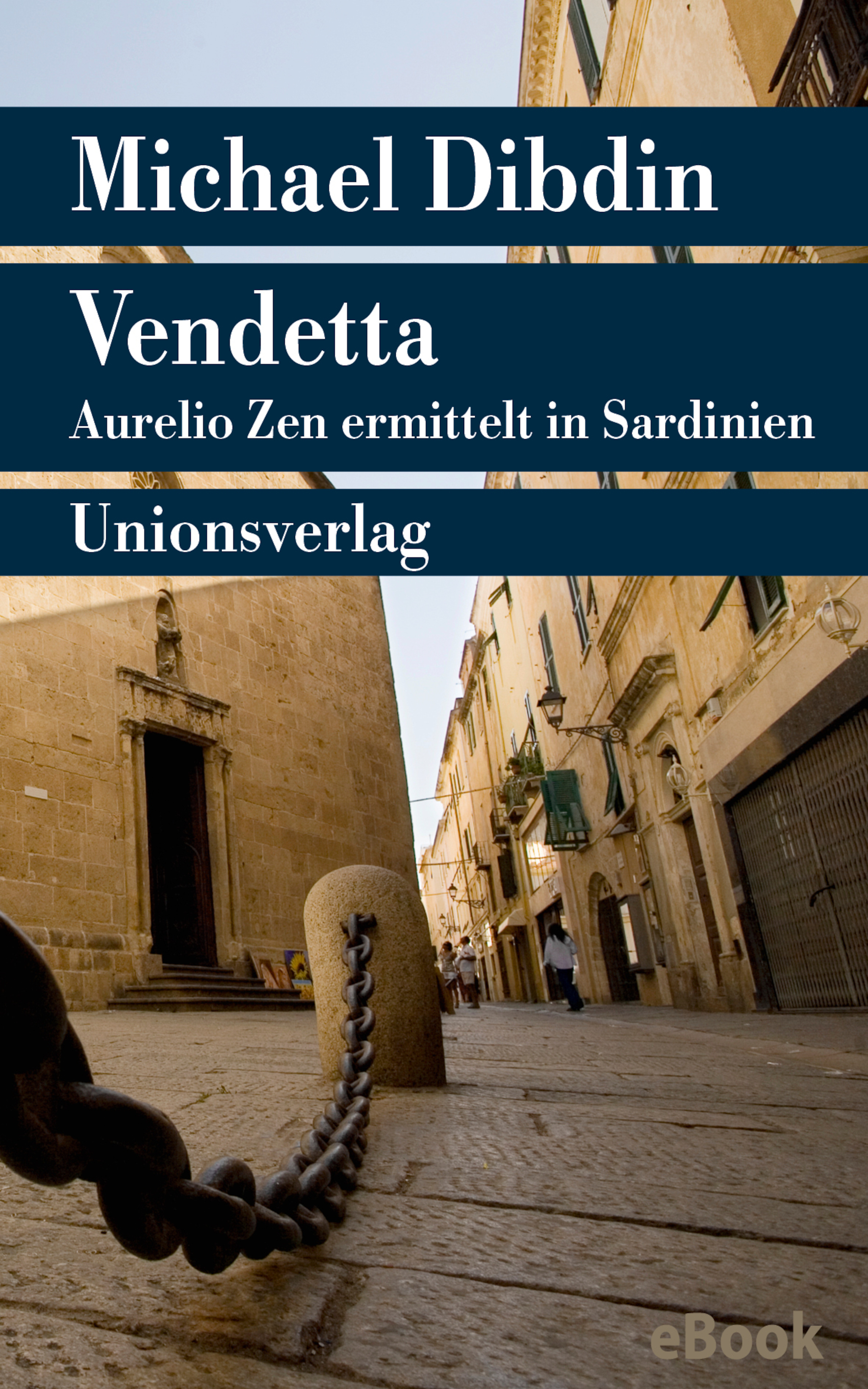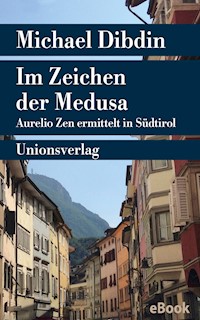
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eigentlich könnte sich Aurelio Zen zurücklehnen: Er lebt mit seiner Freundin Gemma im toskanischen Lucca und bearbeitet Routinefälle. Aber der rastlose Polizist ist froh, als er in die Dolomiten geschickt wird, wo die Leiche eines seit Jahren vermissten Offiziers der Gebirgsjäger aufgetaucht ist. Der Arzt, der die Leiche untersucht hat, berichtet Zen von einer Tätowierung auf dem Arm des Toten: Sie zeigt das Haupt der Medusa. Als bald darauf eine weitere Leiche mit einer Medusa-Tätowierung gefunden wird, merkt der Kommissar, dass er einer Verschwörung auf der Spur ist, in die höchste Kreise des Landes verwickelt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Kommissar Aurelio Zen wird in die Dolomiten geschickt, wo die Leiche eines vermissten Offiziers der Gebirgsjäger aufgetaucht ist. Als eine weitere Leiche mit der rätselhaften Medusa-Tätowierung gefunden wird, merkt Zen: Er ist einer Verschwörung auf der Spur, in die höchste Kreise verwickelt sind.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Michael Dibdin (1947–2007) studierte englische Literatur in England und Kanada. Vier Jahre lehrte er an der Universität von Perugia. Bekannt wurde er durch seine Figur Aurelio Zen, einen in Italien ermittelnden Polizeikommissar.
Zur Webseite von Michael Dibdin.
Ellen Schlootz arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie hat u. a. Werke von Ian Rankin und David Hosp ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Ellen Schlootz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Michael Dibdin
Im Zeichen der Medusa
Aurelio Zen ermittelt in Südtirol
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ellen Schlootz
Aurelio Zen ermittelt (9)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2003 im Verlag Faber and Faber, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2004 im Goldmann Verlag, München.
Originaltitel: Medusa (2003)
© by Michael Dibdin 2003
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Emya
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30894-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 13.06.2022, 13:51h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
IM ZEICHEN DER MEDUSA
1 – Ein zäher Nebel hing in den Straßen und …2 – Ich nehme an, du hast von dieser furchtbaren …3 – Nach einer perfekt ausgeführten Wende tauchte er aus …4 – Die Taschenlampe fungierte als Genius Loci, und obwohl …5 – Die Nacht glitt bei hundertvierzig Stundenkilometern am offenen …6 – Sobald die untergehende Sonne hinter einer Wolkenwand weit …7 – Als Zen die Bar in der Nähe der …8 – Während der Wartezeit, die Brugnoli ihm auferlegt hatte …9 – Am späten Vormittag ließ Claudia ihren Wagen vorfahren …10 – Zen ging langsam zurück nach Hause, ein zufriedenes …11 – Die altmodische Pendeluhr in ihrem hohen, sargförmigen Kasten …12 – Il Paradiso è all’Ombra delle Spade. Ja …13 – Na, so was, dachte Claudia, das ist ja …14 – Die Tür wurde von einem bärtigen Mann geöffnet …15 – Von den verschiedenen Transportmöglichkeiten, die es von Luca …16 – Das Schlimmste an der ganzen Sache war …17 – Zens Zug sollte kurz nach zwei Uhr morgens …18 – Als das Auto zum ersten Mal vorbeifuhr …19 – Gabriele Passarini!«20 – Zwei Tage später trat Aurelio Zen kurz nach …Mehr über dieses Buch
Über Michael Dibdin
Über Ellen Schlootz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Michael Dibdin
Zum Thema Italien
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Pulchra es amica mea suavis et decora sicut Hierusalem terribilis ut castrorum acies ordinata. Averte oculos tuos a me quia ipsi me avolare fecerunt.
Du bist schön, meine Freundin, lieblich wie Jerusalem, schrecklich wie Heerscharen. Wende deine Augen von mir, denn sie verwirren mich.
Das Hohelied 6:3
1
Ein zäher Nebel hing in den Straßen und gab den Fassaden der Häuser etwas Geheimnisvolles, ließ vertraute Dinge fremd erscheinen und bedeckte die Fenster mit einer feuchten Schicht, die dichter zu sein schien als Wasser. Gabriele versuchte, von der dicken Frau auf dem Sitz neben ihm wegzurücken, die sich an ihrem Handy in den schaurigsten Details über die Darmoperation einer älteren Verwandten ausließ, hatte aber trotzdem nicht genügend Platz, um seine Zeitung bequem aufschlagen zu können. Das Einzige, was er mühelos lesen konnte, war die Überschrift, die sich auf die anhaltenden Feindseligkeiten in einem fernen Land bezog, wo junge Männer töteten und getötet wurden. Während sich draußen dröhnend und kreischend der Verkehr staute, rumpelte die Straßenbahn vorfahrtberechtigt durch die vom Nebel verhüllte Stadt und kündigte ihr Näherkommen in periodischen Abständen mit einem schrillen Klingeln an.
»Allerdings!«, sagte die dicke Frau gerade. »Erst muss ich das Auto bei Pia abholen, falls sie überhaupt schon da ist, was ich bezweifle, und wies dann weitergeht, das wissen die Götter, bei diesem verdammten Nebel.«
Gabriele drückte sich gegen das Fenster und klappte den Kragen seines grünen Lodenmantels hoch, ein symbolischer Versuch, die Frau auszublenden. Er liebte den Nebel, wenn die ganze Welt leiser wurde und alles dicht verhüllt war. Glänzendes wurde matt, Schrilles gedämpft, allem Hässlichen um einen herum wurde regelrecht die Substanz entzogen. Dinge wurden zu bloßen Vorstellungen, die raue Gegenwart zu einer vagen Erinnerung.
Durch eine ähnliche Verschiebung hatten sich auch die Erinnerungen an die zahllosen Nebeltage in seiner Kindheit gewandelt. Die nebulösen Erinnerungen an Krankheit, echt oder vorgetäuscht, an Fieber, Grippe und Übelkeit. »Ich fühle mich nicht gut, Mamma.« Sie hatte ihm immer nur zu bereitwillig geglaubt. Und da er wusste, dass er ihr eine Freude machte, hatte es ihm kaum Gewissensbisse bereitet, wenn er Symptome vortäuschte oder übertrieb. Seine Mutter mochte es, wenn er krank war. Es gab ihr das Gefühl, gebraucht zu werden. Manchmal hatte er sogar den Verdacht gehabt, sie wusste, dass er simulierte, verzieh es ihm aber und ermunterte ihn insgeheim sogar dazu.
Nebel assoziierte Gabriele auch mit der Daunendecke, die seine Mutter aufschüttelte und sanft auf ihn sinken ließ, während die Uhr machtlos verkündete, dass er eigentlich in der Schule sein müsste, bei all diesen Rabauken und Strebern. »Meine Wolke«, hatte er die Decke genannt. Schwerelos und warm, wie sie war, warf er sie zurück, sobald seine Mutter das Zimmer verlassen hatte, um zum Bücherregal zu laufen und sich dort eine Auswahl an Romanen zu holen, die er mit ins Bett nahm, wo er die Wolke wieder über sich zog. Bücher stellten auch eine Form von Nebel dar, der sich herabsenkte, um die maßgebliche offizielle Version der Dinge zu infiltrieren, sie heimtückisch zu unterwandern und damit zu entlarven, dass alles nur Lug und Trug war. Natürlich wusste er, dass die Geschichten erfunden waren, die Figuren nur Marionetten, der Ausgang vorherbestimmt, doch warum erschienen sie dann so viel wirklicher als die Realität? Und warum war außer ihm niemand schockiert über so einen herrlichen Skandal?
Quietschend hielt die Straßenbahn. Die dicke Frau stand auf, immer noch ununterbrochen in ihr Handy redend, trat hinaus auf die Straße und war im gleichen Augenblick verschwunden. Die Türen schlossen sich, und die Bahn setzte sich schwerfällig wieder in Bewegung. Nun, wo der Sitz neben ihm frei war, breitete Gabriele seine Zeitung aus und überflog rasch die aktuellen außen- und innenpolitischen Berichte. Wie so oft fiel ihm dabei ein Ausspruch seiner Mutter über Essensreste ein. »Tu einfach irgendwas Neues dazu, dann kannst dus noch einmal servieren.«
Hier in der Altstadt schien der Nebel noch dichter zu sein, viel realer als die vagen Andeutungen von Stein und Glas, die ab und zu trübe im Dunst auftauchten und wieder verschwanden. Gabriele wandte sich den Cronaca-Seiten zu und las etwas über einen Familienstreit mit tödlichem Ausgang in Genua, einen Drogentoten in Turin und die Entdeckung einer Leiche in einem stillgelegten Militärtunnel hoch oben in den Dolomiten.
Die Straßenbahn fuhr langsam auf die nächste Haltestelle zu, die letzte Station vor der, an der er aussteigen musste. Gabriele legte die Zeitung zusammen, knickte sie so, dass sie fest und handlich war, schob sie in die Manteltasche und stieg mit sieben weiteren Fahrgästen aus. Einen Hustenanfall vortäuschend, wartete er an der Haltestelle, bis sich die Leute im Nebel zerstreut hatten. Derweil zockelte die hell erleuchtete Straßenbahn davon und ließ ihn halb blind in den weißen Nebelschwaden zurück.
Er überquerte die Straße, um auf den Bürgersteig zu gelangen. Dabei musste er einem Auto ausweichen, das viel näher war, als die Lichter den Anschein erweckt hatten. Dann ging er unsicher in die Richtung, in die die Bahn gefahren war, blieb dabei immer wieder stehen, um sich lauschend umzusehen und in die schwere Luft zu schnuppern. Nach wenigen Blocks tauchte ein Café auf, das in aller Eile aus ein paar Stücken Glanz und Schimmer zusammengeschustert zu sein schien. Gabriele blieb kurz stehen, dann stieß er die Tür auf.
Er war noch nie an dieser Haltestelle ausgestiegen, noch nie in diesem Café gewesen. Deshalb war es nur natürlich, dass er die Räumlichkeiten, die Einrichtung und vor allem die Kundschaft mit lebhaftem Interesse betrachtete. Er musterte die anderen Gäste gründlich, insbesondere diejenigen, die nach ihm hereinkamen. Als man seinen Cappuccino und sein Brioche vor ihn hinstellte, ging er damit bis ans äußerste Ende der Marmortheke, wo diese in einem Bogen an die Wand stieß. Von dort konnte er den gesamten Raum überblicken, nicht nur den Eingang. Die Gäste schienen genau die Sorte Leute zu sein, die man in dieser Art Café in dieser Gegend von Mailand um diese frühe Stunde erwartete: solide, professionell, gut betucht und mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie standen zu zweit oder in größeren Gruppen beieinander, und niemand schenkte ihm die geringste Aufmerksamkeit.
Gabriele nahm die Zeitung aus seiner Tasche, faltete sie verstohlen auf und las den Artikel noch einmal. Dann warf er sie in den Mülleimer und wischte sich die Hände an einer Papierserviette ab, die er aus dem metallenen Spender auf der Theke gezogen hatte. Wer hätte das gedacht? Nach all den Jahren.
Wären da nicht die Postkarten gewesen, wäre es ihm mittlerweile vielleicht gelungen, die Sache zu vergessen. Abgesehen von dem einen Mal, als ein Journalist von einer kommunistischen Zeitung unter dem Vorwand, ein Buch kaufen zu wollen, zu ihm gekommen war und nach Leonardo gefragt hatte. Doch Gabriele war ihn ganz schnell wieder losgeworden.
Das mit den Postkarten fing in dem Jahr an, nachdem Gabriele seinen Abschied genommen hatte. Seitdem waren sie regelmäßig jedes Jahr gekommen, egal wo er zu der Zeit gerade wohnte, alle in Rom abgeschickt und mit dem Poststempel des Jahrestages versehen, an dem Leonardo gestorben war. Seit 1993 kamen sie im Laden an. Es war immer die gleiche billige Touristenansichtskarte der Loggia dei Lanzi in Florenz mit dem Bild von Cellinis Bronzestatue des Perseus, der das abgeschlagene Haupt der Medusa hält. Gabrieles Name und Adresse waren auf die linke Hälfte der Rückseite gedruckt. Der Raum, der für eine Nachricht vorgesehen war, wurde immer frei gelassen.
»Wir sollten jetzt besser gehen«, sagte einer der Männer an der Theke. »Sie warten sicher schon auf uns.«
Und sie würden auch auf ihn warten, dachte Gabriele. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht im Laden, dann zu Hause. Was die Sache noch schlimmer machte, war, dass er keine Ahnung hatte, wer »sie« waren. Medusa war etwas, das er seit Langem hinter sich gelassen hatte. Er hatte sich sogar die Tätowierung entfernen lassen, ein chirurgischer Eingriff, der ihn eine Menge Geld gekostet und ihm einige kleinere Beschwerden beschert hatte. Alles, was er je über die Organisation gewusst hatte, waren die Namen der drei anderen, die zu seiner Zelle gehörten. Aber es musste doch außer ihnen noch viel mehr gegeben haben, und über dem Ganzen eine allumfassende Kommandostruktur, die zweifellos bis hoch in die militärische und politische Hierarchie hinein reichte. Vor einigen Jahren hatte er aus einem Artikel in der Zeitung erfahren, dass Alberto – jetzt Oberst – Guerrazzi mittlerweile ein hohes Tier beim Geheimdienst war. Solche Leute hatten eine unvorstellbare Macht. Wenn sie sich dadurch bedroht fühlten, dass möglicherweise die Wahrheit über Leonardos Tod ans Licht kam – und das taten sie zweifellos –, würden sie vermutlich sofort präventiv eingreifen – und völlig unberechenbar.
Draußen hatte der Nebel kein bisschen nachgelassen. Gabriele schlüpfte in den ersten Hauseingang, an dem er vorbeikam, und blickte zurück. Niemand kam aus dem Café, das er gerade verlassen hatte. Mit gesenktem Kopf ging er langsam weiter, scheinbar darauf bedacht, nicht zu stolpern und Hindernissen auszuweichen. Ein munteres Klingeln kündigte eine weitere Straßenbahn an. Sie kam quietschend an der Haltestelle zum Stehen, an der er normalerweise jeden Morgen ausstieg. Er wartete, bis sich die Gruppe von Pendlern zerstreut hatte, dann ließ er seinen Blick forschend die Straße entlangschweifen. Die Geschäfte im Erdgeschoss des großen Palazzo aus dem 18. Jahrhundert waren gerade dabei zu öffnen. Es waren hauptsächlich Läden für Mode und Accessoires, dazwischen ein Schmuckhändler, ein Friseursalon und der antiquarische Buchladen, der ihm gehörte. Bisher waren nur wenige Leute unterwegs und keine offenkundigen Beobachter, doch er wusste, dass das nichts zu bedeuten hatte. Als er merkte, dass er sich selbst auffällig verhielt, wandte er sich nach links und begann, um den Block zu gehen.
Ich bin nicht gut in so was, dachte er. Nie gewesen, und werde es nie sein. Er hatte sich wirklich sehr bemüht, doch er konnte machen, was er wollte, er war halt kein Naturtalent wie Alberto, Nestore oder der arme Leonardo. »Nicht gerade das Zeug zum Offizier.« Diese Bemerkung hatte er nie vergessen. Sie hatte ihn getroffen, obwohl Offizier eigentlich das Letzte war, was er werden wollte, wenn er ehrlich mit sich selbst gewesen wäre. Aber im Grunde war es ohnehin egal gewesen. Es wurden ein paar Fäden gezogen, Beziehungen spielen gelassen, und er bekam sein Patent trotzdem, dank des Einflusses seines Vaters, was dieser ihn natürlich immer hatte spüren lassen.
Doch jener Ausbilder an der Militärakademie hatte recht gehabt. Gabriele hatte nicht das Zeug zum Offizier. Zwar konnte er Befehle gehorsam wie ein Hund befolgen, doch er vermochte es nicht, sie in einer Weise zu erteilen, die bei anderen den gleichen blinden Gehorsam erzeugte. Noch nicht mal bei ihm selbst. Vor allem fehlte ihm die Fähigkeit, geschickt zu improvisieren, wenn die Situation kritisch wurde und kein Vorgesetzter in der Nähe war, der ihm sagte, was zu tun war. So wie jetzt.
Was sollte er bloß tun? Wo sollte er hin? Seit Monaten hatte er nicht mehr mit seiner Schwester gesprochen, und außerdem würden sie ihn dort ganz schnell finden. Das Gleiche galt für die wenigen engen Freunde, die er hatte, selbst wenn er ohne eine Erklärung bei einem von ihnen unterkommen könnte. Eine Reise ins Ausland war zwar verführerisch, doch dazu brauchte man Kreditkarten, einen Ausweis und alles Mögliche, eine Papierspur, die sich leicht verfolgen ließ. Am besten wäre es, einfach zu verschwinden, bis sich die Lage geklärt hatte.
Mit vorgetäuschter Zielstrebigkeit schritt er durch die dichten Nebelschwaden. Als ein weiteres Café vor ihm auftauchte, ging er kurz entschlossen hinein und bestellte einen Whisky. Gabriele trank nur selten, und niemals vor dem Mittagessen. Er kippte den widerlich schmeckenden Alkohol in sich hinein wie Medizin und starrte sein Konterfei im Spiegel hinter der Bar an. Wie immer war er überrascht über seinen robusten, drahtigen Körper und den entschlossenen Blick. Er selbst empfand sich als schmächtig, klein, gebrechlich und absolut unzulänglich. Das Leben hatte sich bei ihm den Scherz erlaubt, eine solche Persönlichkeit in den Körper eines professionellen Weltergewichtsboxers zu stecken. In der Schule und später auf der Akademie hatte ihn das davor bewahrt, zusammengeschlagen zu werden, doch selbst jene Siege empfand er als hohl, als hätte er sie auf betrügerische Weise errungen. Und anders als die Männer hatten die Frauen in seinem Leben sich nie täuschen lassen. Ganz im Gegenteil, diejenigen, die es länger als ein bis zwei Wochen mit ihm aushielten, hatten ihn gerade wegen jener Schwäche geliebt, die sie so scharfsinnig diagnostizierten. Auch wenn es für eine Weile schön gewesen war, wieder bemuttert zu werden, so war es ihm am Ende doch wie eine weitere Niederlage erschienen.
Außerdem hatten sie alle richtige Mütter sein wollen, und er hatte nicht die Absicht, dazu beizutragen, dass dieselbe erbärmliche und traurige Farce von Neuem ablief. Hippolyte Taine, dessen gesammelte Werke Gabriele gerade las, hatte erbarmungslos wie immer den Nagel auf den Kopf getroffen: »Drei Wochen Flirt, drei Monate Liebe, drei Jahre Streit, dreißig Jahre Zusammenraufen, dann fangen die Kinder wieder von vorne an.« Das sollte ihm nicht passieren. Außerdem könnte es ja ein Junge werden. Und was er an Vater-Sohn-Konflikten erlebt hatte, reichte ihm für mehrere Leben. Die Frauen hatten das gespürt und sich jemand anderes gesucht, und mittlerweile hatte Gabriele jegliches Interesse an der ganzen Sache verloren. Wenn man keine Kinder wollte, was hatte das dann für einen Sinn? Auch erschien ihm in seinem Alter Sex leicht eklig und dumm, und wie die Gesellschaft heutzutage auf Sex fixiert war, fand er deprimierend und krank. Aus diversen Bemerkungen, die seine Mutter von Zeit zu Zeit hatte fallen lassen, war das zumindest eine Sache, die er mit seinem Vater gemein hatte.
Das Café füllte sich allmählich. Es war klein und ziemlich abgerissen für diese Gegend, die Klientel eine ganz andere als in dem vorherigen Lokal: Händler, Straßenkehrer, Kuriere, Polizisten, Rentner, Hausmeister …
Es dauerte einen Moment, bis ihm die rettende Idee kam. Dann war Gabriele auch noch schlau genug, nicht sein Handy zu benutzen. Der Münzfernsprecher befand sich im hinteren Teil des Cafés, dort wo Tische und Stühle in einen Bereich übergingen, in dem sich Mineralwasserkästen stapelten, Kartons mit Chipstüten herumstanden, unbenutztes Werbematerial und eine kaputte Eistruhe, deren Deckel aufstand. In der Nähe hing eine gerahmte Luftaufnahme in Schwarz-Weiß an der Wand. Sie zeigte eine Kleinstadt irgendwo im Schwemmland südlich von Mailand, vielleicht Crema oder Lodi. Das Foto musste kurz nach dem Krieg aufgenommen worden sein, denn außerhalb der Stadtmauer gab es nur wenig Bebauung, lediglich ein paar Einfamilienhäuser und den Bahnhof. Dahinter erstreckte sich die endlose Weite, von unbefestigten Straßen wie mit schwachen Linien durchzogen. Dazwischen waren hier und da wie Punkte abgelegene Cascine zu erkennen, jene im rechten Winkel angelegten Bauernhöfe, die charakteristisch für die Po-Ebene sind.
Er stand dort mit dem Hörer in der Hand und starrte auf die Fotografie. Nach einer Weile verwandelte sich das Amtszeichen in ein zorniges Kreischen. Gabriele legte kurz auf, warf dann eine Münze ein und wählte neu. Jetzt wusste er, was er tun musste, und es könnte sogar funktionieren.
»Pronto.«
»Fulvio, hier ist Gabriele Passarini.«
»Salve, dottore.«
»Erinnern Sie sich noch, wie ich mich vor Jahren mal aus dem Laden ausgesperrt habe?«
Ein kurzes Lachen. »Haben Sie es wieder geschafft?«
»Ich habs wieder geschafft. Und ich möchte, dass Sie genau das tun, was Sie das letzte Mal getan haben. Verstehen Sie?«
»Sie meinen, ich soll runtergehen …«
»Ja, ja! Genau wie beim letzten Mal. Ich warte auf Sie.«
Kurzes Schweigen. Als Fulvio schließlich sprach, klang seine Stimme nervös, vielleicht weil Gabriele sich so dringlich angehört hatte. »In Ordnung, Dottore. Ich hab zwar heute Morgen wahnsinnig viel zu tun, aber …«
»Es soll nicht zu Ihrem Schaden sein.«
Er hängte ein, wischte die Hände an seinem Mantel ab und kehrte an die Bar zurück, wo er einen Kaffee bestellte. Den trank er sofort aus, zahlte die Rechnung und verließ das Café.
Fulvio wartete bereits an der Tür auf ihn. Der Hausmeister war ein hagerer, gebeugter Mann mit einem permanent überraschten Gesichtsausdruck. Der war auf den Verlust seiner Augenbrauen bei einem Arbeitsunfall zurückzuführen, was ihm ein leicht dümmliches Aussehen gab. Doch in Wirklichkeit war Fulvio die maßgebliche Person, wenn nicht sogar die treibende Kraft hinter allem, was im Gebäude passierte. Gabriele hatte das sehr früh erkannt und sich stets große Mühe gegeben zu signalisieren, dass er die Sache durchschaute und zu schätzen wusste – jedes Jahr zu Weihnachten einen Panettone aus einer der besten Konditoreien der Stadt, Pralinen für seine Frau zum Geburtstag und gelegentlich ein gut bemessenes Trinkgeld.
Der Hausmeister winkte Gabriele herein, dann zog er die rostige Eisentür zu und schloss sie wieder ab. Eine schwache Glühbirne beleuchtete die steile Treppe, die in den Keller führte.
»Hat sich irgendwas getan?«, fragte Gabriele beiläufig, womit er auf die Floskel zurückgriff, die sich zwischen ihnen für diese Art Gespräch eingespielt hatte.
Fulvio seufzte tief. Nachdem Gabriele am Telefon so offenkundig erregt geklungen hatte, schien der Hausmeister jetzt froh, zum gewohnten Thema zurückkehren zu können. »Was soll ich Ihnen sagen? Signora Nicolai hatte letzte Woche wieder einen leichten Herzanfall, aber sie hat sich inzwischen erholt und wird uns sicher noch alle überleben. Pasquino und Indovina gehts eigentlich unverändert, und die Familie Gambetta streitet sich immer noch darüber, wer was von ihrem Onkel erben soll. Aber ich versichere Ihnen, Dottore, früher oder später wird hier eine Wohnung frei.«
»Aber vermutlich nicht mehr zu meinen Lebzeiten.«
»Eh, eh, eh!«
Sie gingen die Treppe hinunter und einen schmalen Gang entlang, der in einen höhlenartigen Raum voller dunkler unförmiger Gebilde führte, deren Zweck in dem wenigen fahlen Licht, das durch die offenen, vergitterten Fenster in Straßenhöhe drang, nicht zu erkennen war. Fulvio wählte einen weiteren Schlüssel aus seinem Bund und schloss eine Tür an der hinteren Wand auf. Er knipste eine schwache Lampe an, und sie durchschritten ein weiteres unterirdisches Gewölbe, in Form und Größe ähnlich dem ersten, nur dass es hier stark nach Kohle roch. Der Boden knirschte unter ihren Füßen, während sie auf eine Treppe in einer Ecke des Raumes zusteuerten, die wieder hinauf ins Haus führte.
Sie hatten etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt, da ging das Licht aus. Die unerträgliche Erinnerung an Schreie, Bitten und Flüche stieg in Gabriele auf. »Du würdest genauso schreien, wenn das mit dir geschähe«, hatte er damals gedacht. Das war das Schlimmste an der ganzen Sache gewesen, die Art und Weise, wie sie Leonardo – den »jungen Priester«, wie Nestore ihn scherzhaft genannt hatte, weil er sich nicht für Frauen zu interessieren schien – auf die unterste Stufe des Menschseins herabgesetzt hatten. Man konnte Menschen bereits zerstören, bevor man sie tötete, und er war Komplize bei einer solchen Zerstörung gewesen und auch beim Akt des Tötens selbst. Vor diesem Grauen hatte es nie ein Weglaufen gegeben, nur Vergessen. Doch Vergessen war jetzt nicht mehr möglich, denn die anderen Beteiligten würden es auch nicht vergessen.
»Dottore?«
Der Widerhall im Raum verlieh Fulvios Stimme eine ungewohnte Autorität, doch als Antwort kam nur ein pfeifendes Atmen, das den Hausmeister an das Geräusch des Blasebalgs erinnerte, den sie benutzt hatten, um den Hochofen anzufachen, damals, als er als Lehrling in der Gießerei angefangen hatte. Er wühlte in seiner Tasche, fand sein Feuerzeug und ließ mit einem Klicken die Flamme auflodern. »Dottore?«
Mit Mühe gelang es Gabriele, den Panikanfall unter Kontrolle zu bringen. Die Schreie verstummten, die grausigen Details verschwanden, und die nackten Felsen verwandelten sich wieder in gemauerte Kellerwände. »Alles in Ordnung«, sagte er.
»Hier ist die Treppe. Folgen Sie mir.«
Sie stiegen die Treppe hinauf und gingen einen kurzen Flur entlang. Nach einigem Gefummel mit Schlüsseln und Feuerzeug schloss Fulvio am anderen Ende eine weitere Tür auf und fiel prompt hin. »Porca Madonna!«
Das Feuerzeug verlosch. In dem Raum hinter der Tür war es dunkel, doch Gabriele ging sicheren Schrittes weiter und nahm seine Schlüssel heraus. Jetzt wusste er, wo er war. Er trat über den am Boden liegenden Hausmeister sowie über den Mopp samt Putzeimer, über den Fulvio gestolpert war, schloss die Innentür auf und öffnete sie. Durch das vor dem Schaufenster heruntergelassene Stahlgitter fiel gerade genug Licht in den Laden, dass man etwas sehen konnte. Inzwischen hatte sich auch Fulvio wieder aufgerafft und tastete nach dem Lichtschalter neben der Tür. Gabriele packte ihn am Arm. »Nein!«
Der Hausmeister sah ihn mit einem erstaunten Blick an, der nichts mit den fehlenden Augenbrauen zu tun hatte. »Kein Licht?«, flüsterte er.
Gabriele schüttelte den Kopf.
»Aber warum denn nicht? Und was soll das Ganze überhaupt?« Fulvio, der sich bei dem Sturz wehgetan hatte und sich verschaukelt fühlte, klang jetzt verärgert. »Sie hatten Ihre Schlüssel ja doch! Was sollte denn dieses Theater? Was ist los?«
Gabriele stand nun mitten im Raum und ließ seinen Blick über die dicht an dicht stehenden Buchrücken schweifen. Ihre dezenten, aber erlesenen Farbtöne schienen die Luft mit leiser Orgelmusik zu erfüllen.
Eine Hand zerrte ihn am Ärmel. »Ich verlange eine Erklärung, Dottore!«
Gabriele legte einen Finger auf seine Lippen. »Alles zu seiner Zeit, Fulvio.« Er war jetzt ganz ruhig, fühlte sich stark und sicher. Er kannte jeden einzelnen Band und hätte von dort, wo er stand, Autor, Titel, Auflage, Erscheinungsjahr und Verlag nennen können. Wenn er doch einfach hier bleiben könnte. Hätte er doch nur oben im Haus eine nette Wohnung, in der er schlafen und sich ab und zu duschen und umziehen könnte, dann hätte er zu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, herunterzukommen und mit seinen Büchern Zwiesprache zu halten!
Er ging zum Safe, der sich hinter dem Schreibtisch befand, von dem aus er normalerweise die sich immer wiederholenden Rituale im Laden lenkte. Der Hausmeister schlurfte unschlüssig herum und murmelte leise vor sich hin. Gabriele drehte am Zahlenrad, um die erforderliche Kombination einzugeben, und zog behutsam die schwere Tür auf. Während er Fulvio den Rücken zukehrte, steckte er rasch ein Bündel Geldscheine in die Tasche.
»So geht das aber wirklich nicht«, sagte der Hausmeister mehrmals mit gekränkter Stimme. »Bei allem Respekt, Dottore, Sie sind mir eine Erklärung schuldig.«
Gabriele schloss den Safe wieder, dann beugte er sich über seinen Schreibtisch und schrieb rasch etwas auf eine Karte. Mit einem letzten Blick auf die Regale richtete er sich auf und ging zu Fulvio zurück. Dabei zog er zwei Geldscheine aus dem Bündel in seiner Tasche und hielt sie ihm hin. »Hier ist Ihre Erklärung«, sagte er. »Ich bin vielleicht für längere Zeit nicht da. Wenn ich zurückkomme, zahle ich Ihnen das Gleiche für jede Woche, die ich fort war. Als Gegenleistung möchte ich, dass Sie ein wachsames Auge auf den Laden werfen, besonders auf die Leute, die vorbeikommen und nach mir fragen. Halten Sie Daten, Aussehen und Namen fest, sofern sie einen nennen, und vor allem, was sie sagen. Außerdem möchte ich Sie noch bitten, das hier an die Schaufensterscheibe zu kleben, sobald ich weg bin.«
Er gab dem Hausmeister die Karte, auf die er etwas geschrieben hatte. Unter Namen und Logo der Buchhandlung stand in Druckbuchstaben Chiuso per lutto.
Fulvio sah ihn nun wieder mit Verständnis, Mitgefühl und Respekt an. »Sie sind in Trauer, Dottore? Ein Todesfall in der Familie?«
Gabriele lächelte fast unmerklich. »Ja«, sagte er. »Ja, darauf läuft es wohl hinaus.«
2
Ich nehme an, du hast von dieser furchtbaren Sache gehört?«
Riccardo war gerade mit einem Stapel Teller in der Hand in die Küche gekommen und blickte verlegen um sich, wie er es immer tat.
»Was für eine Sache?«, fragte Claudia und befreite ihn von seiner Last.
Er antwortete nicht sogleich, sondern wandte sich um und schloss die Tür zum Wohnzimmer. Das hatte er noch nie getan. Für einen Moment fragte sie sich …
Aber das war doch Unsinn. Schließlich war das nur Ricco, und außerdem waren diese Zeiten längst vorbei. Sie stellte die Teller auf die Spüle und sah ihn leicht ungehalten an. Diese geselligen Nachmittage mit den Zuccottis liefen auf beruhigende Weise nach einem festen Muster ab, das nichts durcheinanderbringen konnte. Die einzig erlaubte Unregelmäßigkeit war der Ausgang der Kartenspiele, und selbst dabei gewannen sie und Danilo fast immer.
»Wovon redest du?«
Die Frage schien den armen Riccardo noch unsicherer zu machen. Und als schließlich die Antwort kam, war es nur ein unzusammenhängendes Gestotter, wie eine völlig verängstigte Liebeserklärung. »Dieser Tote. Leiche, meine ich. In den Bergen … Was für eine furchtbare Geschichte.« Er rieb sich hilflos die Hände. »Sie hat dreißig Jahre dort gelegen, heißt es.«
Claudia rümpfte angewidert die Nase. »Es kam was darüber in den Nachrichten. Natürlich ist das furchtbar. Aber warum erzählst du mir das?«
Riccardo blickte auf den Fußboden, zur Spüle, dann aus dem Fenster auf die Dächer von Verona, überallhin, nur nicht zu ihr. Es sah beinah so aus, als würde er gleich anfangen zu weinen, und plötzlich war die Antwort auf ihre herzlose Frage ganz offenkundig. Er musste das Opfer gekannt haben, oder zumindest die Familie. Von einem Gefühl der Reue ergriffen, trat sie auf ihn zu, nahm seine Hand und streichelte sie sanft. »Es tut mir ja so leid«, sagte sie.
In diesem Augenblick ging die Tür auf, und Raffaela kam herein. »Oh!«
Sie stellte die Kaffeekanne hin, die sie als Vorwand mitgebracht hatte. Auch das war neu. Wenn sie sich bei den Zuccottis trafen, deckte Raffaela den Tisch, und Danilo half ihr beim Abräumen. Hier bei Claudia machten sie und Riccardo die ganze Arbeit. Und wie beim Kartenspielen losten sie nie die Partner aus.
»Ich hoffe, ich störe nicht!«, fuhr Raffaela in neckischem Ton fort.
»Natürlich nicht!«, antwortete ihr Mann unwirsch. Von nervösem Zögern war bei ihm nun nichts mehr zu spüren. »Ich wollte bloß …«
Er verstummte.
»Ricco hat mir gerade von der furchtbaren Sache mit dem Bergsteiger erzählt, den man tot in dieser Höhle in der Nähe von Cortina gefunden hat. Ich wusste nicht, dass ihr beide persönlich davon betroffen seid. Das tut mir ja so leid.«
Raffaela Zuccotti sah sie mit einem Blick an, der klar zu verstehen gab, wenn sie, Claudia, auch nur einen Augenblick meinte, dass sie, Raffaela, auf eine so offenkundig fadenscheinige Ausrede hereinfallen würde, irrte sie aber gewaltig. Dann blickte sie mit beredtem Schweigen ihren Mann an.
»Ich dachte, es könnte vielleicht jemand sein, den Claudia gekannt hat«, sagte Riccardo kläglich.
»Einen toten Bergsteiger?«, fragte seine Frau zynisch.
»Man weiß nicht, wer er war. Er wurde von einer Gruppe österreichischer Bergsteiger gefunden. Das heißt, eigentlich waren es Höhlenforscher.«
Dank ihrer dreißigjährigen Tätigkeit als Lehrerin an einem Liceo classico war Raffaela keineswegs auf den Mund gefallen. »Ob sie nun Gipfel oder Höhlen erkundet haben«, sagte sie mit einem ostentativen Blick auf Claudias üppige Formen, »jedenfalls versteh ich nicht, warum sich irgendwer von euch darüber aufregen sollte.«
Claudia lachte betont ungezwungen. »Um Himmels willen, Raffaela! Das Ganze war doch nur ein Missverständnis. Ricco erwähnte diese Meldung aus den Nachrichten, und ich hab aus irgendeinem Grund gedacht, er hätte den armen Mann gekannt. Ich wollte ihm nur mein Mitgefühl zeigen, weiter nichts.«
Sie ließ die beiden einfach stehen und kehrte ins Wohnzimmer zurück, wo Danilo am Couchtisch saß und gedankenverloren die Karten mischte. Claudia ließ sich neben ihn aufs Sofa sinken und begann einen ausführlichen Monolog über den jüngsten Prominentenskandal. Dies geschah in einem fast unhörbaren Flüstern, und sie schenkte den Zuccottis keinerlei Beachtung, als sie aus der Küche kamen.
»Vielen, vielen Dank, Cara!«, rief Raffaela, die wie gewohnt die Situation in die Hand nahm. »Alles war perfekt wie immer. Wir haben es sehr genossen, aber jetzt müssen wir wirklich gehen. Sieht nach Regen aus, findet ihr nicht? Komm, Ricco.«
Ihr Mann bot einen äußerst merkwürdigen Anblick. Er starrte Danilo auf eine Weise gebannt an, die sich Claudia nicht erklären konnte.
»Riccardo!«, drängte seine Frau.
»Certo, sì. Arrivo. Anzi, andiamo. Cioè …«
Claudia deutete ein Winken an und lächelte.
Als sich die Wohnungstür endlich hinter ihren Gästen schloss, stand Claudia vom Sofa auf. »Ich zieh mir was Bequemeres an«, sagte sie, drehte sich um, ging aber nicht.
Gehorsam stand Danilo auf und zog den Reißverschluss an ihrem Kleid auf. Während Claudia durch den Flur ging, der ins Schlafzimmer führte, rutschte ihr das Kleid bereits über die Schultern bis zur Taille. Ohne die Tür zu schließen, hakte sie ihren Büstenhalter auf und ließ ihn mit einem leisen Seufzen zu Boden fallen. Sie trat die Schuhe von sich und zwängte sich aus dem Kleid, dann zog sie die Strümpfe aus und öffnete das verhasste Mieder. Fröhlich trällernd stieg sie über die achtlos hingeworfenen Kleidungsstücke und schlüpfte in etwas Seidiges wie in eine jüngere Haut.
»Was sollte das denn nun wieder?«, bemerkte sie, als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte.
Danilo stand jetzt vor dem Sideboard, das mit Fotos von Claudias Sohn Naldo in jedem Alter von der Geburt bis zwanzig vollgestellt war. Er mischte immer noch nervös die Karten.
»Raffaela scheint das Leben schrecklich schwer zu nehmen, Poverina. Nicht dass Altwerden für irgendeinen von uns einfach wäre, aber stell dir mal vor, man hat sich vierzig Jahre auf Dauerdiät gesetzt mit diesem grässlichen Riccardo und stellt plötzlich fest, dass die Uhr abgelaufen ist. Das muss so sein, als wäre man mit einer tödlichen Krankheit ans Bett gefesselt und hätte vorher nie etwas Aufregendes gemacht, wäre nie irgendwo gewesen.«
»Während du von Bett zu Bett gehüpft bist, alles gemacht hast und dich nie irgendwelchen Einschränkungen unterworfen hast.«
Claudia wickelte den knöchellangen Hausmantel locker um sich und ließ ihr erprobtes Lachen hören. »Also ehrlich, was du so von dir gibst! Ich habe mich immer vorbildlich verhalten, solange Gaetano am Leben war.«
Danilo zog ironisch eine Augenbraue hoch.
»Ich meine, ich hab nie jemanden aus unseren Kreisen gebumst«, entgegnete Claudia in scharfem Ton. »Was kann man mehr verlangen?«
Danilo wollte anscheinend nichts Genaueres wissen und nichts dazu sagen. Aber er machte auch keinerlei Anstalten zu gehen. Eine weitere kleine Anomalie. Die häuften sich an diesem Tag.
»Möchtest du noch ein Stück Kuchen?«, fragte Claudia ihn betont freundlich. »Oder noch einen Kaffee?«
Danilo legte die Karten hin und sah sie an. Er schien etwas sagen zu wollen, dann fing er auf seine typisch jungenhafte Art schallend an zu lachen, was Claudia jedes Mal bezaubernd fand, obwohl sie wusste, dass er dieses Lachen auf Wunsch produzieren konnte, wann immer es ihm passte.
»Warum lachst du?«, fragte sie.
»Mir fiel gerade eine Bemerkung von Gaetano übers Kartenspielen ein. Wusstest du, dass sich unsere Karten von den in allen anderen Ländern gebräuchlichen unterscheiden? Nicht nur in den Bildern, sondern bei uns gibt es nur vierzig Karten, weil die Zehnen, Neunen und Achten fehlen. Gaetano war der Meinung, dies stehe symbolisch für alles, was mit dem italienischen Militär nicht stimme. Fast ein Drittel der gesamten Streitkräfte bestünde aus höheren Offizieren, und der Rest wäre Kanonenfutter. Die Ersteren wären nicht immer dumm, und die Letzteren häufig tapfer, doch es fehle ein solides, zuverlässiges Korps von Sottuficiali, die die gesamte Truppe zusammenhalten und dafür sorgen, dass die große Masse ihre Arbeit tut. Deshalb hätten die Deutschen den Krieg durchgehalten, selbst nach Stalingrad und der Normandie. Ihre Unteroffiziere waren angeblich die besten der Welt.«
»Ja, Gaetano konnte einen mit militärischen Dingen ziemlich langweilen«, antwortete Claudia träge. »Aber bei ihm musste ich das ertragen. Schließlich war er mein Mann. Von dir muss ich mir das nicht bieten lassen.«
Danilo sah sie an, als versuche er, ihr irgendetwas zu ersparen. Ein unbehagliches Schweigen breitete sich aus.
»Nun ja, ich glaub, ich nehm jetzt ein Bad«, kündigte Claudia schließlich mit forscher Stimme an und steuerte auf den Flur zu. »Wenn du gehen willst, mach einfach die Tür hinter dir zu.«
Danilo folgte ihr, packte sie am Handgelenk und zog sie zurück ins Zimmer. Verblüfft und beinah ein bisschen erregt ließ Claudia sich von ihm ziehen. Danilo war für sie ein unkomplizierter Freund und Partner beim Kartenspiel, eine unerschöpfliche Quelle für infamen Tratsch, ein Wesen von vielfältigem Charme und unbestimmter Geschlechtlichkeit. Jedenfalls hatte er nie auch nur das geringste körperliche Interesse an ihr gezeigt.
»Ich muss dir was erzählen«, sagte er. »Setz dich. Ich hol dir was zu trinken.«
»Ich trinke nicht.«
»Und ob du das tust, Cara. Das rieche ich von hier. Wermut, würde ich sagen. Von der süßen Sorte.«
Ihre Schultern hingen herab, und sie wusste, dass ihr Hausmantel in unziemlicher Weise aufstand und ihr halber Busen zu sehen war, doch das kümmerte sie am allerwenigsten. Danilo öffnete hektisch die Türen des Sideboards und schloss sie wieder.
»In der Küche«, erklärte sie ihm. »Über der Spüle.«
Claudia öffnete eine silberne Dose, die rein dekorativ aussah, und nahm sich gerade eine der seltenen Zigaretten, die sie sich gestattete, als Danilo mit einem Becherglas zurückkam, das fast bis zum Rand mit Cinzano Rosso gefüllt war. Mit einer einzigen fließenden Bewegung – so hatte es den Anschein – schaffte er es, ihr das Glas zu reichen und gleichzeitig mit seinem Feuerzeug Feuer zu geben.
»Also?«, fragte sie mit unüberhörbarem Sarkasmus in der Stimme. Was auch immer hier ablief, es zog sich bereits viel zu lange hin.
Es kam keine Antwort. Danilo stand einfach nur da und starrte in die Luft. Claudia trank einen großen Schluck von der roten Flüssigkeit, die noch widerlicher schmeckte als sonst. Aber immerhin war Cinzano ein Getränk für Damen. Sie könnte einige Frauen nennen, die zu Gin und Wodka übergegangen waren und nie zurückgefunden hatten.
»Danilo, in all den Jahren, die wir uns kennen, hast du mich zum Lachen gebracht und zum Weinen. Und du hast mich wütend gemacht. Ein- oder zweimal hast du mich sogar zum Nachdenken gebracht. Nun fängst du an, mich zu langweilen. Ich hätte nie gedacht, dass das je passieren könnte. Wenn du mir etwas zu sagen hast, dann sag es um Himmels willen!«
Danilo lächelte nervös. »Tut mir leid, ich weiß bloß nicht, wie ich anfangen soll. Eigentlich sollte Riccardo das übernehmen. Er hatte genügend Zeit, die ganze Sache zu durchdenken und sich zu überlegen, wie er es am besten rüberbringen könnte. Doch Raffaela ist dazwischengekommen und hat ihn nach Hause gezerrt. Deshalb muss ich nun in die Bresche springen. Wie dem auch sei, es hat im Wesentlichen mit dieser Leiche zu tun, die man letzte Woche in den Bergen gefunden hat.«
»Das ist mir schon klar. Aber was um Himmels willen ist denn damit los?«
Er nahm drei vergebliche Anläufe anzufangen, dann breitete er flehend die Arme aus. »Wie viel hat Ricco dir erzählt?«
»Nichts. Er wollte gerade zum Thema kommen, da kam Raffaela wie ein Ehedrachen auf Kontrollgang hereinmarschiert.«
Offensichtlich erleichtert, nutzte Danilo den kleinen Scherz und lachte. »Ach ja, ich verstehe! Also, die Sache ist die, die Identität der Leiche ist zwar noch nicht offiziell festgestellt worden, doch dem Regiment nahestehende Quellen in Rom haben diverse Personen hier über gewisse diesbezügliche Tatsachen informell in Kenntnis gesetzt. Von denen haben wiederum einige Riccardo informiert, der hat es mir erzählt, und wir sind beide darin übereingekommen, dass es besser wäre, wenn du es als Erstes von uns erfährst.«
»Was erfährst, um Gottes willen?«
Danilo zögerte erneut, dann preschte er los wie ein Pferd, das über einen Zaun springen will: »Leonardo Ferrero.«
Claudia rührte sich nicht und sagte auch nichts. Mindestens eine Minute lang zeigte sie überhaupt keine Reaktion. Schock kann durchaus etwas Nützliches sein und äußert sich in unterschiedlichster Weise. Jenen Namen aus Danilos Mund zu hören, war, als hörte man einen Pudel den geheimen Namen Gottes aussprechen.
Sie beugte sich vor, um die Asche von ihrer Zigarette zu schnippen, dann stand sie langsam auf und blickte sich verwirrt um wie jemand, der auf der Heimfahrt von der Arbeit im Bus eingeschlafen ist, und als er aufwacht, feststellt, dass er sich in einem fremden Land befindet.
Danilo hustete. »Soweit ich weiß, hast du ihn gekannt.«
Claudia lächelte heiter, als sähe sie die Sache nun klar. »Leutnant Ferrero? Natürlich hab ich ihn gekannt. Er war einer von Gaetanos Günstlingen. Aber das ist alles sehr lange her.« Endlich schien sie Danilos Schweigen zu bemerken. »Wieso fängst du denn jetzt davon an?«
»Weil nach den Informationen, die wir erhalten haben, und ich muss betonen, dass die streng vertraulich sind, die vorläufige Untersuchung der Leiche, die man in einem dieser Tunnel oben in den Bergen gefunden hat, nahezulegen scheint, dass es sich um ihn handelt.«
Claudia trat ans Fenster, das zum Hof hinausging. Die Frau in der Wohnung gegenüber hatte ihre Fensterläden geöffnet, was sie nur tat, wenn sie am Abend einen ihrer zahlreichen jungen Liebhaber empfing. Später dann, kurz vor dem entscheidenden Augenblick, würde sie die Läden neckisch wieder schließen. Wenigstens bin ich niemals so tief gesunken, dachte Claudia zerstreut. Mit seinen romantischen Eroberungen zu prahlen, war vulgär. Sie rauchte ihre Zigarette zu Ende, öffnete das Fenster und warf den Rest hinaus. »Das ist doch absurd«, sagte sie und drehte sich wieder zu Danilo um. »Leutnant Ferrero ist vor dreißig Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Eine Explosion im Benzintank. Gaetano und ich waren auf der Beerdigung.«
»Ich auch. Und wir haben das natürlich alle geglaubt. Aber anscheinend stimmte es nicht.«
»Was ist denn wirklich passiert?«
Danilo machte eine hilflose Geste mit den Armen. »Das versuchen die Behörden jetzt herauszufinden. Und es kann durchaus sein, dass sie früher oder später hierherkommen, um dich zu befragen. Deshalb würde ich dir empfehlen, dich darauf vorzubereiten.«
Claudia holte sich ihren Drink und trank die Hälfte davon in einem Zug aus. »Aber was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun?«
Danilo sah ihr in einer Weise in die Augen, wie er das noch nie getan hatte. »Ich glaube nicht, dass du wirklich meine Meinung dazu hören willst, Claudia. Wir kennen die Antwort, und es wäre unnötig schmerzlich für uns beide, darüber zu reden. In unserem Alter möchte man sich Schmerz so weit wie möglich ersparen, findest du nicht?«
Das Telefon klingelte. Ausnahmsweise war sie ganz begierig, den Hörer abzunehmen. Es war der allwöchentliche Pflichtanruf von Naldo.
»Ciao, Naldino! Wie gehts dir, mein Schatz? Und wie läuft das Restaurant? Tatsächlich? Oje! Nun ja, es wird ganz bestimmt wieder besser, wenn erst mal Frühling ist.«
In diesem Stil fuhr sie noch mehrere Minuten fort, übertrieb ganz bewusst ihre mütterliche Überschwänglichkeit in der Hoffnung, dass Danilo endlich kapierte und ging. Doch der machte keinerlei Anstalten, das zu tun. Irgendwann begann der Erzählfluss zu versiegen, und Naldo klang schon ein wenig besorgt, als ob er befürchtete, seine Mutter wäre betrunken. Und vielleicht war sie sogar ein wenig beschwipst, denn sie verspürte plötzlich den Drang, Naldo zu erzählen, dass man die Leiche seines Vaters gefunden hatte. Lediglich Danilos Anwesenheit bewahrte sie davor.
Das Dumme war nur, dass Danilo immer noch da war, als sie auflegte. Claudia betrachtete ihn mit einer Miene, als hätte sie gerade einen äußerst üblen Geruch im Raum bemerkt und rätselte darüber, wo der wohl herkäme. »Verzeih mir bitte, wenn ich ein bisschen schwer von Begriff bin«, sagte sie, »aber ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wovon du redest.«
Danilo ging zu ihr hinüber und nahm ihre Hände in seine. Noch mehr Körperkontakt. Um ihm nicht in die Augen sehen zu müssen, blickte Claudia auf die weißen, perfekt manikürten Finger, die ihre Hände festhielten. Nicht gerade die Hände eines Soldaten, würde man meinen, obwohl Danilo fast vierzig Jahre gedient hatte. Er hatte mit Waffen, Messern, Granaten und Bomben hantiert und vielleicht auch mit einigen Auserwählten unter den jungen Rekruten, die im Laufe der Jahre die Kaserne von Verona passiert hatten. Doch nichts von alledem hatte eine Spur hinterlassen. Dann blickte sie auf ihre eigenen Hände und erinnerte sich, was diese getan hatten.
»Cara, du musst doch die Gerüchte kennen, die damals, als Gaetano starb, kursierten …«
Sie entriss ihm ihre Hände. »Was für Gerüchte? Ich verstehe das nicht. Ich weigere mich, das zu verstehen!«
Danilo seufzte tief. »Du verstehst das ganz genau.« Er deutete auf das Fenster. »Und da draußen sind eine Menge Leute, die das auch verstehen oder es zu verstehen glauben. Du weißt doch, wie das in dieser Stadt ist. Die Leute sind nur zu gern bereit, irgendeinem herumschnüffelnden Bullen Tratsch aufzutischen. Und es wird eine Untersuchung stattfinden, durch die Polizia di Stato, nicht die Carabinieri. Die hat man nämlich abgezogen, aber anscheinend leitet das Innenministerium gerade eigene Nachforschungen in die Wege. Irgendein politisches Gerangel, das ich nicht verstehe. Das Wichtigste ist jedenfalls, dass du vorbereitet bist. Denk mal in aller Ruhe darüber nach, was du ihnen erzählen willst. Sieh deine Papiere durch, damit du sicher sein kannst, dass da nichts ist, das besser nicht in die Hände der Justizbehörden fallen sollte. Sie könnten einen Durchsuchungsbefehl haben.«
»Um dieses Haus zu durchsuchen?«
»Um dein gesamtes Eigentum zu durchsuchen«, sagte Danilo spitzfindig.
Claudia runzelte die Stirn. »Aber warum in aller Welt sollten sie das tun wollen?«
»Nun ja, das hängt wohl davon ab, was sie im Verlauf ihrer Ermittlungen alles herausfinden. Jedenfalls sind Riccardo und ich unbedingt der Meinung, dass man besser kein Risiko eingehen sollte. Sowohl in deinem eigenen Interesse als auch um der Ehre des Regiments willen.«
Letzteres war mit besonderer Betonung gesagt worden. Danilo nickte einmal ruckartig, dann drehte er sich auf dem Absatz um, ging hinaus und knallte die Tür beinah hinter sich zu.
Nachdem er fort war, stand Claudia eine Zeit lang regungslos da. Dann ging sie in die Küche und füllte ihr Glas erneut aus der Flasche Cinzano Rosso, die noch offen auf der Anrichte stand. Noch nie hatte Danilo in einem derartigen Tonfall mit ihr gesprochen – wie ein Unteroffizier auf dem Exerzierplatz, der einen jungen Rekruten zur Schnecke macht. Was um Himmels willen ging hier vor? Wenn die Leiche, die man gefunden hatte, tatsächlich Leonardo war, dann sollte eigentlich sie durchdrehen. Stattdessen drehten alle anderen durch.
»Die Ehre des Regiments!« Sie hätte niemals gedacht, dass sie dieses Klischee nach Gaetanos Tod noch einmal hören würde. Doch anscheinend schlossen sich wieder einmal die Reihen, und diesmal gegen sie. Kein Wunder, dass Danilo es seinem Freund hatte überlassen wollen, ihr die Sache nahezubringen. Riccardo war ein Gentleman durch und durch, absolut anständig, wenn auch ungeheuer langweilig, und wenn er etwas mehr Zeit gehabt hätte, hätte er schon einen Weg gefunden, ihr zu verstehen zu geben, was geschehen war und was getan werden musste, ohne ihre Gefühle zu verletzen und ihre Handlungsfreiheit einzuschränken.
Sie hatte geglaubt, dass Danilo so ähnlich wäre, doch nun erkannte sie, wie sehr sie sich geirrt hatte. Er war nicht gutmütig, er war ein Gefühlsmensch. Das war etwas ganz anderes. Und wie alle Gefühlsmenschen konnte er von einer Sekunde auf die andere bösartig werden, wenn man seine Pläne durchkreuzte. Aber womit hatte sie seine Pläne durchkreuzt? Was wollte er überhaupt? Wie viel wusste er? Er hatte dies und das angedeutet, aber war es aus Takt und Diskretion geschehen, wie er behauptete, oder einfach aus Ignoranz? Er hatte irgendein Spiel mit ihr getrieben, dessen war sie sich sicher, doch sie wusste nicht, was für ein Spiel das war, und noch viel weniger, was es bezweckte. Im Grunde wusste sie überhaupt nicht viel über Danilo, wurde ihr plötzlich klar.
Andererseits, dachte sie, als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte und sich unerhörterweise eine zweite Zigarette nahm, wusste er auch nicht viel über sie, geschweige denn darüber, was wirklich passiert war. Natürlich hatte es bei Gaetanos Tod einigen böswilligen Tratsch gegeben, wie Danilo ihr unbedingt unter die Nase hatte reiben müssen, doch die einzige Person, die der Sache auch nur halbwegs nachgegangen war, war jener aufdringliche Polizeiinspektor gewesen. Und dem hatte man ziemlich klar die Grenzen aufgezeigt, dank ihrer Beziehungen zur Provinzverwaltung und wo auch immer.
Es gab also wirklich keinen Grund zur Sorge außer natürlich für die, denen es um »die Ehre des Regiments« ging. Die müssen sich in ihre frisch gestärkten Höschen scheißen, dachte sie und benutzte dabei eine österreichische Redewendung, die sie gelegentlich von ihrer zweisprachigen Mutter gehört hatte. Wenn die Ermittler vom Innenministerium auch nur einen Bruchteil dessen herausfanden, was damals tatsächlich geschehen war, wäre die Ehre des Regiments auf absehbare Zeit so besudelt wie diese vollgeschissenen Höschen. Es wäre ein Skandal, neben dem alles andere verblassen würde.
Doch die an den Schalthebeln der Macht würden natürlich dafür sorgen, dass das nicht passierte, daher auch der diskret warnende Unterton von Danilos letzter Bemerkung, sie solle der Polizei gegenüber vorsichtig sein. Und das nicht nur wegen ihrer eigenen Verstrickung in die Sache, sondern weil sie zu einer Belastung für diejenigen würde, die noch mehr zu verlieren hatten, wenn sie etwas Falsches sagte. Und die würden dann keinen Augenblick zögern, sie zu opfern, um sich selbst zu retten. Ja, das war die Botschaft gewesen: eine geschmacklose Drohung, verpackt in eine dünne Schicht scheinbarer Sorge um sie.
Sie trank einen weiteren großen Schluck Cinzano. Die Erkenntnis, zu der sie gerade gelangt war, erschütterte sie. Gleichzeitig war sie stolz und froh, dass sie immer noch genügend Grips hatte, so etwas zu durchschauen. Also gut, die Situation war klar. Nun musste sie entscheiden, was zu tun war, eine sehr viel schwierigere Sache, der sie sich im Augenblick ganz gewiss nicht gewachsen fühlte. Sie brauchte ein bisschen Zeit, um zu verarbeiten, was geschehen war, und sich eine Strategie zurechtzulegen. Am besten sollte sie jetzt erst einmal zum Garten fahren und das BUCH befragen. Das würde ihr wie schon so oft helfen, die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Und dann könnte sie mal wieder eine kleine Reise nach Lugano unternehmen und einfach abwarten, bis sich die ganze Angelegenheit beruhigte. Ihrer Erfahrung nach taten solche Dinge das letztlich immer.
3
Nach einer perfekt ausgeführten Wende tauchte er aus dem Wasser auf, holte tief Luft und wuchtete sich von Neuem durch die Wellen, die er bei seiner letzten Bahn erzeugt hatte. Drei, vier, fünf, sechs … Die mächtigen Arme prügelten auf das Wasser ein, das ihm die behaarten Schultern und den Rücken entlanglief und in einer festen Haarlocke endete, wie der Schwanz eines kleinen Parasiten, der Zuflucht im Hinternspalt des Mannes suchte.
Acht, neun, zehn … Kurz vor der Wand machte er eine Rolle und stieß sich erneut ab. Wie ein Torpedo schoss er ein paar Meter unter Wasser durch das Becken, bevor er die Wasseroberfläche wieder durchbrach. Bereits achtundvierzig Bahnen, und er fühlte sich gut. Ja, er fühlte sich prächtig. Seine Arme und Beine waren immer noch kräftig und genossen ihre Arbeit. Selbst der Schmerz, der seine Muskeln heiß durchströmte, diente lediglich zur Stimulanz. Doch vor allem war seine Voglia wieder da, sein Siegeswille. Er hatte sich vorgenommen, zum ersten Mal fünfzig Bahnen zu schwimmen, um seinen Geburtstag zu feiern, und nun wusste er, dass er das konnte.
Von der Straße am Hang aus betrachtet, wenn dort ein Beobachter gestanden hätte, glichen das Haus, der Swimmingpool und die umliegenden Terrassen dem freigelegten Teil eines ursprünglich größeren antiken Mosaikbodens: ein azurblaues Rechteck, das mit den rostfarbenen Dachziegeln kontrastierte, beides abgestimmt auf die viereckigen und keilförmigen ockerfarbenen Steinplatten sowie die stattliche Reihe silbriger Olivenbäume, die das Haus umgab. Was die Schatten anging, die die in Töpfen entlang der Auffahrt zum Haus stehenden Sträucher warfen, so hätte man die vielleicht als uralte Flecken erklären können, Wein zum Beispiel oder Blut.
Acht, neun, zehn … Eine weitere perfekte Rolle, und noch einmal stieß er sich von der Wand ab, um den richtigen Schwung für die letzte Bahn zu bekommen. Als er nach den ersten Schlägen den Kopf aus dem Wasser streckte, hörte er das Geräusch zum ersten Mal. Zunächst hielt er es für eine Hörstörung, eine Art Tinnitus, hervorgerufen durch Wasser im Gehörgang, verbunden mit außergewöhnlicher Anstrengung. Als er das zweite Mal Wasser in die Luft spie, wusste er, dass das Geräusch tatsächlich da war, doch erst beim dritten Luftholen war ihm klar, was es war. Nun ja, die konnten ruhig warten, wer auch immer sie waren.