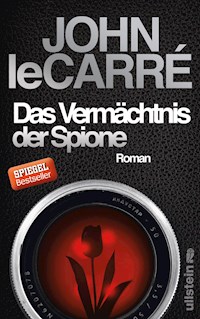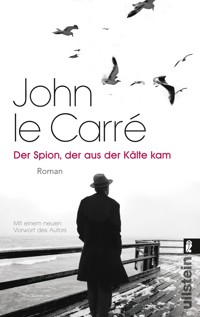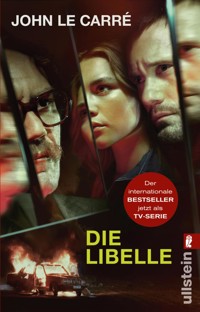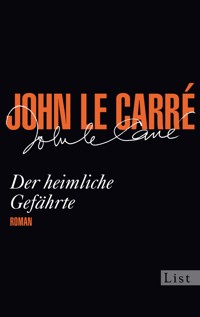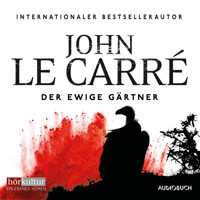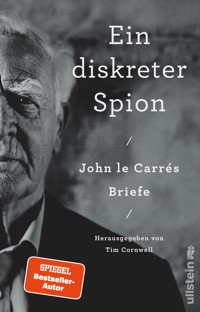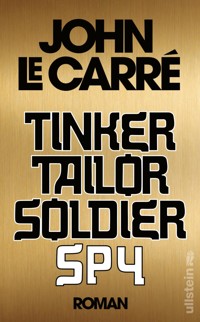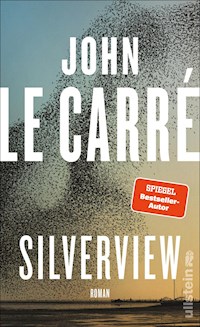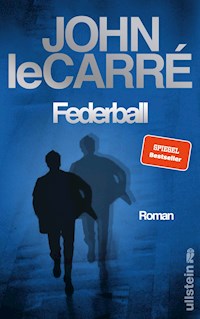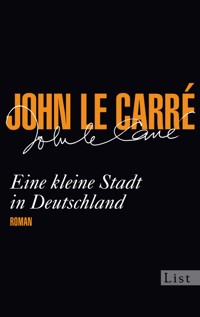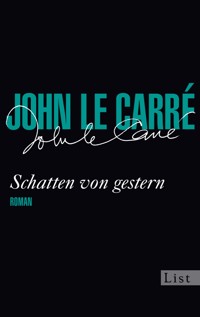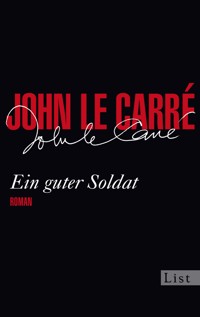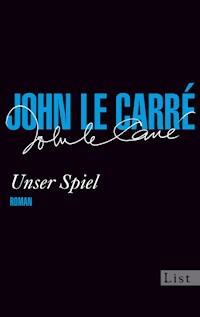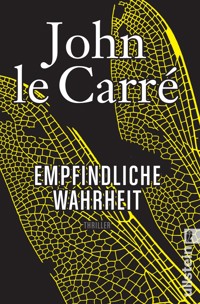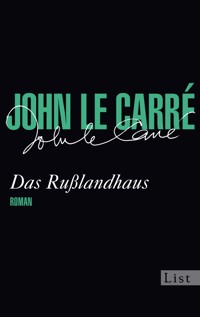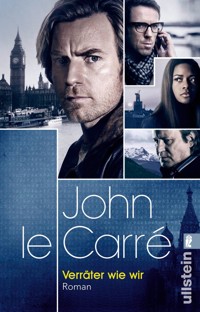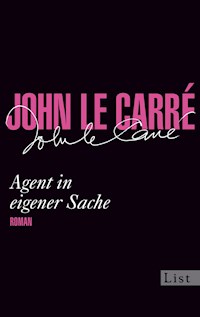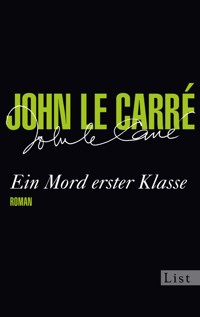14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - George Smiley, Chef des britischen Geheimdienstes, soll nach einer gescheiterten Operation seinen Posten räumen. Doch da stellt sich heraus, dass einer seiner Leute ein Doppelagent ist, der insgeheim für Moskau arbeitet. Smiley setzt sich auf seine Fährte und gerät dabei, als Tarnung selbst zum Maulwurf geworden, mitten ins Reich des großen Gegners im kalten Krieg … Der Weltbestseller jetzt verfilmt mit Oscarpreisträger Colin Firth. Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
London, Mitte der 1970er Jahre. Bereits im Ruhestand wird der britische Geheimagent George Smiley dennoch mit einem gefährlichen Auftrag betraut: Er soll einen Doppelagenten enttarnen, der für Moskau den britischen Geheimdienst ausspioniert. Nur mit Hilfe seines Scharfsinns und einer Handvoll enger Freunde macht sich Smiley auf die Jagd …
Bei Erscheinen eine Sensation und seitdem als einer der spannendsten Agententhriller aller Zeiten geliebt, wurde der Roman um den pensionierten Topspion George Smiley bereits 1980 schon einmal fürs Fernsehen mit Alec Guiness in der Hauptrolle verfilmt. Jetzt drehte der schwedische Regisseur Tomas Alfredson (bekannt durch So finster die Nacht) eine atemberaubende und international höchst erfolgreiche Kinoversion: mit dem charismatischen Gary Oldman als George Smiley und Oscar-Preisträger Colin Firth in der Rolle des schillernden Bill Haydon.
Der Autor
John le Carré, geboren 1931 Poole, Dorset, studierte in Bern und Oxford Germanistik, bevor er in diplomatischen Diensten u. a. in Bonn und Hamburg tätig war. Der Spion, der aus der Kälte kam begründete seinen Weltruhm als Bestsellerautor. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall und London.
In unserem Hause sind von John le Carré bereits erschienen:
Absolute Freunde · Agent in eigener Sache · Dame, König, As, Spion · Das Rußlandhaus · Der ewige Gärtner · Der heimliche Gefährte · Der Nachtmanager · Der Spion, der aus der Kälte kam · Der Schneider von Panama · Der wachsame Träumer · Die Libelle · Ein blendender Spion · Ein guter Soldat · Ein Mord erster Klasse · Eine Art Held · Eine kleine Stadt in Deutschland · Empfindliche Wahrheit · Geheime Melodie · Krieg im Spiegel · Marionetten · Schatten von gestern · Single & Single · Unser Spiel · Verräter wie wir
John le Carré
Dame, König, As, Spion
Roman
Aus dem Schwedischenvon Rolf und Hedda Soellner
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0403-8
Sonderausgabe im List Taschenbuch1. Auflage Februar 20123. Auflage 2012© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004© 2002 für die deutsche Ausgabe byEcon Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München© 1974 by le Carré ProductionsTitel der englischen Originalausgabe: Tinker, Tailor, Soldier, Spy(Hodder and Stoughton, London)Übersetzung: Rolf und Hedda Soellnermit freundlicher Genehmigung des Verlags Kiepenheuer und Witsch, KölnVorwort © 1991 by David CornwellÜbersetzung des Vorworts von Werner Schmitz2002 Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, MünchenUmschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: Cover Photograph by Jack English; Cover artwork© 2011 Karla Films Ltd, Paradis Films S.A.R.L. andKinowelt Filmproduktion GmbH. All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Für James Bennett und Dusty Rhodes
VORWORT
Deutsch von Werner Schmitz
Es war immer mein Wunsch, einmal einen Roman in Cornwall spielen zu lassen, und bis heute bin ich ihm nie so nahe gekommen wie mit Dame, König, As, Spion. Das unfertige Manuskript, das jahrelang bei mir in der Schublade gelegen hatte, ehe ich mich ernstlich daran machte, den Roman auszuarbeiten, kam noch ganz ohne George Smiley aus. Es begann vielmehr mit einem vereinsamten, verbitterten Mann, der allein an der Kliffküste Cornwalls lebt und eines Tages einem schwarzen Auto entgegenstarrt, das sich den Hang hinunter auf ihn zubewegt. Im Kopf hatte ich mir als Schauplatz eine Stelle ausgemalt, ähnlich dem kleinen Hafen Porthgwarra im Westen Cornwalls, wo die Häuser sich bis dicht ans Wasser drängen und den Eindruck machen, als würden sie von den Hügeln dahinter ins Meer geschoben. Der Mann trug einen Eimer in der Hand und wollte gerade seine Hühner füttern. Er hinkte, genau wie Jim Prideaux in dem Roman, den Sie jetzt vor sich haben, und wie Jim war er ein ehemaliger Angehöriger des Britischen Geheimdienstes, »Circus« genannt, und durch einen Verräter in den eigenen Reihen zu Fall gekommen.
Mein ursprünglicher Plan sah so aus, daß die Ermittler des Circus den Mann auf eine Weise wieder ins Boot holen sollten, daß der unbekannte Verräter sich provoziert sähe, erneut in Aktion zu treten und sich auf diese Weise selbst zu entlarven. Die ganze Geschichte sollte in der Gegenwart spielen und nicht in Rückblenden, wie sie jetzt angelegt ist. Doch als ich mit der Ausarbeitung des Buchs begann, stellte ich fest, daß ich mich selbst in die Enge trieb. Ich fand einfach keine plausible Methode, geradlinig voranzuschreiten und gleichzeitig auf den Weg zurückzublicken, über den mein Mann an die Stelle gelangt war, an der die Romanhandlung einsetzt. Und so trug ich nach mehreren frustrierenden Monaten das ganze Manuskript in den Garten, verbrannte es und fing noch einmal von vorne an.
Ich hatte mir jedoch noch ein anderes Problem aufgeladen. Ich wollte nämlich etwas beschreiben, das damals meinen Lesern neu war und – trotz aller Presseberichte über die Infiltration unserer Geheimdienste – vielleicht auch heute noch neu ist: Es ging mir um die verquere Logik, die beim Einsatz eines Doppelagenten waltet, und um das enorme Chaos, in das ein feindlicher Dienst stürzen kann, wenn seine Informationsbeschaffung unter die Kontrolle des Gegners gerät.
Gewiß, wir alle wußten mehr oder weniger, daß Kim Philby einmal als Leiter der Gegenaufklärung des Britischen Geheimdienstes gearbeitet hatte und in die amerikanischen Bemühungen, den KGB zu unterwandern, eingeweiht gewesen war. Wir wußten, daß er zeitweilig sogar als Chef des Britischen Geheimdienstes vorgesehen war. Vielleicht wußten wir auch, daß er persönlich den führenden Moskau-Beobachter der CIA, James Jesus Angleton, bei der Enttarnung von Doppelagenten unterstützt hatte, einem Gebiet, auf dem Philby als außerordentlicher Experte galt. Vielleicht hatten wir gelesen, daß George Blake, ein weiterer KGB-Verräter innerhalb des SIS, etliche britische Agenten an seine sowjetischen Vorgesetzten verraten hatte – heute sagt er, es seien Hunderte gewesen, und wer vermöchte die Prahlerei dieses Elenden zu widerlegen? Die Sache, für die er gekämpft hat, ist wie seine Opfer längst gestorben. Nur wenige Leute haben damals jedoch begriffen, was für ein Hin und Her die Arbeit eines Doppelagenten ausmacht.
Denn während der heimliche Verräter einerseits alles tut, die Aktionen des eigenen Dienstes zu hintertreiben, strebt er andererseits ebendort eine erfolgreiche Karriere an; zu diesem Zweck liefert er der eigenen Seite die Tips und Hinweise, die sie zur Rechtfertigung ihrer Existenz so nötig hat, und spielt ganz allgemein den fähigen und vertrauenswürdigen Burschen, den freundlichen Helfer in dunkler Nacht. Die Kunst – am besten geschildert in J. C. Mastermans Bericht über die britische Doppelspielstrategie gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg – besteht demnach darin, die Balance zu finden zwischen dem, was den Doppelagenten in seiner Rolle als loyalen Angehörigen seines Dienstes bestätigt, und dem, was für die eigene Seite gut ist, deren unablässige Anstrengungen wiederum allein dem Ziel gelten, den gegnerischen Dienst bis zu dem Punkt zu unterwandern, wo er dem Land, das ihn unterhält, mehr Schaden als Nutzen bringt; oder, um mit Smiley zu reden: wo der Gegner komplett umgedreht ist.
In solch einer erbärmlichen Lage befand sich der SIS in den Glanzzeiten von Blake und Philby; ähnlich schlimm stand es um die CIA, freilich durch eigenes Verschulden, und zwar wegen des paranoiden Einflusses von Angleton selbst, der infolge der Entdeckung, daß er dem erfolgreichsten Doppelagenten des KGB aus der Hand gefressen hatte, den Rest seines Lebens zu beweisen suchte, daß die CIA wie der SIS von Moskau gesteuert werde – und daß demnach die gelegentlichen Erfolge der CIA bloß Häppchen seien, die ihr von den teuflischen Ränkeschmieden des KGB zur Beschwichtigung hingeworfen würden. Angletons Annahme war falsch, aber die Auswirkungen auf die CIA nicht weniger katastrophal, als wenn er Recht gehabt hätte. Beide Geheimdienste hätten ihren Ländern – moralisch und finanziell – weit weniger geschadet, hätte man sie einfach aufgelöst.
Ich habe Blake und Philby nie kennengelernt, aber Philby war mir immer ganz besonders unsympathisch, während Blake mir fast schon unnatürlich sympathisch war. Die Gründe dafür, fürchte ich, haben viel mit dem verdrehten Snobismus meiner Klasse und Generation zu tun. Philby mochte ich nicht, weil er mir in manchen Dingen sehr ähnlich war. Er hatte eine Privatschule besucht, er war der Sohn eines launischen, tyrannischen Vaters – des Forschers und Abenteurers St. John Philby –, er konnte mühelos Menschen für sich gewinnen und seine Gefühle gut verbergen – insbesondere seinen heftigen Abscheu vor der Bigotterie und den Vorurteilen der herrschenden Schichten Englands. Ich fürchte, all dies traf irgendwann einmal auch auf mich zu. Daher glaubte ich ihn nur allzugut zu verstehen, und auf seltsame Weise scheint er das gespürt zu haben, denn im letzten Interview vor seinem Tod hat er seinem Gesprächspartner Phil Knightley erzählt, er habe das Gefühl, mir sei etwas Diskreditierendes über ihn bekannt. Und in gewisser Weise hatte er Recht: Ich wußte ebenso wie er, wie es ist, unter dem so übergroßen Einfluß eines Mannes aufzuwachsen, daß man als sein Kind schlechthin gezwungen ist, zu Tricks und Täuschung zu greifen. Und ich wußte, oder glaubte zu wissen, wie leicht die dadurch geschürte Wut und Introvertiertheit sich zu einer Haßliebe gegenüber den Vaterbildern der Gesellschaft – und letztlich der Gesellschaft selbst – auswachsen konnte, so daß aus dem kindlichen Rächer ein erwachsenes Raubtier wird; ein Thema, das ich in meinem am stärksten autobiographisch geprägten Roman Ein blendender Spion angeschnitten habe. Ich ahnte, wenn man so will, daß Philby einen Weg eingeschlagen hatte, der auch mir selbst gefährlich offenstand, auch wenn ich ihn nicht gewählt hatte, ahnte, dass er einen der – Gott sei Dank nicht realisierten – Entwürfe meines eigenen Wesens darstellte.
Im Gegensatz dazu war mir Blake sympathisch, weil er halb Holländer, halb Jude war und wegen beider Eigenschaften kaum als eingeweihtes Mitglied des britischen Establishments in Frage zu kommen schien. Philby wurde im Innern der Festung geboren und verbrachte sein Leben damit, ihre Fundamente auszuhöhlen; Blake hingegen stammte aus der Fremde, hatte unter seiner Herkunft zu leiden und unternahm große Anstrengungen, von jenen akzeptiert zu werden, die ihn insgeheim verachteten: seinen Arbeitgebern. Als ich daher anfing, mein kleines »Bestiarium der Verdächtigen« zusammenzustellen, achtete ich darauf, daß mindestens zwei – Bland und Esterhase und vielleicht auch Jim Prideaux – durch ihre Herkunft jener Gesellschaft entfremdet waren, der sie dienten.
Soviel zum dokumentarischen Hintergrund. Alles andere sind – gut fundierte – Gedankenspielereien. Der Ursprung des Wortes »Maulwurf«, mit dem ich einen langfristig arbeitenden, bei der Gegenseite eingeschleusten Agenten bezeichne, ist nicht nur mir ein kleines Rätsel, sondern auch den Herausgebern des Oxford English Dictionary, die schriftlich bei mir anfragten, ob ich den Ausdruck selbst erfunden habe. Ich konnte die Frage nicht mit Gewißheit beantworten, meinte mich aber zu erinnern, daß während meiner kurzen Dienstzeit als Mitarbeiter des Nachrichtendienstes dieser Ausdruck beim KGB gebräuchlich war. Ich glaubte ihn sogar mit eigenen Augen in einem Anhang zu dem Bericht der Royal Commission über die Petrovs, die irgendwann in den fünfziger Jahren in Canberra zu den Australiern übergelaufen waren, gesehen zu haben. Aber die Leute vom OED konnten die Quelle ebensowenig wiederfinden wie ich, und daher hielt ich es lange Zeit für möglich, daß das Wort tatsächlich von mir selbst stammte. Dann bekam ich eines Tages einen Leserbrief, der mich auf Francis Bacons Historie of the Reigne of King Henry the Seventh hinwies; dort ist in der Ausgabe von 1641 zu lesen:
»Was seine geheimen Spione anbetrifft, die er sowohl zu Hause als auch im Ausland beschäftigte, um mit ihrer Hilfe aufzudecken, welche Machenschaften und Verschwörungen gegen ihn im Gange seien, so war dies in seinem Fall zweifellos berechtigt: denn solche Maulwürfe waren auch unablässig zugange, seine eigene Herrschaft zu untergraben.«
Nun, natürlich hatte ich Francis Bacons Ausführungen über Maulwürfe nie gelesen. Woher er wohl den Ausdruck hatte? Oder hatte ihn die Verwendung dieser durchaus angemessenen Metapher belustigt?
Der andere Jargon ist frei erfunden, aber auch davon sind seither, wie man mir sagt, zumindest einige Wendungen in den Sprachgebrauch der Profis übergegangen. Ich habe beim Schreiben des Romans keinen besonderen Kult daraus gemacht: Ich wollte nur unterstreichen, daß Spionage für jene, die sie betreiben, ein Handwerk ist wie jedes andere, und daß es, wie andere Berufe, ein eigenes Vokabular hat. Die Russen haben in dieser Hinsicht stets mehr Phantasie gehabt, sie lebten unter anderem in täglichem Kontakt mit Schuhmachern (Fälschern), Nachbarn (Mitgliedern eines befreundeten Geheimdienstes) oder Pianisten (Funkern). Mein Geheimvokabular war demnach eher eine Marotte, doch als die BBC-Verfilmung auf den Bildschirm kam, fand die Nation es eine Zeitlang recht amüsant, und dafür war ich dankbar.
Wie ich das Buch heute, sechzehn Jahre später, in Erinnerung habe? Positiv. Erstens wegen der glücklichen Ereignisse, die auf seine Veröffentlichung folgten – ich denke an die Enttarnung Blunts, an die Fernsehserie: der großartige Alec Guinness als George Smiley, ganz zu schweigen von der wunderbaren Besetzung insgesamt und der Regie. Zweitens, weil es mich nach den schlechten Kritiken, mit denen sein Vorgänger, Der wachsame Träumer, bedacht worden war, wieder aufrichtete. Drittens und vor allem aber ist es mir wegen des kleinen Jungen Bill Roach in angenehmer Erinnerung, für den es zwei Vorbilder gab: eins aus meiner Zeit als Lehrer, das andere aus Ein blendender Spion, wo er als Sohn des armen Pym auftritt. Roach war natürlich nicht sein richtiger Name, und er hat meines Wissens auch nicht der Belegschaft nachspioniert. Aber seine Wachsamkeit ist mir im Gedächtnis geblieben, als wäre es meine eigene gewesen, und ich weiß noch, wie überaus nahe ich mich ihm gefühlt habe, vielleicht weil ich in ihm mich selbst als Fünfzehnjährigen wiedererkannt habe.
Unvergeßlich ist mir auch Connie Sachs, die mich bei den Circus-Recherchen unterstützt hat – eine typische Vertreterin der letzten Generation von Geheimagentinnen: jener klugen, unglücklichen Damen der englischen Oberschicht, die sich im Krieg dem Geheimdienst angeschlossen hatten, dann dabeiblieben, um für den Frieden zu kämpfen, und die aus der reichen Schatzkammer ihrer Erfahrungen gar manches mitzuteilen wußten, woran wir Grünschnäbel uns weiden konnten.
Es ist seltsam, aber nach den Umwälzungen der letzten Jahre hat Dame, König, As, Spion bereits als historischer Roman zu gelten. Ich glaube jedoch nicht, daß das Buch deswegen überflüssig geworden ist, und hoffe, Sie haben ebenso viel Vergnügen daran wie ich selbst, wenn ich gelegentlich einen Blick hineinwerfe.
John le Carré 1991
Die Personen des Romans
In den Hauptrollen
Control
ehemals Chef des Circus, des Britischen Geheimdiensts
Percy Alleline
neuer Chef des Circus
George Smiley
ehemals Controls rechte Hand
Peter Guillam
zur Zeit Chef der Skalpjäger in Brixton
Bill Haydon
Einsatzleiter des Teams unter Percy Alleline
Roy Bland
}
Mitarbeiter von Bill Haydon
Toby Esterhase
Lauder Strickland
Leiter der Bankabteilung des Circus
Diana Dolphin
die Gestrenge der Personalabteilung des Circus
Ricki Tarr
Außenagent im Fernen Osten, zu Guillams Section in Brixton gehörig
Steve Mackelvore
Außenagent in Paris
Lord Miles Sercombe
Staatssekretär in Whitehall
Oliver Lacon
der Mann des Ministers
Inspektor Mendel
George Smileys Freund und Helfer
Sam Collins
Manager eines Spielclubs
Jerry Westerby
Sportjournalist
Roddy Martindale
ein gefürchteter Schwätzer
Karla,
der Große Geheimnisvolle auf der
alias Gerstmann
Gegenseite
Gerald,
sowjetrussischer Agent
der »Maulwurf«
innerhalb des Circus
Oberst Viktorow, alias Alexei Poljakow
Kulturattaché der sowjetischen Botschaft in London
Boris
Mitglied einer russischen Handelsdelegation in Hongkong
Irina
Boris’ Frau
Mr. Thursgood
Direktor des Thursgoodschen Internats
Jim Prideaux
Aushilfslehrer bei Mr. Thursgood
Max
ein tschechischer Babysitter a. D.
Bill Roach
ein schwieriger Zögling
Ann
George Smileys schöne Frau
Camilla
Peter Guillams schöne Freundin
Ian
Bill Haydons Freundin
Connie Sachs
eine Dame mit phänomenalem Gedächtnis
Mrs. Graham Pope
Inhaberin des Hotels »Islay«
Ferner wirken mit
Angehörige beider Geheimdienste, Lehrerinnen, Lehrer und Schüler des Thursgoodschen Internats, einige Oxford-Professoren, Babysitter, Inquisitoren, Hausdamen, ein tschechischer General, eine tote Eule u. a. m.
ERSTER TEIL
1
Jim Prideaux trifft im Thursgoodschen Internat ein und wird von einem Schüler adoptiert
Jim wäre nie zu Thursgood gekommen, wenn den alten Major Dover beim Taunton-Rennen nicht der Schlag getroffen hätte. Er fing dort ohne Einstellungsgespräch mitten im Quartal an – es war Ende Mai, obwohl man es dem Wetter nicht anmerkte. Vermittelt hatte ihn eine fragwürdige Agentur, die sich auf Aushilfslehrkräfte für Heimschulen spezialisierte, und er sollte die Fächer des alten Dover übernehmen, bis passender Ersatz gefunden wäre. »Er ist Linguist«, erklärte Thursgood im Lehrerzimmer, »ein Notbehelf«, und fegte kämpferisch die Haarlocke aus der Stirn. »Priddo.« Er buchstabierte den Namen »P-R-I-D- …« Französisch war nicht sein Fach, er konsultierte einen Zettel – »E-A-U-X, Vorname James. Ich glaube, bis Juli können wir uns mit ihm behelfen.« Der Lehrkörper konnte mühelos die Zeichen lesen. Jim Prideaux war ein armer Weißer aus dem Schulmeisterstand. Er gehörte der gleichen traurigen Gilde an wie die selige Mrs. Loveday, die einen Persischlamm-Mantel getragen und den Religionsunterricht in der Unterstufe erteilt hatte, bis ihre Schecks platzten; oder wie der selige Mr. Maltby, der Klavierlehrer, der mitten aus einer Chorübung abberufen worden war, um der Polizei bei ihren Nachforschungen behilflich zu sein, und ihr, nach allem was man wußte, noch heute behilflich war, denn Maltbys Reisekoffer lag noch immer im Keller und wartete auf seine Weisung. Einige Lehrer, vor allem Marjoribanks, waren dafür, daß man den Koffer öffnete. Er enthalte, sagten sie, verschwundene bekannte Kostbarkeiten: Aprahamians silbergerahmtes Bild seiner libanesischen Mutter zum Beispiel, Best-Ingrams Schweizer Armeemesser und Matrons Uhr. Aber Thursgood wehrte sich entschieden gegen ihr Drängen. Seit er die Schule von seinem Vater geerbt hatte, waren erst fünf Jahre vergangen, aber sie hatten ihn bereits gelehrt, daß manche Dinge am besten unter Verschluß bleiben.
Jim Prideaux kam an einem Freitag unter Regengüssen an. Die Schauer rollten wie Geschützrauch über die braunen Hänge der Quantocks herab und preschten dann über die leeren Kricketplätze gegen den Sandstein der alten Fassaden. Er kam kurz nach dem Lunch, in einem alten roten Alvis mit schrottreifem Wohnanhänger, der früher einmal blau gewesen war. Der frühe Nachmittag ist bei Thursgood eine friedliche Zeit, eine kurze Kampfpause im Rückzugsgefecht eines jeden Schultags. Die Jungens werden zur Mittagsruhe in ihre Schlafsäle geschickt, die Lehrer sitzen beim Kaffee im Lehrerzimmer und lesen Zeitung oder korrigieren Hefte. Thursgood liest seiner Mutter einen Roman vor. So kam es, daß Bill Roach als einziger von der ganzen Schule Jim ankommen sah, sah, wie der Dampf aus dem Kühler des Alvis brodelte, wie der Wagen den bröckeligen Fahrweg entlangkeuchte, die Scheibenwischer auf Hochtouren liefen und der Wohnanhänger durch die Pfützen hinterherrumpelte.
Roach war neu an der Schule und als lernschwach eingestuft, wenn nicht gar als geistesschwach. Thursgood war seine zweite Privatschule in zwei Halbjahren. Er war ein fettes kurzbeiniges Kind mit Asthma und einem romantischen Herzen, und er verbrachte stets einen großen Teil der Ruhezeit damit, keuchend am Fußende seines Bettes zu knien und durchs Fenster zu schauen. Seine Mutter lebte in Bath auf großem Fuß, sein Vater galt allgemein für vermögender als die übrigen Väter, eine Auszeichnung, die den Sohn teuer zu stehen kam. Als Kind einer gescheiterten Ehe war Roach von Natur aus ein guter Beobachter. Wie Roach beobachtete, hielt Jim nicht vor den Schulgebäuden an, sondern nahm die Kehre zum Wirtschaftshof. Er kannte also die Anlage. Roach kam später zu dem Schluß, daß Jim sich eingehend erkundigt oder Pläne studiert haben mußte.
Auch im Hof machte er noch nicht halt, sondern fuhr weiter ins nasse Gras, schnell genug, um nicht steckenzubleiben. Dann über die Koppel in die Senke, Kopf voran und weg war er. Roach erwartete fast, daß der Wohnanhänger am Grabenrand abknicken werde, so schnell riß Jim ihn hinter sich her, aber er lüpfte nur das Hinterteil und verschwand wie ein riesiges Karnickel in seinem Loch.
Die Senke gehört zur Folklore des Thursgoodschen Internats. Sie liegt in einem Stück Ödland zwischen dem Obstgarten, dem Vorratshaus und den Stallungen. Der Betrachter sieht weiter nichts als eine grasbewachsene Bodenmulde mit Erdhügeln an der Nordseite, etwa von Bubenhöhe und mit Gestrüpp überwuchert, das im Sommer morastig wird. Diese Erdhocken verliehen der Senke ihre besondere Eignung als Spielplatz, und ihre Legende, die je nach der Phantasie jeder neuen Jungengeneration wechselt. Sie sind die Reste einer aufgelassenen Silbermine, sagt der eine Jahrgang und buddelt begeistert nach Reichtümern. Sie waren eine römisch-britannische Befestigung, sagt ein anderer und inszeniert Schlachten mit Stöcken und Lehmgeschossen. Für wieder andere ist die Senke ein Bombenkrater aus dem Krieg, und die Erdhocken sind sitzende Menschen, die durch die Explosion ums Leben kamen. Die Wahrheit ist viel prosaischer. Vor sechs Jahren, kurz ehe er mit der Empfangsdame des Schloßhotels durchbrannte, hatte Thursgoods Vater den Bau eines Schwimmbeckens angeregt und die Jungens dazu gebracht, daß sie eine große Grube aushoben, mit einem tiefen und einem flachen Ende. Aber die eingehenden Gelder reichten nie ganz aus, um das ehrgeizige Vorhaben zu finanzieren, und so wurden sie an andere Pläne verzettelt, zum Beispiel einen neuen Projektionsapparat für den Kunstunterricht und die Vorarbeiten zur Einrichtung einer Champignonzucht in den Schulkellern. Und sogar, sagten die Zyniker, als Nestpolster für ein gewisses, sündiges Liebespaar, das inzwischen nach Deutschland, die Heimat der Dame, entfleucht war. Jim ahnte nichts von diesen Zusammenhängen. Aus schierem Glück hatte er die einzige Stelle des Thursgood-Anwesens gewählt, die, jedenfalls für Roach, mit übernatürlichen Eigenschaften ausgestattet war.
Roach blieb am Fenster, sah aber nichts mehr. Der Alvis samt Anhänger waren im toten Winkel verschwunden, und wären nicht die nassen roten Fahrspuren auf dem Gras gewesen, so hätte er sich fragen können, ob er das Ganze nicht bloß geträumt habe. Aber die Spuren waren da, und als die Glocke das Ende der Mittagsruhe anzeigte, zog er seine Gummistiefel an und stapfte durch den Regen zum Rand der Senke. Als er hinunterlinste, sah er Jim, der einen Militär-Regenmantel trug und einen höchst absonderlichen Hut, breitrandig, wie ein Safarihut, aber aus Haarfilz und an einer Seite mit verwegenem Piratenschwung hochgeschlagen, und das Wasser rann herab wie aus einer Regenrinne.
Der Alvis stand im Wirtschaftshof. Roach erfuhr nie, wie Jim ihn aus der Senke herausgezaubert hatte, aber der Anhänger war noch drunten, er stand am tieferen Ende auf verwitterten Ziegelsteinen aufgebockt und Jim saß auf der Treppe, trank aus einem grünen Plastikbecher und rieb sich die rechte Schulter, als hätte er sie an etwas gestoßen, und der Regen troff aus seinem Hut. Dann hob sich der Hut, und Roach starrte plötzlich in ein äußerst grimmiges rotes Gesicht, das im Schatten der Hutkrempe und durch einen braunen, vom Regen zu zwei Fangzähnen verklebten Schnurrbart noch grimmiger wirkte. Das übrige Gesicht war kreuz und quer von zackigen Furchen durchzogen, so tief und verwinkelt, daß Roach in einem seiner Phantasieblitze zu dem Schluß kam, Jim müsse einmal irgendwo in den Tropen sehr ausgehungert gewesen sein und inzwischen wieder zugenommen haben. Der linke Arm lag noch immer über der Brust, die linke Schulter war noch immer zum Hals hochgezogen. Aber die ganze verdrehte Gestalt verhielt sich regungslos, sah aus wie ein festgefrorenes Tier: ein Edelhirsch, lautete Roachs optimistische Interpretation, etwas Besonderes.
»Wer zum Teufel bist denn du?« fragte eine sehr militärische Stimme.
»Sir, Roach, Sir. Ich bin ein Neuer.«
Das ziegelrote Gesicht musterte Roach aus dem Hutschatten hervor noch eine Weile. Dann entspannten sich seine Züge zur großen Erleichterung des Jungen zu einem wölfischen Grinsen, die linke Hand, die über der rechten Schulter gelegen hatte, nahm ihr langsames Massieren wieder auf, und gleichzeitig hob die Rechte den Plastikbecher für einen Schluck.
»Ein Neuer, so?« wiederholte Jim, noch immer grinsend, in den Plastikbecher. »Na, das trifft sich ja großartig.«
Dann stand Jim auf, wandte Roach den verkrümmten Rücken zu und machte sich, wie es schien, an eine gründliche Untersuchung der vier Beine des Anhängers, eine sehr kritische Untersuchung, einschließlich mehrmaligen Testens der Aufhängung, mehrmaligen Neigens des seltsam bedeckten Kopfs und Unterschiebens von Ziegelsteinen in verschiedenen Lagen und an allen möglichen Stellen. Inzwischen trommelte der Frühlingsregen auf alles herab: auf Jims Mantel, seinen Hut und das Dach des grünen Anhängers. Und Roach stellte fest, daß Jims rechte Schulter sich während aller dieser Manöver überhaupt nicht bewegt hatte, sondern zum Hals hochgeschoben blieb, als steckte ein Felsbrocken unter dem Regenmantel. Er überlegte daher, ob Jim vielleicht einen Buckel habe und ob alle Buckligen solche Schmerzen hätten wie Jim. Und ferner nahm er ganz allgemein zur Kenntnis, daß Leute mit schmerzendem Rücken lange Schritte machten, es mußte mit dem Gleichgewicht zusammenhängen.
»Ein Neuer also? Na, ich bin kein Neuer«, fuhr Jim nun viel freundlicher fort und zog an einem Bein des Anhängers. »Ich bin ein alter Hase. So alt wie Rip van Winkle, wenn du’s genau wissen willst. Älter. Irgendwelche Freunde? Hast du Freunde?«
»Nein, Sir«, sagte Roach einfach, in dem müden Ton, den Schuljungen immer anschlagen, wenn sie »nein« sagen und jede positive Reaktion den Fragestellern überlassen. Von Jim kam jedoch überhaupt keine Reaktion, und Roach vermutete in jäher Hoffnung in ihm eine verwandte Seele.
»Mein Vorname ist Bill«, sagte Roach. »Bill bin ich getauft, aber Mr. Thursgood nennt mich William«.
»Bill ist schon in Ordnung.«
»Ja, Sir.«
»Hab’ eine Menge Bills gekannt. Waren alle in Ordnung.«
Damit war gewissermaßen die Bekanntschaft geschlossen. Jim schickte Roach nicht weg, also blieb Roach am Grabenrand stehen und linste durch seine regenverschmierten Brillengläser hinunter. Die Ziegel, so stellte er bewundernd fest, waren vom Gurkenbeet geklaut. Einige waren schon immer ein bißchen locker gewesen, und Jim mußte sie noch ein wenig mehr gelockert haben. Roach fand es wundervoll, daß jemand, der gerade erst im Thursgood angekommen war, so kaltblütig sein konnte, sozusagen die Bausteine der Schule für seine eigenen Zwecke zu klauen, und er fand es doppelt wundervoll, daß Jim für seine Wasserversorgung den Hydranten angezapft hatte, denn dieser Hydrant war Gegenstand einer besonders strengen Schulregel: Schon das Berühren wurde mit Prügeln bestraft. »He du, Bill. Du hast nicht vielleicht zufällig sowas wie eine Murmel bei dir?«
»Wie bitte, Sir, eine was, Sir?« fragte Roach und beklopfte verwirrt seine Taschen.
»Murmel, alter Junge. Runde Glasmurmel, kleine Kugel. Spielen Jungens heute nicht mehr mit Murmeln? Haben wir getan zu meiner Schulzeit.«
Roach hatte keine Murmel, aber Kerani in 111 C besaß eine ganze Sammlung, die per Flugzeug aus Beirut gekommen war. Er brauchte ungefähr fünfzig Sekunden, um ins Schulgebäude zurückzurasen, trotz heftiger Gegenwehr eine Murmel an sich zu reißen und keuchend wieder an der Senke einzutreffen. Dort zögerte er, denn für ihn war die Senke bereits Jims Revier, und Roach würde es nicht ohne Erlaubnis betreten. Aber Jim war im Wohnwagen verschwunden, also stieg Roach nach einer Weile zaghaft den Abhang hinunter und reichte die Murmel durch die Tür hinein. Jim sah ihn nicht sofort. Er nippte an seinem Becher und starrte durchs Fenster auf die schwarzen Wolken, die in allen Richtungen über die Quantocks jagten. Dieses Nippen war, wie Roach feststellte, eine schwierige Sache, denn Jim konnte nicht einfach aufrechtstehend schlucken, er mußte den ganzen entstellten Rumpf nach hinten kippen, um den richtigen Winkel zu erzielen. Inzwischen war der Regen wieder heftiger geworden, er prasselte wie Hagel auf den Wohnwagen.
»Sir«, sagte Roach, aber Jim bewegte sich nicht.
»Nix wie Scherereien mit einem Alvis, hat praktisch keine Federung«, sagte Jim endlich, mehr zum Fenster als zu seinem Besucher. »Man fährt praktisch mit dem Hintern auf der Straße, was? Haut jeden zum Krüppel.« Und kippte den Rumpf zurück und trank.
»Ja, Sir«, sagte Roach und wunderte sich, daß Jim anzunehmen schien, er könne Auto fahren.
Jim hatte den Hut abgenommen. Das sandfarbene Haar war kurz gestutzt, stellenweise mußte die Schere zu tief hineingeraten sein. Diese Stellen waren fast sämtlich auf einer Seite, und Roach schloß daraus, daß Jim sich das Haar selber geschnitten hatte mit seinem hellen Arm, wodurch er noch einseitiger wirkte.
»Ich bringe Ihnen eine Murmel«, sagte Roach.
»Sehr nett von dir. Danke, alter Junge.« Jim nahm die Murmel und ließ sie langsam in seiner harten staubigen Handfläche herumrollen, und Roach wußte sofort, daß er in allen möglichen Dingen sehr geschickt sein mußte; daß er zu den Leuten gehörte, die mit Werkzeug und mit Gegenständen im allgemeinen umzugehen wußten. »Nicht eben, siehst du, Bill«, erklärte er, die Augen noch immer auf die Murmel geheftet. »Schlagseite. Wie ich. Paß auf«, und wandte sich energisch zum größeren Fenster. Ein Stück Aluminiumrinne lief an der Unterseite entlang, die das Kondensationswasser auffangen sollte. Jim legte die Murmel hinein und sah zu, wie sie ans andere Ende rollte und auf den Boden fiel.
»Uneben«, wiederholte er. »Hecklastig. So geht’s nicht, wie? He, he, wo bist du denn hin, du kleines Biest?«
Der Wohnwagen war nicht besonders wohnlich, stellte Roach fest, während er sich bückte, um die Murmel zu suchen. Er hätte irgend jemandem gehören können, war allerdings peinlich sauber. Eine Koje, ein Küchenhocker, ein Gaskocher, eine Propangas-Flasche. Nicht einmal ein Bild seiner Frau, dachte Roach, der außer Mr. Thursgood noch nie einem Junggesellen begegnet war. An persönlichen Gegenständen entdeckte er lediglich einen Werkzeugbeutel aus Sackleinen, der an der Tür hing, einiges Nähzeug, das neben der Koje verwahrt war und eine selbstfabrizierte Dusche, bestehend aus einer durchlöcherten und säuberlich am Dach festgelöteten Keksdose. Und auf dem Tisch eine Flasche, die ein farbloses Getränk enthielt, Gin oder Wodka, dachte Roach, denn das trank sein Vater, wenn er in den Ferien die Wochenenden bei ihm verbrachte.
»Ost-West scheint okay, aber Nord-Süd hängt ganz eindeutig«, erklärte Jim nach einem Test an der anderen Fensterrinne. »In was bist du besonders gut, Bill?«
»Ich weiß nicht, Sir«, sagte Roach hölzern.
»In irgendwas bist du bestimmt gut, das ist jeder. Wie steht’s mit Fußball? Bist du gut in Fußball?«
»Nein, Sir«, sagte Roach.
»Bist du am Ende ein Stubenhocker?« fragte Jim zerstreut, ließ sich mit einem kurzen Grunzton aufs Bett nieder und nahm einen Schluck aus dem Becher. »Aber du siehst mir wirklich nicht aus wie ein Stubenhocker«, fügte er höflich hinzu. »Obwohl du ein Einzelgänger bist.«
»Ich weiß nicht«, wiederholte Roach und schob sich einen halben Schritt auf die offene Tür zu.
»Also, was ist dann deine starke Seite?« Er tat wiederum einen langen Zug. »In irgendwas mußt du gut sein, ist jeder. Meine starke Seite war Steine übers Wasser hüpfen lassen.«
Nun war das eine besonders unglückliche Frage, denn sie beschäftigte Roach ohnehin fast den ganzen Tag. Ja, in letzter Zeit bezweifelte er sogar, ob er überhaupt irgendeinen Daseinszweck hatte. Bei Arbeit und Spiel fand er sich bedenklich ungenügend; sogar die kleinen Alltagspflichten in der Schule, wie Bettenbau und Kleiderbürsten, schienen seine Fähigkeiten zu übersteigen. Auch seine Frömmigkeit ließ zu wünschen übrig, wie die alte Mrs. Thursgood ihm vorgeworfen hatte, in der Kapelle schnitt er sogar Grimassen. Er nahm sich diese Unzulänglichkeiten sehr zu Herzen, am meisten aber nahm er sich das Scheitern der elterlichen Ehe zu Herzen, das er hätte vorhersehen und verhindern müssen. Er fragte sich sogar, ob er nicht direkt dafür verantwortlich sei, ob er zum Beispiel abnorm bösartig oder träge oder ein Störenfried sei und sein schlechter Charakter den Bruch herbeigeführt habe. In seiner letzten Schule hatte er versucht, sich durch Schreikrämpfe und simulierte Anfälle von progressiver Paralyse, an der seine Tante litt, verständlich zu machen. Seine Eltern hatten den Fall gemeinsam beraten, wie sie es in ihrer vernünftigen Art zu tun pflegten, und ihn in eine andere Schule gesteckt. Und als ihn nun hier, in dem engen Wohnwagen, diese Frage aus dem Mund eines zumindest halbgottgleichen Wesens unversehens ansprang, hätte sie ihn um ein Haar in die Katastrophe gestürzt. Er fühlte, wie ihm die Hitze ins Gesicht schoß, sah, wie seine Brillengläser sich beschlugen und der Wohnwagen in einem Meer von Kummer zu versinken schien. Roach erfuhr nie, ob Jim es bemerkt hatte, denn dieser hatte sich plötzlich abgewandt, war zum Tisch gegangen und bediente sich nun aus dem Plastikbecher, wobei er rettende Bemerkungen von sich gab.
»Also, ein guter Beobachter bist du mal auf jeden Fall, alter Junge. Das sind wir Eigenbrötler alle, haben keinen, auf den wir uns verlassen können, was? Außer dir hat mich kein Mensch entdeckt. Ganz schöner Schreck, steht da droben wie vom Himmel gefallen. Hab’ gedacht, du bist ein Juju-Mann. Bill Roach ist der beste Beobachter im ganzen Stall, wetten? Wenn er seine Brille aufhat. Wie?«
»Ja«, stimmte Roach dankbar zu, »das bin ich.«
»Dann bleib jetzt mal hier und beobachte«, befahl Jim und stülpte sich den Safari-Hut wieder auf den Kopf, »während ich ’rausgehe und die Beine reguliere. Willst du?«
»Ja, Sir.«
»Wo ist die Murmel?«
»Hier, Sir.«
»Du rufst, wenn sie rollt, ja? Nord, Süd, eben in welcher Richtung, verstanden?«
»Ja, Sir.«
»Weißt du, wo Norden ist?«
»Hier«, sagte Roach prompt und streckte blindlings den Arm aus.
»Richtig. Also, du rufst, wenn sie rollt«, wiederholte Jim und verschwand in den Regen. Kurz darauf fühlte Roach den Boden unter seinen Füßen schwanken und hörte einen Aufschrei des Schmerzes oder der Wut, als Jim sich mit einem widerspenstigen Bein abquälte.
Im Lauf dieses Sommerquartals ehrten die Jungens Jim durch die Verleihung eines Spitznamens. Erst nach mehreren Anläufen fanden sie das Richtige. Sie hatten es mit Wüstenfuchs probiert, was den militärischen Einschlag traf, sein gelegentliches harmloses Fluchen und seine einsamen Streifzüge in die Quantocks. Trotzdem setzte Wüstenfuchs sich nicht durch, und sie versuchten Pirat und eine Weile Gulasch. Gulasch wegen seiner Vorliebe für heiße Gerichte, des Geruchs nach Gewürzen und Zwiebel und Paprika, der ihnen in Schwaden entgegenschlug, wenn sie auf ihrem Weg zur Abendandacht im Gänsemarsch an der Senke vorüberzogen. Gulasch wegen seines vollendeten Französisch, dem angeblich etwas Lasches anhaftete. Spikely aus Fünf B konnte es täuschend nachahmen: »Du hast die Frage gehört, Berger. Was blickt Emil an?« Eine ruckartige Bewegung der rechten Hand. – »Starr mich nicht so an, alter Junge, ich bin kein Juju-Mann. Qu’est-ce qu’il regarde, Emile, dans le tableau que tu as sous le nez? Mon cher Berger, wenn du jetzt nicht bald einen anständigen französischen Satz zusammenbringst, je te mettrai tout de suite à la porte, tu comprends, du Knallkopf.« Aber diese schrecklichen Drohungen wurden nie wahr gemacht, weder auf Französisch noch auf Englisch. Wunderlicherweise trugen sie sogar noch zu der Aura von Güte bei, die Jim bald schon umgab, eine Güte, die nur Jungensaugen an großen, kräftigen Männern entdecken können.
Trotzdem, Gulasch war auch nicht das Richtige. Es fehlte der Hinweis auf die innere Kraft. Auch war Jims leidenschaftliches Englischsein nicht berücksichtigt, das einzige Thema, mit dem man ihn todsicher vom Unterricht ablenken konnte. Knallfrosch Spikely mußte nur eine geringschätzige Bemerkung über die Monarchie fallenlassen, die Vorzüge eines fremden – vorzugsweise warmen – Landes in den Himmel heben, und schon schoß Jim das Blut ins Gesicht, und er ereiferte sich gute drei Minuten lang über das Privileg, als Engländer geboren zu sein. Er wußte, daß sie ihn hochnahmen, aber er konnte sich einfach nicht zurückhalten. Oft beendete er seine Erbauungspredigt mit einem reuigen Grinsen und murmelte etwas von Ablenkungsmanövern und Betragensnoten und langen Gesichtern, wenn gewisse Herrschaften nachsitzen müßten und das Fußballspiel versäumten. Aber England war seine große Liebe; im Ernstfall würde er niemanden ihretwegen leidenlassen.
»Bestes Land in der ganzen verdammten Welt!« hatte er einmal gebellt. »Weißt du, warum? Weißt du warum, Knallfrosch?«
Spikely wußte es nicht, also nahm Jim ein Stück Kreide und zeichnete einen Globus. »Im Westen ist Amerika«, sagte er, »voll gieriger Narren, die ihr Erbteil versauten. Im Osten China-Rußland«, er zog keine Grenze: »Arbeitskluft, Gefangenenlager und ein verdammt langer Marsch nirgendwohin. In der Mitte …«
Schließlich verfielen sie auf Rhino.
Es war zum Teil eine Art Reim auf Prideaux, zum Teil eine Anspielung auf seine Geschicklichkeit als Selbstversorger und auf den Bewegungshunger, den sie ständig an ihm beobachteten. Wenn sie morgens vor Kälte zitternd an der Dusche Schlange standen, sahen sie schon Rhino die Coombe Lane heranstiefeln, wie er mit einem Rucksack auf dem Buckel von seinem Morgenmarsch zurückkam. Beim Zubettgehen konnten sie seinen einsamen Schatten durch das Kunstglasdach der Ballspielhalle erspähen, wo Rhino unermüdlich die Betonmauer attackierte. Und an warmen Abenden beobachteten sie ihn manchmal durch die Fenster des Schlafsaals beim Golfspielen, wobei er den Ball mit einem gräßlichen alten Schläger im Zickzack über den Platz trieb, oft, nachdem er ihnen aus einem besonders englischen Abenteuer-Buch vorgelesen hatte: Biggles, Percy Westerman oder Jeffrey Farnol, die er auf gut Glück aus der schäbigen Bibliothek geholt hatte. Sooft ein neuer Schlag fällig war, warteten sie auf das anfeuernde Grunzen beim Ausholen, und sie wurden selten enttäuscht. Sie führten genau Buch über seinen Leistungsstand. Beim Kricket-Match hatte er fünfundzwanzig geschafft, ehe er einen Ball absichtlich zu Spikely ins Aus schlug. »Fang ihn, du Knallfrosch, fang ihn, hüpf! Gut gemacht, Spikely, braver Junge, dafür bist du schließlich da.«
Außerdem wurde ihm, trotz seines Hanges zur Toleranz, eine gesunde Witterung für kriminelle Veranlagungen bescheinigt. Er hatte sie bereits mehrmals bewiesen, am überzeugendsten aber ein paar Tage vor Ferienbeginn, als Spikely in Jims Papierkorb den Entwurf für die morgige Klassenarbeit fand und reihum an Anwärter für jeweils fünf neue Pennies auslieh. Mehrere Jungen zahlten ihren Obolus und lernten die Antworten eine qualvolle Nacht hindurch beim Schein der Taschenlampen unter der Bettdecke auswendig. Als jedoch die Klassenarbeit geschrieben wurde, legte Jim ein völlig anderes Aufgabenblatt vor.
»Das da könnt ihr gratis haben«, bellte er und setzte sich hinters Pult. Und nachdem er seinen Daily Telegraph entfaltet hatte, widmete er sich in aller Ruhe den jüngsten Weisheiten der Juju-Männer, wie er, soviel die Jungens begriffen hatten, so ziemlich alle Leute mit intellektuellen Ansprüchen benannte.
Dann war die Sache mit der Eule passiert, die in ihrer Meinung über ihn einen besonderen Platz einnahm, denn dabei hatte der Tod eine Rolle gespielt, etwas, worauf Kinder verschieden reagieren. Da das Wetter unverändert kalt war, brachte Jim einen Eimer Kohlen mit ins Klassenzimmer, und an einem Mittwoch zündete er ein Feuer an, setzte sich mit dem Rücken davor und las ein dictée. Zuerst fiel ein bißchen Ruß durch den Kamin, was Jim nicht beachtete, dann kam die Eule herunter, eine ausgewachsene Schleiereule, die zu Dovers Zeiten gewiß manchen ungestörten Winter und Sommer hindurch dort oben genistet hatte und nun ausgeräuchert war, benommen und schwarz und erschöpft vom verzweifelten Herumschlagen im Rauchfang. Sie purzelte über die Kohlen und dann als zusammengesunkenes Häuflein auf den hölzernen Fußboden, flatterte und prustete noch ein bißchen und hockte dann da wie ein Teufelsbote, verkrümmt, aber atmend und glotzte aus starren, rußverklebten Augen auf die Jungens. Es war keiner unter ihnen, der sich nicht gefürchtet hätte; sogar Spikely, der Held, fürchtete sich. Nur nicht Jim, der den Vogel ohne viel Federlesens zusammenfaltete und wortlos mit ihm hinausging. Sie hörten nichts, obwohl sie die Ohren spitzten. Eine Weile später ertönte Wasserplätschern hinten im Korridor, wo Jim sich offenbar die Hände wusch. »Er war pinkeln«, sagte Spikely und erntete ein nervöses Gelächter. Aber als sie im Gänsemarsch das Klassenzimmer verließen, entdeckten sie, säuberlich gefaltet, säuberlich getötet, die Eule, die auf dem Misthaufen neben der Senke auf ihr Begräbnis wartete. Jemand hatte ihr, wie die Beherzteren feststellten, den Hals gebrochen. Nur ein Wildhüter, erklärte Sudeley, verstehe sich darauf, eine Eule so perfekt zu töten.
Im anderen Teil des Hauses Thursgood waren die Meinungen über Jim weniger ungeteilt. Der Geist Mr. Maltbys starb schwer. Matron erklärte ihn, genau wie es Roach tat, für heldenhaft und schutzbedürftig: es sei ein Wunder, daß er mit diesem Rücken das Leben meisterte. Marjoribanks sagte, er sei in betrunkenem Zustand unter einen Bus geraten. Es war auch Marjoribanks gewesen, der bei jenem für Jim so glorreichen Lehrermatch auf den Sweater hingewiesen hatte. Marjoribanks war kein Kricketspieler, war aber hinuntergegangen und hatte an Thursgoods Seite zugesehen.
»Glauben Sie, daß der Sweater koscher ist?« hatte er in scherzhaftem Tonfall gekräht, »oder glauben Sie, er hat ihn geklaut?«
»Leonard, das ist sehr unfair«, rügte Thursgood und klopfte seiner Labradorhündin die Flanken. »Beiß ihn, Ginny, beiß den bösen Mann.«
Aber als Thursgood dann wieder in seinem Arbeitszimmer war, hatte seine Heiterkeit sich gelegt, und er wurde äußerst nervös. Mit falschen Oxford-Leuten wußte er umzugehen, hatte er doch während seiner Amtszeit schon mit Altphilologen zu tun gehabt, die kein Griechisch konnten, und mit Geistlichen, die keinen Schimmer von Theologie hatten. Wenn man solche Burschen mit den Beweisen für ihren Betrug konfrontierte, so brachen sie zusammen, weinten und gingen fort, oder sie blieben für das halbe Gehalt. Männer jedoch, die ihre tatsächlichen Fertigkeiten geheimhielten, gehörten einer unbekannten Spezies an, von der er nur wußte, daß er sie nicht mochte. Nachdem er im Universitäts-Almanach nachgeschlagen hatte, rief er die Agentur an, einen gewissen Mr. Stroll.
»Um welche bestimmte Information geht es?« fragte Mr. Stroll unter gräßlichem Röcheln.
»Um keine bestimmte.« Thursgoods Mutter saß über einer Näharbeit und schien nicht zuzuhören. »Nur, wenn man einen schriftlichen Lebenslauf anfordert, dann möchte man einen vollständigen. Der keine Lücken aufweist. Nicht, wenn man die volle Gebühr bezahlt.«
An dieser Stelle kam Mr. Thursgood der verzweifelte Verdacht, er habe Mr. Stroll aus einem Schlummer geweckt, in den sein Gesprächspartner nun wieder zurückgesunken sei. »Ein sehr patriotisches Haus«, bemerkte Mr. Stroll endlich.
»Ich habe ihn nicht wegen seines Patriotismus engagiert.«
»Er war im Krankenhaus«, keuchte Mr. Stroll weiter wie durch greuliche Schwaden von Zigarettenrauch. »Bettlägerig. Rückenmark.«
»Meinetwegen. Aber ich nehme an, er hat nicht die ganzen letzten fünfundzwanzig Jahre im Spital verbracht. – Touché«, flüsterte er seiner Mutter zu und hielt die Hand über die Sprechmuschel, und wiederum fragte er sich, ob Mr. Stroll nicht eingeschlafen sei.
»Sie haben ihn bloß bis Quartalsende«, rasselte Mr. Stroll endlich. »Wenn er Ihnen nicht paßt, feuern Sie ihn. Sie wollten eine Aushilfe, Sie haben eine Aushilfe gekriegt. Sie wollten was Billiges, Sie haben was Billiges gekriegt.«
»Sei dem, wie ihm wolle«, entgegnete Thursgood unverzagt, »aber ich habe Ihnen eine Gebühr von zwanzig Guineas gezahlt, mein Vater hat viele Jahre lang mit Ihnen gearbeitet, und ich habe ein Recht auf verbindliche Auskünfte. Sie schreiben hier – darf ich vorlesen? – Sie schreiben hier, vor seiner Versetzung auf verschiedenen Auslandsposten mit kommerziellen Angelegenheiten und Recherchen beschäftigt. Das gibt doch wirklich wenig Aufschluß über sein Berufsleben, wie?«
Die Mutter nickte beipflichtend über ihrer Näharbeit. »Überhaupt keinen«, sagte sie laut.
»Das wäre das erste. Ich möchte aber noch einiges.«
»Nicht zu viel, Darling«, warnte seine Mutter.
»Ich weiß zufällig, daß er anno 1938 in Oxford war. Warum hat er nicht fertig gemacht? Was ist schiefgegangen?«
»Ich vermeine mich zu entsinnen, daß es um jene Zeit ein Zwischenspiel gegeben hat«, sagte Mr. Stroll nach einem weiteren Jahrhundert. »Aber Sie sind wohl zu jung, um sich daran zu erinnern.«
»Er kann schließlich nicht die ganze Zeit im Gefängnis gesessen haben«, sagte seine Mutter nach sehr langem Schweigen, ohne von ihrer Arbeit aufzublicken.
»Er hat irgendwo gesteckt«, sagte Thursgood erbittert, und starrte über die windgepeitschten Gärten hinweg zur Senke.
Während der ganzen Sommerferien, in denen er sich mühselig zwischen dem einen und dem anderen Haushalt hin und her bewegte, zwischen freudigem Willkommen und Zurückweichen, machte Bill Roach sich Sorgen über Jim, ob sein Rücken schmerzte, wie er sich jetzt Geld verdiente, nachdem er niemanden mehr zu unterrichten und nur das Gehalt für ein halbes Quartal zum Leben hatte; und vor allem, ob er noch da sein würde, wenn das neue Quartal beginnen würde; denn er hatte das vage Gefühl, Jim lebe so gefährlich auf der Weltoberfläche, daß er jeden Augenblick herunter und ins Leere stürzen könnte; denn er befürchtete, Jim könne, wie er selber, von keiner natürlichen Schwerkraft festgehalten werden. Er rief sich ihre erste Begegnung wieder ins Gedächtnis, insbesondere die Frage nach seinen Freunden, und er bekam eine Heidenangst, daß er nicht nur die Liebe seiner Eltern, sondern auch die Zuneigung Jims verspielt hatte, vor allem wegen ihres Altersunterschieds. Und daß Jim daher weitergezogen war und sich bereits anderswo nach einem Gefährten umsah, die blassen Augen in anderen Schulen umherschweifen ließ. Er stellte sich ferner vor, daß Jim, genau wie er selber, eine tiefgehende Bindung gehabt hatte, die ihn enttäuscht hatte und für die er einen Ersatz suchte. Aber hier war Bill Roach mit seinem Latein am Ende: Er hatte keine Ahnung, wie Erwachsene einander liebten. Er konnte praktisch so wenig für ihn tun. Er schlug in einem medizinischen Werk nach und fragte seine Mutter über Bucklige aus, und er hätte zu gerne eine Flasche von seines Vaters Wodka mitgehen lassen, um sie im Thursgood als Köder auszulegen, aber er getraute sich nicht. Und als ihn schließlich der Chauffeur seiner Mutter an den verhaßten Stufen absetzte, blieb er nicht einmal mehr stehen, um sich zu verabschieden, sondern rannte, so schnell er konnte, zum Rand der Senke, und da stand zu seiner grenzenlosen Freude Jims Wohnwagen noch immer am alten Platz in der Mulde, um eine Nuance verdreckter, und daneben war ein frischer Erdhaufen aufgeschüttet, für Wintergemüse. Und Jim saß auf der Stufe, grinste zu ihm auf, als hätte er Bill kommen hören und das Willkommen-Grinsen schon bereit gehabt, ehe Bill am Rand der Senke erschienen war.
In diesem Quartal erfand Jim einen Spitznamen für Roach. Anstatt Bill nannte er ihn nur noch Jumbo. Er gab dafür keinen Grund an, und Roach war, wie dies bei Taufen üblicherweise der Fall ist, nicht in der Lage, Einspruch zu erheben. Dafür ernannte Roach sich selber zu Jims Beschützer, als Ersatzmann für Jims verschwundenen Freund, wer immer dieser Freund gewesen sein mochte.
2
George Smiley entdeckt, daß unerwünschte Gesellschaft deprimierender ist als gar keine
Im Gegensatz zu Jim Prideaux war Mr. George Smiley von der Natur nicht für Eilmärsche im Regen ausgerüstet, schon gar nicht mitten in der Nacht. Er hätte, genau gesagt, die Endform sein können, für die Bill Roach der Prototyp war. Der kleine, rundliche und, schonend ausgedrückt, mittelalte Mann gehörte dem Aussehen nach zu Londons Sanftmütigen, die nicht das Erdreich besitzen werden. Seine Beine waren kurz, sein Gang war alles andere als beschwingt, die Kleidung teuer, schlechtsitzend und ungemein durchnäßt. Sein Mantel, der etwas von einer Witwentracht an sich hatte, war aus jenem schwarzen lockeren Gewebe, das wie geschaffen ist, den Regen aufzusaugen. Entweder waren die Ärmel zu lang oder seine Arme zu kurz, denn wie bei Roach, wenn er seinen Regenmantel trug, verschwanden die Finger fast in den Stulpen. Aus Eitelkeit trug er keinen Hut, da er zu Recht annahm, daß Hüte ihn lächerlich machten: »Wie ein Eierwärmer«, hatte seine schöne Frau bemerkt, nicht lange, ehe sie ihn das letzte Mal verlassen hatte, und ihre Kritik war ihm, wie so oft, geblieben. So hatte der Regen sich in großen, nicht abzuschüttelnden Tropfen auf seinen dicken Brillengläsern gesammelt und zwang ihn, den Kopf abwechselnd zu senken oder in den Nacken zu werfen, während er den Gehsteig vor den geschwärzten Arkaden der Victoria Station entlangeilte. Er war auf dem Weg nach Westen, zur Freistatt in Chelsea, seiner Wohnung. Sein Schritt war aus irgendeinem Grund eine Spur unsicher und wäre Jim Prideaux aus dem Schatten auferstanden und hätte ihn gefragt, ob er Freunde habe, so hätte er wahrscheinlich geantwortet, ein Taxi wäre ihm lieber.
»Ein Schwätzer, dieser Roddy«, brabbelte er vor sich hin, als ein neuerlicher Wasserschwall gegen seine ausladenden Backen klatschte und dann in sein durchweichtes Hemd rann. »Warum bin ich nicht einfach aufgestanden und gegangen?«
Zerknirscht rief Smiley sich noch einmal die Gründe für sein augenblickliches Elend in den Sinn und kam mit einer vom demütigen Teil seines Charakters untrennbaren Sachlichkeit zu dem Schluß, daß er sie ausschließlich selber geliefert hatte.
Es war von Anfang an ein vertrackter Tag gewesen. Er war zu spät aufgestanden, nachdem er am Vortag bis spät in die Nacht hinein gearbeitet hatte, eine Gewohnheit, die sich trotz seines hartnäckigen Widerstands eingenistet hatte, seit er im Jahr zuvor aus dem Dienst ausgeschieden war. Dann hatte er entdeckt, daß ihm der Kaffee ausgegangen war, und sich im Laden angestellt, bis ihm auch die Geduld ausging und er hochgemut beschloß, sich der Regelung seiner geschäftlichen Angelegenheiten zu widmen. Sein Bankauszug, der mit der Morgenpost gekommen war, hatte ihm gezeigt, daß seine Frau den Löwenanteil seiner monatlichen Pension abgehoben hatte: Na schön, entschied er, dann würde er irgend etwas verkaufen. Die Reaktion war unsinnig, denn er stand sich recht gut, und die obskure City-Bank, auf die seine Pension überwiesen wurde, zahlte sie ihm regelmäßig aus. Dennoch verpackte er eine frühe Grimmelshausen-Ausgabe, einen bescheidenen Schatz aus den Oxforder Jahren, und machte sich feierlich auf den Weg zu Heywood Hills Buchhandlung in der Curzon Street, wo er mit dem Inhaber dann und wann freundschaftliche Gelegenheitskäufe ausfeilschte. Unterwegs steigerte er sich noch mehr in seinen Unmut hinein und traf von einer Telefonzelle aus eine Verabredung mit seinem Anwalt für den Nachmittag.
»George, wie können Sie so vulgär sein? Von Ann läßt man sich nicht scheiden. Schicken Sie ihr ein paar Blumen nach und kommen Sie zum Lunch.«
Dieser Rat richtete ihn auf, und frohen Herzens näherte er sich Heywood Hill, nur um Roddy Martindale, der vom wöchentlichen Haarschnitt kam, geradewegs in die Arme zu laufen.
Martindale hatte keinen legitimen Anspruch auf Smiley, weder beruflich noch gesellschaftlich. Er arbeitete auf der nahrhaften Seite des Foreign Office, und seine Aufgabe bestand darin, auswärtige Würdenträger zum Lunch zu führen, die kein Mensch sonst auch nur in seinen Holzschuppen eingeladen hätte. Er war ein flatterhafter Junggeselle mit grauer Mähne und jener Behendigkeit, wie sie nur Dicke haben. Er hatte ein Faible für Knopflochblumen und zartfarbene Anzüge, und er machte sich unter fadenscheinigsten Begründungen einer intimen Vertrautheit mit den großen rückwärtigen Räumen von Whitehall anheischig. Vor ein paar Jahren, kurz vor ihrer Auflösung, hatte er eine untergeordnete Whitehall-Gruppe zur Koordinierung von Nachrichten seiner Mitwirkung gewürdigt. Während des Krieges war er dank einer gewissen mathematischen Begabung in die Randbereiche der Geheimwelt eingedrungen; und einmal hatte er, wie er zu berichten nie müde wurde, zusammen mit John Landsbury vom Circus an einer höchst delikaten Chiffriersache gearbeitet. Aber der Krieg lag, wie Smiley sich zuweilen selber in Erinnerung rufen mußte, dreißig Jahre zurück.
»Hallo Roddy«, sagte Smiley. »Nett, Sie zu sehen.«
Martindale sprach mit jenem dröhnenden Von-Mann-zu-Mann-Ton der Oberklasse, der Smiley bei Urlaubsaufenthalten im Ausland mehr als einmal aus seinem Hotel vertrieben hatte: »Mein lieber Junge, wenn das nicht der Maestro persönlich ist! Mir hat man gesagt, sie säßen bei den Mönchen in St. Gallen oder sonstwo und schwitzten über alten Handschriften! Gestehen Sie auf der Stelle. Ich will genau wissen, was Sie treiben, jede kleinste Einzelheit. Geht es Ihnen gut? Lieben Sie England noch immer? Was macht die entzückende Ann?« – sein unsteter Blick flackerte die Straße auf und ab, ehe er auf dem eingewickelten Grimmelshausen unter Smileys Arm zur Ruhe kam – »eins zu hundert, daß das ein Geschenk für sie ist. Hab’ schon gehört, daß Sie sie maßlos verwöhnen.« Er senkte die Stimme zu vernehmlichem Flüstern: »Hören Sie, Sie sind doch nicht wieder auf Kriegspfad? Sollte das alles nur Tarnung sein, George, nur Tarnung?« Seine feuchte Zunge fuhr rasch in die Winkel des kleinen Mündchens, dann verschwand sie wie eine Schlange zwischen den Wülsten.
So beging Smiley die Torheit, sich durch das Versprechen loszukaufen, daß sie noch am gleichen Abend gemeinsam am Manchester Square in einem Club essen würden, dem sie beide angehörten, den Smiley jedoch mied wie die Pest, nicht zuletzt, weil Martindale dort Mitglied war. Am Abend war er noch immer knüppelsatt vom Lunch im White Tower, denn sein Anwalt, ein alter Genießer, hatte entschieden, daß nur eine gewaltige Mahlzeit George von seinen Depressionen heilen könne. Martindale war, wenn auch auf einem anderen Weg, zur gleichen Entscheidung gelangt, und vier endlose Stunden lang hatten sie sich, bei Speisen, die Smiley anwiderten, Namen zugeworfen, als wären sie vergessene Fußballer: Jebedee, Smileys einstiger Tutor: »Ein schwerer Verlust für uns, weiß der Teufel«, murmelte Martindale, der, soviel Smiley wußte, Jebedee noch nicht einmal vom Sehen gekannt hatte. »Und so begabt für das Spiel, was? Einer der wirklich Großen, sag’ ich immer.« Dann Fielding, der Altfranzose in Cambridge: »Ach, dieser köstliche Sinn für Humor. Scharfer Denker, ganz scharf!« Dann Sparke, der Orientalist, und schließlich Steed-Asprey, der eben diesen Club gegründet hatte, um Nervensägen wie Roddy Martindale zu entkommen. »Ich kannte seinen armen Bruder, wissen Sie, halb soviel im Kopf und das Doppelte an Muskeln. Alles Hirn ging an den andern, weiß Gott.«
Und Smiley hatte sich durch den Alkoholdunst diesen Unsinn angehört, »ja« und »nein« gesagt und »ein Jammer«, und »nein, er wurde nie gefunden«, und einmal zu seiner lebenslänglichen Beschämung, »na, na, Sie schmeicheln mir«, bis Martindale mit fataler Unabwendbarkeit auf aktuellere Ereignisse zu sprechen kam, auf den Machtwechsel und Smileys Ausscheiden aus dem Amt.
Wie vorherzusehen war, begann er mit Controls letzten Tagen: »Ihr alter Boß, George, Teufel nochmal, der einzige, der je seinen Namen geheimgehalten hat. Natürlich nicht vor Ihnen: vor Ihnen hatte er nie Geheimnisse, George, nicht wahr? Ein Herz und eine Seele, Smiley und Control, heißt es, bis ans Ende.«
»Zuviel der Ehre.«
»Zieren Sie sich nicht, George, ich bin ein alter Hase, vergessen Sie das nicht. Sie und Control waren so miteinander.« Die plumpen Finger deuteten kurz zwei verschlungene Ringe an. »Deshalb sind Sie auch geflogen, machen Sie mir nichts vor, und deshalb hat Bill Haydon Ihren Job gekriegt. Deshalb ist er Percy Allelines Mundschenk, und nicht Sie.«
»Wenn Sie’s sagen, Roddy.«
»Das tue ich. Ich sage noch mehr. Viel mehr.«
Als Martindale sich näher zu ihm beugte, erhaschte Smiley den Hauch einer der kultiviertesten Trumperschen Duft-Kreationen.
»Ich sage noch folgendes: Ich sage, Control ist überhaupt nicht gestorben. Er wurde unlängst gesehen.« Mit einer flatternden Handbewegung erstickte er Smileys Proteste. »Lassen Sie mich ausreden. Willy Andrewartha hat ihn im Flughafengebäude von Johannesburg, in der Wartehalle, aus nächster Nähe gesehen. Keinen Geist. Fleisch und Blut. Willy kauft sich an der Bar ein Sodawasser gegen die Hitze, Sie haben Willy lang nicht mehr gesehen, er ist ein Faß. Er dreht sich um, und da steht Control direkt neben ihm, in so einem gräßlichen Burenkostüm. Sowie er Willy sieht, wird er schneeweiß und stürzt davon. Wie finden Sie das? Jetzt wissen wir also Bescheid, wie? Control ist überhaupt nicht gestorben. Er wurde von Percy Alleline und seiner Drei-Mann-Kapelle verjagt und hat sich nach Südafrika abgesetzt, Teufel nochmal. Na ja, man kann’s ihm nicht verübeln, wie? Man kann’s einem Menschen nicht verübeln, daß er an seinem Lebensabend noch ein bißchen Frieden möchte. Ich jedenfalls nicht.«
Die Ungeheuerlichkeit dieses Gerüchts, das durch einen immer dicker werdenden Wall geistiger Erschöpfung zu ihm drang, verschlug Smiley einen Augenblick die Rede.
»Das ist doch lächerlich! Das ist die idiotischste Geschichte, die ich je gehört habe! Control ist tot. Er starb nach langer Krankheit an Herzversagen. Außerdem haßte er Südafrika. Er haßte jeden Ort mit Ausnahme von Surrey, dem Circus und Lords Cricket Ground. Wirklich, Roddy, Sie dürfen solche Gerüchte nicht verbreiten.«
Er hätte hinzufügen können, ich hab’ ihn selbst eingescharrt, in einem lausigen Krematorium im East End, am letzten Heiligen Abend, allein. Der Pfarrer hatte einen Sprachfehler.
»Willy Andrewartha war schon immer der gottverdammteste Lügner«, überlegte Martindale gänzlich ungerührt. »Ich sagte genau das gleiche zu ihm: purster Unsinn, Willy, Sie sollten sich schämen.« Und nahtlos weiter, als hätte er niemals in Gedanken oder Worten diese alberne Annahme geteilt: »Der Tschechen-Skandal, der war wohl der letzte Nagel zu Controls Sarg. Der arme Kerl, der in den Rücken geschossen wurde und in die Zeitungen kam, und der angeblich immer so dick mit Bill Haydon war. Ellis mußten wir ihn nennen, und so nennen wir ihn noch, nicht wahr, auch wenn wir seinen wirklichen Namen so gut kennen wie unsern eigenen.«
Listig wartete Martindale, daß Smiley seinen Trumpf daraufsetzte: Aber Smiley war nicht gesonnen, auf irgend etwas irgendeinen Trumpf zu setzen, also versuchte Martindale eine dritte Tour:
»Irgendwie finde ich Percy Alleline als Chef nicht recht glaubhaft, Sie etwa? Ist es das Alter, George, oder nur mein angeborener Zynismus? Sagen Sie’s mir, Sie sind ein so guter Menschenkenner. Ich glaube, Macht paßt einfach nicht zu Leuten, mit denen man aufgewachsen ist. Könnte das die Lösung sein? Es gibt so wenige, die mir heutzutage noch imponieren können, und der arme Percy ist ein so durchsichtiger Mensch, finde ich immer, vor allem nach diesem Reptil, Control. Diese ganze kernige Kumpanei, wie kann man so jemanden ernst nehmen? Man muß sich nur an ihn erinnern, wie er in den alten Tagen an der Bar im Travellers lungerte, an seiner Stummelpfeife nuckelte und den großen Tieren Drinks spendierte: also, wenn einer schon intrigieren muß, sollte er’s raffinierter anfangen, meinen Sie nicht auch? Oder finden Sie, daß der Erfolg die Mittel heiligt? Was ist sein Trick, George, sein Geheimrezept?« Er sprach mit höchster Eindringlichkeit, beugte sich mit gierigen und erregten Augen über den Tisch. Nur Essen konnte ihn normalerweise in solche Erregung versetzen. »Sich mit den Fähigkeiten seiner Untergebenen schmücken, das ist wohl heutzutage das Führungsprinzip.«
»Wirklich, Roddy, ich kann Ihnen nicht helfen«, sagte Smiley matt. »Ich habe Percy nie als Größe gekannt. Nur als –« Er fand das Wort nicht mehr.
»Als Gernegroß«, half Martindale mit glitzernden Augen aus, »immer mit einem Auge auf Controls Purpurkleid, Tag und Nacht. Jetzt trägt er es, und der Mob liebt ihn. Wer ist also sein starker linker Arm, George? Wer verdient ihm seine Lorbeeren? Er macht sich fabelhaft, hört man von allen Seiten. Kleine Lesesäle in der Admiralität, kleine Ausschüsse mit komischen Namen schießen aus dem Boden, roter Teppich für Percy in allen Whitehall-Korridoren, die sein Fuß betritt, jüngere Mitarbeiter werden von oberster Stelle beglückwünscht, Leute, von denen man nie gehört hat, kriegen Orden für nichts und wieder nichts. Ich hab’ das alles schon mal gesehen, wissen Sie.«
»Roddy, ich kann Ihnen nicht helfen«, wiederholte Smiley und schickte sich an, aufzustehen. »Sie überfordern mich, ehrlich.« Aber Martindale zwang ihn, sitzen zu bleiben, hielt ihn mit einer feuchten Hand am Tisch fest, während er noch schneller auf ihn einsprach.
»Also wer ist der Pfiffikus? Percy nicht, das steht fest. Und sagen Sie nicht, die Amerikaner vertrauten uns auf einmal wieder.« Der Griff wurde härter. »Das kluge Kind Bill Haydon: unser moderner Lawrence von Arabien. Genau, Bill ist es, Ihr alter Rivale.« Martindales Zunge streckte wiederum den Kopf heraus, erkundete das Terrain und zog sich zurück, wobei sie eine kleine Schneckenspur hinterließ. »Ich habe gehört, Sie und Bill hätten einst alles miteinander geteilt«, sagte er. »Orthodox war er ja nie, was? Genies sind das niemals.«
»Noch einen Wunsch, Mr. Smiley?« fragte der Kellner.
»Oder Bland: der letzte Strohhalm der Nation, der Akademiker aus der Proleten-Presse.« Noch immer wollte er nicht lockerlassen. »Und wenn diese beiden nicht den Laden schmeißen, dann ist es jemand im Ruhestand, wie? Ich meine, jemand, der angeblich im Ruhestand ist, ja? Und wenn Control tot ist, wer bleibt dann noch übrig? Außer Ihnen?«
Sie zogen ihre Mäntel an. Der Garderobier war schon heimgegangen, sie mußten sich selber von den braunen Ständern bedienen.
»Roy Bland ist nicht aus der Proleten-Presse«, sagte Smiley laut. »Er war am St. Anthony’s College in Oxford, wenn Sie’s genau wissen wollen.«
Gott sei mir gnädig, etwas Besseres ist mir nicht eingefallen, dachte Smiley.
»Seien Sie doch nicht albern, mein Lieber«, fuhr Martindale ihn an. Smiley hatte ihn gelangweilt, er schaute mürrisch drein und wie jemand, den man übers Ohr gehauen hatte, traurige senkrechte Falten hatten sich in der unteren Wangenpartie gebildet. »Natürlich ist St. Anthony’s eine Proleten-Presse. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß in der gleichen Straße eine Elite ausgebildet wird. Oder daß Bland Ihr Protegé war. Jetzt ist er vermutlich Bill Haydons Protegé – geben Sie ihm kein Trinkgeld, ich habe eingeladen, nicht Sie. Bill ist ihnen allen ein Vater, immer gewesen. Zieht sie an wie Bienen. Nun ja, er hat eben etwas Strahlendes, das, was manchen von uns fehlt. Star-Qualität nenne ich es, einer der wenigen. Es heißt, die Frauen liegen ihm buchstäblich zu Füßen, und das ist noch das wenigste.«
»Gute Nacht, Roddy.«
»Vergessen Sie nicht, Ann zu grüßen.«
»Bestimmt nicht.«
»Ich will’s hoffen.«
Und jetzt goß es in Strömen. Smiley wurde naß bis auf die Haut, und Gott hatte zur Strafe sämtliche Taxis vom Antlitz Londons getilgt.
3
George Smiley kommt vom Regen in die Traufe
»Purer Mangel an Willenskraft«, schalt er sich und lehnte das Anerbieten einer Dame unter der Tür dankend ab. »Man nennt es Höflichkeit, aber in Wahrheit ist es nur Schwäche. Martindale, du Strohkopf. Du aufgeblasener, falscher, weibischer, nichtsnutziger …« Mit einem weiten Schritt setzte er über ein vermutetes Hindernis hinweg. »Schwäche«, wiederholte er, »und die Unfähigkeit, ein erfülltes Leben unabhängig von Institutionen zu führen …«, eine Pfütze entleerte sich säuberlich in seinen Schuh, »und emotionale Bindungen, die ihren Sinn längst überlebt haben. Als da sind meine Frau, der Circus, mein Leben in London. Taxi!«