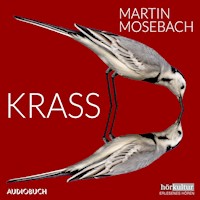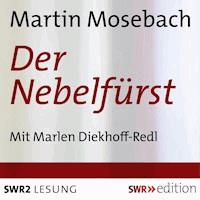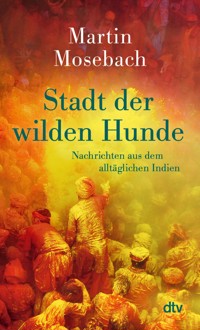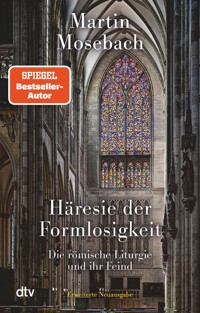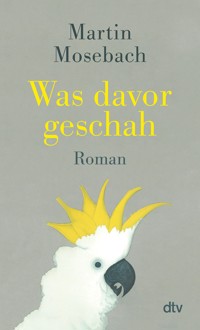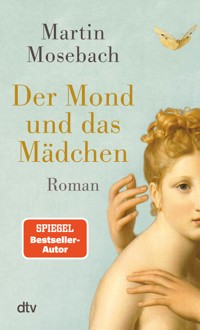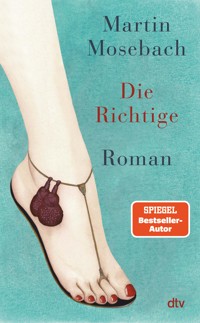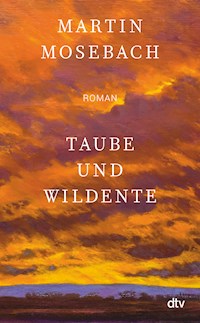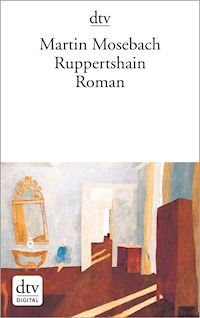8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman einer verrückten Liebe und eine herrliche Persiflage auf den Kunst- und Architekturbetrieb Der Aufzug führt unmittelbar in den siebten Stock. Als sich seine Schiebetür sich öffnet, steht der Erzähler im gleißenden Licht einer modernen Architektenwohnung. Doch was ihm noch mehr Eindruck macht als der berühmte Mann, für den er arbeiten soll, ist dessen Tochter Manon. Er verliebt sich in sie, sie ist ihm allerdings nicht treu. So entschließt er sich zur Flucht und nimmt den Auftrag an, einen indischen Königspalast in ein modernes Hotel umzubauen. Aber Manon folgt ihm.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Aufzug führt unmittelbar in den siebten Stock. Als sich eine Schiebetür öffnet, steht der Erzähler im gleißenden Licht einer modernen Architektenwohnung. Doch was ihm noch mehr Eindruck macht als der berühmte Mann, für den er arbeiten soll, ist dessen Tochter Manon. Er verliebt sich in sie, sie ist ihm allerdings nicht treu. So entschließt er sich zur Flucht und nimmt den Auftrag an, einen indischen Königspalast in ein modernes Hotel umzubauen. Aber Manon folgt ihm.
Virtuos spielt Mosebach mit dem Unglück und seiner Komik und erzählt eine aufregende Geschichte von in sich zusammenfallenden Machtverhältnissen.
Von Martin Mosebach ist bei dtv außerdem lieferbar:
Das Bett
Rotkäppchen und der Wolf
Stadt der wilden Hunde
Ruppertshain
Der Mond und das Mädchen
Was davor geschah
Häresie der Formlosigkeit
Taube und Wildente
Die Richtige
Martin Mosebach
Das Beben
Roman
Erstes BuchManon
1.
Unterirdische Verbindung
Der Aufzug führte vom Parterre unmittelbar in den siebten Stock. Als die Schiebetür sich öffnete, umgab mich Licht aus großen Fensterscheiben, das von allen Seiten im Überfluß herabfiel. In dieser Raumlosigkeit hatte der Ankömmling das Gefühl, in den Himmel oder jedenfalls auf ein schwindelnd hohes, im Winde schwankendes Aluminiumgerüst hinaufgeschossen zu sein. Vor mir tat sich eine luftige Treppe auf, zwischen deren Stufen man auf ein tiefergelegenes Stockwerk und weitere Treppen hinabblickte. Hier oben schien die Welt nur aus Treppen zu bestehen. Die Stufen schwangen leicht, wenn man sie betrat, ein heller, metallischer Ton erklang. Die Wipfel der Kastanien lagen beträchtlich unter mir. In der Tiefe wogten grüne Wolken. Dies war eine Architektenwohnung, vor Jahrzehnten schon in der Absicht geschaffen, den Stil ihres Meisters besonders rein darzustellen, so kompromißlos, wie man nur bauen kann, wenn nicht die Bedenken eines Bauherren unablässig die schönsten Pläne durchkreuzen. Die Wohnung war als Museum für die Sammlung ihres Schöpfers konzipiert.
»Ich brauche keine Wände für Bilder, ich brauche Lichträume um meine Objekte«, hatte er in jenem Aufsatz geschrieben, der seine Wohnung in einer Architekturzeitschrift vorstellte, und diese Objekte waren afrikanische Masken und Figuren in einer Fülle, als habe hier hoch über der Stadt ein ganzes schwarzes Volk angesiedelt werden sollen. Man kennt das gesprungene Holz solcher Plastik, die Stricke aus zerfaserndem Hanf, die Zähne, Muscheln, Knochen, die in sie hineingearbeitet sind. Diese Roheit und Bäuerlichkeit des Materials war nun von lauter Glas umgeben, stand auf Plexiglasstelen, schwebte an unsichtbaren Fäden von der Decke, lehnte sich an spiegelblank polierte Aluminiumwände. Die dicken Augenlider der Masken, die zu schwer waren, um sich für mehr als einen Sehschlitz zu heben, die Körperchen in der hockenden Haltung von verwachsenen Zwergen mit übergroßen Geschlechtsteilen, die von Narben geschmückten Frauenkörper mit Zitzenbrüsten waren in eine gleichsam ärztliche Sphäre von Wissen und Reinheit gehoben, fern vom Schweiß der nächtlichen Tänze, vom Wummern der Trommeln und den Ritualen der Beschwörung, für die sie geschaffen worden waren. Zwischen den afrikanischen Holzgebilden standen japanische jadegrüne Keramiken auf ihren Glaswürfeln.
Dies war das Haus des Seniorpartners von Kross & Gran, dem größten und wirtschaftlich potentesten Architekturbüro, mit dem ich je zu tun hatte. Er hatte das industrialisierte Bauen noch als die Riesenaufgabe erlebt, die es war: Ganzen Kontinenten ein neues Gesicht zu geben. Sein Teil waren Flughäfen gewesen, Messehallen, neue Städte, Riesenschlangengeflechte von Autobahnen, kleinteiliger Planung hatte er sich selten widmen können, und um so wichtiger war dies private Gehäuse für ihn geworden, seine Teilhabe am Künstlertum der neuen Ideen. Ich hadere nicht mehr mit diesem Geschmack, er ist eine Generationenfrage. Wenn wir anfangen, etwas nicht mehr schön zu finden, heißt das nur, daß Menschen eines bestimmten Jahrgangs in die Minderheit geraten. Dort befand Herr Gran sich schon eine ganze Weile, aber obwohl von den Geschäften zurückgezogen, war er immer noch einflußreich und mächtig. Daß ich zum Tee im Hause Gran gebeten wurde, war eine hohe Ehre. Gran bekundete manchmal den Wunsch, mit gegenwärtig laufenden Projekten seiner Sozietät vertraut gemacht zu werden – er wolle »noch einmal ein bißchen Pulverdampf riechen«, nannte er das. Oft enthielten solche Einblicknahmen für ihn Enttäuschungen und Beunruhigungen, die seine Frau fürchtete, und sie versuchte, hinter den Kulissen, wie sie sagte, bei den Geschäftsführern um Behutsamkeit zu werben.
»Er wird im April fünfundachtzig.«
Frau Gran war viel jünger als ihr Mann, der nur junge Frauen mochte und schon dreimal geschieden war. Diese Vorliebe hatte ihn Geld gekostet, ihm aber auch den Ansporn gegeben, noch mehr zu verdienen, vor allem aber die Fähigkeit dazu.
»Eine junge Ehefrau hat mich selbst immer um Jahrzehnte verjüngt«, sagte er noch jetzt gern, indem er mit seinem Gebiß spielte und die gebräunte, von Aderngeflecht überwölbte Hand fest auf den gleichfalls gebräunten Arm seiner Frau legte. Frau Gran jedoch war von dem Zusammenleben mit dem immer gebrechlicher werdenden Greis gezeichnet. Sie war erst sechzig, aber die Sorgen um seine Verdauung, auch das Gehen mit kleinen Schritten ließen sie trotz ihres glänzend konservierten Zustandes furchtsam und ältlich erscheinen. Wenn sie ihn begleitete und eben längst nicht mehr an seinem Arm geführt wurde, sondern selbst zu führen hatte, hielt sie nach Stufen und Teppichfalten Ausschau, die ihn stürzen lassen könnten. Sorgenvoll waren ihre Augenbrauen zusammengezogen, und ihr Blick flehte gleichsam die ganze Welt an, Herrn Gran mit Katastrophennachrichten zu verschonen. Ihr Blond war alterslos, unversehrt wie das Haar einer Jungfrau, die nach Jahrhunderten im Sarg völlig unverwest aufgefunden wird. Der leichte Schritt, mit dem sie mir entgegenkam, hallte im metallenen Treppenhaus. Sie ging mir voraus, bis sich das lichte Raumdurcheinander in eine langgestreckte Halle ordnete, mit einer asymmetrisch geformten Feuerstelle aus unebenen Schieferplatten. Hier befand sich das Sanktuarium für eine phallische Gottheit mit mageren Kinderärmchen, Turmschädel und Kugelbauch aus ausgedörrtem Holz, das vielleicht länger unter Wasser gelegen hatte. Auf einem Schiefertisch war ein Teetablett aus altem Silber, mit großer Teekanne und schönen Tassen aus dem 18. Jahrhundert vorbereitet. Frau Gran setzte sich auf die Kante eines vier Meter langen Ledersophas, ein zartgliedriger Vogel, der nichts braucht als seine Stange, um sich festzuklammern, und schenkte den Tee mit großer Vorsicht ein. Er war rotgolden wie alter Cognac. In diesen Räumen wirkten Farben, wenn sie denn überhaupt auftraten, um so stärker.
»Mein Mann hat sich heute morgen aufgeregt«, sagte sie gedämpft, als wolle sie vermeiden, daß Unbefugte mithörten, und tatsächlich gab es in dieser Wohnung keine Türen.
»Unsere Tochter ist der Augapfel meines Mannes. Er kann sich nicht daran gewöhnen, daß sie nun schon längst kein kleines Mädchen mehr ist und ihre eigenen Wege geht. Deshalb hat es heute Vormittag eine kleine Auseinandersetzung gegeben – in Liebe natürlich, meine Tochter liebt ihren Vater womöglich noch mehr als er sie, aber sie hat seinen Kopf geerbt, und von einem gewissen Alter an kann auch Liebe sehr anstrengend sein.« Daß Herr Gran mich empfangen wolle, sei gut und schön, für mich natürlich ein kostbares Erlebnis, dessen mich gewiß niemand berauben wolle, aber sie sehe ihre Aufgabe vor allem darin, zu bremsen, wo Gran seine Kräfte nicht ganz richtig einschätze. Auch ich wünschte doch selbstverständlich nicht, daß Gran nach anregendem – allzu anregendem – Gespräch mit mir später noch stundenlang vor Husten nicht einschlafen könne.
Ich sah diese Worte als den höflichen, aber bestimmten Versuch, mich zum sofortigen Aufbruch zu bewegen. In Grans kritischem Zustand durfte nichts riskiert werden, was das kostbare Lebensrestchen bedroht hätte.
»Nein, wenn Sie jetzt gingen, machten Sie alles nur schlimmer«, sagte sie beschwörend und legte mir kräftig die kühlen Finger auf die Hand. »Herr Gran würde nicht verstehen, was geschehen ist, und mich beschuldigen, Sie vertrieben zu haben. Und dann wäre der Husten erst recht unvermeidlich.« Sie bat mich um meine Mitwirkung bei einer »kleinen Verschwörung«. Sie werde das Gespräch im Auge behalten, und wenn sie bemerke, daß Herr Gran sich anstrenge, werde sie ihn fragen, ob er seine Tropfen schon genommen habe – und auf dieses Zeichen hin könne ich mich mühelos verabschieden, denn das Tropfeneinnehmen sei stets eine Ruptur, in der Herr Gran die Kraft nicht finden werde, seine Medikamente zu sich zu nehmen und gleichzeitig den Gast am Gehen zu hindern.
Fern rollte dunkler Husten, dem es wohl gelang, den Schleim in den Bronchien zu lockern. Unhörbar waren Grans Schritte. Er schob sich auf englischen Samtpumps voran, das dicke gelbe Malakkarohr, auf das er sich stützte, war mit einem Gummipfropfen ausgerüstet. Bei Gran mischte sich Hinfälligkeit mit Geputztheit. Sein Tweedanzug war weit und von individuellem, gemeinsam mit dem Schneider erarbeitetem Schnitt, die erdbeerfarbene Krawatte sandte Lebenslust- und Frühlingshauch-Signale aus, aber die Gesichtshaut war papierdünn, und die verbliebenen Härchen lagen wie mit der Säuglingsbürste nach dem Bad geglättet auf dem großen Schädel. Den nachhaltigsten Eindruck in seinem Gesicht machte die Nase, die nach scharfem Einschnitt an der Wurzel immer noch recht fleischig vorsprang, seinem Geist entsprechend, der stets etwas Vorandrängendes, sich Einmischendes besessen hatte. Ägyptische Skarabäen hielten die Manschetten zusammen, aus denen die Hände groß und braun hervorragten; wie die Hand die Stockkrücke hielt, daran war Willenskraft und zupackendes Festhalten abzulesen. Er kam von weither über den spiegelglatten Steinboden und sank in einem Sessel zusammen, so daß die Anzugjacke sich hob und die Revers sich im Nacken auftürmten. Es war, als werde er in seinen Anzug hineingezogen.
»Sie sind der junge Mann, der mit Herrn Doktor Grothe arbeitet«, begrüßte er mich, und tatsächlich war dieser Grothe in seiner Firma mein häufigstes Gegenüber, ein fleißiger, etwas enttäuschter Mann, der für eigentlich unrentable Hotelprojekte abgestellt war – in Prospekten machten die Arbeiten freilich etwas her, wahrscheinlich war es der Werbeeffekt, der Kross & Gran bewog, sich mit solchen Winzigkeiten zu belasten.
»Grothe ist mein Sorgenkind«, sagte Gran, »mir ist Grothe oft nicht mutig genug. Ich sage das nicht hinter seinem Rücken, ich habe es ihm selber schon oft gesagt.«
Gerade das war nicht richtig. Gran konnte in seiner Schwäche und in dem Gefühl, die Entwicklung nicht mehr in Händen zu halten, der Versuchung zur Intrige nicht widerstehen und hatte sich deshalb darauf verlegt, die jüngeren Partner in deren Abwesenheit recht harsch zu kritisieren. Zum Glück kam das Gespräch jetzt auf die afrikanischen Masken. Ich hätte zur Frage des Mutes von Dr. Grothe ungern Stellung nehmen wollen. Gran sagte, er sei ein Sammler der ersten Stunde. Er habe nicht wie die dummen Deutschen erst nach dem Zweiten Weltkrieg entdecken müssen, daß die plastische Kunst des schwarzen Kontinents nicht weniger aufregend sei als die der Griechen. »Ich habe schon in den zwanziger Jahren in Verbindung mit Michel Leiris gestanden.« Die erste Maske habe er nebenbei in Belgien erworben, das sei damals eine Fundgrube gewesen.
»Wenn ich daran denke, was die Stücke damals gekostet haben«, diesen Satz ließ er unvollendet wie ein alter Wüstling, den bei der Schilderung vergangener Liebesabenteuer die Erinnerung überwältigt. »Ich war jung, ich hatte keinen Pfennig Geld, aber was ich hatte, habe ich für afrikanische Kunst ausgegeben.« Er habe nebenbei Picasso gekannt. Nicht sehr gut, sei ihm aber mehrfach begegnet. »Er wollte mich malen, er sagte, meine Nase sei kubistisch.«
Frau Gran schien an dieser Vorstellung etwas Fragwürdiges zu finden, sie schüttelte verständnislos den Kopf.
»Das war vor deiner Zeit, my darling.« Die englischen Wörter sprach er so überscharf aus, daß ich nicht wußte, ob er sie im Spaß gebrauchte, ein explizites »my darling« kam allerdings später noch wiederholt, ich vermutete deshalb, daß er dem abgegriffenen Kosewort durch zelebrierende Aussprache seine shakespearische Würde zurückzugeben wünschte.
»Wieso kam es nicht zu dem Porträt?«, fragte Frau Gran, und hier hatte ich den sicheren Eindruck, daß sie diese Frage schon häufig gestellt hatte, womöglich bei jedem Besuch, den ihr Mann empfing, ein ehegattenhaftes Stichwortgeben, als sei die Frage nach einem immerhin möglich gewesenen Picasso-Porträt noch niemals zwischen ihnen erörtert worden.
»Ich glaube nicht mehr an Porträts«, antwortete Gran, und so leise er knarrte und zirpte, es lag doch Triumph in seinen Worten. »Und Picasso gab mir sogar recht: Ein Porträt sei nur erlaubt, wenn es unähnlich sei.«
»Köstlich«, sagte Frau Gran und schenkte cognacfarbenen Tee nach.
Absatzklacken in der Ferne ließ Herrn Gran aus den Tiefen seines Anzugs in die Höhe fahren. »Manon? Ist sie noch im Haus?« sagte er gedämpft und zugleich alarmiert zu seiner Frau. Der Gleichmut, der souveräne Umgang mit den großen Phänomenen der Zeit war wie weggeblasen aus seiner Miene. Er war wie ein Kind, das die Mutter in der Nähe ahnt und das fürchtet, sie könne ihm dennoch entkommen. Aber die Schritte näherten sich. Er durfte sich beruhigen. Er zwang sich wieder zu Disziplin und wandte sich mir mit der bereits erprobten Miene kritischer Gleichgültigkeit zu. Nein, er würde keinesfalls die Stimme heben, um Manon zu rufen.
Und er wurde belohnt. Hinter seinem Rücken erschien ein großes schönes Mädchen, mit einem vielfältig gemusterten Kaschmirschal über der Schulter, so lang, daß er hinter ihr auf dem Boden schleifte, legte ihre große und zugleich zarte Hand auf seine Wange, neigte sich zu ihm herab und küßte mit geschlossenen Augen voller Liebe seinen Kopf. Er ließ sich zurücksinken. Die Mutter verfolgte den Austausch der Zärtlichkeiten mit Rührung.
»Ein Liebespaar«, flüsterte sie mir zu. Manon blickte auf, sah mich aus ihren großen grauen Augen an und bestätigte, was ihre Mutter gleichsam beiseite gesprochen hatte: »Natürlich, wir sind ein Liebespaar.«
Jedes Interesse an meiner Person war jetzt dahin. Die Eltern forschten bange und zugleich bemüht, nicht zuviel Interesse spüren zu lassen, nach den Plänen ihrer Tochter.
»Wirst du nun hierbleiben?« fragte der Vater und »Wirst du nun morgen abend fahren?« die Mutter. Das schöne Mädchen sah lächelnd auf das Elternpaar, setzte sich zu ihrem Vater auf das lange Sopha und kuschelte sich in das Leder, als wolle es einen Winter dort verbringen.
»Ich friere«, sagte sie sanft klagend und zog den Schal fester um sich herum.
»Wirklich, es ist kalt«, sagte Gran. Sein Zorn regte sich. »Es ist seit heute morgen eiskalt in der Wohnung.«
»Ich habe mit dem Hausmeister telephoniert«, sagte Frau Gran, von Kummer gezeichnet. Sie klagte sich an, daß sie einfach nicht bemerkt habe, wie kalt es in der Wohnung sei, weil sie sich so viel bewege; kein Vorwurf lag darin gegen Faulpelze, die sich nicht tummelten, nur Gewissenserforschung, wie sie es soweit habe kommen lassen, daß ihr Mann und ihre Tochter zu Hause, statt Schutz und Trost zu finden, unter der Herbstkälte litten. Wenn die Kälte Manon aus dem Haus trieb, dann wäre der Frieden, das ahnte Frau Gran, für eine Weile dahin. Sie ergriff die Hand ihres Mannes. Tatsächlich, die war kalt und steif.
»Mir wird schlecht von dem vielen Tee«, sagte Manon, die noch keine Tasse getrunken hatte.
In ihrer Gegenwart gerieten ihre Eltern aus dem wohlerprobten Konzept. Sie wollten der Tochter etwas bieten, was ihre Aufmerksamkeit fesselte. Hatte sie es sich auch so bequem gemacht, als wolle sie sich für einen Winterschlaf einmummeln: sogar ich täuschte mich nicht darüber, daß ihr Aufenthalt nur flüchtig sein würde. Dieses Sich-tief-und-entspannt-ins-Sopha-Sinkenlassen hatte schauspielerischen Charakter. Die dargestellte Gelöstheit sollte den kurzen Augenblicken, bei denen es bleiben würde, in der Erinnerung eine größere Dauer verleihen. Die Eltern sollten noch eine Weile von dem inneren Bild zehren, wie vertrauensvoll und kindlich, wie glücklich ihre Tochter in väterlicher und mütterlicher Gesellschaft geruht hatte. Herr Gran trachtete dennoch danach, Zeit zu gewinnen, und war sogar bereit, mir dafür eine Rolle zuzuweisen, die mir an sich nicht zugekommen wäre. Anstatt ihm ehrfürchtig zu lauschen, wie es vorgesehen war, sollte nun ich sprechen. Das Unbehagen, einem anderen Menschen zuhören zu müssen, der dazu noch vollständig bedeutungslos war, und die hoffnungsvolle Freude, Manon unterhalten und damit zum Verweilen überlistet zu sehen, lagen auf seinem mageren Gesicht im Streit. Doch Manon nahm alles, was ich auf wiederholte Aufforderung des Elternpaares immer weiter ausbreitete, mit einer Hingabe auf, als sei sie endlich an den Stoff geraten, der ihre Lebensrätsel löste. Ganz abwegig mochte das noch nicht einmal sein; für wohlhabende Leute ist das gesamte Hotelwesen von brennendem Interesse. Wenn das Wort Hotel fällt, werden diese Menschen in ihrem Innersten berührt, eine geheime Saite der Seele beginnt zu schwingen. Es ist, als ob an das Hotel alles delegiert sei, was ein ökonomisch abgesichertes Leben an außerordentlichen Zuständen noch erwarten darf. Und als Unterabteilung des Gesamtfaszinosums Hotel vermochte meine Sparte, das »besondere Hotel«, das »unwiederholbare Hotel«, das »individualistische Hotel«, das den Gästen mit dem Zimmerschlüssel ihren Anteil an einer bedeutenden, beruhigenderweise jedoch abgeschlossenen und damit unverbindlichen Geschichtsepoche verlieh, durchaus noch größere Aufmerksamkeit zu wecken.
Manons Lauschen war einzigartig. Ihre Augen verdunkelten sich. Ihr lässiges Ruhen und Sich-Einkuscheln auf dem Sopha war nun nichts als Vorbereitung auf ein konzentriertes Lauschen. Immer noch fühlte ich die Peinlichkeit, hier vorgeführt zu werden wie ein Schuljunge, aber unter ihren Augen gab es kein Verweigern. Ich sprach nur für sie. Ihre Lippen waren halb geöffnet und glänzten. Es war, als nehme sie meine Worte nicht mit dem Gehör auf, sondern mit dem Mund. Herr Gran hatte indessen den Punkt erreicht, an dem das Unbehagen, zuhören zu müssen, in quälende Langeweile umschlug. Es half ihm auch nichts mehr, sich zu sagen, daß er diese Prüfung selbst gewollt habe und sie um so leichter ertragen könne, als der gewünschte Erfolg nicht ausblieb. In seinen nur mühsam beweglichen Körper fuhr der Ungeduld-Dämon und ließ ihn knacken und zucken. Frau Gran beugte sich zu ihm. Ich meinte, sie von den angekündigten Tropfen flüstern zu hören, aber nun nicht mehr als mir bestimmtes Signal zum schleunigen Aufbruch, sondern vielmehr um Gran selbst das Ausbrechen aus dem Konversationscirculus möglich zu machen. Hustend und grummelnd und seine baldige Rückkehr verheißend, tappte er hinweg, von seiner Frau behutsam geführt.
»Waren Sie mit meinen Eltern auf der Dachterrasse?« fragte Manon unversehens. Sowie ihre Eltern den Salon verlassen hatten, war ihre Hingerissenheit beendet. Sie stand mit einer einzigen schlangenhaften Bewegung auf, als gelte es, daran zu erinnern, daß selbst der hinfälligste Mensch eigentlich als Idealwesen gedacht worden sei. Die Dachterrasse war weit und zugig. In Betonkübeln wuchsen japanische Fichten, die in ihrer Geduckt- und Verdrehtheit aussahen, als habe nie abreißender Wind ihre Gestalt verformt. Nahm auf den riesigen Sonnensesseln aus weißem Segeltuch auch einmal jemand Platz? Die Bodenplatten wackelten. Die Semiramis-Phantasie, die diese weit hingebreitete Dachterrasse einst hervorgebracht hatte, war verblaßt. Der Himmel wölbte sich weiß-grau über das dunkelgrüne Kastaniengewoge tief zu unseren Füßen.
»Früher kamen hier die schönsten Vögel«, sagte Manon, »aber die Raben haben alle vertrieben. Sie kommen in Schwärmen aus dem Park mit ihren blauen Schnäbeln und ihrem Krächzen und sitzen dann hier groß und feist und sind unheimlich.«
Ich ließ mich verleiten, weiter zu dozieren, obwohl dies Kapitel doch glücklich hätte abgeschlossen sein können, seit die Alten mich nicht mehr antrieben. Das seien keine Raben, sagte ich, das seien Krähen, und zwar Saatkrähen. Raben seien größer.
»Diese schwarzen Vögel sind aber auch groß«, sagte Manon. Ja, aber Raben seien riesengroß – keine sehr gescheite Bemerkung, denn ich wußte ja nicht, wie groß Manons Vögel gewesen waren. Die Wahrscheinlichkeit war auf meiner Seite, aber warum sollte sie keine Raben gesehen haben? Die einsamsten und wildesten Tiere fanden inzwischen den Weg in die Großstadt. Was nicht ausgerottet war, machte seinen Frieden mit der Zivilisation und versuchte sich in der Kohabitation. Zwischen den Kastanienwogen lugte zwei Parallelstraßen weiter das Schieferdach einer hübschen Villa hervor, eines florentinischen Hauses, eines Miniaturpalazzos aus den Jahrzehnten der Renaissance-Verherrlichung. Jetzt war das meteorologische Institut darin untergebracht. Auf dem Belvedere ragte ein Windmesser in die Luft, ein Kreuz mit vier Halbkugeln, die den Wind wie ein Konditor sein Schokoladeneis in Kugellöffeln maßen. Die Terrasse wurde von einem Geländer aus dicken Glasscheiben begrenzt, nicht angenehm für Schwindlige, unter meinen Zehenspitzen gähnte der Abgrund.
»Dies Institut steht auf einer Ader, die es mit allen Erdbeben der Welt verbindet«, sagte Manon, als ich auf die sich träge drehenden Windhalbkugeln zeigte. »Wenn irgendwo die Erde bebt, zeichnen sie es hier auf. Wenn in der Türkei oder in Sizilien oder in Pakistan die Häuser einstürzen, dann zuckt es hier immer noch schwach – es gibt auch hier Erdbeben, aber schwache«, das alles klang aus dem Mund dieser frühen Schönheit seltsam naiv, schulmädchenhaft und auswendiggelernt. Nein, nein, widersprach ich in törichter Beflissenheit, ich wisse schon, was sie meine: Im Schaukasten neben dem Eingang des Instituts würden zwar tatsächlich alle Erdbeben der ganzen Welt, wie stark oder schwach auch immer, angeschlagen, aber doch nicht, weil sie gerade in diesem Haus meßbar seien. Die Leute in dem Haus dort unten erführen von den Erdbeben auf demselben Weg wie wir: durch das Fernsehen. Mir war, als höre sie das nicht gern. Doch, doch, sie wisse es genau, das mit der Ader, es gebe diese Ader. Sie wisse von dieser Ader seit langem, sie wohne schließlich hier und habe während eines Abendessens einmal neben dem Direktor des Instituts gesessen, der dasselbe gesagt habe – nein, kein Zweifel, sie mäßen dort alles unmittelbar bis China und Japan. Sie hatte sich in dieser Vorstellung fest eingerichtet. Vor unserer Unterhaltung waren ihr die Erdbeben und die Seismographen vielleicht gar nicht so wichtig gewesen, sie hatte sie hingenommen wie alle anderen Wunder, die ihr Leben umgaben, jetzt aber, wo jemand sie in Zweifel zog, spürte sie, daß es auf deren Verteidigung ankam. Ihr Weltgebäude war bedroht, wenn die Erdbebenmessungen nicht dort unten stattfanden. Ich schwieg, und auch sie schwieg.
»Es ist eine schöne Vorstellung, daß von hier aus Adern und Nerven in den gesamten übrigen Teil der Welt gehen«, sagte ich schließlich in versöhnlicher Geschmeidigkeit. »Daß man von hier aus, genau von hier aus, die gesamte übrige Welt am Wickel hat und verstehen kann …«
»Es ist nicht nur schön, es ist vor allem wahr«, sagte Manon, und ihre Augen blickten nun gleichfalls wieder sanft, wenngleich etwas zerstreut.
Unten schob sich ein großer dunkelblauer Wagen vorsichtig in die stille Straße. Warum verbindet man mit Riesenautos Langsamkeit, raupenhaftes Gleiten? Der Wagen dort unten hatte sein Tempo gedrosselt, weil er halten wollte. Zielstrebig schob er sich in die Einfahrt des Granschen Hauses. Der Fahrer blieb im Wagen sitzen. Er wartete. Er war verabredet.
»Ich muß leider los«, sagte Manon, die dem Auto ebenso wie ich mit den Augen gefolgt war. »Würden Sie mich hinunterbegleiten?« Es zeigte sich, daß sie fertig zum Ausgehen war, sie war von der Ankunft des Autos nicht überrascht. Die Aufzugskabine, in der wir uns gegenüberstanden, war eng. Sie war eigentlich zu eng für ihren Prachtkörper, wenn noch ein fremder Mann dazupassen sollte. Ich war in dieser Enge förmlich von Verlegenheit überwältigt. Soviel ich zuvor gesprochen hatte, sowenig sagte ich jetzt, und wenn ich zu Boden blicken wollte, sah ich ihre Brüste unter dem enganliegenden Pullover. Auch sie schwieg. Doch als ich mich vor der Haustür von ihr verabschieden wollte, fühlte ich plötzlich ihre weichen Lippen auf den meinen. Vor der dunkelblauen großen Limousine küßten wir uns lang, ohne uns dabei sonst zu berühren.
»Verzeihen Sie bitte«, sagte sie, als wir uns voneinander lösten, »dies ist etwas sonderbar, eigentlich nicht für Sie bestimmt, für den Mann im Auto aber eigentlich auch nicht – nicht böse sein.« Sie ging um den Wagen herum und stieg ein, nicht ohne mir noch einmal zuzulächeln. Der Mann hinter den getönten Scheiben war sehr braungebrannt. Ein goldenes Armband und Goldknöpfe an seiner Jacke blitzten durch das grüne Glas. Stoisch wartete er unsere Verabschiedung ab. Ich hätte sie nicht in solcher Gesellschaft vermutet.
2.
»Hier müßte man einen Film drehen«
Wenn ich mir als Schüler vorstellte, eines Tages Architekt zu sein, hatte ich natürlich nicht im Sinn, in einem Riesenbüro jahraus, jahrein Aufzugsschächte von mittleren Hochhäusern zu zeichnen, nein, es sollte viel höher hinaus mit mir gehen, nicht nur Paläste, Dome, Museen wollte ich entwerfen, sondern gleich ganze Städte, zu denen die Paläste nur Zellbausteine bildeten. Einzelgebäude sah ich niemals deutlich vor mir. So groß und mächtig sie auch sein mochten, sie sollten nur Werkstoff für das Ganze werden. Man erinnert sich der Städte im Hintergrund von Poussin-Landschaften, ein Geschiebe trigonometrischer Körper, das man sich zur Verdeutlichung in der Küche mit Konservendosen und Milchtüten gut veranschaulichen kann, und ich bin überzeugt, daß gewisse Stillebenmaler, die Flaschen und Büchsen hin und her rückten, dabei eigentlich an Städte dachten. Morandi bemalte die Flaschen und Dosen aus seiner unerschöpflichen Rumpelkammer mit grauem und blauem Lack, um ihnen das Flaschen- und Dosenhafte zu nehmen und sie zu reinen Körpern zu machen, und solche reinen Körper kann man sich mühelos in jede Größe übersetzen. Aber das Wichtigste war mir doch, daß die Bauten meiner Phantasiestadt, die eines Tages eine reale werden würde, sich auf engstem Raum zusammendrängten. Durch die Lage auf einer Landzunge oder Insel, an einer Schlucht, an einer Felswand, in einer Flußschleife, von Stadtmauern umgeben, wie sie unter den politisch allerdings traurigen Bedingungen des zwanzigsten Jahrhunderts durchaus nicht verschwunden waren, sollte der Stadtraum kostbar sein, ein Geschachtel der Bauwerke erzwingen und alle meine Pyramiden, Zylinder, Würfel und halbkugelförmigen Kuppeln zu einem Gesamtgebilde verschmelzen, aus dem keine Einzelteile mehr zu lösen waren. Die Normalvoraussetzung moderner Architekten, jener immense Rasenplatz nämlich, auf dem das Bauwerk wie ein gelandetes Raumschiff weniger steht als parkt, war mir ein Graus. Und wo war den Stadtplanern, die ihren Größenwahn auf nur vom Horizont begrenzten Plätzen austobten, schon etwas zur Pflasterung eines solchen Platzes eingefallen? Asphaltbahnen, Beton- und Kunststeinplatten, die bereits nach kurzem zersprangen und sich verschoben, bedeckten meist ein wahrhaft grenzenloses Elend. Zu diesen maßlosen Plätzen und Boulevards gehörten die mickrigen Grasbüschel, die sich zwischen den Ritzen unweigerlich ausbreiteten und bereits die bevorstehende Verwahrlosung ankündigten.
In meiner vollgestopften, luftlosen, in ihrem Innern dunklen Idealstadt, die ihren Bewohnern wie ein Innenraum erscheinen würde, sollte es überhaupt keine Pflanzen geben, kein Gras, keine Geranien, keinerlei dekorative Stadtbegrünung und Blumenbeete, man sollte sich in Steinschluchten bewegen und das Himmelsblau hoch über sich in geometrischen Ausschnitten sehen. Meine Illusionen kamen mir schon nach den ersten Monaten auf der Technischen Hochschule abhanden. Ich sah, daß ich überhaupt nicht wie ein Architekt empfand und urteilte. Es ging gar nicht um das Bild einer Stadt, wie es sich etwa auf meinen Poussin-Landschaften präsentierte: kristallin, geballt, ineinandergesteckt, oder in abgeschwächter Form auf Merian-Veduten, wo die Städte viel ordentlicher und geheimnisloser, aber doch immer noch als zusammenhängende Körper erschienen. Man hatte sich von dem Gesamtbild einer Stadt längst verabschiedet. Mein malerischer Blick war völlig fehl am Platze. In meiner Anlage zum Dekorativen, zum Bühnenbildmäßigen, zu alldem, was eben in dem nicht ganz unproblematischen Begriff »malerisch« enthalten ist, lag von vornherein etwas Unprofessionelles. Ich wollte mich am Anblick eines Gebäudekomplexes offenbar erwärmen wie an einem Kaminfeuerchen. Nun, mit Kaminfeuern sollte ich in der Zukunft dann derart gründlich zu tun bekommen, daß sie ihren herzstärkenden Reiz für mich schließlich verloren. Das Studium schloß ich dennoch mit einem ordentlichen Diplom ab. Ich habe dann Jahre damit zugebracht, Tiefgaragen und Aufzugsschächte zu berechnen, aber dann gelang der Befreiungsschlag. Heute bin ich ausschließlich mit den schönen, oder vielmehr den schönheitlichen Aspekten des wohlhabenden Lebens befaßt.
»Wir planen für Sie das besondere Luxushotel«, heißt es in unserem auf Bütten gedruckten, mit eingeklebten Tiefdruckphotos ausgestatteten Prospekt. Das »Wir« bedeutet, daß ich meiner Beschäftigung nicht allein nachgehe – das könnte ich gar nicht, die eigentliche Bauerei habe ich von meinen Schultern gewälzt, wechselnde freie Mitarbeiter und manchmal kleinere Büros ziehe ich hinzu, wenn es ernst wird mit einem Projekt, aber das Entwickeln der »Idee«, wie man jeden bescheidenen Einfall heute zu nennen pflegt, das ist allein meine Sache und bringt auch das Geld. Mit Arbeit verdient man bekanntlich nicht viel, je anspruchsvoller sie ist, desto mehr muß man womöglich draufzahlen. Pessimistische Kulturkritik ist leider wohlfeil; wer die entsprechende Klage anstimmt, hat stets die Mehrheit auf seiner Seite. Unversehens sitzt man mit den unerfreulichsten Zeitgenossen in einem Boot, von denen keiner daran denkt, beim eigenen Haus auch nur einen Pfennig mehr für Schönheit und Solidität auszugeben. Und so ist mein Geschäft, das so viel abwechslungsreicher und reizvoller ist als die übliche Architektenfron, denn auch mit der allgemeinen, letztlich von jedermann gewollten ästhetischen Misere aufs engste verbunden.
Ich nämlich lege meine Hand an schöne, gelegentlich sogar spektakulär schöne alte Gebäude, die zwar zuweilen vom Verfall bedroht sind, jedoch ihre Geschichte, ihre nach heutiger Rechnung wahrhaft unbezahlbaren Mauern, das anmutige Auf und Ab ihrer eingesunkenen Ziegeldächer, ihre Lage, die die Schönheit der Landschaft nicht nur nicht stört, sondern sie vielfach noch steigert, als habe die Landschaft von Anbeginn nur auf diese Ergänzung von Menschenhand gewartet, die all das über Jahrhunderte bewahrt haben. Ich nehme an einem der wirkungsvollsten Anschläge auf die europäische Kultur teil: an der Hotelisierung der Welt.
Das höchste Lob, das der Zeitgenosse zu spenden vermag, wenn er eine guterhaltene Stadt, ein pittoreskes Gemäuer, ein unzerstörtes Interieur besichtigt: »Hier müßte man einen Film drehen.« Die Verwendung als Hintergrund für Drehbuchdialoge ist tatsächlich die einzige Form der Nützlichkeit, die man solchen in die Gegenwart gelangten architektonischen Zimelien noch zuzuerkennen vermag. Nur der Film schlägt noch eine Brücke ästhetischer Verbindlichkeit vom Mittelalter in unsere Zeit. Der Film und das Hotel.
Wenn keiner mehr weiß, was mit dem verlassenen Schloß, dem säkularisierten Kloster, dem aufgegebenen mittelalterlichen Weiler, dem frühklassizistischen Gefängnis, der uralten Mühle, mit den Scheunen, Ställen, Landgütern, Gründerzeitfabriken und alten Bahnhöfen anzufangen sei, nachdem das Gesetz verbietet, sie einfach abzureißen, dann kommt unfehlbar die Erleuchtung: das Hotel. Vorbei ist die Zeit, in der das Hotel ohne weiteres von außen als solches zu erkennen war, vom ländlichen Gasthof bis zum Badehotel der Belle Époque, nein, es ist sogar umgekehrt: Ein mit großem Aufwand gebautes Gründerzeithotel kann nur selten noch als Hotel genutzt werden, da müssen Büros und Apartments und Ladengalerien und Kulturzentren hinein. Dafür gibt es nichts auf der Welt, was nicht Hotel werden könnte. Auch früher sind Häuser heruntergekommen. Die Abtei wurde Irrenhaus, das Schloß Gefängnis, die Kirche Kornspeicher. Die Hotelisierung aber macht etwas anderes mit den alten Häusern. Als wirklicher Kenner und Nutznießer der Materie weiß ich, daß die Natur eines Schlosses bei der Verwandlung in ein Irrenhaus weniger leidet als bei der Umgestaltung in ein opulentes Hotel. Erst das Hotel macht die einsam auf dem Felsvorsprung ins Meer ragende Burg zur Kulisse. In Frankreich wurden nach der Dreyfus-Affäre viele Klöster geschlossen und profanen Zwecken zugeführt, ich kenne ein tausendjähriges, das zur Knopffabrik wurde. Die Wege im Park sind heute noch mit rundgestanzten farbigen Muschelresten bestreut. In der Verletzung, die das Fabrikwesen für die heiligen Mauern bedeutete, war immer noch etwas von dem Kampf zwischen Christentum und Illuminismus zu spüren. Würde dieser Komplex zum Hotel, wozu er sich gut eignete – Klöster geben viel bessere Hotels als Schlösser –, dann sähe er von Ferne womöglich wieder viel klösterlicher aus, teuer restauriert, das Feldsteinmauerwerk mit der Zahnbürste zu hellem Gelb gereinigt und wäre doch nur ein säuberlich abgenagtes und präpariertes Gerippe.
Was macht ein altes großes Haus zum Hotel? Es ist der Swimming Pool zwischen den Barockrabatten. Nachts leuchtet er magischer als die Blaue Grotte in Capri und beweist, daß der störrische alte Palast nun endlich unter das bequeme Joch der Nutzbarkeit gezwungen worden ist. In Kalifornien gibt es Täler, die tagsüber in stiller Ländlichkeit dazuliegen scheinen – aber wenn es dunkel wird, beginnen überall bis an den Fuß der hohen Berge die Swimming Pools zu glühen wie Katzenaugen im nächtlichen Dschungel. Das ganze Land wird zur Papierlaterne aus schwarzem Karton, mit türkisen Transparentpapierlöchern, durch die die Realitäten hervorblitzen, das ausländische Geld, das sich auf seinem beständigen Kreisen um die Weltkugel für nur einen winzigen historischen Augenblick hier niedergelassen hat und vielleicht morgen schon anderswo ist. Verlöschen wenigstens dann die Swimming Pools? Gegenwärtig kommen eher noch neue hinzu, und ich bin nach Kräften daran beteiligt. Ich bin für meine organisch wirkenden, für meine sich »schonungsvoll in das Ensemble einfügenden« Swimming Pools berühmt – was es gar nicht gibt, so viel phosphoreszierendes Türkis kann kein Zauberkünstler verstecken. Ich zwänge Schwimmbecken zwischen Klippen, vor Orangerien, in Zitronenhaine, hinter barocke Follies und in gotische Waschhäuser. Die Pool Bar trägt ein originales Mönch- und Nonnendach aus alten, von mir gelegentlich selbst zusammengesuchten Ziegeln, in Riesentonkübeln mit Mediceer Wappen blüht Oleander.
Nein, wir machen das gut – man gestattet doch, daß ich, während ich mich hier anpreise, zu meinem hochstaplerischen »Wir« zurückkehre?
Große alte Häuser zeichneten sich einst vor allem durch den ungenutzten Platz in ihnen aus. Vor den Salons lagen Vorzimmer, die nur zum Durchschreiten da waren. Von den Korridoren öffneten sich zahlreiche Türen zu Zimmern, in denen nur selten einmal jemand schlief. Kabinette, Speicher, Keller, Vorratskammern, Turmzimmer, die niemals jemand betrat, legten einen Kranz um die tatsächlich bewohnten Räume. Die vergessenen, die leeren, die verstaubten Zimmer, immer abgeschlossen und nur mit dem großen Schlüsselbund der Beschließerin zu öffnen, waren die schlafenden Möglichkeiten des Gebäudes, wie ein Mensch unentwickelte Talente besitzt – es hätte im Leben alles auch anders kommen können, warum ist man nicht Opernsänger geworden, die Stimme war da. Aber wir Zeitgenossen dulden nichts Potentielles. Alles muß ans Licht gezerrt werden. Jeder gemauerte Weinkeller, dessen Reiz gerade darin bestand, daß man ihn selten, allein und mit einer Taschenlampe betrat, muß zum Kellerrestaurant ausgebaut werden, Pferdeställe zu Maisonette-Apartments, Speicher zu Ateliers mit Riesenfenstern und angestrahlten Dachkonstruktionen. Kein Haus darf sein Geheimnis behalten. Nirgendwo könnte noch ein vergessener Koffer stehen, in dem Generationen später Manuskripte oder silberne Suppenlöffel oder zerfallene Seidenkleider gefunden werden. Weil das Haus bis auf den letzten Quadratzentimeter genutzt ist, erscheint es plötzlich klein. Ohnehin ist es nur noch Anhängsel, dekorative Brosche an dem Trakt, der daneben hochgezogen wird und der aussieht wie überall auf der Welt.
Kann man seine Arbeit eigentlich gut machen, wenn man derart über sie herzieht, wie ich das hier tue? Die Frage ist beantwortet: durch meinen Erfolg. Im letzten Jahr sauste ich zwischen einem Weingut in Portugal, einer Kreuzritterburg auf Rhodos und einem neugotischen Schloß in Mecklenburg hin und her. Und macht mir denn dies systematische Ausblasen von oft nur schwach flackernden Flämmchen der Vergangenheit vielleicht gar noch Spaß? Es macht mir einen gewissen Spaß. In meinem Innern gibt es einen für mich unentwirrbaren Salat von Ressentiments: gegen unfähige, aber erfolgreiche Stadtplaner, gegen dumme Hotelentwickler, gegen die unverschämte Souveränität alter Häuser, gegen die Unmöglichkeit, etwas gelungenes Altes auch nur annähernd nachzuahmen, gegen reiche Leute, gegen arme Leute.
Und dann hat meine Arbeit inzwischen unverwischbare Spuren in meinem Leben hinterlassen. Ohne sie hätte ich niemals Manon kennengelernt, und ohne sie wäre ich nicht nach Sanchor gefahren.
3.
Zurück zur Natur
Durch meine Arbeit habe ich Manon kennengelernt, und durch meine Arbeit bin ich ihr wiederbegegnet und habe mich ihr von einer neuen, unerwarteten Seite angenähert. Sie war keineswegs verlegen, als sie später davon erfuhr. Wenn etwas herauskam, was sie kunstvoll verschleiert hatte, blieb sie stets so gleichgültig, daß man sich fragte, warum sie ihr Camouflage-Werk überhaupt betrieb.
Daß meine Auftraggeber ein besonders luxuriöses »ökologisches Hotel« planten, war nun wirklich keine ausgefallene Idee, und der Künstler, der es gestalten sollte, hatte sich sein esoterisches Air zwar bewahrt, baute aber längst in ganz Mitteleuropa höhlenhafte Wohnsiedlungen, organische Bahnhöfe und von russisch-bayrischen Goldkuppeln überragte Kraftwerke. Er war nicht mehr jung, aber Kunstzeitschriften und Fernsehen vermittelten ein jugendliches Bild von ihm. Sein langer Bart war noch dunkel, obwohl von Silberfäden durchzogen, sein magerer Körper dunkelbraun gebrannt. Er war ein Gymnosoph und zeigte sich gern in der ernsthaften, unschuldsvollen Nacktheit eines soeben im Amazonasgebiet entdeckten Indianers. Inzwischen hatte er ein Museum seiner selbst geschaffen, einen großen Häuserblock mit einem Restaurant voller Palmen, mit Ausstellungsräumen, die den rechten Winkel vermieden, und einer Dachgartenwohnung für sich und seine Familie, die aber nur selten bewohnt wurde. Meist lebte er auf seinem großen Segelboot, auf einer Insel im Mittelmeer oder auf seinem von biologisch gedüngten Gemüsefeldern umgebenen Landsitz in Kärnten. In den fünfziger Jahren hatte er von Paul Klee inspirierte bunte Spiralbilder gemalt, die aber den Dekorationen australischer Aborigines huldigen sollten, und war damit berühmt geworden. Jetzt ging es darum, die damals gefundene Formensprache zu vervielfältigen und jeden Ort der Welt, der sich dafür anbot, mit einer vereinfachten Version dieser frühen Bilder zu schmücken. Es war, als sollten die Farbspiralen der Aborigines, aus den Rahmen befreit und auseinandergerollt, ganze Länder umspannen, nach dem Vorbild von Dido mit jener Kuhhaut, die in Spiralstreifen geschnitten immerhin die Grenzen des zu gründenden Karthago markierte.
Ich nahm es hin, daß ich nicht der einzige war, der dem Meister an dem Vormittag, da er mir eine Audienz in der Museumscafeteria gewährte, ökonomische Vorschläge unterbreiten sollte. »Meister« war übrigens die vorgeschriebene Anredeform innerhalb der Mauern des Museumskomplexes. Der Künstler hatte erkannt, daß »Professor« zu seiner Nacktheit einen womöglich komischen Kontrast gebildet hätte. Die Mädchen im Museumsladen, der größten Räumlichkeit des Museums, die Kellner im Restaurant, die Aufseher und Assistenten, sie alle sagten »Meister«, wenn sie den ehrwürdigen, durch sein magisches Haus schreitenden Greis begrüßten. Er war nicht nackt, denn draußen lag Schnee. Die bunten Industriekacheln, die, in Scherben zerschlagen, Außen- und Innenmauern des Kunsthauses schmückten, hoben sich scharf von der ringsum alles Häßliche bedeckenden und beruhigenden Weiße ab. Wie mit dem großen Mietshauskomplex, den er zu seinem Kunst-Gehäuse verwandelt hatte, war er mit seinem Namen verfahren. Wer wußte noch, wie er im Paß hieß, aber wie viele Menschen verbanden mit seinem selbstgeschaffenen Prophetennamen Assoziationen von kindlicher Buntfarbigkeit. Er war inthronisiert als König im Reich der Phantasie. Phantasie war eines der Schlüsselwörter seiner Lehren, vorzüglich in Zusammenhang mit »Befreiung der Phantasie«. Erlösung zur Kreativität, Wirklichkeit des Traums – das waren in den Jahrzehnten, in denen er seine Botschaft verkündet hatte, feste Begriffe geworden, die seine Sammler und Bewunderer gern übernahmen. Er schien schläfrig, als er mir entgegenkam, und wäre er nicht so klein gewesen, hätte man ihn einen »schönen Greis« nennen können, mit langen orientalischen Augenwimpern und einer scharfen, schmalen Adlernase, die sein ausgemergeltes Gesicht wie ein Messer teilte. Auf dem Kopf trug er ein orientalisch besticktes Käppchen. Er hatte keine Schuhe an, so daß man die rotgeringelte Socke am rechten, die gelbgeringelte am linken Fuß gut erkannte. Ein Bergsteigergesicht, ein Guru-Kopf voll Weisheit und Güte.
Mit mir wartete der Vertreter eines Buchversandes, der eine vom Meister geschmückte Bibel herausbringen wollte.
»Die Bibel ist für mich ein Märchenbuch«, sagte der Meister, aber aus seinem schmallippigen Asketenmund klang das nicht sarkastisch. »Märchen« waren hier etwas Edles, Schönes und enthielten unendlich viel Wahrheit. »Die Märchen haben die ganze wissenschaftliche Zukunft vorweggenommen«, erklärte er dem demütigen, zu jeder Belehrung bereiten Verlagsabgesandten, der hinter seiner Ergebenheit jedoch sein Geschäftsziel nicht aus dem Auge verlor und heimlich auf die Uhr sah, »Tiere mit Menschenköpfen und Menschen mit Tierköpfen, das ist eine Vorwegnahme der Gentechnologie.«
Dabei sah er schnell zu mir herüber, als wolle er sich in jede nur erdenkliche Richtung absichern: Dem Vertreter als berufsmäßigem Verehrer der Bibel ein Kompliment machen, indem er ihr die Schönheit der Märchen zusprach, mir als möglichem Verächter der Bibel mit der Anspielung auf die allerneueste Wissenschaft schmeicheln. Der Verlagsmann ertrug diese Deutungen, von denen ihm jede einzelne unsagbar gleichgültig war. Er hatte ersichtlich überhaupt keine Meinung bezüglich der Bibel, außer daß es sich um ein verkäufliches Buch handelte, und zwar besonders, wenn man einen Verkaufsköder hatte und nicht »nur einfach eine Bibel verkaufen« wollte; selbst dann lief der Artikel noch erstaunlich gut.
»Wir haben hier eine Graphik von Ihnen für den Buchrücken…«, sagte er in eine nachdenkliche Pause des Meisters hinein, »und wir wollen ja Einzelstückcharakter erzielen.«
»Der Einzelstückcharakter entsteht durch den Wechsel der Farbkombinationen«, sagte der Meister milde. »Sie können die Graphik in Rot, in Blau, in Grün und in Gelb drucken und haben dann Einzelstückserien von je hunderttausend Exemplaren. Ich hätte natürlich auch gerne etwas Gold- und Silberpapier dabei, um den orientalischen Märchencharakter zu betonen. Die Bibel als Buch der Sheherazade … Das ist mein Lieblingsgedanke.«
»Ja, wundervoll«, sagte der sorgenzerfurchte Verlagsmann, »aber Gold und Silber treiben die Kosten hoch, wir sind gegenwärtig bei einem Blindprägepreis von …«
»Nein, bitte keine Zahlen«, sagte der Meister und strich den dunklen, von nahem sehr dünnen Bart. »Ich bin der Künstler und gebe mich ganz. Wie Sie dann finanziell zurechtkommen, müssen Sie selber sehen.«
»Es ist ein teures Projekt«, seufzte der Verlagsmann. Ich fühlte, daß er sich wegwünschte. Der Überdruß an Künstlern stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ein Leben ohne Kunst und ohne Bibel, in diesem Augenblick war das sein Traumziel. »Künstler sind verrückt und schwierig«, mochte er von Kindheit an von seinen Eltern gehört haben, ordentlichen Leuten, beide in städtischen Diensten, die niemals einen Künstler zu sehen bekommen hatten, aber nun war es, als stecke der Meister mit diesen Eltern unter einer Decke und erfülle die Pflicht, den elterlichen Weisspruch empirisch zu bestätigen.
Der große Mann dachte nach.
»Ich frage mich, ob es zu meiner Bibel nicht noch ein passendes Lesezeichen in gestanztem Goldpapier geben sollte, und eine asymmetrisch gestaltete, blattvergoldete Kerze in passendem Lapislazuli-Leuchter. Wir könnten als Unterlage der Bibel auch an einen Patchwork-Quilt denken –«
»Erst muß die Kuh vom Eis«, unterbrach ihn der Verlagsmann. Er klang jetzt ängstlich. Seine Redensart paßte zur Jahreszeit. Drei Tassen Kaffee hatte der Meister bringen lassen, jeder von uns hatte nur ein paar Schlucke getrunken.
»Sie sprechen mit meinem Agenten Herrn Tofet«, sagte er mit großer Milde. »Und vergessen Sie nicht, unsern Kaffee zu bezahlen.«
Das war eine Prinzipiensache, erzieherisches Wirken. Ein solcher Mann mußte lernen, daß in der Sphäre der Kunst Geld keine Rolle spielte und daß der Meister niemals welches bei sich trug, weil ihm Vögel und Eichhörnchen die Körner sammelten und zu Füßen legten. Daran änderte sich auch nichts, wenn das Kaffeehaus ihm gehörte.
Draußen stauten sich Schulklassen, die ins Museum geführt werden sollten. Der Meister ging mit seinen verschiedenfarbigen Socken durch die Menge der schnatternden Kinder; die Menge teilte sich und wich auf gedämpftes Kommando der Lehrerin zurück: »Das ist ER.« Er hörte das Respektsgewisper in seinem Rücken, drehte sich aber nicht um. Im Aufzug schwebten wir davon, als entziehe uns eine Wolke den Blicken des Volkes.
Die Pläne für unser Hotel waren fix und fertig, wie sich oben in dem kahlen, häßlichen Zimmer mit Eisenstühlen und einem Küchentisch herausstellte. Der Meister hatte den Entschluß gefaßt, einen vor vielen Jahren gemachten Plan für ein »ökologisches Stadtviertel«, das nicht verwirklicht worden war – denn Sozialwohnungen lassen sich viel weniger leicht in Erdhöhlen unterbringen als Luxusappartements – jetzt als Hotelplan auszugeben.
»Rom und Griechenland und die Gotik und die Renaissance waren eine Katastrophe für die Menschheit«, sagte er, während er auf das bereits etwas verstaubte Modell zeigte, das seit Jahrzehnten immer wieder ausgestellt wurde, ohne daß der Funke bei einem stadtplanenden Investor übergesprungen wäre. »Das war eine Architektur der Macht, und die Macht ist böse. Ich fordere eine Architektur der Ohnmacht. Das Bauhaus war schon besser als die traditionelle europäische Architektur, denn es hat sie vernichtet, aber wir müssen jetzt einen Schritt weiter gehen. Das goldene Zeitalter herrschte, als das Gold noch im Boden lag.« Von wem stammte dieser Satz? Hätte ich ihn das gefragt, ich hätte gewiß einen traurigen, weisen Blick als Antwort erhalten.
»Große Architektur sind für mich Blockhütten in den Favelas, Slums, Schrebergartenhütten mit vielen Anbauten, afrikanische Erdhütten, amerikanische … irgendwas in Amerika…?« Ich vermutete, daß ihm das Wort Pueblo fehlte, half ihm aber nicht. Sein Modell glich freilich diesen Vorbildern nicht. Von oben betrachtet war alles grün, mit grünen Sägespänen beklebt wie die Landschaft in einer elektrischen Eisenbahn. Aus diesem welligen Rasen- und Hügelland ragten kleine Maulwurfshaufen, die eine Tür und ein Fenster hatten. So sahen früher Eiskeller auf dem Land aus oder die Zufluchtsräume, die in Amerikas Taifun-Regionen neben den Pappwohnhäusern gegraben werden.
Die Fenster des Zimmers öffneten sich auf den Dachgarten, der schneebedeckt war, aber der Schnee hatte das wüste Unkrautgestrüpp nicht vollständig verborgen – »Meine Gärten sind alle vollkommen naturbelassen«, sagte der Meister, der meinem Blick nach draußen gefolgt war. Jeder weiß, wie eine Wiese aussieht, die jahrelang niemand gemäht hat. Die Natur mag von der Vielfalt ausgehen, strebt aber zur Einfalt. Aus dem Chaos geht nach dem würgenden Kampf der kräftigsten Pflanzen gegen die zarteren ein monotones Brenneßel- und Queckenfeld hervor. Arme, wäßrige Blätter stehen über holzig-krautigem Gebüsch. Jetzt im Schnee sah der meisterliche Naturgarten womöglich am harmonischsten aus. Sollte auch die Hotel-Hügellandschaft in eine Unkrauthalde verwandelt werden? »Sie haben für alle Dächer Rasen vorgesehen? Wenn man das Hotel von einem höhergelegenen Punkt überblickt, wird es unsichtbar sein? Wird das Hotel wie ein Golfplatz wirken? Oder soll der Rasen auf den Dächern wie grüner Schnee erscheinen?« Das waren mehr generelle Fragen, ich richtete sie nicht eigentlich an den Meister.
»Grüner Schnee. Das ist der Ausdruck, den ich gesucht habe.« Er nahm einen unförmigen Zimmermannsbleistift, der zum Schreiben auf Papier gar nicht geeignet ist, und kritzelte mit ungefügen, hin- und herfallenden Linien die Worte »Grüner Schnee« in ein Oktavheft. Dann sah er mich unversehens mißtrauisch an. Würde ich für die Benutzung von »grüner Schnee« Tantiemen verlangen? Würde ich später durch die Welt laufen und jedermann erzählen, »grüner Schnee« hätte eigentlich ich und nicht der Meister erfunden? In seiner Ratlosigkeit fand er die Ausflucht sich totzustellen. Seine Augen wurden ausdruckslos, das Kinn fiel herunter, das Gesicht bekam etwas von einem vertrockneten Kuheuter. Dies war ein Zauberschlaf. Wenn er aus ihm erwachte, wäre die Welt erneuert, er und ich hätten beide vergessen, daß »grüner Schnee« von mir stammte.
In das Schweigen näherte sich ein Paar. Mann und Frau blieben befangen im Türrahmen stehen. Sie trugen Wintermäntel und Schals und hielten zusammen eine große Tasche. Der Verlagsmann mit seiner Ausstrahlung eines von vielen Sorgen bedrückten Familienvaters war schon fern der Künstlerwelt gewesen, als Bücherverkäufer aber in immerhin gelegentlicher Berührung mit Literaten, er wußte, worauf er sich einzustellen hatte. Das eben eingetroffene Paar hingegen betrat zum erstenmal ein Künstleratelier, und das nun noch in hoher Mission. Der Mann war Subdirektor in der Marketingabteilung eines Autokonzerns, die Frau war seine Assistentin, eine bodenständige Bayerin, die gut auch Wirtin hätte sein können, so frisch und resch trat sie auf, und doch fühlte sie, daß hier Reschheit nicht am Platze sei, sondern Dämpfung des frischen Auftretens und Ehrfurcht. Beide hielten Visitenkarten in den Händen und streckten sie dem Meister entgegen, wie Städter mit Zuckerstückchen ein vielleicht doch plötzlich zubeißendes Pferd für sich einnehmen wollen. Der Meister erwachte nicht sofort. Er ließ die Karten in der Luft schweben, schlug dann die großen, tierhaften Augen auf und sagte, indem er auf den Küchentisch zeigte: »Legt sie halt da her, sie sind ohnehin für den Herrn Tofet. Sie werden kaum erwarten, daß ich mir Ihre Namen merke.«
Er tat nichts, um den beiden ihren Auftritt zu erleichtern, obwohl er in seiner Zerstreutheit und Verschlafenheit genau instruiert war, was die Leute wollten. Sie flüsterten miteinander, während sie ihre Tasche gemeinsam auspackten. Schließlich hatten sie ein längliches schwarzes Kunststoffnetz in einem gerundeten Aluminiumrahmen hervorgeholt. Der Mann übernahm die technischen Erklärungen. Jedermann sei bekannt, daß den Insassen eines Cabriolets bei zurückgeschlagenem Verdeck das Haar vom Wind verstrubbelt werde. Dies Netz, über dem zusammengefalteten Verdeck mit einem einfachen Handgriff einzusetzen, leite den Wind ab, so daß man mit völlig unzerstörter Frisur den Wagen verlasse.
Wollten sie das Netz dem Meister verkaufen? Besaß er ein Cabriolet? Reiste er nicht auf fliegenden Teppichen? Ein Cabriolet jedenfalls paßte überhaupt nicht zu ihm, schon eher ein Wohnwagen, in dem während der Fahrt Brei gekocht wurde. Und so war auch nicht er es, der etwas kaufen sollte, sondern das tuschelnde und unsicher lächelnde Paar. Das schwarze Plastiknetz erfüllte eine Funktion, es war nicht schön und nicht häßlich, es war ein nichtiger technischer Gegenstand, ebenso praktisch und unnötig wie beinahe alle industriellen Erzeugnisse. Aber es sollte mehr werden. Der Sturmwind im Haar war lästig, aber auch ein Zeichen für Lebenslust und Wildheit, und wenn er gebannt war, mußte etwas anderes an seine Stelle treten, das gleichfalls die einzigartige Köstlichkeit, im Cabriolet herumzubrausen, fühlen, ja Bild werden ließ. Das Paar erläuterte, sich ins Wort fallend und sich ergänzend, daß man in der Marketingabteilung auf einen Einfall gekommen sei, der »alle« begeistere, und in diese Begeisterung der vier oder sieben Personen, die mit »alle« gemeint waren, wünschten sie den Meister hineinzuziehen.
»Wir stellen uns vor, auf dieses Netz eines Ihrer Gemälde zu drucken – damit geben wir jedem Cabriolet individuelles Flair.«
Ich kannte den Meister noch nicht genug, ich hatte die Vorstellung seines kauzigen, kompromißlosen Künstlertums, die er von sich verbreitet hatte, noch zu eindringlich im Gedächtnis. Jeden Augenblick mußte es zu einem Ausbruch kommen, der die Abgesandten in ihre Marketing-Abteilung zurücktrieb. Der Meister hatte die Worte des arbeitenden Paares in einem bangen Gestammel auslaufen und verhallen lassen. Er schwieg und legte die feinknochige Hand auf seinen Bart. Dann erhob er sich und ging zu einem Regal. Dort standen zwei neue Teekessel, der eine aus rotem, der andere aus weißem Email, Nostalgieprodukte aus einem Kaufhaus, für den Gebrauch in Skihütten bestimmt. Diese beiden Kessel stellte er vor das Paar. Das Paar war zum Ablegen der Wintermäntel nicht ermutigt worden. Obwohl das Zimmer schlecht geheizt war, standen dem Mann schon die Schweißtropfen auf der Stirn.
»Ich denke in letzter Zeit öfter über Autos nach«, sagte der Meister und setzte sich hinter die Teekessel. Die Assistentin ließ das Netz sinken, ihr Chef hielt seine Seite des Netzes noch in die Höhe.
»Diese Teekessel sind Autos«, sagte der Meister. Er habe diese beiden Teekessel soeben gekauft, um seine neue Idee bezüglich der Autoproduktion zu erproben. Es gehe um das große Thema Individualismus in der Massenproduktion. Darum kreisten all seine Gedanken.
»Nun lassen Sie doch endlich dieses grausliche Ding und kommen einmal her.« Er sah dem Chef tief in die Augen, während er die nervigen Hände auf die Deckel der Teekessel legte. Er war ein Zauberer. Das Paar blickte gebannt, die Frau schloß sich der Hypnose ihres Vorgesetzten willig an, obwohl der Meister an sie keine Seelenkraft verschwendete. Er lüpfte die Deckel, den weißen und den roten, und vertauschte sie: Der rote saß jetzt auf der weißen Kanne, der weiße auf der roten. Tableau! Hatte das Paar verstanden? Natürlich nicht, die Hingerissenheit, in die sie sich programmatisch hineingesteigert hatten, behinderte ihr Denkvermögen. Der Meister schüttelte das Haupt, erhob sich, so sportlich er war, mit Mühe und ging erneut zum Regal.
»Hier haben Sie einen Wecker aus dem Kaufhaus« – er zeigte ein weiteres Nostalgieprodukt, einen nachgeahmt-altertümlichen Messingwecker – »Sehen Sie die Schellen? Der Wecker ist aus Messing, aber die Schellen sind aus Kupfer. Ich habe den Verkäufer gezwungen, an diesen Messingwecker die Kupferschellen von einem Kupferwecker dranzuschrauben – für den übrigbleibenden Kupferwecker mit den übrigbleibenden Messingschellen habe ich ihm eine Garantie ausgesprochen: Ist er in einem Jahr nicht verkauft, nehme ich ihn ab – Er hat tatsächlich einmal angerufen, aber ich weiß nicht mehr, wie das ausgegangen ist.«
Mir war klar, wie das Geschäft ausgegangen war. Der zusammengestoppelte Wecker war nicht verkauft worden, aber der Meister hatte erklärt, sich an nichts zu erinnern, und darum gebeten, in Ruhe gelassen zu werden. So schoß es mir durch den Kopf, während das Paar noch immer nichts verstand. Und deshalb bekam es jetzt die Füße des Meisters entgegengestreckt.
»Was sehen Sie? Eine rote und eine gelbe Socke. Ich habe den Verkäufer gezwungen, mir nicht ein Paar rote oder ein Paar gelbe Socken zu verkaufen, sondern eine rote und eine gelbe – verstehen Sie endlich?«
In die inzwischen zu Verzweiflung gewordene Stummheit des Autopaares hinein begann er mit einer Müdigkeit, die von dem erschöpfenden Kampf gegen die Schwerfälligkeit der Menschengeister zeugte, seine Idee nun unverrätselt darzulegen. Es war die Zeit gekommen, wo er nicht mehr in Gleichnissen sprach. Es schwebe ihm ein Auto vor, bei dem alle Teile des Chassis – die Türen, die Motorhaube, der Kofferraumdeckel, die Kotflügel – andersfarbig lackiert seien. Der Kunde solle sich beim Kauf sein neues Auto selbst farblich zusammenstellen können. In diesem vom Kunden selbst schöpferisch gestalteten Auto offenbare sich eine »neue Philosophie«. Diese »neue Philosophie« aber, das habe er beschlossen, werde er mit der durch das Paar hier repräsentierten Autofabrik in die Wirklichkeit umsetzen.
»So wie ich durch den weißen Deckel auf der roten Kanne aus einem gesichtslosen Massenfabrikat ein individuelles Objekt habe werden lassen, so werden Sie das erste individuelle Auto anbieten können.« Die Vorteile lägen auf der Hand. Wenn man eine Schramme an diesem Auto habe, müsse man nur das entsprechende beschädigte Teil neu lackieren, nicht gleich, wie jetzt, den ganzen Wagen. Aber das liefere er ihnen nur als Verkaufsargument, das eigentliche Konzept wurzele natürlich im Philosophisch-Ästhetischen. Mit dieser Botschaft schicke er sie nun nach Stuttgart zurück.
»Alle haben sich schon so auf Ihre Graphik auf dem Netz gefreut«, sagte der Marketingmann schüchtern.
»Ich habe Größeres mit Ihnen vor«, antwortete der Meister. Er versank in Schweigen. Er zergrübelte sein Hirn nach einem schlagenden Wort, das das Brett vor dem Kopf dieser Leute zerhauen würde. Dann bückte er sich und zog alle gelben Socken aus. Sein Fuß war entfleischt wie eine Hahnenkralle; Fußnägel und gegerbtes, um Sehnen und Knochen gespanntes Fleisch bestanden aus derselben leblosen Substanz. Er zeigte die Socke vor, der Mann mußte sie in die Hand nehmen, die Frau auch. Sie war an der Ferse grün gestopft.
»Verstehen Sie mich endlich? Ich habe sie bewußt nicht gelb stopfen lassen.«
Im übrigen könne man die wirkungsvollsten Farbnamen erfinden, um der Phantasie der Käufer auf die Sprünge zu helfen: alabastergrün, tigergelb, orchideenblau, arterienrot, augenweiß und erdschwarz.
»Der Wiederverkauf wird unmöglich sein«, murmelte die Assistentin.
»Dummes Zeug«, sagte der Meister und tauschte aufs neue die Deckel der Teekannen. Das Paar folgte ihm bei diesem Tun mit geheucheltem Interesse, um den dünnen Diskussionsfaden bloß nicht reißen zu lassen.
»Der ganze Vorstand müßte über Ihr Projekt entscheiden«, sagte der Mann in dem Versuch, auf das nun unbeachtet auf dem Boden liegende Netz zurückzukommen.
»Ich möchte gern mit kompetenten Leuten sprechen«, antwortete der Meister schläfrig, »dann bringen Sie mir den Vorstand.«
»Das Netz hier könnten wir auf unserer Ebene entscheiden«, sagte der Mann. Die beiden standen in ihren Wintermänteln vor dem Tisch des Meisters wie Prozeßzeugen vor einem aus einer Höhle geholten weisen Richter. »Es geht uns bei der Sache überhaupt nicht um Geld – es ist die Schönheit der Idee, für die wir kämpfen. Wir sind auch schon mit den Erben von Miró in Palma de Mallorca im Gespräch. Dort kann man sich eine Zusammenarbeit sehr gut vorstellen, die Erben von Miró sagen, es gehe Ihnen vor allem um die Verbreitung des Werkes ihres Großvaters, sie sähen eine Zusammenarbeit mit der Industrie sehr positiv.«
»Um Geld geht es mir auch nicht«, sagte der Meister. Große Würde lag in seinen Worten. »Und auch mir geht es darum, der Industrie zu helfen.« Zur Technik habe er seit jeher vertreten: Es gebe keine schlechte Technik an sich, nur gut angewandte und schlecht angewandte. Er erhob sich mühsam, das Paar mußte zusehen, wie sehr sich der erfinderische Greis um seinetwillen anstrengte. Auf dem Regal lag allerlei Papier. Er suchte quälend lang, als sei er allein, und kehrte dann mit einer Zeitschrift zurück. Diese Zeitschrift schenke er ihnen. Darin stehe ein Interview mit ihm, und in diesem Interview habe er zuerst preisgegeben, daß er ein Auto plane.
»Aber damals habe ich nicht gesagt, daß ich das Auto mit Ihnen plane. Zeigen Sie das Ihren Herrschaften, das wird sie überzeugen.« In diesem Augenblick betrat ein dunkelbraungebrannter Mann mit Brillantinescheitel die Szene, Herr Tofet, der Agent, und neben seinem aus der Höhle gekrochenen Herrn war er mit goldfunkelnden Knöpfen am Blazer, Goldarmband und dickem Goldring die überraschendste Erscheinung. Er grüßte knapp und wandte sich dann sofort in gebrochenem Deutsch an den Meister, in dringender Angelegenheit. Er komme von Kurzenegger und Silvini, den Anwälten: Die Sache mit der Veröffentlichung der Photos sei entschieden.
Der Meister wurde hellwach. Tofet legte einen Stoß großer Schwarzweißabzüge auf den Tisch. Ich konnte sie, ohne den Kopf zu verdrehen, in Ruhe studieren, während das Paar sich bückte und bedrückt und blamiert das Netz wieder in die Tasche packte. Auf einem Bootsdeck stand der Meister, der Wind spielte in seinem silberfädigen Bart. Das arabische Mützchen war sein einziges Bekleidungsstück. Er war vollkommen fleischlos. Man hätte mit dem Fingerknöchel auf sein Brustbein klopfen mögen, das hätte geklungen wie ein Holzbrett. In der Unschuld eines Wilden hielt er dem Kameraauge das kleine Schrumpelding zwischen seinen Beinen hin. Er besaß eine Souveränität, als sei er der einzige Mann auf der Welt. Und neben ihm stand, ohne Hose, aber mit einer winzigen Bluse, die kaum die großen Brüste bedeckte, vom Wind leicht zerzaust, aber so milchblaß wie immer, Manon, in sternenhafter, von nichts Irdischem berührter Heiterkeit.
Der Meister sah mich unversehens an und sagte dann zu Herrn Tofet: »Das ist ein großer Schweiger. Die sind die schlimmsten. Sie sagen nichts, aber sie machen nachher die schlimmsten Sachen.«
4.
Das silberne Telephon
Sein Instinkt trog den Meister nicht. Ich sah aus dem Fenster in den struppigen Dachgarten, in dem die Spatzen zwischen den vertrockneten Strünken umherhüpften, als hofften sie, hier oben auf eine vergessene Samenkapsel zu stoßen, die ihre Körnchen bis in den Januar bewahrt hatte. Eine stille Weile fühlte ich seinen Blick auf mir ruhen. Es war, als krabbele mir eine schwerfällig gewordene Fliege in den Hemdkragen. Ich wartete darauf, daß dieser Unverschämtheit irgend etwas folgte, ein gespielter Wutanfall vielleicht, aber dem Meister schien es zu genügen, einen Verdacht recht grob auszusprechen, um die Gefahr damit gebannt zu haben. Der braune Herr Tofet nahm die Worte seines Herrn ungerührt entgegen. In seiner Sphäre war es wohl üblich, sich vor den Leuten in acht zu nehmen. War er nicht selbst ein solcher Schweiger? Er sprach kaum, während er im Zimmer war, und schenkte mir so viel Aufmerksamkeit wie dem Küchenstuhl, den er soeben zur Seite schob.
Ich war zu meiner Tat entschlossen, seitdem ich Manon erkannt hatte, und der Entschluß versetzte mich in die entspannte Ruhe einer Katze, die vor dem Mauseloch lauert und jede Bewegung unterdrückt. Solange ich aus dem Fenster sah, davon war ich überzeugt, würden auch der Meister und Tofet sich nicht mit den Photographien beschäftigen. Ich hatte nur eine einzige Sehnsucht: eines dieser Bilder genau zu studieren und mich daran buchstäblich satt zu sehen. Während ich meine ganze Kraft auf den Verzicht wandte, den Photostapel auch nur aus den Augenwinkeln zu streifen, steigerte sich meine Hoffnung zur Gewißheit. Ich gehöre jener Generation an, der es völlig selbstverständliche Übung war, in Buchhandlungen zu stehlen. Nicht der Schatten eines schlechten Gewissens trübte die Tage meiner Freunde, die sich ganze Regale zusammenklauten – schon im Wort »klauen« lag die lustige Harmlosigkeit, die solche enteignenden Feldzüge angeblich auszeichnete. Meine Hemmungen, es gleichfalls so zu halten, hatten nichts mit meiner Moral zu tun, sondern nur mit meiner Feigheit. Ich genierte mich früher sogar dafür, ein teures Buch gekauft zu haben, und log meinen Kumpanen eine Räubergesinnung vor, zu der mir tatsächlich der Mumm fehlte. Und jetzt übertraf ich die frechsten Bücherdiebe meiner Bekanntschaft an Kaltblütigkeit. Hinter meinem Rücken entfernten sich die Stimmen. Es sollte in dem angrenzenden Zimmer etwas geholt und betrachtet werden. Als hätte ich alle Zeit der Welt, wandte ich mich mit Engelsgeduld dem Tisch zu, trat an ihn heran, nahm, ohne mich umzusehen, das oberste Photo in die Hand und legte es mit Sorgfalt in die Pappmappe, die ich bei mir trug. Alle bösen Geister standen auf meiner Seite. Unter dem Bild, das ich genommen hatte, lag ein sehr ähnliches, es war nur etwas weniger von den Planken des Segelbootes darauf zu sehen.
Als ich aufblickte, bemerkte ich den Automann und seine tüchtige Assistentin, die noch nicht entlassen waren und den Vorgang verfolgt haben mochten, aber meine Miene blieb unbewegt. Mir war, als befände ich mich in meinem guten Recht, und so empfanden es auch die beiden in ihren Wintermänteln und hatten, obwohl sie Zeugen des beiläufigen Handgriffs waren, wahrscheinlich alsbald vergessen, was sich vor ihren Augen abgespielt hatte.
In meinem Büro nahm ich eine große Papierschere und