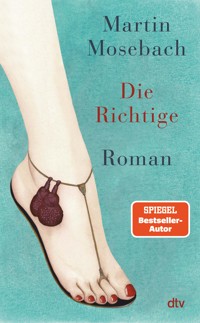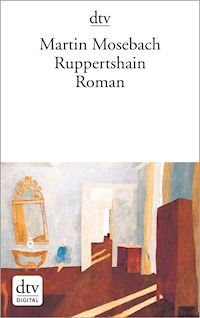10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein vollendet ausgeführtes Romangemälde.« Literarische Welt Wie jedes Jahr verbringt die Familie Dalandt den Sommer in der Provence. Die Hitze macht träge, in der Zypresse zirpen Zikaden, und jeden Morgen läuft die Hausherrin im Nachthemd durch den Garten zum Pförtnerhaus, wo der Verwalter sie erwartet. Ihr Mann ist durch eine eigene verhängnisvolle Beziehung abgelenkt. Da entzündet sich ein Ehestreit an ›Taube und Wildente‹, einem Stillleben aus dem 19. Jahrhundert. Was hat es mit dem zinnoberroten Punkt in seinem Zentrum auf sich, macht der es nicht zu einem modernen Meisterwerk? Aber die Frau will es verkaufen, die Spannung zwischen beiden wächst. Martin Mosebach, der menschliche Schwächen schildert wie kein zweiter, malt mit Wörtern. Ein flammender Roman über Kunst, Liebe und Verrat. Über den Abgrund in einer Ehe und einen Fehltritt mit Folgen, über Schönheit, Verdammnis und Verlust – virtuos und fesselnd erzählt von einem der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwart. »Ein unerhörtes Stück Literatur über Liebe, Kunst und Verrat samt glorioser Pointe.« Tobias Haberl, Süddeutsche Zeitung »Provence, ein altes Landhaus, das uralte Drama des Menschlichen, ein stilistischer Lesegenuss von hohem Rang.« Iris Radisch. Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Martin Mosebach
Taube und Wildente
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Erster Teil
Sommer
1
Grausamkeit. Zuschauen, wie etwas Schönes zerfetzt wird. Schon eine halbe Stunde lang sitze ich, gefesselt von diesem Anblick, auf dem Gartenstuhl nahe der Zypresse, in deren staubigem Schwarzgrün die Zikaden sägen, unablässig arbeitend, als versuchten sie, als ganzes Volk den Baum in kleine Stücke zu zerlegen. Dieses Zikadenkratzen bei Gluthitze gehört zu den Sommern in der Chaumière, gerade zur Stunde der Siesta, die ich allerdings niemals halte. Ich bin eigentlich immer wach, nicht angestrengt genug, um zu schlafen.
Umso erstaunlicher, daß ich erst gestern meine erste Zikade gesehen habe. Diese Insekten haben sich bisher unsichtbar für mich gemacht, obwohl sie groß sind wie Maikäfer und lange Flügel haben, die ihren Körper weit überragen. Und da lag nun also ein solches Prachtinsekt tot zu meinen Füßen. João hat mir offenbart, das sei eine Zikade. Sofort war klar: Dies ist ein besonderes Lebewesen. Die breite Stirn, die kugelartigen Augen, der dick gepanzerte Nacken, der mit Rüstungsringen geschützte Unterleib, in eine Bürzelspitze auslaufend, die Riesenflügel wie aus glänzendem Zellophan, in eine feine schwarze Äderung gespannt. João kehrte sie weg, noch während ich über sie gebeugt war, ich wagte nicht zu protestieren. Aber von der Zikade hatte ich genug gesehen, um zu bedauern, daß sie im Kehricht gelandet ist. Ein großes Tier, dem es gelingt, im Verborgenen zu leben, zugleich aber durchdringend zu lärmen.
Und was man einmal gesehen hat, das stellt sich, nach der ersten Bekanntschaft, meist auch ein zweites Mal ein, diesmal sogar lebend. Die junge schwarze Katze, die uns besucht, ohne sich jemals berühren zu lassen, lag genüßlich, in tiefer Entspannung, hingestreckt zu meinen Füßen. Dann das Heben des Kopfes, Aufmerksamkeit. Wodurch? Das blieb mir zunächst verborgen. Und dann, unversehens, ein sachtes Schwirren wie von einem Miniaturpropeller; die Katze hat sich aufgerichtet, sitzt auf den Hinterbeinen, hat den Kopf geneigt und schlägt mit der weichen Vorderpfote ein festes Ding, nicht zu erkennen, von dem das Schwirren ausgeht. Wie ein Ballspieler dribbelt sie mit diesem brummenden Körper, der so hart ist, daß ich es beim Aufschlagen auf dem Boden ganz leise wie ein Auf-Holz-Klopfen zu hören meine.
Eine Zikade, die zweite meines Lebens, jetzt lebendig, aber in Todesnot. Wie schmecken Zikaden? Wie Taschenkrebse? Aber der Katze ist es nicht eilig mit dem Fressen. Sie schlägt das flügelschnarrende Insekt zwischen den Pfoten hin und her; seine großen Flügel sind jetzt ein Hindernis, sie gestatten nur, die Luft wie eine zähe Substanz langsam zu durchbohren, müßten aber Raketenkraft entwickeln, um den Insektenkörper über den Kopf der Katze hinwegschießen zu lassen, hinein in das sichere Luftreich, das ihn eben noch rings umgab und jetzt unerreichbar für ihn ist.
Es gab kein Entkommen für die Zikade. Dabei ließ ihr die Katze doch Zeit und betrachtete sie nach jedem Schlag versonnen. Zum nächsten Schlag holte sie erst wieder aus, wenn ihr Opfer sich zu bewegen begann. War es dieses Propellerschnarren, das sie ebenso reizte wie mich? Ein organisches Maschinchen war da eingeschaltet. Die Katze gab der inzwischen angeschlagenen Zikade – die Hiebe mit den Pfoten mochten sie verwundet haben – eine Chance; die Folter des Insekts inszenierte sie als ein tänzerisches Spiel. Nie habe ich die Katze so elegant, so anmutig gesehen.
Sie stand auf einem Bein, pirouettierte, fand aus der Drehung in einen Sprung über die Zikade hinweg und näherte ihre Schreckensmaske von der anderen Seite, um alsbald wieder zuzuschlagen. Ja, ich durfte mir vorstellen, ihre eigentliche, von ihr stets geheimgehaltene Fortbewegungsweise sei zweibeinig, nur unter menschlicher Beobachtung lasse sie sich auf vier Beine nieder. Und womöglich konnte sie sogar fliegen, sich aus der Pirouette in die Luft erheben. Selbst in der Luft wäre sie der Zikade überlegen, ein leichtes, das schwerfällige Tier mit einem präzisen Tatzenhieb aus seiner Flugbahn heraus auf den Boden zu schleudern. Wie drollig war ihre Miene, als spielte sie mit einem knisternden Papierball und nicht mit einem verzweifelten Lebewesen.
Und jetzt schon nicht mehr verzweifelt, vielmehr unbewegt, von den größer werdenden Katzenaugen durchdringend betrachtet, mit der Pfote angestoßen, auch mit der anderen, und immer noch nicht zuckend und schwirrend. Die Katze drehte sich weg, das war enttäuschend; sie schlich sich davon, verstimmt. Hatte sie für ihren Geschmack zu viel Mühe an die Zikade gewandt und sich gar lächerlich gemacht? Sie ließ sie liegen, keinen Augenblick hatte sie erwogen, sie zu fressen.
Ich neigte mich zu dem kleinen Leichnam hinab. Die Rüstungsringe saßen noch gut, nein, einer hatte sich gelockert, darunter drang es feucht hervor. Die Riesenflügel waren zerfetzt; die konnten kein Schwirren mehr hervorbringen. Die Zikade war nur noch Unrat und würde später von João wie die erste weggekehrt werden, noch nicht einmal wert, im Magen des Raubtieres zu landen.
In der Antike hätte man solche Kleinkämpfe zwischen Haustieren als Idylle bezeichnet, Modelle für reizende Bildchen auf einer Freskenwand. Und ›idyllisch‹ ist auch unser Leben hier – ich untätig, in der Hitze Papier bekritzelnd, João Schnecken vom Anis absammelnd, Marjorie nackt im dunklen Zimmer unter dem Moskitonetz dämmernd, Paula in der Hängematte schlafend, die Kleine an sich geschmiegt, ein friedliches Bild, und am Flügel im Haus versucht sich Max seit einer Stunde an einer Klavierfassung von ›L’après-midi d’un faune‹ – tüdeltüdeldü –, wobei der Witz des Stücks doch gerade in der Flöte liegt. Ich habe mir abgewöhnt, seine Bemühungen zu kommentieren, sogar vor mir selbst.«
Aus Ruprecht Dalandts »Provenzalischem Journal«
2
Cornelius De Kesel war nun schon zwölf Jahre tot, aber in La Chaumière noch durch seine Statthalter auf Erden anwesend, das Ehepaar dos Santos, von der Algarve stammend, doch seit langem wie Hunderttausende ihrer Landsleute in Frankreich zu Hause: João zunächst als Maurer, Anna in Haushalten arbeitend, bis sie gemeinsam die Sorge für den damals fünfundsechzigjährigen De Kesel übernommen hatten, Anna von da an als Köchin, João als Gärtner; das war eine willkommene Rückkehr zur Landwirtschaft, die ihm von Jugend auf vertraut war. Außerdem bediente er bei Tisch; dann steckten seine breiten Pratzen in weißen Baumwollhandschuhen. Mit der dazugehörenden weißen Jacke zog er jeden Abend buchstäblich einen neuen Menschen an, der Landmann verabschiedete sich, an seine Stelle trat der mürrische, die Mahlzeit streng dirigierende Majordomus. Das war De Kesels Schule, der die Leute genauestens eingearbeitet hatte; sein Ideal war gewesen, einen Zustand zu erreichen, in dem er keine Anweisungen mehr geben mußte. Der Haushalt als Uhrwerk, das vom Wechsel der Jahreszeiten und der Schicksale unbeeindruckt weiterläuft, das war sein Ziel, inzwischen nicht mehr leicht zu erreichen; perfektes Personal war teuer geworden.
João und Anna hatten ihren Herrn verstanden. Was er von ihnen wollte, sollte er gern haben, solange es auf ihre Weise geschehen konnte. Pünktlich ein Mittag- und ein Abendessen auf den Tisch stellen, alle drei Tage die Betten frisch beziehen und, ganz wichtig, Früchte aus dem Garten einmachen – Cornelius De Kesel aß jeden Tag seines Lebens vor den Mahlzeiten eine auf seinem Grundstück geerntete und getrocknete Feige, auf dem Programm stand auch heute noch selbstgemachte Quittenpaste zum Kaffee und eine süße Tomatenmarmelade –, viel mehr durfte nicht erwartet werden. Auf das Kochen verschwendete Anna keine Kräfte. Ihre Küche war, freundlich gesprochen, einfach, andere nannten sie jämmerlich oder gar ungenießbar, doch wenn musterhaft serviert wurde, hatte Cornelius De Kesel sich damit abgefunden, und seine Tochter Marjorie und auch die Enkelin Paula verbanden keine besondere Freude mit dem Essen und waren im geheimen womöglich gar dankbar, daß die Speisen, die in der Chaumière auf den Tisch kamen, keine unüberwindliche Versuchung für den Gaumen darstellten. Der alte De Kesel hatte eisern nur auf die Zeremonien gehalten – das Hühnchen, das auf großer Platte gebracht wurde, hatte eßbar auszusehen, das mußte genügen. Er erteilte seinen Domestiken, nachdem er ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, keinerlei Befehle mehr, denn alles stand fest, von dem vor dem Essen im Salon gereichten Aperitif bis zum nach dem Essen servierten Kaffee, und das Ehepaar dos Santos hätte, als es erst die Verhältnisse überblickte, darüber hinausgehende Anweisungen auch nur mißvergnügt aufgenommen.
Es waren dann mehr und mehr sie, die das Haus regierten. Sie bestimmten die Abläufe, und Extrawünsche hatten so lange zurückzustehen, bis es einmal paßte. Besucher, die von Anna oder João empfangen wurden, spürten sofort deren Mißtrauen und ahnten, durch ihre Anwesenheit den Betrieb aufzuhalten. Bot De Kesel seinen Gästen etwas zu trinken an, blickte er mit ängstlicher Miene zu Anna, die noch in der Tür stand und schweigend auszudrücken schien, daß Wichtigeres sie eigentlich daran hinderte, den Gast zu bedienen. Wenn sie dann das Glas gebracht hatte, begann sie ein Getuschel mit dem Hausherrn, der ihr beklommen lauschte und sie mit einem unentschlossenen Winken der Greisenhand dazu ermächtigte, doch bitte nach ihrem Gutdünken zu verfahren. Im Hinausgehen sandte sie noch einen langen Blick voller Vorwurf zu dem Neuankömmling, dem inzwischen klar war, daß seinem Bleiben hier enge Grenzen gesetzt seien.
Beide dos Santos’ waren kurzbeinig und breit. Wenn João im Garten arbeitete, quoll aus seinem Unterhemd ein dichtes Gebüsch weißer Haare; seine Stirn war niedrig, die Nase flach, wie von einem Boxhieb zertrümmert. Anna war in ihrer Jugend wahrscheinlich gewesen, was man ein »süßes Mädchen« nennt, hatte davon in ihren vorgerückten Jahren aber nur eine gewisse Süßlichkeit der Miene bewahrt, vor allem, wenn sie etwas Gebackenes zum Dessert hereinbrachte: Jetzt kommt etwas ganz besonders Köstliches, das habt ihr alle nicht erwartet – es war gerade diese Verkündigungsmiene, die Ruprecht Dalandt so sehr verstimmte, daß er seinen Kopf zum Teller senkte, um ihrem Blick nicht zu begegnen. Auch seine Frau Marjorie gehörte nicht zu den Freunden der dos Santos’ und hatte speziell an der Sauberkeit ihres Badezimmers öfter etwas auszusetzen – die einzige Kritik, die sie übte, jedes Mal längeres Beleidigtsein damit auslösend.
»Ich bitte dich, laß die Leute ihre Arbeit tun«, pflegte der alte De Kesel zu sagen, wenn er solche Zusammenstöße mitbekam. »Und denke auch daran, daß ich hier die Anweisungen gebe.«
»Aber du gibst ja keine«, war stets ihre Antwort; der Alte hatte daraufhin ärgerlich in sich hineingemurmelt.
Er hatte seiner Tochter in einem besonderen Legat aufgetragen, den dos Santos’ niemals zu kündigen, als handele es sich bei dem Paar um die Vasallen eines Feudalherrn, mit denen man sich in Schicksalsgemeinschaft befand. Und Marjorie unternahm dann auch keinen Versuch, etwas am Status zu ändern, obwohl sie es liebte, während der Mahlzeiten etwa zu bemerken: »Wir essen gerade den teuersten Salat der Provence« – das mochte zutreffen, wenn man die Stunden, die João im unordentlichen, teils von Unkraut überwachsenen Küchengarten verbrachte, auf die Blätter in der Schüssel umlegte. Ruprecht, ihr Mann, vertrat ohne Nachdruck den Standpunkt, mit einem Legat könne keine Ewigkeitsgarantie verbunden sein – jetzt sei der Schwiegervater zwölf Jahre tot, und damit sei es den dos Santos’ zuzumuten, an die Algarve zurückzukehren –, aber es stand derart unumstößlich fest, er habe in der Chaumière nicht das Geringste zu sagen, daß Marjorie sich die Mühe schenkte, seinen Vorstoß abzuwehren. Nein, an die Verfassung dieses Besitzes sollte nicht gerührt werden, die war ihrem Willen entzogen. Wenn sie auch jeden Sommer ihres Lebens in der Chaumière verbracht hatte, änderte das nichts daran, daß die Anlage nun einmal nicht ihr gehörte, sondern der Familienstiftung, deren Begünstigte neben entfernteren Verwandten sie und ihre Schwester waren; nur daß diese Schwester in Kalifornien lebte, das Haus ohnehin nicht mochte und Europa nur selten besuchte.
Zugunsten der dos Santos’ ist anzuführen, daß solche Sommerresidenzen, die lange Zeit im Jahr unbewohnt daliegen, gewöhnlich eine gute Woche brauchen, bis es wieder behaglich in ihnen ist – La Chaumière hingegen, im festen Griff der Portugiesen, präsentierte sich im Mai bereits sehr bewohnt, gar beseelt, wenngleich von einer nicht unbedingt menschenfreundlichen Seele. In dicken Bündeln hingen Lavendelgarben in allen Zimmern; das hatte Cornelius De Kesel so eingeführt, den Muffigkeit mehr gestört hatte als Ungemütlichkeit. Erst kurz vor der Ankunft der Familie wagte sich der Verwalter ins Haus, der gleichfalls noch zu Lebzeiten von Cornelius De Kesel seine Tätigkeit begonnen hatte und in einem Feldsteingemäuer wohnte, einem zum Pförtnerhaus umgebauten Stall, dort, wo das Grundstück an die Straße grenzte. Er machte eine Liste der im Winter erforderlich gewordenen Reparaturen und kam mit seinen Handwerkern, die hier ein Stück Regenrinne, da einen Wasserhahn, dort einen Fenstergriff in Ordnung brachten. Von den dos Santos’ wurde der Mann nicht geschätzt, mußte als eine Art Favorit von De Kesel jedoch respektiert werden und stand weiterhin in einer Art Freundschaftsverhältnis zur Familie.
Gerade die Freunde des Hauses waren ihnen verdächtig. Um so verletzender, daß Marjorie dem Verwalter die Zimmerverteilung mitgeteilt hatte und nicht ihnen. Sie mißgönnten ihm, daß er mehr wußte als sie, und Anna lauschte mit zusammengekniffenen Augen und angedeutetem Kopfschütteln, als vernehme sie den schrillsten Unsinn, während er ihr von seinem Tablet vorlas: »Madame in ihrem Zimmer, Monsieur in seinem Zimmer, Mademoiselle Paula im Blumenzimmer, ihre kleine Tochter in dem angrenzenden Kabinett, Monsieur Max im Durchgangszimmer, Monsieur Allmendinger im grünen Zimmer, Madame Stiegle im Empirezimmer.« Alles Zumutungen nach langen Wochen, in denen das Haus sich ausnahmslos selbst bewohnt hatte.
»Das sind sieben Personen – und Sie kommen ja auch zum Essen dazu.« Es klang wie ein Vorwurf.
Ja, der Verwalter würde bei den Mahlzeiten immer anwesend sein. Er bewachte zwar noch andere Sommerhäuser, aber wenn Marjorie mit ihrer Familie anreiste, dann war er zur Stelle. Auch er war Teil der Erbschaft von Cornelius De Kesel, der selbst im fortgeschrittenen Alter noch an die Dekoration des Hauses gedacht hatte. Den Kamin im Salon wünschte er in einem ländlich naiven Barock marmoriert zu sehen, und da wurde ihm aus der Stadt der englische Dekorationsmaler Damien Devereux empfohlen. Der betrat die Chaumière, um dort zu bleiben. Es war ihm wohl vorher noch gar nicht bewußt gewesen, daß er eine solche Heimstatt gesucht hatte, die ein sicheres Fundament für das tägliche Leben bot und zugleich provisorisch genug war, um sich nicht festgelegt fühlen zu müssen.
Nach der Kaminmalerei, bei der verschiedene Versionen ausprobiert wurden, fand sich noch anderes, was im Haus neu gefaßt werden sollte. Dem alten De Kesel muß die schweigsam-sarkastische Art des langsam, stets nur wie nebenbei arbeitenden Mannes höchst angenehm gewesen sein. Noch nicht alt, hatte er schon damals tiefe Falten im scharf geschnittenen, eher kleinen Gesicht, sein dichtes, feines Haar fiel ihm beständig in die Stirn. Etwas diskret Tragisches ging von ihm aus. Er hatte sich das Leben bequem eingerichtet, ohne in die Mühle eines regelrechten Berufs zu geraten, hatte ohne Geld denselben Traum vom Leben im Süden wie Cornelius De Kesel geträumt und war nun in die Jahre gekommen, in denen ihm nicht mehr der Kredit gewährt wurde, den er in seiner Jugend genossen hatte; die Augen sahen traurig unter den langen Wimpern hervor, während er an billigen Torpedo-Zigarren saugte. Aber in all dem lag auch etwas von Zuverlässigkeit und Treue, und obwohl die Verwaltung von La Chaumière, die er schließlich übernommen hatte, nie wirklich überprüft wurde, enthielten seine Abrechnungen nichts Mißtrauen Erregendes, das war schon in Ordnung so.
Und er war klug genug, es nie zum Streit mit den dos Santos’ kommen zu lassen. Seine Korrektheit entwaffnete sie, sie zogen sich im Umgang mit ihm in schlechte Laune zurück, aber das taten sie bei allen anderen ja ebenfalls.
3
Fritz Allmendinger, in Ruprecht Dalandts Papyros Press der Mann der Zahlen und des Vertriebs, holte die neue Lektorin am Bahnhof ab; Sieglinde Stiegle hatte Angst vorm Fliegen und war mit dem Zug angereist. Die Hitze im Abteil hatte ihr zugesetzt, sie war aufgelöst und machte abwehrende Gesten, als Allmendinger sie umarmen wollte.
»Gut, daß du kommst, Sieglinde. Ich langweile mich zu Tode, und ohne dich kann die Arbeit nicht anfangen – was heißt hier Arbeit; Dalandt kann ja gar nicht arbeiten, hat noch nie gearbeitet. Wir müßten ihn nur irgendwie dazu bringen, den Startschuß zu geben, sonst rutscht uns das ganze Programm davon.«
Allmendinger sah sie bei diesen Worten nicht an, seine Augen waren auf die Straße gerichtet. Sein Sportwagen war ein älteres Modell, das er schonte, aber in La Chaumière hatte er gern damit vorfahren wollen. Das gab ihm Sicherheit und milderte den Druck des fremden Wohlstands, der auf ihm lastete, wenn er in die sommerliche Residenz des Verlegers eingeladen – oder besser: einbestellt – wurde.
Sieglinde Stiegle hatte als Gepäck einen großen Rucksack und eine Tasche bei sich. »Ich war unsicher, was ich einpacken sollte. Dalandt hat gesagt: ›Alles ganz einfach bei uns‹, aber wenn ich ihn mir ansehe, dann kann ich das nicht glauben.«
»Doch, darfst du glauben. Wir beide sind Intellektuelle, ohnehin nicht für voll genommen – man zieht sich zwar zum Abendessen um, aber ich vermute, nur für das Personal. Und du darfst dir auch keine Villa vorstellen, keine großartigen Gartenanlagen. Nein, alles ganz natürlich, bäuerlich, wie aus dem Bilderbuch – antiluxuriös! Ein schlichter Rückzugsort für eine Künstlerseele. Nicht gerade strohgedeckt, auch größer als eine Hütte, aber das Haus ist kaum zu sehen, ins Gelände hineingedrückt, die meisten Räume zur ebenen Erde, die Schlafzimmer im Dachgeschoß mit schrägen Wänden und Mansardenfenstern, aus dem Schornstein der Rauch vom Holzfeuer, jetzt natürlich nicht, es ist zu heiß, aber das gehört eigentlich dazu. Und drumherum nur Macchia, ausgetrocknetes Gestrüpp, Gewürzkräuter, Kaninchen, aber auch kleine Schlangen und Skorpione – besser nicht in Sandalen spazierengehen!«
»O weh, ich habe nur Sandalen dabei …«
»Du wirst kaum zum Spazierengehen kommen. Was du dir klarmachen mußt, wenn du diesen verwunschenen Besitz siehst: Dahinter steht ein ungeheures Geld. Dalandt hat die Tochter des Mannes geheiratet, der in den vierziger Jahren La Chaumière gekauft hat. Der aber war der Sohn von Job De Kesel, und der wiederum hatte nichts mit Künstlerparadiesen zu tun, der hat Bergwerke im Kongo besessen, als das die wichtigste belgische Kolonie war – unvorstellbar reich …« Allmendinger erlag dem Zauber der hohen Zahlen. Multimillionäre gab es inzwischen haufenweise, das hatte keinen Glanz mehr, nach heutigen Begriffen mochte Job De Kesel Milliardär gewesen sein, »vielfacher Multimilliardär«, entfuhr es ihm.
Sieglinde Stiegle vermutete, das sei ein Scherz, aber das war es nicht; er brauchte die Übertreibung, um das, was er beschreiben wollte, in seiner Unbegreiflichkeit deutlich werden zu lassen.
»Ein solches Vermögen!« Und er meinte mit diesem Ausruf nicht einfach nur den Haufen Geld, sondern auch, wie der zustande gekommen war. Die Heerscharen von Schwarzen, die in den Gruben geschuftet hatten – Tausende, das waren Allmendinger auch schon wieder viel zu wenig, Zehntausende, ganze Völkerschaften, ganze Stämme, unter erbärmlichen Umständen, Menschen, die sich gar nicht vorstellen konnten, was mit den von ihnen aus dem Boden gegrabenen Metallen eigentlich geschah, wofür sie gut waren, wohin sie gelangten, wer den Vorteil hatte von der immensen Anstrengung. Und wenn diese Völker nun gesehen hätten, wofür sie Schweiß und Blut vergossen hatten? Nur als Beispiel herangezogen: Ägypten. Die Arbeiter an den Pyramiden, die hatten, sofern sie das noch erlebten, die unerhörten, bis heute überwältigenden künstlichen Berge in ihrer Vollkommenheit geschaut – was hingegen hätte sich den Blicken der Schwarzen aus dem Kongo als Ergebnis ihrer Viecherei präsentiert? La Chaumière, ein Häuschen in der Macchia, mit mürrischen Domestiken, die für die Ankunft von Sieglinde Stiegle Hühnerbeinchen vorbereiteten. Darin, so Allmendingers erregte Rede, drücke sich der Geist des Zeitalters aus: das Verdampfen des Anschaulichen. Es sei dieser malerische Bauernhof in ausgetrocknetem Land einfach kein optisches Äquivalent für die Leiden der ausgebeuteten Kongolesen.
»Was wäre denn eines?« Ihre Stimme klang, als wehre sie sich gegen Allmendingers Pathos, aber der war um eine Antwort nicht verlegen.
»Der Brüsseler Justizpalast, maßlos, brutal, bedrohend – ein Ungerechtigkeitstriumph. Aber doch nicht diese spätkapitalistischen Schäferspiele!«
Sieglinde Stiegle ließ nicht nach. »Der Geschmack hat sich eben geändert. Heute liegt die Botschaft vor allem in der Adresse – im übrigen, je wohlhabender, desto unauffälliger. Und vielleicht ist nicht mehr so viel Geld da wie damals, wer weiß?«
»So viel sicher nicht. Es ist ja schon die dritte Generation, die nicht mehr aktiv mit dem Vermögen arbeitet. Das wird nur noch verwaltet, aber das heißt nicht, daß Marjorie Dalandt eine sorglose Genießerin wäre. Ums Geld geht es den ganzen Tag, gerade mit Dalandt. Er hat Papyros ja schon vor seiner Ehe mit ihr gegründet; es war immer ein Verlag, der nicht leben und nicht sterben konnte, aber das waren zugleich die besten Jahre: Von damals stammt unser Prestige. Seitdem sie für das Ganze bürgt, ist er viel vorsichtiger geworden. Sie besteht auf einer schwarzen Null – Dalandt, sonst so allergisch gegen Politikersprache, benutzt den Ausdruck in aller Unschuld. Und wundere dich nicht, wenn du das Ehepaar den ganzen Tag rechnend erlebst: Das hast du bezahlt, und das schuldest du mir, und das habe ich längst zurückgegeben et cetera, das ist ein richtiges Spiel zwischen den beiden. Sie hat immerhin in Harvard ihren MBA gemacht und hat unseren Dalandt inzwischen zum Buchhalter erzogen. Die Zeiten seines verlegerischen Idealismus sind vorbei. Er sucht jetzt nicht mehr nur die Anerkennung der Feuilletons, sondern will Geld verdienen.«
»Aber das schadet uns doch nicht.« Sieglinde Stiegle hatte aus seinen Worten offenbar einen Anklang von elitärer Sentimentalität herausgehört, verbunden mit der Neigung, dem Chef am Zeuge zu flicken: die Fortsetzung jener männlichen Dominationskämpfe, die schon in Deutschland in seiner Klage zum Ausdruck gekommen waren, er müsse in diesem Verlag alles ganz allein machen, Dalandt kümmere sich um nichts und führe in ihren Besprechungen erhabene Tischreden, anstatt in die sachlichen Niederungen hinabzusteigen. Darauf wollte sie sich nicht einlassen. »Meine Erfahrungen mit ihm sind bisher ganz erfreulich. Er hat Sinn für Lektoratsprobleme und steigt ins Detail ein …«
»Stichprobenartig. Du wirst schon sehen. Er schaut sich nur jede zehnte Seite an.«
»Vielleicht ganz klug. Wenn da alles in Ordnung ist, bedeutet das ja auch schon etwas, und wenn nicht, kann ich daraus Rückschlüsse auf die anderen Seiten ziehen.«
»Du wirst schon sehen.«
Sie hatten die Vororte der Stadt verlassen und befanden sich auf der Landstraße, die in Kunstkreisen weithin berühmt war, weil sie einen ikonisch gewordenen Blick bot. Allmendinger machte eine Geste, als schöbe er einen Vorhang zur Seite. »Voilà, die Montagne Sainte-Victoire! Der Berg schwebt über der Chaumière, deshalb ist das Haus überhaupt gekauft worden. Es ist eingefügt in ein gigantisches dreidimensionales Cézanne-Gemälde.«
Sieglinde Stiegle drehte den Kopf, so weit es ging. Tatsächlich, da war er, der Cézanne-Blick. Niemals hätte sie diesen von ihr bewunderten Meister als Naturalisten bezeichnet. Sie war stets überzeugt gewesen, daß es sich bei seinen Landschaften um Stilisierungen handelte, die vor allem die eigene Handschrift ausstellen sollten, die sehr spröde, geradezu bröckelige Pastosität, die wie unter Überwindung eines Widerstands aufgetragenen Flecken, die durch viel Weiß ermatteten Farben, das schwache Grün, das fahle Gelb, die nicht ineinander verschmolzenen Farbfelder, und hier offenbarte sich nun, daß der Mont Sainte-Victoire wirklich so aussah: in der Sonne wie ein Kadaver ausgedörrt, trocken wie Gips oder Mehl, blaß und ausgesogen. Dies alles war naturgetreu erfaßt, jedenfalls jetzt im Mittagslicht – abends mochte der Berg seine müden Wangen rosa schminken, aber war es nicht ein besonderes Verdienst seines Malers, daß er sich mit romantischem Lichtzauber nicht eingelassen, sondern seinen Lebensberg in der nüchternen Nacktheit des Tageslichts hatte erscheinen lassen? Phantasie war schön und gut, aber noch aufregender war die Entdeckung, daß ein Kunstwerk, das sie für gänzlich autonom gehalten hatte, in Wahrheit sehr eng an eine Realität angelehnt war und sie sogar übertraf. In ihrem Erstaunen hatte sie Allmendinger einen Augenblick nicht weiter zugehört.
»Es gibt auch einen Maler im Haus, einen Mann mit Familienanschluß und einer für mich unklaren Position, einen Engländer, der mal angefangen hat, im Haus herumzumarmorieren, und zum Glück bald wieder damit aufgehört hat. Er scheint ein Parasit des alten De Kesel gewesen zu sein, hält sich jetzt aber aus eigenem Recht auf dem Grundstück auf und verwaltet das Haus; ein ewiger Jüngling, inzwischen schon deutlich am Rand zum Greisenalter, eine Art Hippie-Existenz. Und dann, als schweigende und sich gelegentlich gefährlich verdüsternde Norne, ist da noch Marjorie Dalandts Tochter Paula aus erster Ehe mit einem algerischen Galeristen aus Paris. Das sieht man auch, sie ist eine maghrebinische Schönheit mit schwarzen Augenbrauen, dick wie mit einem angebrannten Kork gezogen.«
»Frida-Kahlo-artig?«
»Das trifft es nicht so schlecht, wenn auch ohne Zöpfe. Eine herbe Person, eher knabenhaft, aber ein beleidigter Knabe, wie Knaben eben sind. Hat eine Tochter, zu der es keinen Vater gibt – bei ihr könnte man sich vorstellen, daß sie das Kind ganz allein, in Parthenogenese, aus sich hervorgebracht hat. Ich vermute, sie mag keine Männer, vor allem solche, die dem Alter nach für sie in Frage kämen – so, wie sie den Freund behandelt, den sie dabeihat.«
Sieglinde Stiegle sah ihn von der Seite an. »Das klingt, als wärst du selbst der Beleidigte, womöglich der Zurückgewiesene? Nach allem, was du mir erzählst, müßtest du doch darauf bedacht sein, der Familie nicht zu nahe zu rücken.«
Die beiden hatten beim ersten Kennenlernen entschieden, daß sie füreinander nicht in Frage kamen, was ihr Verhältnis spannungsfrei machte und sogar ein gewisses Vertrauen hatte wachsen lassen, das war nicht selbstverständlich. Der Verlag war klein, der Kernbestand der Mitarbeiter an einer Hand abzuzählen, und nach jahrelangem Zusammenwirken widerstand Dalandt nicht der Neigung, die anderen gegen Allmendinger einzunehmen – damit hatte er auch bei ihr schon begonnen –, während Allmendinger daran arbeitete, eine Front gegen Dalandt zu schmieden. Wobei »schmieden« ein zu starkes Wort ist, denn die Menschen, mit denen er im Verlag zu tun hatte, waren nach seiner Erfahrung nicht aus Stahl, vielmehr überhaupt nicht metallisch, sondern aus biegsamer, zum Zerfallen neigender Materie. Allmendinger meinte aber, beobachtet zu haben, daß Sieglinde Stiegle dem kunstvollen Werben, bestehend aus kleinen Komplimenten, verständnisvollem Lächeln, ernsthaftem Zuhören, wie Dalandt das eben zu mischen verstand, bisher nicht nachgegeben hatte. Der Verleger wurde von ihr genauso abwehrend ironisch behandelt wie er selbst – oder gehörte das schon zum Flirt? Er fuhr fort, ihr Dalandt von dessen bedenklichsten Seiten her zu schildern, natürlich unter sorgfältiger Vermeidung irgendwie gehässiger Untertöne, nein, einfach genauso psychologisierend und analysierend, wie das von einem Kenner der Literatur zu erwarten war. Man sprach in seinen Kreisen schließlich über jeden so, auch über Freunde. Ungedämpfte Solidarität wäre als naiv empfunden worden.
Der Wagen rumpelte jetzt über den Feldweg, der durch ein Steineichenwäldchen zum Haus führte. Sie bogen in eine Kurve, das Wäldchen lichtete sich, und auf dem abfallenden Gelände lag La Chaumière. Zunächst war nur das alte Mönch-und-Nonnen-Dach sichtbar, dann die Nebengebäude, die ein Geviert bildeten und die Anlage geradezu wie einen kleinen Weiler aussehen ließen.
»Allerliebst«, sagte Sieglinde Stiegle und spitzte die Lippen, um dem altmodischen Lob den richtigen mimischen Kommentar mitzugeben, obwohl das soeben niemand würdigen konnte.
4
Marjories Taktlosigkeiten wurden dadurch erträglich, daß sie das, was für andere peinlich sein mochte, mit einer Ruppigkeit äußerte, die anästhesierend wirkte. Was ihr gerade durch den Kopf ging, sprach sie aus, ungefiltert, und die Zuhörer verstanden das und billigten ihr eine gewisse Unschuld zu. Wer täglich mit ihr zu tun hatte, Ruprecht, Paula, der Verwalter Damien, war ohnehin abgehärtet – da fiel die kleine Nike heraus, die schnell gekränkt war und ihrer Großmutter nicht verzieh, wenn sie Wünsche handgreiflich durchsetzte; ein sechsjähriges Mädchen zweimal um etwas zu bitten kam für Marjorie nicht in Frage. Nur bei ihr stimmte Nike kein Wehgeschrei an, wenn sie ihr mit festem Griff aus der Hand nahm, was sie nicht anfassen sollte. Das Heulen ging erst los, wenn Paula, die Mutter, hinzutrat, und konnte überhaupt so lange aufgespart werden, bis ihr ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit sicher war.
»Sind Sie die Nachfolgerin von …« Marjorie wandte sich, den Suppenlöffel leicht in der Hand wiegend, von Sieglinde Stiegle zu Fritz Allmendinger. »Wie hieß noch Ihre letzte Freundin?«
Sieglinde Stiegle errötete, Allmendinger haspelte vage Erklärungen, denn beide waren nicht darauf vorbereitet, zu diesem Punkt Auskunft zu geben. Daß da seit neuestem möglicherweise doch etwas in der Luft lag, war eher unwahrscheinlich, vor allem was Sieglinde Stiegle anging, die zwar Ausschau nach einem Freund hielt, zugleich aber ein Mißtrauen gegen Männer in ihrem Alter hegte, die noch nicht vergeben waren. Und Allmendinger war weder Witwer noch geschieden, sein Freiheitszustand nicht greifbar.
»Sie gehören offenbar zu den klugen Frauen, denen das Aussehen ihrer Partner gleichgültig ist. Nicht zu diesen dummen Gänsen, wie ich eine bin. Bei meinen beiden Ehen habe ich auf die Schönheit der Männer geachtet – Toufik war so schön, daß sich die Leute auf der Straße nach ihm umgedreht haben, und Ruprecht war zwar an den Ecken schon etwas abgestoßen, ich allerdings auch. Sie glauben mir vermutlich nicht, daß meine Mutter bildhübsch war, ein Mannequin, sagte man damals noch, was ja auch Puppe heißt, und genau das war sie in ihrem kurzen Leben. Leider hat nicht sie mir das Gesicht vererbt, sondern mein Vater, ich bin seine Verdopplung, und zum Glück hat sich bei Paula dann Toufik durchgesetzt. Und bei Nike …«
Wohin strebte sie in ihrem unbedachten Monolog, während alle Anwesenden auf ihre inzwischen leeren Teller blickten? Hat der Ehemann die Pflicht, einer sich abzeichnenden Entgleisung seiner Frau zuvorzukommen? Ruprecht fand das offenbar nicht; als er den Kopf hob und seiner ins Stocken geratenen Frau ins Gesicht sah, geschah dies in vollständiger Gelassenheit, ja Ausdruckslosigkeit, als denke er: Was habe ich mit dieser Frau zu tun?
Später, als abserviert war und im Salon Whisky angeboten wurde, entspannte es sich wieder. Darauf folgte ein nächtlicher Spaziergang, nur auf gebahnten Wegen, ums Haus herum, eine von Cornelius De Kesel eingeführte Sitte, die den Rückzug der Gastgeber einleitete. Damit war der gesellschaftliche Zwang aufgehoben.
Allmendinger schlenderte mit Sieglinde Stiegle hinter der Familie her. Ziel war ein großes, aus der römischen Antike stammendes Ölfaß aus Ton, auf einem gemauerten Sockel und von hohen Lupinen umgeben, ebenso wenig gepflegt und sogar etwas struppig, als wüchsen sie an einem Bahndamm. Das war auch das Abzeichen der De Keselschen Gemüsegärten, diese leichte Verwahrlosung, die Marjorie beibehielt, indem sie João einfach so machen ließ, wie er es unter ihrem Vater gewohnt gewesen war. Zu den unumstößlichen Gesetzen des Verstorbenen gehörte: Gepflegte Gärten seien kleinbürgerlich, bei ihm müsse es so aussehen, als sei da einmal etwas angelegt worden, was aber allmählich von der Natur zurückerobert werde. Eine Lampe mit weißem Licht hing über dem Hof und bestrahlte die tönerne Amphore wie ein Filmscheinwerfer. Wer in ihre Richtung sah, wurde geblendet.
»Ist es eigentlich schön hier?« fragte Sieglinde Stiegle so leise, daß das Knirschen der Kiesel auf dem Weg die Stimme beinah verschluckte. Sie war unsicher geworden.
Allmendinger antwortete nicht, sondern verweilte in seinen eigenen Phantasien, die er jetzt, ebenso gedämpft, aussprach. »Ich überlebe ein solches Essen, indem ich nicht mehr zuhöre und mir alle Anwesenden als Hunde vorstelle. Bei manchen ist das leicht, der Engländer mit seinem unerschütterlich mannhaften Trübsinn hat ja ohnehin ein richtiges Hundegesicht, von einem Basset etwa, mit den vorwurfsvollen Triefaugen und den hängenden Lefzen –«
»Aber bei den anderen muß man etwas nachdenken.« Sieglinde Stiegle war ihm ins Wort gefallen und schloß sich seinem Spiel mit kleinem Lachen an. »Der Freund der Tochter ist ein Schäferhund, von unbegrenzter Dienstwilligkeit.«
»Ja, aber bei der Tochter ist es nicht so leicht, und wenn ich jetzt sage, die ist ein schwarzer Dobermann, dann meine ich weniger die physische Ähnlichkeit als diese Ausstrahlung von Bedrohlichkeit, das Fehlen einer Beißhemmung, das hinter dem Schweigen verborgen sein könnte.«
»Auf jeden Fall ist sie eine schwarze Hündin, die dunklen Augenbrauen verlangen das einfach. Und ihre kleine Tochter ein Zwergspitz – das kann sich vielleicht noch auswachsen, dieses Spitznasige mit den blanken Nagetieraugen, ihre bösartige Weise, hübsch zu sein.«
»Du magst das Kind also auch nicht, Sieglinde, niemand scheint es zu mögen. Das versucht die Mutter mit verzehnfachtem Aufwand wettzumachen. Es bekommt dadurch das Gefühl, immer auf der Siegerseite zu sein, denn es weiß genau, daß vor Paula alle Angst haben und auf Katzenpfoten gehen –«
Sieglinde Stiegle unterbrach ihn erneut. »Aber die Großmutter ist keine Katze, die ist nun wirklich ein Mops, mit wenig Nase und mit Quellaugen, vermutlich schilddrüsenkrank. Das würde das unkontrollierte Sprechen erklären.«
Das Gesicht habe sie vom Vater. Cornelius De Kesel sei ein feinsinniger Mops gewesen, der Typ des ängstlichen Despoten. Allmendinger sprach, als hätte er den Alten noch erlebt, was aber nicht sein konnte. Er beschrieb das Photo, das in einem breiten Silberrahmen auf der Kommode seines Zimmers stand. De Kesel hatte darauf churchillhafte Züge, ins Alterslose hineinretuschiert, was Greis und Säugling ineinandergleiten ließ.
»Und welcher Hund ist Dalandt?« Die Frage hätte sie nicht stellen müssen, denn sie hatte sich schon entschieden, und zwar für den afghanischen, langhaarigen Windhund, der ebenso vornehm wie gefühlvoll aussah und dem ebenfalls eine schwere Locke in die Stirn fiel. Und wenn das Fell des Hundes auch noch grau war –
»Dalandt ist schneeweiß, seitdem ich ihn kenne. Ich weiß gar nicht, wie sein Haar als junger Mann gewesen ist. Le vieux beau – wie würdest du das übersetzen?«
Sieglinde Stiegle dachte nicht lange nach. »Alternder Schönling.«
»Da siehst du, wie plump wir Deutschen sind. Wenn wir Schönheit begegnen, werden wir giftig.«
»Und doch habe ich es richtig übersetzt.«
Sie hielt inne, denn der vor ihr gehende Ruprecht war ebenfalls stehengeblieben, drehte sich um und kam auf sie zu.
»Sie sprechen von der Übersetzung – wunderbar. Ab morgen wollen wir uns darüberbeugen, in zwei Tagen sollten wir das geschafft haben.«
5
Ruprecht hatte in den letzten Jahren, als ein gewisser Erfolg von Papyros Press sich abzeichnete – darunter auch die weithin beachtete Prämierung als bester deutscher Kleinverlag des Jahres –, seine Tätigkeit als Essayist zurückstellen müssen; das Halten des erreichten Niveaus bedurfte beständiger Anstrengungen. Die Existenz als Schöngeist, die er geführt hatte, als er Marjorie kennenlernte, war längst nicht mehr weiterzuführen, und zugleich hatte er seine Freude an der Ökonomie entdeckt, jetzt, da nicht mehr einfach aus schierem Mangel aufs Geld geachtet werden mußte, sondern eine nennenswerte Masse vorhanden war, bei der das Haushalten sich lohnte. Er widerstand der Versuchung, mit höheren Einnahmen ein bißchen verschwenderisch zu sein; das Leben mit Marjorie hatte ihn gelehrt, daß solche Anwandlungen auf eine Arme-Leute-Mentalität schließen ließen.
Stets sah er den Blick seiner Frau auf sich gerichtet, einen eher zerstreuten Blick, denn sein Verlag interessierte sie nicht, aber sie wurde manchmal von der Neugier ergriffen, wie er zurechtkomme. Sie hatte genügend Geschäftsinstinkt von ihrem Großvater geerbt, um zu wissen, daß die schwarze und die rote Null nicht immer genau zu unterscheiden sind, und war im geheimen bereit, in einer Notlage von Papyros Press einzuspringen; nicht unbegrenzt, aber doch so, daß das Unternehmen noch einmal eine Chance erhielte. Was sie dabei hauptsächlich beschäftigte, war die Frage, wie Ruprecht es anstellen würde, ihr seine Verlegenheit zu gestehen. Aber dieser Augenblick kam nicht, denn sein Verzicht auf das Abfassen eigener Essays trug Früchte. Der Verlag stand jetzt viel stabiler da als zur Zeit ihrer Heirat, und wenn hinter seinem Rücken geraunt wurde, er habe den Verlag durch seine Verbindung mit ihr saniert, dann widersprach er dem nie, wenn er so etwas mitbekam. Das Gerücht von potenten Bürgen im Hintergrund förderte den Kredit. Er hatte seine Gründe, von Marjorie soweit wie möglich unabhängig zu bleiben.
In diesem Sommer sollte die Schreibabstinenz aber einmal unterbrochen werden. Er hatte Allmendinger in dessen verdrossenes Gesicht hinein angekündigt, daß er einen eigenen Essayband vorbereite. Warum eigentlich dachte er trotz wachsender Abneigung niemals daran, diesen freudlosen, jeden Enthusiasmus abtötenden Mann loszuwerden? Das wurde überhaupt nicht erwogen, und auch Allmendinger hatte offenbar nicht vor, den Verlag zu verlassen, obwohl er täglich zu leiden schien, wenn er mit Ruprecht zu tun hatte. Nein, diese unharmonische Konstellation war eisern – gänzlich ausgeschlossen, sie aufzulösen, das hatte geradezu etwas Institutionelles.
Allmendinger betrachtete den Verlag als sein Werk, das war Ruprecht sehr wohl bekannt. Um das Anstellungsverhältnis zu beenden, hätte er den Laden schließen oder verkaufen müssen, die einzige Drohung, die dann doch über Allmendingers Haupt hing und dessen Lage ein wenig ungemütlicher machte. Wenn man es recht überlegte, war dieses festgefahrene Verhältnis mit den grauenvollen Wiederholungen in Dantes Hölle verwandt – der Vergleich kam ihm nicht von ungefähr, denn er plante tatsächlich schon lange einen Dante-Essay, die hohe Schule des Essays schlechthin: der Dante-Essay. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie höhnisch Allmendinger darüber sprechen würde: »Natürlich schreibt er einen Dante-Essay, darunter tut er’s nicht, nur was ganz Feines darf es sein.« Und dabei war sein Interesse an der Danteschen Höllenvision aufrichtig. Ohne dem Christenglauben anzuhängen, pflegte er die Gewissenserforschung rücksichtslos und verwandte darauf so viel Zeit, daß Psychologen womöglich von Zwangsgedanken gesprochen hätten.
»Ich bin der, der das und das getan hat«, so sagte er im Stillen vor sich hin, wenn er mit Marjorie über Geld sprach oder mit Allmendinger über das Programm. Und das war ein Dante-Gedanke: Die Menschen waren das, was sie getan hatten – ob in lasterhafter Wiederholung oder auch nur ein einziges Mal. Ihre Tat definierte sie erschöpfend; da gab es keine Ausflucht, kein »Ich ist ein anderer«, im Gegenteil. Zwischen eine Person und ihre Tat paßte kein Blatt Papier – kein Attest, kein Plädoyer, keine die Person und ihre Motive zerlegende Analyse. Die Tat des Menschen war seine Form, ohne die Tat gab es ihn gar nicht, die Tat ließ ihn entstehen, und zwar als einen auf ewig Verdammten. Das war der beunruhigende Gedanke, der aus der ›Inferno‹-Lektüre auf ihn übergesprungen war. Um dies als Bedrohung zu empfinden, bedurfte es nicht der Vorstellung eines Totengerichts, das jedem nach seinen Sünden die Strafe zumißt. Dieses Gericht entstammte der Mythologie, selbst der Katholik Dante hatte es mit archaischen Figuren wie Minos und Radamanthys besetzt. Eine altertümliche Märcheninszenierung, auch als solche erkannt, und doch drückte sie nichts anderes aus als das, was bis heute galt: Ich bin, was ich getan habe. Und wenn das galt, was war dann er?
Ruprecht kannte die Antwort. Zunächst war es, als hätte sich mit der Überschreitung eine bis dahin verschlossene Tür aufgetan, dahinter ungeahnte Möglichkeiten, eine Offenbarung. Aber dann zeigte sich sehr schnell, daß der neue Raum sehr klein war und immer dasselbe darin ablief. Er war seit Jahren mit einem optischen Tinnitus vertraut, mit Bildern, die ihn nie verließen, jedem seiner Worte unterlegt waren und neben jedem seiner Gedanken herliefen. In unbeholfener technischer Sprache: Da war etwas eingerastet, etwas hängengeblieben, ein Kratzer in der Schallplatte behinderte das Weiterwandern des Tonabnehmers. Die Tat war in ein ewiges Jetzt übergegangen und hatte aus sich heraus die Qual geboren, das Kind der Sünde oder gar ihr eigentliches Wesen. Das immer neue Eintauchen in das kochende Pech, das Kreisen unter Feuerregen, das Hocken in der Kloake, das Festfrieren im Eis, ohne jemals darin erfrieren zu können – lange Zeit hatte er sich der nicht selten vertretenen Ansicht angeschlossen, all dies seien Wahnbilder einer sadistischen Phantasie, mit dem Nebenzweck, die Leute einzuschüchtern und den sogenannten Gnadenmitteln der Kirche zuzutreiben, die sich an der Angststeuer mästete. Aber er wußte inzwischen, daß nur wenig Phantasie bei diesen Schilderungen im Spiel war, daß es sich vielmehr um einen Realismus handelte, um ein Phänomen, das keineswegs erst nach dem Tod eintrat, sondern schon bei warmem Blut.
Nicht jede Sünde brachte es hervor. Es mußte etwas sein, was keinesfalls hätte geschehen dürfen, das Verletzen einer Grenze, die auch ein sittlich verwahrlostes Subjekt noch zurückhält. Diese Grenze lag für jeden woanders, je nachdem, wie entwickelt das Gewissen war, aber es gab sie gewiß auch bei einem vollständig verrohten Menschen.
Und wenn sie überschritten war? Dann konnte es zu dem kommen, was Dante in der Hölle beschrieben hatte: Die Gedanken spalteten sich in zwei Teile. Der eine Teil lief weiter und wandelte sich mit den Umständen des Tages, brachte neue Einfälle hervor, stand mit der Umgebung in Verbindung, antwortete, erfand, hatte witzige Einfälle oder geriet in Verdüsterung. Der davon abgespaltene Teil hingegen hielt den begangenen Exzeß beständig gegenwärtig und unterspülte damit die Festigkeit des Denkens; das obszöne Bild, das er bewahrte, war allem Späteren von nun an unterlegt, es relativierte alles. Dante hatte das, was er beschrieb, ganz sicher mit eigenen Eindrücken solide gemacht. Seine Höllenlandschaften bezogen sich auf ihm vertraute Gegenden Italiens, deren Charakter er lediglich steigerte, und deshalb durfte man überzeugt sein, daß er auch die Prägung der bösen Tat gekannt hatte, die sich nicht abschütteln ließ.
Ruprecht wußte, wie es war, wenn der Geist an der begangenen Grenzüberschreitung klebenbleibt und das, was später noch geschieht, entwertet. Ein kurzer Film lief ab, Tag und Nacht, seit Jahren schon, vor seinem inneren Auge, was sonst er auch tat – während er sich mit Allmendinger über die geplante Leontjew-Übersetzung beriet oder bei einem Abendessen, wenn er neben Marjories alten Freunden saß. Eine weiche Linie von der einen Schulter bis zur schlanken Hüfte und zum Becken, bräunliche Haut, jung und samtig, ein unterdrückter Schmerzenslaut, ein Heben des Kopfes mit tiefschwarzem Haar, aber nicht hin zu ihm, eine fast noch kindliche Hand, die einen Speicheltropfen von den Lippen nimmt, ein Faden bildet sich dabei, und dann hinunterwandert, um sich damit einzusalben, während das Gesicht mit verlorenem Profil wie nachdenklich vor sich hin blickt, die überraschende Erfahrenheit dieser Geste, die Unterwerfung unter seine Wollust, als wäre sie darin unterwiesen worden – dies alles eindrucksvoll, frisch wie am ersten Abend, das Gefühl einer Vergiftung in seinen Adern erzeugend, immer aufs neue, als letztes Bild vor dem Einschlafen und als erstes beim Erwachen.
Viele sind mit dem Wort Ewigkeit schneller zur Hand, als es angesichts der Unvereinbarkeit von Zeit und Ewigkeit erlaubt wäre. Der Bilderunterstrom, der ihn auf die Wahrscheinlichkeit eines Realismus bei Danteschen Höllenstrafen schließen ließ, der hielt erst sieben Jahre an – sieben Jahre lag inzwischen zurück, was als inneres Bild nicht vergehen wollte, unabgeschwächt, stets gleich eindringlich und seinen Körper unter Strom setzend, der in den gut geschnittenen Anzügen jugendlich straff aussah, nackt aber die faltige Sehnigkeit eines Asketen besaß, der mit dem sinnlichen Leben abgeschlossen hat. Ein junges Mädchen sollte so etwas nicht sehen, das war ein Gedanke, der ihn streifte, wenn er sich nach dem Baden im Spiegel sah, die Sorge, die müde gewordene Haut und die zitzig hängenden Brustwarzen könnten das Gefühl des Widerwillens in einer Jüngeren auslösen, was ihn etwa daran hinderte, in Anwesenheit anderer in ein Schwimmbecken zu steigen. Aber dann das Staunen, die Erleichterung, schließlich die Überflutung mit Dankbarkeit, als das Befürchtete damals vor sieben Jahren nicht eingetreten war. Stattdessen nur köstliche Unterwerfung, und auch dieses Erlebnis blieb frisch, ließ sich nicht vertreiben und verhinderte ein Erwachen von Reue. Und auch das verband das bruchlose Andauern der unwillkommen-willkommenen Bilder mit den Danteschen Höllenstrafen. Die Mörder und Verräter, die Geizigen und die Verschwender bereuten ja ihre Taten nicht, noch nicht einmal, weil die sie in die ewige Verdammnis gebracht hatten. Keiner von ihnen dachte auch nur flüchtig: Hätte ich doch nicht getan, was ich getan habe; hätte ich gewußt, was das für Folgen haben würde, dann hätte ich es nicht getan. Nein, keiner der Verdammten vermochte, sich die eigene Person, sein Ich, ohne die verbrecherische Tat vorzustellen.
Und Ruprecht ging es nicht anders. Die unerwartet hohe Strafe für das Geschehene bestand darin, daß es kein Danach geben sollte, auch wenn das Herz das Blut noch jahrelang durch die Adern pumpte, keine Zeichen geistiger Ermattung sich einstellten und selbst Alterserscheinungen maßvoll blieben. Das seidenweiche volle Haar, vor mehr als zwanzig Jahren leuchtend weiß geworden, ließ ihn neben dem künstlichen Orange von Marjories Locken sogar jugendlich aussehen. Aber das alles half nichts, denn er mußte sich eingestehen: Das Leben war vorbei.
6
La Chaumière war behaglich, das typische Landhaus der Vorkriegszeit, dabei war es erst in den vierziger Jahren eingerichtet worden: Der lange Refektoriumstisch, die ländlichen Stühle aus dem achtzehnten Jahrhundert mit korbgeflochtenen Lehnen, die leinenbezogenen Kissen, die warmes Licht verbreitenden Lampen in chinesischen Vasen, das alles war durch die gemeinsame Patina zu einem wohnlichen Ensemble zusammengeschmolzen.