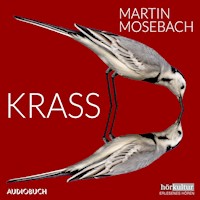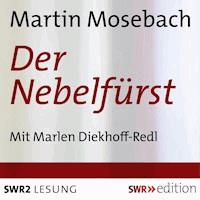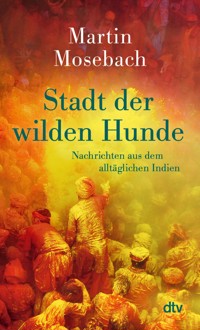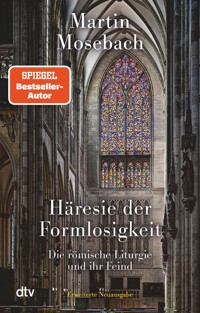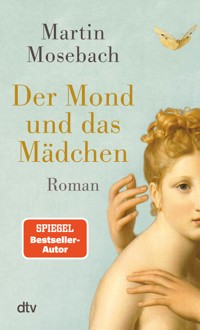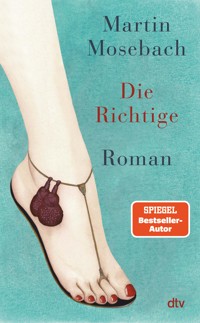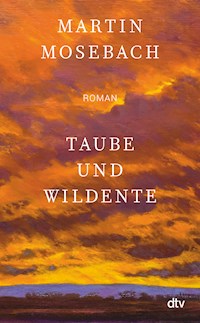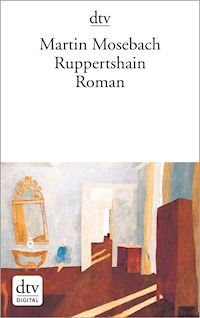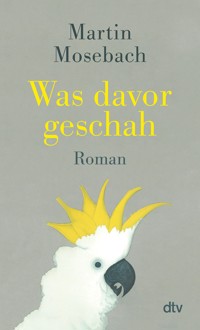
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Funkelnd, meisterhaft, unterhaltsam!« Pia Reinacher, Die Weltwoche In einem intimen Moment stellt eine junge Frau ihrem Liebhaber jene Frage, die unschuldig klingt und doch den Keim der Eifersucht enthält: Wie war das eigentlich mit dir, bevor wir uns kannten? Seine Antwort gerät zu einem Gespinst aus Wahrheit und Dichtung, einem Lügenpalast. Frankfurt ist dabei die phantastische Bühne für ein schwebendes Gesellschaftstheater: Muss eine Familie, müssen zwei Ehen zerfallen, damit ein Paar sich findet?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
In einem intimen Moment stellt eine junge Frau ihrem Liebhaber jene gefährliche Frage, die unschuldig klingt und doch schon den Keim der Eifersucht enthält: Wie war das eigentlich mit dir, bevor wir uns kannten? Seine Antwort gerät zu einem Gespinst aus Wahrheit und Dichtung, einem wahren Lügenpalast, errichtet aus soliden Bausteinen von Wirklichkeit. Frankfurt ist dabei die phantastische Bühne für ein schwebendes, groteskes Gesellschaftstheater: Muss eine Familie, müssen zwei Ehen zerfallen, damit ein glückliches Paar sich findet?
Von Martin Mosebach sind bei dtv außerdem erschienen:
Das Bett
Rotkäppchen und der Wolf
Das Beben
Stadt der wilden Hunde
Der Mond und das Mädchen
Taube und Wildente
Die Richtige
Martin Mosebach
Was davor geschah
Roman
Der Autor dankt dem Wissenschaftskolleg zu Berlin für Gastfreundschaft und Unterstützung.
1.
Musikalische Introduktion
»Wie war das …?«
»Wie war was?«
»Als es mich noch nicht gab?«
»Das war, als ich ein halbes Jahr allein in Frankfurt lebte …«
»Wie war das, als du allein in Frankfurt gelebt hast?«
»Ach, das war nichts Besonderes, das war so …«
Eine Wohnung habe ich schnell gefunden, einfach weil ich die erste beste genommen habe. Nein, nicht die erste beste. Es war buchstäblich die erste, die man mir zeigte, und ich habe sofort zugegriffen, obwohl sie zu teuer für mich war. Das Licht in dem Zimmer, das zur Straße hinausging, hat mich verführt. Keine auffällig schöne Straße, nebenbei. Häuser, kurz vor dem Ersten Weltkrieg gebaut; erstaunlich, daß das billige Bauen, die dünnen Mauern, die mickrigen Proportionen da schon angefangen hatten, obwohl der große Paukenschlag, der die Verwüstung der Städte einleitete, noch gar nicht herniedergedonnert war; er schwebte noch in der Luft über dem Fell, und doch hatten die Bauherren und Architekten das Neue schon gerochen und zogen daraus ihre kapitalvermehrenden Schlüsse. Aber das Licht in dem großen Zimmer, das hatten sie nicht geplant. Das wurde von einer riesenhaften Kastanie hervorgebracht, die auf der anderen Straßenseite stand, so hoch wie die dreistöckigen Häuser, aber von den Lasten ihrer Laubmeere gebeugt, sie wölbte sich über der Fahrbahn und neigte sich meiner Wohnung entgegen, man glaubte, vor dem schmalen Balkon meines Zimmers geradezu in ihre gefächerten hellgrünen Blätter greifen zu können. Die Kastanie war wie ein gigantischer Schwamm, der das flüssige Sonnenlicht in sich hineinsaugte und auf den sanften Druck des Sommerwindes hin wieder abgab, hellgrün gefärbt wie das Wasser in einem großen alten Glas. Das ganze Fenster war von der wäßrig wogenden Blättermasse ausgefüllt, das Kastanienlaub, unten breit und rund, am Stiel spitz zusammenlaufend und an einem einzigen Punkt aufgehängt, war in stiller Bewegung, das dem Atmen eines Körpers glich. Eines Körpers, der scheinbar voluminös und undurchdringlich war, in Wahrheit aber nur aus Luft bestand und aus den zarten Laubmembranen.
»Es ist hier allerdings recht dunkel«, sagte der Hausmeister, der mir die Wohnung aufgeschlossen hatte. Nein, dunkel war es nicht, sondern dämmrig wie in einer von Sonnenpünktchen gesprenkelten Laube. Gegen Abend – vom geröteten Himmel war freilich nichts zu sehen – vertiefte sich für eine kostbare halbe Stunde das Grün, das frisch Grasige wurde satter, smaragdfarben, und enthielt noch genügend schweres Licht, als das Zimmer schon ganz in die Nacht versunken war. Dies Licht strahlte jetzt aber nicht mehr, sondern wurde körperlich, es blieb im Leib der Krone eingeschlossen, wie das Licht sehr früher Kirchenfenster nur die Glasstücke erglühen läßt, aber die Kapelle nicht ausleuchtet. An meinem ersten Abend in der Wohnung setzte ich mich auf einen Stuhl in der Mitte des Zimmers und sah auf das Fenster wie auf eine Filmleinwand. Ich glaubte, niemals in einem schöneren Zimmer gewesen zu sein.
Die Straße war leicht gebogen, das ging noch auf den Feldweg zurück, der hier durch Wiesen geführt hatte, bevor das ganze Viertel in einem Wurf geplant worden war. Daß der Baum älter als die Häuser war, verriet nicht nur seine Höhe, sondern auch das Vorgartenmäuerchen zu seinen Füßen, das respektvoll um ihn herum führte. Dies kleine Zeichen der Bewunderung für seine Schönheit bewies, daß die Planer sich damals nicht als göttergleich empfanden, als besäßen sie das Privileg, Welten zu schaffen, als habe es vor ihnen nichts gegeben. Der Baum durfte aus einer vergangenen Ländlichkeit in die städtische Gegenwart hineinragen, und inzwischen war auch die neue Zeit zwar nicht alt, aber doch schon ältlich geworden, und der Baum steckte immer noch voller Lebenskraft und war alt und jugendlich zugleich, unter seiner grünen Hülle eine Heimat für tausend kleine Lebewesen. Vor allem aber für eines: Das machte sich aber erst am nächsten Abend bemerkbar.
Bei der ersten knappen Flötenphrase war es mir schon klar: dies war keine Amsel und keine Meise. Diese Stimme gehörte nicht einem der Singvögel, die sonst in dieser Stadt umherflatterten, Spatzen gab es erstaunlich wenige, dafür aber dicke Tauben, Krähen und Elstern, das Großgeflügel trug wahrscheinlich seinen Anteil Schuld am Verschwinden der kleinen. Dieser Flötenton aber war etwas ganz anderes als das Piepsen, das sonst aus einem Vogelkörperchen dringt. Es ließ mich aufhorchen, so wie das Parkett die Ohren spitzt, wenn in einer Oper die Diva ihre ersten Töne hinter der Kulisse singt, gedämpft und fern, und doch weiß jeder: Das ist sie – jetzt geht’s los. Was da aber vor meinem Fenster hinter den Kaskaden herabstürzender Blätter nun losgehen sollte, dies hielt mich mindestens ebenso in Bann wie der Gesang der Operngöttin ihren Verehrer. Der weiß ja, was er erwarten darf, und hofft nur, daß sie so schön singen wird wie auf ihrer besten Aufnahme, die er auswendig kennt. Ich hingegen war unvorbereitet, oder besser, es gab in mir nur eine Vorstellung aus der Literatur, eine von Lyrik gezüchtete Phantasie ohne größeren Wirklichkeitsgehalt als der Vogel Phönix – und doch, sie genügte, denn sie beschwor tatsächlich etwas Außerordentliches. Und so wußte ich, während die Dämmerung sich von der Hinterwand des Zimmers allmählich im Raum ausbreitete und das Laub draußen nur noch für sich selbst leuchtete: Das ist eine Nachtigall.
Sie hat einen Alt, dachte ich, wie man über eine Sängerin spricht. Und wirklich war dies Flöten nicht mit der Hervorbringung eines Musikinstruments aus Holz oder Silber vergleichbar, obwohl es so rein klang, so ungemischt und schlackenlos, wie man das mit einer Mechanik, einem Apparat verbindet. Aber man hat gewissen Sängerinnen nicht umsonst den Ruhmesnamen einer Nachtigall verliehen, das bestätigte sich jetzt. Eine bestimmte äußerst künstliche und kunstvolle Gesangstechnik des neunzehnten Jahrhunderts, inzwischen gänzlich aus den Opernhäusern verschwunden, zum letzten Mal vielleicht von Amelita Galli-Curci beherrscht, war ohne Zweifel vom Nachtigallengesang inspiriert. Töne, von denen man nicht glauben kann, daß sie von menschlichen Lippen, Zungen, Zähnen, Gaumen und Kehlen gebildet werden, sondern die als glattgeschliffene, zarte Körper im Menschenleib wohnen und ihn zuweilen wie ein Schwarm silberner Fische mit dem Atem zu verlassen scheinen, während die Sängerin selbst in verzauberter Unbeweglichkeit dies tönende Wunder bestaunt. Jetzt erst eröffnete sich mir in ganzer Fülle das Wort »Gurgel«. Die Nachtigall war ganz Gurgel, und aus dieser Gurgel sprudelte es und schluchzte es, gurrte und jubelte es in kühnen Läufen, die zu Koloraturen wurden und in sattem Schnarren wie aus dem Innern einer feuervergoldeten Pendule endeten. Der Name, der den Gesang der Nachtigall am genauesten erfaßte, war ihr französischer: Rossignol, ein rollendes R wie aus ihrer Kehle, die köstliche Tiefe des Alt und der kapriolierende Aufstieg der Phrase in die Lüfte, alles war in den drei Silben eingefangen.
Denn es war zum Staunen: Sängerinnen, die Vergleichbares leisteten, hatten ihre Körper schwer und unförmig werden lassen, und das geschah keineswegs in ästhetischem Widerspruch zu ihrer Stimme, denn die flötenhafte Schwerelosigkeit war auch das Ergebnis von Kraft. Von der Nachtigall wußte ich nur, daß sie winzig sei, bräunlich, wie einer der selten gewordenen Spatzen, aber schlanker, ein wenig gestreckter, kindlich-edler. Ich vermutete, daß ich sie nicht finden würde, so ausdauernd ich auch in die grünen Fluten starrte. Sie saß dort im Innern allein, wie ein einsamer Sängerknabe unter der Peterskuppel, sie machte in Ermangelung eines klangtragenden Körpers den ganzen Baum zu ihrem Resonanzraum. Und ihre Kraft entsprach diesem Riesenraum.
Die ganze Straße lag in jenem tiefen Schweigen, wie es in manchen Augenblicken nur in Großstadtstraßen möglich ist, die unversehens erscheinen können, als habe eine Katastrophe sie entvölkert. Herrschte dies Schweigen nur, damit die Kraft der Nachtigall sich ungestört entfalte? Ihr Gesang war eine Demonstration dieser Kraft. Zuerst bewunderte ich die goldene volle Tiefe der Töne, aber dann kam eine kurze Stille, eine Atempause, die eine noch kräftigere Salve vorbereitete. Ein müheloses Schmettern und Triumphieren lag jetzt in ihrem Gesang, ich meinte den Willen zu spüren, durch Unermüdlichkeit und sich immer weiter steigernde Anläufe zu verblüffen. Ihr Gesang wurde zu einem Ausdruck der Unbesiegbarkeit. Das war kein Lockgesang. Die Nachtigall bedurfte keines weiteren Wesens, sie pfiff nicht listig oder verzweifelt, um auf sich aufmerksam zu machen, sie sang, wie ein Stern strahlt in der kosmischen leeren Nacht. Ob glücklich oder unglücklich – das waren keine Kategorien für die Nachtigall. Ihre Sehnsucht war erfüllt, sie bedurfte keiner Hoffnung, kein Augenblick in ihrem Leben war vorstellbar, der sie über den gegenwärtigen Zustand hinausführen würde.
Gedichte hatten mich auf die Nachtigall vorbereitet, Hafis und Brentano, aber nun, als ich die Nachtigall endlich hörte und erfuhr, welche Lautfülle sich hinter diesem Namen verbarg, der nur ein Signalwort zur Erzeugung einer bestimmten poetischen Atmosphäre gewesen war, erschien es mir unversehens als hochgefährlich, die Nachtigall in ein kunstvolles lyrisches Zeilengespinst hineinzupflanzen. Nie mehr würde ich vergessen, was eine Nachtigall wirklich war: kein Gewürz, kein Parfum, kein Symbol, sondern eine Gewalt, deren bloße Nennung jedes Gedicht aus dem Gleichgewicht brachte, das schwanke lyrische Boot mußte kentern, wenn die körperlose Nachtigall an Bord ging, wenn sie aufstieg als das eigentliche, das unübertreffliche Chef d’œuvre, ein Lebewesen, das mit seiner Kunst identisch war und pulsierend und stolz jedes Kunstwerk übertraf.
Hörte sie niemals auf? Ich erinnere mich nicht an das Ende des Gesangs. Ich war so gebannt, daß ich darüber einschlief – dies war einmal der keineswegs untypische Fall, daß nicht die Langeweile, sondern das Entzücken in den Schlaf hinübergleiten ließ, während die Sängerin sich immer noch steigerte und die vorangegangenen Triumphe zum Fundament für noch größere Siege machte.
Dann war ich zwei Tage verreist, und als ich am dritten Tag, wieder gegen Abend, nach Hause kam und in meine Straße einbog, empfing mich dort eine eigentümliche Helligkeit und Reinlichkeit, die ich als Stimmung nicht in Erinnerung hatte. Auch im Abendlicht sah die Straße aufgeräumt bis zur Blankheit aus, ihre perspektivische Verjüngung war wie mit einem Kurvenlineal gezeichnet. Dann wurde es mir klar, nach einem zeitlosen Augenblick der Verwirrung: Der Baum war weg – seine Schattenmassen lagen nicht mehr über der Straße. War da überhaupt ein Baum gewesen? Das Gartenmäuerchen führte immer noch um die Stelle herum, an der er gewurzelt hatte. Aber es umrahmte jetzt einen mit der Motorsäge abgeschnittenen Stumpf. Die Ränder waren hellgelb, aber das Mark des Stammes sah aus wie zerkrümelter Tabak. Der Stamm war offenbar gänzlich verfault gewesen. Wäre der Baum umgestürzt, er hätte vermutlich meinen Balkon in die Tiefe gerissen.
2.
Der geheimnisvolle Mieter
Ich sagte schon, daß die kleine Wohnung, in die ich gezogen war, in einer stillen, für mich eigentlich zu teuren Gegend lag, ältere und Nachkriegsmietshäuser wechselten sich in der Straße ab, eine sterile Stille lag über ihr, kein Bierlokal und kein Lebensmittelladen war in der Nähe, es gab eigentlich wirklich keinen Grund, hierher zu ziehen, es war auch nicht nahe zur nächsten U-Bahn-Haltestelle. Das scheint zu einer deutschen Stadt zu gehören: Große Regionen der Totheit, eine Art urbaner Holzwolle, in die die belebteren Teile eingepackt sind und in denen alle Bewohner sich miteinander verabredet haben, möglichst unsichtbar zu bleiben.
Gegenüber hatte sich wohl einmal ein Schlüsselgeschäft etabliert, das vor kurzem umgezogen war, nur die Leuchtreklame – ein großer Sicherheitsschlüssel, von einer roten Neonlinie umgeben – war an dem Haus zurückgeblieben und wurde immer noch allnächtlich angeschaltet. Dieser rotglühende Schlüssel war nun zu einer Fassadendekoration geworden, die eine vieldeutige Botschaft verbreitete – vielleicht die Warnung, den Schlüsselbund niemals auf die glühende Herdplatte zu legen? Seitdem der große verfaulte Baum gefällt worden war, der mit seinem Laub den rotglühenden Schlüssel beinahe vollständig verdeckt hatte, fiel von diesem roten Licht etwas in mein Zimmer, ein schwacher, unbestimmt theatralischer Schein, der den leeren Raum möblierte; ich schlief gern dabei ein, und wenn ich nachts erwachte, umgab mich die Stimmung einer altmodischen Dunkelkammer.
Das Haus war groß, enthielt hauptsächlich aber Zweitwohnungen, die meisten Mieter habe ich nie gesehen, es gab Tage, an denen die Verlassenheit dieses Hauses auch dann spürbar wurde, wenn ich meine Räume gar nicht verließ und mich inmitten der leeren Gehäuse um mich herum fühlte wie der Portier eines Bürohauses am Wochenende. Aber das war mir gerade recht so. Zu den wenigen Dingen, die ich gelernt habe, gehört es, jene Wochen und Monate der Stille zu schätzen, die man erlebt, wenn man in eine neue Stadt zieht und dort keinen Menschen kennt. Alleinsein, sich seinen Gedanken hingeben, wenig sprechen, sogar ein wenig Trübsal blasen – wenn man das erst einmal als wiederkehrendes Erlebnis begriffen hat, dann kann man ihm eine Dichte abgewinnen, in der man die Zeit geradezu tropfen hört. Noch nicht einmal die Bücher hatte ich ausgepackt, lag nur einfach, wenn es dunkel wurde, auf dem Bett und sah den Schatten zu, die manchmal durch den roten Schlüsselschein, das kühle Feuer dort draußen wanderten. Die Geräuschlosigkeit des Hauses steigerte sich dann in ein leises Rauschen wie aus einer Muschel, und auf diesem Rauschen trieben einmal eine Stimme, einmal ein leise bullerndes Motorrad oder ein knappes, sofort ersticktes Bremsenquietschen wie Korken auf schneller Strömung an mir vorbei. Kleine Vorfälle erhielten Gewicht und ließen mich grübeln. Was ich sonst nie beachtet hätte, wurde mir zu einem Rätsel wie ein Traumbild, dem man nach Erwachen noch eine Weile nachhängt. Spuren nachgehen, Indizien sammeln, um sich daraus ein Bild verborgener Vorgänge zu machen, sich in versteckte Verhältnisse, die nur in winzigen Erschütterungen an die Oberfläche der Wirklichkeit gelangen, hineinzuphantasieren, das war mein verantwortungsloses und selbstverständlich ganz planlos betriebenes Vergnügen.
Wenn ich meine Wohnungstür aufschloß, drang hinter der benachbarten, sehr großen und hohen, mit graviertem Milchglas versehenen Flügeltür, die offenbar in eine geräumige Wohnung führte, ein Quieken hervor, als spiele dort jemand mit einem Gummitier. Zunächst gab es kein Namensschild an dieser Tür, dann prangte eines Tages ein offenbar altes Messingtäfelchen daran: »Frhr. v. Sláwina« hieß der Mensch, bei dem es so aufgeregt quiekte. Ein Name aus der Sphäre der Donaumonarchie, wie ich vermutete, dazu paßte auch das große Hirschgeweih, das in dem sonst unmöblierten Entrée aufgehängt war. Sekundenlang sah ich seine Spitzen durch den geöffneten Türspalt, dann fiel die mit drei Riegeln beschwerte Tür ins Schloß.
Eines Abends standen dann zwei leere Rotweinflaschen vor der Tür, schon aus der Ferne minderwertig wirkend, mit obskuren Etiketten, Wein, wie man ihn nachts an einer Tankstelle kauft. Das Haus, in das ich eingezogen war, galt in der Makler-Sprache als »gepflegt« – man hätte auch von kompromißloser Unpersönlichkeit sprechen können. Leere Flaschen standen vor den anderen Wohnungstüren jedenfalls nicht herum, und diese beiden Phantasie-Schloßabfüllungen verharrten lange auf ihrem Platz, bis sie am Samstag abend schließlich verschwunden waren. Hätte ich mich nicht in meinem milden Einsamkeitsrausch befunden, ich hätte diese Flaschen unter dem altmodischen Messingschild »Frhr. v. Sláwina« gar nicht wahrgenommen, ich bin selber sehr unordentlich, ich wäre der letzte, der sich für leere Rotweinflaschen vor ander Leuts Türen interessiert, aber nun geriet mir alles zum Stilleben, das zur Betrachtung einlud.
Etwas später begegnete ich auf der Treppe einer alten Frau mit langen grauen Haaren, die nicht frisch gewaschen waren. Sie war sehr zart und gebeugt, trug einen sandfarbenen Kaschmirpullover und Hosen und blickte mich schüchtern, ja geradezu demütig an, als bestehe die Gefahr, daß ich Auskünfte von ihr verlangte. Sie hatte einen kleinen zierlichen Dackel an der Leine, einen Zwergdackel mit übergroßen Rehaugen und flinken Bewegungen, aber ebenso ängstlich wie seine Herrin, ein teurer Hund, so kam mir vor, eine seltene Züchtung, der die für ihn hohen Stufen mit geschmeidigen schlangenartigen Bewegungen gleichsam hinauffloß. An diesem Tag stand eine zersprungene grüne Plastikente vor der Tür des Freiherrn, ein schwimmuntüchtiges Badewannenspielzeug. Gab es in der großen Wohnung ein Kind? Gehörte das Quietschen zu einem Dreijährigen, zu dem Hund oder zu der Ente? Bei diesen Fragen verweilte ich ein wenig, ich stellte mir sogar die Greisin quietschend vor, aber das wollte nicht gelingen, bei ihr lag ein leises Wimmern näher. Später sah ich ein paarmal einen rothaarigen, angelsächsisch wirkenden Mann in fein gestreiftem Geschäftsmannsanzug aus der Wohnung kommen, er ließ die Tür besonders satt scheppernd ins Schloß fallen, es teilte sich im Geräusch mit, wie schwer die Tür armiert war. Der Mann wirkte unangenehm berührt, als er mich sah, er wandte den Kopf ab und grüßte nicht; vor der Tür standen jetzt übelriechende Mülltüten, die auch Pizzakartons mit angenagten Resten enthielten. Im ganzen Treppenhaus verbreitete sich der Geruch der gewürz- und ölgetränkten Pappkartons, die ältere Frau im ersten Stock, die nur selten da war, mußte ausgerechnet von ihrer Reise nach Hause kommen, als diese kalte Pizzawolke im Treppenhaus hing, und machte Lärm, vergeblich allerdings, auf Telephonate und Klingeln rührte sich in der Wohnung nichts. Sie ließ dann die Müllsäcke von ihrer Putzfrau hinuntertragen. War der rothaarige Angelsachse vielleicht doch Baron Sláwina? Ich kam von dieser Vermutung wieder ab, als ich ihn mit dem Briefträger englisch sprechen hörte; wie befriedigt war ich, daß dies Buttermilchgesicht wirklich mit der englischsprachigen Welt verbunden war. Es klangen nun auch gelegentlich Klavierakkorde durchs Treppenhaus, in wiederholten Anläufen übte sich jemand in Sláwinas Wohnung in einer Liszt-Mazurka. In diesen Läufen war der Ehrgeiz zu spüren, sich nicht zu betrügen, die schwierige Stelle mit einem dissonanten Akkord wirklich zu bewältigen und nicht in seliger Dilettantenart darüber hinwegzugleiten – ich versuchte, diese Verbissenheit physiognomisch mit der Erscheinung des rothaarigen Angelsachsen zu verbinden, der bei Begegnungen wegblickte – stand dies Abwenden nicht doch in innerer notwendiger Verbindung mit einem einsamen Kunstheroismus? Unten im Eingang wartete ein Rollstuhl mit einem Etikett der Singapore Airlines – darauf die Adresse: »Mrs. Tamara Kakabadze, c /o Sláwina«. Im Briefkasten fand ich die Nachricht, ein Paket für mich sei bei Sláwina abgegeben worden, mit einer Telephonnummer. Mehrmals rief ich bei meinem Nachbarn an, durch dessen breiten Flur die Klavierläufe rauschten, aber niemand nahm ab. Erst am nächsten Abend meldete sich eine weibliche Stimme, jung, zerstreut, mit englischem »Hello?«, verträumt fragend, als sitze die Sprecherin in einer tiefen Grotte und prüfe dort einsam das Echo. Ich kam kaum dazu, nach meinem Paket zu fragen.
»It’s outside«, unterbrach sie mich in fernem Singsang, der sich auf »tut mir leid« reimte – nein, das war ganz gewiß keine Angelsächsin, die kam von weit her – aus Asien, woher auch der Rollstuhl herbeigeflogen war? Wie eilends ich auch zur Tür stürzte, ich kam zu spät. Draußen lehnte das Bücherpaket, wie von Zauberhand herbeigebracht, und das Schloß der Nachbartür klickte – nicht zugeschmissen, wie bei dem Mann, sondern zugehaucht – ich stellte mir vor, die Sprecherin habe den Nachmittag im Bett verbracht, im Dunkeln womöglich, und gehe jetzt bei hereinbrechender Dämmerung erst ins Bad. Auf keinen Fall gehörte die Stimme zu der dicklichen Philippinin mit den pockennarbigen Wangen und dem Samthaarreif, die Samstag morgens mit Mülltüten beladen aus der Wohnung kam und sämtliche Schlösser mit Schlüsseln von einem großen Schlüsselbund rasselnd wie ein Burgtor verschloß. Die Frau antwortete nicht auf meinen Gruß und sah mich nur mit durchdringendem Ernst an. Diese Verschlossenheit kam ihrer Profession entgegen, Hausbesorger sollen diskret sein. Aber natürlich wartete ich auf die Frau mit der weichen, singenden Stimme und wurde gefoppt und enttäuscht – immer andere Leute kamen aus der Wohnung, nur sie nicht, die ich vermessener- und unrealistischerweise an ihrer Stimme auch physiognomisch glaubte erkennen zu können. War der ältere, dunkelbraunhäutige, indisch-paschtunische Sportsmann mit dem hängenden weißen Schnurrbart und den Schweinslederlippen ihr Vater? Ich konstruierte eine Familie um Sláwina herum, die Greisin mit dem zarten Dackel war seine Schwiegermutter, der Paschtune sein Schwiegervater, der rothaarige Angelsachse sein Schwager aus erster Ehe, aber diese Schlüsse überzeugten mich selber nicht, sie glitten aus meiner Phantasie rasch wieder davon. Denn in welchem Verhältnis standen die beiden jungen Männer in Jeans zu der Frau mit der weichen Stimme? Ich habe beide nur von hinten gesehen, sie hatten Tüten dabei, in denen es klirrte, ein Junge mit nacktem Oberkörper öffnete ihnen – schwupp, waren sie verschwunden. Hatte man die vier leeren Sektflaschen, die am nächsten Tag vor der Tür standen, in ihrer Gesellschaft geleert? Erst drang nichts anderes als Klavierläufe und Quieken aus der Wohnung, dann hörte auch das auf, und das einzige Lebenszeichen aus der Sláwina-Wohnung war nun ein großer Wasserfleck an der Wand des Treppenhauses, dort mochte wohl das Bad liegen – oder sickerte das Wasser doch vom Stock darüber?
Eines Morgens stand der Hausverwalter mit einem Handwerker im Treppenhaus und schüttelte beim Anblick des Flecks den Kopf. Er habe dem Herrn Sláwina eigens gesagt, daß er die Sauna nicht benutzen dürfe – die Sauna sei nie dicht gewesen, trotz zahlreicher Reparaturen, sie müsse dort wieder herausgerissen werden und bis dahin – in diesem Augenblick öffnete die Philippinin die Tür, sandte uns einen mißtrauischen Blick zu, runzelte die Stirn und begann, alle Schlösser der Wohnungstür abzuschließen. Wo sei Herr Sláwina? fragte der Hausverwalter, und sie gab zur Antwort: »Sláwina no, Sláwina no, Sláwina nix« – einem Haiku ebenbürtige Verse, und stieg mit unbewegter Miene die Treppe hinab.
Es gibt Geheimnisse, die uns nicht mehr fesseln, wenn sie allzu unauflöslich bleiben, und Anstrengungen, die über mein spekulierendes Kombinieren vor dem Einschlafen hinausgingen, hatte ich ohnehin nicht im Sinn, um zu erfahren, wie in der Nachbarwohnung gelebt wurde. Meine Abende wurden abwechslungsreicher, ich machte Bekanntschaften in der Stadt und fing an, mich zu verabreden und auszugehen. Titus Hopsten lud mich in sein Elternhaus ein, und von da an war ich nur noch selten zuhause, denn seine Schwester Phoebe zog einen ganzen Schweif von Leuten hinter sich her, die alle freundlich und neugierig auf ein neues Gesicht waren. Eines Abends stand ein junger Türke in Lederjacke auf den Eingangsstufen meines Hauses, weißhäutig und schwarzhaarig, er streckte die Nase in die kühle Luft, als nehme er Witterung auf, um dann ins Leben hineinzustoßen wie ein Adler, ganz und gar mit dem Lebendigsein beschäftigt, oben fiel die Sláwina-Tür charakteristisch schwer ins Schloß, der junge Mann streckte sich, sprang die Stufen hinab und rannte los. Vorn lag die Zukunft, das Vergangene ließ er hinter sich zurück.
»So müßte man immer leben«, dachte ich, aber wer da bei Sláwina ein und aus ging, das war mir inzwischen gleichgültig. Und es dauerte dann auch noch Monate, bis ich den Freiherrn von Sláwina endlich selber sah.
3.
Das Mädchen im Zug
Eine regelrechte Einladung konnte man Titus Hopstens Aufforderung, ich möge am Sonntag nachmittag hinaus ins Haus seiner Eltern kommen, dort seien »ein paar Leute«, wahrlich nicht nennen, aber unter Verwendung des Wortes »einladen« den Halbfremden dort hinaus zu bitten, hätte er wahrscheinlich hoffnungslos spießig gefunden. Ich konnte mir bei diesem jungen Mann mit dem verwöhnt-hübschen, ein wenig spitzen Gesicht ein grundsätzliches Mißtrauen gegen jede Art von Formeln vorstellen, als sei alles, was man so sagen könne, im Grund unmöglich. Wir standen in einer nach Büroschluß überfüllten Bierkneipe, es war ein Getümmel von dunklen Anzügen, aber die Krawatten waren zum Teil schon abgelegt, denn es war ein geradezu verrückt heißer Tag, wie er, so lernte ich bald, in Frankfurt nicht selten ist. Die Hitze brachte eine Ausnahmestimmung hervor, die Leute, die nicht erschöpft waren, gerieten außer Rand und Band. Er allein schien von der Hitze unberührt. Er schwitzte nicht, als bestehe seine Haut aus einer wärmedämmenden Substanz. Tatsächlich war die Hand, die er mir zur Begrüßung reichte, klein und leicht. Eine Zufallsbekanntschaft, und er gab mir während der ganzen Unterhaltung das Gefühl, als sei er darauf aus, mir so schnell wie möglich zu entkommen, nachdem wir ein paar gemeinsame Bekanntschaften festgestellt hatten. Das Telephon verdarb ihm die Stimmung, seine bemühte Freundlichkeit verschwand, sowie er sich seinem Apparätchen zuwandte und lakonisch und nicht ohne Schärfe hineinsprach. Dann schenkte er mir wieder ein herzliches, geradezu freundschaftliches Lächeln, und dann schweifte sein Blick auch schon wieder unruhig und unbestimmt verärgert über die Menge, keinesfalls als suche er jemanden, sondern als befinde er sich nicht in einer Kneipe, sondern auf einem Empfang, der ihn langweile, den er aber nicht sofort wieder verlassen könne. Er schaffte es, die Einladung nach Falkenstein und den Austausch unserer Telephonnummern nach einem Manöver aussehen zu lassen, mich loszuwerden, wie es ja meist gehalten wird, als bestehe geradezu eine Übereinkunft, die verbiete, eine überlassene Telephonnummer jemals anzurufen. Und ich wäre wohl kaum auf den Gedanken gekommen, auch nur abzusagen, wenn ich in meinem Alleinsein nicht inzwischen begonnen hätte, ein allererstes leises Ungenügen am Fehlen von Gesellschaft zu empfinden.
So saß ich denn am nächsten Tag im Vorortzug. Neugierig war ich schon, der Name Hopsten war meinen Kollegen nicht unbekannt. Das waren »gute Leute«, wie es in einer bezeichnenden Mischung aus Moral und Berechnung hieß, und ganz frei war auch ich nicht von dieser Mentalität – grundsätzlich, wie ich mit bescheidenem Stolz sagen kann, aber eben doch. Ich habe dafür sogar den Beweis. Mir gegenüber saßen in der Bahn eine jüngere und eine ältere Frau, nein, ein Mädchen und eine vielleicht vierzigjährige, reichlich verwüstete Person. Kein Zweifel, die beiden gehörten zusammen. Ich empfand etwas Verwandtschaftliches in dem kunstvoll verfilzten Haarwust des Mädchens und dem womöglich sogar absichtsvoll schlampig gelb gefärbten Haar der Frau. Sonst gab es wahrlich keine Ähnlichkeit. Die Ältere hatte ein graues Gesicht und dicht beieinander stehende Augen, »dumm und heimtückisch«, sagte ich mir genießerisch, während die Junge ein Engelswesen war, mit einer Haut, die wahrscheinlich schon errötete, wenn ein zu heftiger Windhauch sie traf. Die Lippen, die kleinen Ohren, die kleine Nase, alles war vollendet ausformuliert, kindlich und zugleich fertig. Ich ließ meine Augen wandern – dort war die Abstoßende, hier war die Bildschöne, dort war die Schmuddelige, hier war die Apfelfrische, dort die Erschöpfte, hier die noch nie mit Mühen in Berührung Gekommene. Beide waren gleich angezogen, in Jeans und weißem T-Shirt, nein, das der Älteren war beschriftet, mit einer vitalistischen Parole, die ihrem Zustand hohnsprach: Viva España, auf dem nicht kleinen, sichtbar von einem Büstenhalter verwahrten Busen, während die Junge ebenso sichtbar ohne einen solchen auskam, die Hügelchen standen so ebenmäßig, als sei Canova eben doch Naturalist gewesen. Aus meinen Worten geht hervor, daß ich mich vollständig schamlos am Anblick der beiden weiden konnte – ja, die früh alternde Schlampe, sie gehörte unbedingt zu dem Genuß hinzu, sie schuf den Kontrast, der aus einer bloß appetitlichen Hübschheit der Jungen eine deutlich darüber hinausgehende Schönheit machte.
Warum ich so unbedenklich glotzen durfte? Die beiden waren beschäftigt, und zwar äußerst gespannt, die Umwelt war für beide versunken. Die Ältere war über ihren nackten Fuß gebeugt und betastete nachdenklich und mißtrauisch den gelben Nagel ihres linken großen Zehs. Nur noch ein kleiner roter Farbrest verriet, daß sie diesen wulstigen, in Hornringen zu einer tierischen Kralle ausgewachsenen Nagel vor Wochen noch lackiert hatte. Aber jetzt war seine Stunde gekommen, jetzt sollte er, nach eingehender Untersuchung, doch schließlich beschnitten werden. Nun wollte aber der kleine Nagelknipser den in unheimlichem Wachstum verdickten Nagel nicht recht packen, immer neu setzte sie an, und immer wieder entglitt das Horn den zierlichen Schneiden. Die Junge hingegen hatte sich eine kleine Wunde am Zeigefinger zugezogen – ja: herrlich, sie hatte sich einen Apfel geschält, und das rote Blut war auf das weiße Apfelfleisch getropft! –, und nun war sie mit dem Stand der Heilung offenbar unzufrieden. Die warm durchblutete gesunde Haut arbeitete nicht so schnell, wie sie das erwarten durfte. Sie hatte das Pflaster abgezogen und betrachtete die rötliche Fingerspitze mit gerunzelten Brauen und leichtem Kopfschütteln, als tadele sie jemanden. Sanft drückte sie die Fingerbeere. Blut kam keines mehr. Aber es tat auf jeden Fall gut, den Finger ein bißchen mit Speichel zu befeuchten. Ernsthaft wie ein trinkender Säugling sog sie an dem wunden Finger, ein therapeutisches Saugen, das zu ihrem Verwundern aber den Zustand der Unversehrtheit nicht augenblicklich wiederherstellte.
Wie verrückt, das sagte ich mir geradezu mit Selbstverachtung, daß ich hier nun auf dem Weg zu irgendwelchen reichen Leuten war, die ich gar nicht kannte und deren Sendbote Titus keine besonders herzliche Gastlichkeit verhieß, anstatt jetzt kurz entschlossen alles zu tun, wenigstens mit allen Mitteln zu versuchen, das Wochenende mit diesem Mädchen zu verbringen. Es war ja offensichtlich, daß diese junge Proletarierin – ein starkes, im Kontrast zu den Hopstens gewähltes Wort –, oder besser, dieses ins Proletariernest geratene Mädchenkind mich unendlich mehr beschäftigen und reizen würde als alles, was mir in dem Hopstenschen Reservat begegnen mochte. Nein, nicht das Haar und nicht die Kleider machten die beiden für mich zu Zusammengehörigen, es waren die stillen Tätigkeiten der beiden, das Nebeneinander wie von zwei Schneiderinnen oder von zwei Montagearbeiterinnen, die in eine komplizierte Tätigkeit versunken waren, das weiß ich noch heute. Ja, noch mehr: Richteten sich die beiden etwa nach gemeinsam bestandenen Kämpfen wieder her? Ich bin noch heute überzeugt: Hätte die Junge mich nur einmal angesehen, ich hätte sofort das Wort an sie gerichtet. Aber hielt sie nicht in Wahrheit so schön still, damit ich sie in Ruhe betrachten konnte? Eine Station vor der Endstation, meiner Station, stiegen beide aus, im letzten Augenblick, auf dem Bahnsteig sah ich sie grußlos auseinandergehen, sie hatten überhaupt nichts miteinander zu tun.
Es dauerte eine Weile, bis ein Taxi kam, dann folgte die Fahrt durch die Villenviertel, die den kleinen mittelalterlichen Ort mit seiner Burg umgaben, dann kam offenes Land, weite leuchtende Wiesen, schließlich ein weißes schiffsartig von Terrassen und Balkons umgebenes Haus, in eine Geländefalte wie zwischen grüne Wogen gedrückt, mit ziemlich langer Auffahrt, kein Name am Briefkasten, das war das Haus Hopsten. Am Eingang kam mir das Mädchen aus dem Zug entgegen, jetzt in einem winzigen Sommerkleid, das die Beine ganz frei ließ. Ich war nicht sicher, ob sie mich nicht doch erkannte. Das Pflaster um den Finger war frisch und reinlich.
»Bei diesem Nichtwiedererkennen blieb es aber doch nicht? Ich muß dir gestehen, ich schätze solche Liebe-auf-den-ersten-Blick-Geschichten nicht so sehr. Steckt nicht meist einfach Wahllosigkeit oder sogar Läufigkeit dahinter?«
»Oft genug hast du sicher recht. Aber ich erzähle tatsächlich eine Liebe-auf-den-ersten-Blick-Geschichte, oder besser ihre Vorgeschichte, Liebe auf den ersten Blick hat nämlich manchmal auch eine Vorgeschichte, so widersprüchlich das klingt.«
Daß Phoebe Hopsten mich nicht wiedererkannte oder nicht wiedererkennen wollte oder, mit einem gewissen Recht, unser Zusammentreffen im Zug einfach zu uninteressant fand, um noch einmal darauf zurückzukommen, ließ sie nicht unfreundlich werden. Sie strahlte, aber sie strahlte eben in viele Richtungen. Haus und Garten waren von Menschen erfüllt, alle mit Gläsern in den Händen, alle, so schien es, in der Hitze schon leicht berauscht. Im Zug hatte ich sie ganz in sich versunken erlebt, in selbstgewählter Isoliertheit, die sich jedes Ansprechen verbat, aber jetzt, da ich sie durch die Menge der Gäste tänzeln sah, jedem einzelnen für einen winzigen Augenblick entzückt zugewandt, war sie noch viel unansprechbarer geworden. Ich musterte die jungen Männer, die meisten eher in ihrem als in meinem Alter, wer wohl Rechte auf sie besitzen mochte, aber immer, wenn ich einen sistiert zu haben glaubte, war sie schon bei einem anderen, dem sie die Hand mit dem kleinen Pflaster in den Nacken legte oder sich für einen Atemzug anschmiegte. Meine Fehleinschätzung im Zug verwirrte mich immer noch stark. Ich hatte sie der schrecklichen Frau mit dem Fußnagel wirklich zugeordnet, ich hatte mir ein, wie ich jetzt feststellen durfte, wirklich schlüssiges Bild von ihrem Milieu gemacht, und das war ein die Phantasie anspornendes, belebendes Bild gewesen, ich kam mir als ihr Entdecker vor, wie ein Mann, der eine Perle im Schweinekoben gefunden hat. Nun fiel es mir schwer, mich davon zu verabschieden. Phoebe war ein goldenes Mosaiksteinchen, das in ganz verschiedene Entwürfe hineinpaßte, so redete ich mir jetzt ein, nein, ich hatte mich nicht geirrt, sie war in ihrer Erscheinung sozial eben nicht festgelegt, sie ging in mehreren vollkommen entgegengesetzten äußeren Zusammenhängen gleich plausibel auf – paßte sie etwa zu ihren Eltern? Das waren doch ohne Zweifel hochrespektable Leute, aber bei ihr kam noch etwas hinzu, etwas weniger Respektables, so meinte ich sicher zu sehen. Und zum Sehen hatte ich Zeit, ich schwamm als Fisch durch diesen schönen Teich und ließ mich nur hier und da in ein Gespräch ziehen. Zunächst mit einem sehr amüsanten, etwas dicklichen Orientalen, Joseph Salam hieß der und kannte ebenfalls niemanden hier, und dann durfte ich sogar mit dem Ehrengast sprechen, dem alten Schmidt-Flex – du hörst richtig, mit weißer Mähne, genauso bedeutend aussehend wie in der Zeitung, in seinem Gefolge die schweigsame Ehefrau, ein trübsinniger Sohn und die sehr hübsche Schwiegertochter, ein solcher Mann tritt nie allein auf.
4.
Kunstwerke am Swimming-Pool
Der Sonntag nachmittag verlief, wie die Hopsten-Familie das schätzte. Gerade auch im gesellschaftlichen Stil bewiesen die Familienmitglieder Einigkeit: Viele Leute sollten dasein, in einem lässigen Kommen und Gehen, nur zum Teil eingeladen, an schönen Tagen sagte man sich einfach bei den Hopstens an, auch das Mitbringen von Freunden war gern gesehen, jedenfalls wenn man Rosemaries Geschmack traf. Sie war ungeniert darin, fühlen zu lassen, ob ihr die Mitgebrachten gefielen oder mißfielen, man sprach allgemein von Rosemaries »erfrischender Offenheit«, wie das auch dann hieß, wenn die Deutlichkeit die Grobheit streifte. Wie Pilger um einen Tempelteich in Indien lagerten die Gäste um den Swimming-Pool, ein eher flaches Becken noch aus den zwanziger Jahren, das sie schwarz hatte kacheln lassen, in Helga Stolziers Lieblingsfarbe, wobei sie inzwischen selbst glaubte, türkise oder himmelblaue Schwimmbassins schon immer häßlich gefunden zu haben. Wie in feine Tinte tauchten die Körper in dieses Becken, es war immer eine kleine Überraschung, sie unter Wasser dann in heller Nacktheit aufleuchten zu sehen. Rosemarie Hopsten trug einen schwarzen einteiligen Badeanzug mit kleinem Beinansatz, der ihre kräftige, an eine Maillol-Skulptur erinnernde Figur mit deutlicher Taille und den geschwungenen Hüften prächtig herausstellte; sie tauchte und warf beim Auftauchen das nasse Haar mit einem Schwung aus der Stirn; als sie auf der Aluminiumleiter aus dem Becken stieg vor den Augen ihrer in Liegestühlen ruhenden und plaudernden Gäste, schimmerte der triefende Stoff wie ein Robbenfell, die Wassertropfen umsprühten sie blinkend, es war ein triumphaler Aufstieg aus feuchten Tiefen, die Gespräche rissen ab, man betrachtete sie, und die forcierte Munterkeit mancher Zurufe verriet, daß da jemand versuchte, seiner Bewunderung Herr zu werden. Rosemarie war mild gebräunt, sie achtete darauf, nicht ledern zu werden, über ihrer schönen festen Haut lag auch, als sie abgetrocknet war, ein feines Glitzern wie von Tautropfen. Bernward Hopsten erhob sich mit der für ihn bezeichnenden hölzernen Steifheit, er trat gegenüber seiner Frau genauso auf, als sei sie eine fremde Dame, mit ruhigem Lächeln, nahm ihr das nasse Handtuch ab und reichte ihr ein Glas Weißwein. Ein perfektes Paar, dachte ich, diese Höflichkeit nach so vielen Jahren und bei derart verschiedenen Temperamenten. Rosemarie war die einzige, die ins Wasser ging, es war warm, aber nicht heiß, und Silvi Schmidt-Flex im winzigen Bikini hielt die mädchenhaften Glieder in die Sonne, mit geschlossenen Augen und ohne sich am Gespräch zu beteiligen. Sie hatte erklärt, das Wasser sei zu kalt – »Siehst du«, sagte Bernward zu seiner Frau, aber die antwortete geradezu schroff, im Juni werde bei ihr kein Schwimmbad geheizt. Das war ein vernünftiger Standpunkt, und ungastliche Sparsamkeit konnte den Hopstens wahrlich niemand vorwerfen. Aus einer großen Silberschüssel ragten mehrere Weißweinflaschen, dieser Wein war frisch und säuerlich und trank sich wie Wasser, Phoebe hatte schon ein paarmal neue Flaschen aus dem Haus geholt. Joseph Salam war es gelungen, den alten Schmidt-Flex in ein Gespräch über den Balkan zu verwickeln, obwohl der Schwiegervater Silvis sich zunächst unnahbar zeigte und Salam sogar recht unverhüllt mit ironischen Blicken musterte; sein lebenslang bewährter Instinkt, Personen, die nicht im Hauptstrom politischer Wohlachtbarkeit schwammen oder sonstwie durch Geld und Einfluß ausgezeichnet waren, augenblicklich herauszuspüren und wegzuschieben, warnte ihn deutlich. Ihm mißfielen auch die sich unter Salams engem Sporthemd abzeichnenden Wölbungen von Muskulatur und Fett, aber aus einem tiefen Liegestuhl ist so leicht kein Entkommen. Salam beugte sich über ihn, trank den Wein mit großen Schlucken, ließ den alten Schmidt-Flex seinen Weinatem riechen und gab sich im übrigen sehr souverän, auch bereit, zu den trockenen Bröckchen, die sein unwilliger Gesprächspartner ihm hinstreute, ein herzliches Gelächter anzustimmen. Er gab vor, in den grundsätzlich unkomisch gemeinten Äußerungen des Alten eine Komik zu entdecken, die der dann doch nicht verleugnen mochte – wer besteht schon darauf, nicht so geistvoll zu sein, wie das offenbar vermutet wird? Schließlich war die Reserve dahingeschmolzen, obwohl Schmidt-Flex senior keinen Wein trank.
»Ich kannte Tito gut«, sagte er eben. Wäre er dem Marschall nicht begegnet, hätte er gesagt: »Wir haben uns komischerweise nie getroffen.« Salam nickte erfahren.
»Ja, der hatte den Balkan begriffen …«
»Oder aber gerade nicht begriffen.« Schmidt-Flex geriet jetzt ins Pädagogische, damit war seine Selbstbeherrschung dahin.
»Köstlich«, Salam seufzte genießerisch, »er hatte ihn eben gerade nicht begriffen.« Aber das darauf folgende Lachen dämpfte er behutsam, um den alten Schmidt-Flex nicht ungeduldig zu machen. Hans-Jörg Schmidt-Flex, der Sohn, saß neben seiner Mutter, beide machten keinen Versuch, ihren Überdruß zu verbergen. Die Mutter war stoisch, unendliche Stunden, in denen sie sich in Gesellschaft gelangweilt hatte, zogen an ihrem inneren Auge vorüber, der Tag, an dem sie glaubte, vor Langeweile aus der Haut fahren zu müssen – er mochte mehr als dreißig Jahre zurückliegen –, an dem sie fürchtete, vor Langeweile zu ersticken, war auch dabei, auch jenes eigentümliche Gefühl von Abgestumpftheit und leerer Leichtigkeit, das zurückblieb, als sie diesen Augenblick der Panik überwunden hatte, es war ihr treu geblieben und hatte ihr Leben erträglich gemacht. Hans-Jörg war in anderer Lage. Er langweilte sich nicht, denn er langweilte sich nie, mißmutig folgte er den Gesprächen, sein Gesicht schien auszudrücken: »Mein Gott, was für Dummheiten, so kann man das wirklich nicht sagen«, vielleicht müßte er sich irgendwann doch noch einmischen, zum unpassendsten Moment natürlich und mit Worten, die ihn ins Unrecht setzen würden.
Vielleicht ist es ein Fehler, sich menschlicher Gesellschaft allzu sehr zu nähern, vor allem wenn sie, aus einer gewissen Entfernung jedenfalls, einen solch zauberhaften Anblick bietet. Das Grün der Wiesen, die sich jenseits des jetzt im hohen Gras beinahe unsichtbaren Zaunes fortsetzten, in sanften Hügeln, Wellungen und Schwellungen – vor zehn Jahren hatten hier noch Kühe geweidet –, der Blick hinab zum Turm der Kronberger Burg und dahinter im rauchfarbenen Dunst auf die Mainebene mit den im Sonnenlicht herausblitzenden Fassaden der verglasten Hochhäuser war wie ein großes Landschaftsgemälde, ja es glich jetzt einem der besten Werke der Kronberger Malerschule aus dem neunzehnten Jahrhundert, auf denen die Himmel immer ein wenig zu blitzeblau und die Wolken wie aus Schlagsahne sind, und mitten in den smaragdgrünen Samt wie Juwelen gebettet diese aus der Ferne so anmutig und heiter wirkenden Menschen, ja, am Gartenzaun stehend und auf diese Gesellschaft blickend, die sich in der bewegten Oberfläche des schwarzen Swimming-Pools spiegelte, dachte ich an Goethes Mandarine, die »am Wasser und im Grünen, fröhlich trinkend, geistig schreibend« den Frühlingstag verbringen. Aber um die alten und älteren Leute herum, die »Erwachsenen« eben, wie eine achtzehnjährige Freundin Phoebes ganz unschuldsvoll sagte, gab es noch sieben oder neun Jungen und Mädchen aus Titus’ und Phoebes Generation – ich blieb bei der Zahl unsicher, weil sich alle so ähnlich sahen, oder sollten mir meine fünfunddreißig Jahre schon einen Altersblick auf eine mir im Ganzen fremd gewordene Generation verschafft haben? Alle hatten schönes Haar und perfekte Zähne, alle waren sie schlank und trainiert, die Jungen in gestreiften Hemden und Jeans hatten alle das hübsche, ein wenig mausehafte Gesicht von Titus mit dem unerschütterlichen Ernst in den Augen, Phoebe allerdings war durch ihren Haarwust, ihre goldene Filzmähne von den anderen Mädchen unterschieden, eine solche Arbeit machte sich nicht jede. Alle rauchten, was von den Erwachsenen niemand tat, als fürchteten sie die Mißbilligung des alten Schmidt-Flex, der sich nicht scheute, Raucher zu einem Privatissimum beiseite zu nehmen, um ihnen die ihnen gewiß noch unbekannten Gefahren des Rauchens zu eröffnen. Rosemarie und Joseph Salam habe ich bei anderer Gelegenheit durchaus mit Zigaretten gesehen.
Was die Szene aber zu einer neuartigen Schönheit gelangen ließ, das war die moderne Technik, das Mobiltelephon, das jeder der jungen Menschen mit sich führte und das von fern betrachtet Bilder hervorbrachte, wie sie im täglichen Leben für Jahrhunderte höchstens auf dem Theater zu erleben waren. Und selbst da schon länger nicht mehr. Denn von dem großen klassizistischen Alphabet ausdrucksvoller Körperhaltungen hat man sich seit langem verabschiedet. Die sprechenden Haltungen der antiken Kunst, in Renaissance und Barock gefeiert, die kühnen Drehungen des Körpers, die ausgestreckten Arme, das Kauern, das Den-Kopf-in-den-Nacken-Legen, die Gesten des Hauptverhüllens, der Melancholie und der Trauer, alle diese den Körper ausstellenden und den stummen Leib zu Beredsamkeit weckenden Haltungen, man sieht sie in Museen in Gold gerahmt, aus der Natur sind sie verschwunden. Nein, sie waren es, waren es bis zur Erfindung des Mobiltelephons. Bis dahin versank der einsame Mensch geradezu in sich selbst wie in einen Topf. Die Mienen wurden verschlossen bis zur Ausdruckslosigkeit. Sprach den Einsamen dann jemand an, mußte er aus seinem dumpfen Brunnen auf die Erde zurücksteigen, die Maske ablegen und zu seiner lebendigen Person zurückfinden. Jetzt sah ich dort drüben ein Mädchen, das abseits saß, das blonde Haar über die Stirn hängen ließ und mit den Locken spielte, eingerollt wie in einen hohlen Baum in einer versonnenen, tiefen Heiterkeit, und nun löste sich das Händchen aus den Locken und fuhr gespreizt in der Luft herum. Ein anderes Mädchen stand am Wasser und blickte hingerissen auf ihr Spiegelbild, die Beine hatte sie wie eine Tänzerin ineinandergedreht, der Kopf war auf die Schulter gesunken und die Hand beschrieb leichte Schmetterlingswellen in die Lüfte. Beide telephonierten, und das Apparätchen, das soviel Schönheit hervorbrachte und den Traum der Antike Wirklichkeit werden ließ: die lebendige Statue, blieb dabei fast unsichtbar. Ihre vorher teilnahmslosen Mienen waren jetzt gleichsam angezündet, die Wangen röteten sich, die Augen glänzten, eine neue Spannung erfüllte die Körper. Näher bei mir schritt – ja, es war ein Schreiten mit langen Beinen – ein junger Mann auf und ab und drehte sich hin und wieder auf den Absätzen. Seine Hände machten rhetorische Gesten, dann versenkte er sie in die Hosentaschen, stand wippend auf Zehenspitzen, legte den Kopf in den Nacken, der Sonne entgegengestreckt, dann fuhr es wie ein Schuß in den gerade gereckten Körper, er beugte den Kopf, er ging in die Knie – hätte ich doch nur ein einziges Mal einen Hamlet-Monolog so intensiv und in allem Ausdruck so beherrscht gesehen. Der Junge trug Kopfhörer und war deshalb noch freier in seinem Stolzieren, beide Arme hatte er zum Sprechen zur Verfügung. Aber das Schönste sah ich erst, als es zum allgemeinen Aufbruch kam, und es war diesmal nicht das Telephon, sondern eine Digitalkamera, was diese Schönheit möglich machte. Bernward stand unten am Tor, er hatte Gäste zu ihren draußen parkenden Autos begleitet, und nun rollte ihm das Kabriolett der jungen Schmidt-Flex entgegen, die oben vor dem Haus hatten parken dürfen. Hans-Jörg saß am Steuer, seine trüben Augen waren hinter Sonnengläsern verborgen, er war ein Mann der Ausrüstungen, des Zubehörs, und er trug auch durchlöcherte Autohandschuhe, neben ihm aber stand in einem wehenden weißen Leinenhemd, das über die Schulter gerutscht war und den Spaghettiträger des Bikini-Oberteils auf der bräunlichen Schulter freigab, Silvi und hielt mit den beiden nackten Armen ebendiesen Photoapparat in die Lüfte, den Blick fest auf das Bildfensterchen gerichtet, sie war wie ein schwebender Engel, eine Siegesgöttin mit goldenem Kranz in der Hand. Bernward stand still und sah mit entzücktem Lächeln auf diese Erscheinung. Als sie neben ihm anhielten, sagte Silvi: »Ich glaube, ich habe ein gutes Bild von dir gemacht.«
»Jetzt bin ich aber enttäuscht – ich dachte, ich erfahre etwas über deinen Herrn von Sláwina, und statt dessen schwärmst du mir von allen möglichen Damen vor.«
»Nein, Sláwina ist noch nicht an der Reihe. Es wäre aber falsch, ihn einfach wieder zu vergessen.«
»Dann ist dein Sláwina wohl eine Art Konserve, die erst im Bedarfsfall geöffnet wird …?«
5.
Eine weiße Feder
Die Salons der Hopstenschen Villa hatten zur Zeit der Erbauung des Hauses anders ausgesehen, wie, davon gab der Bildband aus den zwanziger Jahren, der auf dem Büchertisch für die Gäste deutlich sichtbar ausgelegt war, eine gewisse Vorstellung, allerdings mehr durch die Bildunterschriften als durch die undeutlichen, etwas verwaschenen Photographien auf dem vergilbten Papier. Die Bauherren damals hatten offenbar einen Schritt aus düsterem wilhelminischem Prunk in die nicht minder prunkvolle Dunkelheit eines starkfarbigen Art déco getan und die nicht besonders großen Räume in tresorartig üppige Kabinette verwandelt. Was sich auf den Photos grauschwärzlich präsentierte, waren einmal Lapislazuli-Kamine, blattvergoldete Plafonds und Wandbespannungen aus Pergament gewesen. Davon war nichts ans Ende des zwanzigsten Jahrhunderts gelangt, aber Rosemarie Hopsten wollte sich von der Vergangenheit durchaus inspirieren lassen. Helga Stolzier stieß bei Betrachtung des bewußten Bildbandes, der Bernward in einem Antiquariat in die Hände gefallen war, einen kleinen Entzückensschrei aus. Es kann durchaus sein, daß ihre mattschimmernden grauen Stucco-Lustro-Wände und die mit schwefelgelbem Ziegenleder bezogenen schwarzen Lacksessel den Erbauern gefallen hätten. Damals, soviel war einem Photo zu entnehmen, hatte ein Picasso der Blauen Periode in dem Zimmer gehangen, wo jetzt ein großer Botero einen zum Ballon aufgepumpten südamerikanischen General zeigte, der aussah, als foltere er seine Feinde nicht mit Elektroschocks, sondern mit Schlagsahne. Die Fülle kostbarer kleiner Sachen, die auf Tischchen, Fensterbänken und dem Kaminsims aufgestellt waren, machte den Raum zu einem idealen Wartezimmer, während vor den Fenstern sich die grünen Wiesen parkartig ausbreiteten, als hätten niemals Kühe auf ihnen gestanden.
Rosemarie Hopsten hatte mich allein gelassen, sie habe draußen noch etwas zu erledigen. Was, das erfuhr ich leicht, denn der Wirtschaftsraum, in dem eine zierliche schwarze Brasilianerin mit rosa Brille auf der Nase bügelte, lag nicht so weit, daß die dort geführte Unterhaltung unhörbar geworden wäre. Die Hausfrau klang verärgert, aber die Brasilianerin sprach ebenfalls mit erhobener Stimme. Ich brauchte gar nicht die Ohren zu spitzen, um den Wortwechsel zu verfolgen.
»Warum sind Sie gestern nicht gekommen?«
Die Brasilianerin sprach nicht gut deutsch. Sie sei krank gewesen.
»Warum haben Sie dann nicht angerufen?«
Das sei nicht gegangen, wie sie schon gesagt habe – »der Akku war leer«.
Moderne Menschen sagen einander nicht ins Gesicht, daß sie den anderen für einen Lügner halten, aber diese Rücksicht oder Vorsicht hatte bei Rosemarie eine Gefühlsstauung zur Folge: Sie glaubte dem Mädchen kein Wort und geriet noch mehr in Zorn.
»Wenn Sie nicht mehr kommen wollen, dann sagen Sie es offen.«
Sie habe schon mehrmals gesagt, daß sie kommen wolle, jetzt wieder das Mädchen, aber wenn sie krank sei, dann gehe es eben nicht.
»So geht das nicht weiter … anrufen kann man immer …«
Der Dialog hatte einen Rondo-Charakter, schraubte sich aber bei jeder vollendeten Umdrehung ein Stück höher. Jetzt fiel eine Tür ins Schloß, die Stimmen kamen nur noch gedämpft und unverständlich. Ich war wieder mir selbst und den Objekten dieser Schatzkammer überlassen.
Da räusperte sich jemand, ein eigentümliches Glucksen folgte. Jetzt erst entdeckte ich einen großen, wie eine chinesische Pagode geformten Käfig. Darin saß ein blütenweißer Kakadu. Er hatte den Kopf auf die Seite gelegt und sah mich an, während es in dem schieferfarbenen Schnabel leise knackte und knusperte, als habe er gerade ein Maiskörnchen aus der Porzellanschale seiner Sitzstange zu sich genommen.
Später erfuhr ich, wie der Kakadu ins Haus gekommen war: nicht aus Tierliebe, sondern weil Rosemarie in der Komposition ihrer Umgebung etwas Kostbar-Lebendiges vermißte, etwas, das sich bewegte, auch ohne daß man es aufzog. Sogar an ein großes Aquarium mit seltenen Fischen hatte sie einen Augenblick lang gedacht, aber Helga riet davon ab: Und wenn es noch so edel sei – ein Aquarium wirke im Ergebnis dann doch immer spießig. Aber ein wundervoller Vogel?
»Federn sind jetzt sehr aktuell.« Von Helgas Seite stand einem Kakadu nichts im Wege. Und kaum war er im Haus, erwies sich, daß er genügend unvorhersehbare Lebenskraft besaß, um sich einen Platz unter den Hausbewohnern, nicht unter den Bibelots zu erobern. Rosemarie war von seinem Anblick befriedigt, und Bernward begann ihn zu lieben. Sogar an der zarten Fahne warm-süßen, nicht unangenehmen Geruchs von Vogelkot, der nun gelegentlich den Raum durchzog, nahm keiner Anstoß. Den Freunden des Hauses war es ein vertrautes Bild, den Kakadu auf Bernward Hopstens Schulter zu sehen, mit dem schneckenhausartigen steinernen Schnabel, der trotz seiner Rundung bös zuhacken konnte, nah an den ungeschützten weichen Lippen.
Wahrscheinlich hatte der Vogel mich schon eine Weile beobachtet, denn sein Kopf war unbewegt, der schwarze Augenknopf war auf mich fixiert. Konnte man mit diesem Knopf eigentlich etwas sehen? Er war wie mit festem schwarzen Seidenzwirn in die aufgepuffte Federfülle hineingestickt, den Boutons vergleichbar, mit denen Polsterer die unter den Stoff gestopfte Füllung arretieren. Das Federweiß war so rein, als sei das ein Kunstkakadu, und um solcher Tugend willen war er schließlich angeschafft worden, er sollte ein lebendes Kunstobjekt sein, und das war er, allerdings in weit höherem Maß, als Rosemarie sich das hatte vorstellen können. Um Brust und Schultern lag kurzes Flaumgefieder wie ein Hermelincape, aber als er jetzt die Flügel öffnete – Taubenflügel, Engelsflügel –, offenbarte er prachtvoll starke Schwingfedern, jede wie gemalt so perfekt – ihm aber nicht perfekt genug. Er konnte sich zum Toilettemachen nicht hinter einen Wandschirm zurückziehen – ein schwarz-goldener Lackschirm wäre ihm angemessen gewesen –, aber in seiner hemmungslosen Genauigkeit beim Durchpflügen des vollkommenen, duftig-festen Gefieders lag auch Schamlosigkeit, sogar Eitelkeit oder womöglich Verachtung. Er war ein Künstler, der im Atelier einem staunend ahnungslosen Besucher ein Bild zeigt, das ganz fertig aussieht, und der sich daraufhin erst richtig an die Arbeit macht. Der runde Schnabel mit dem beträchtlichen Überbiß war sein wichtigstes Instrument, obwohl ich nicht begriff, wie mit dieser runden Zange überhaupt etwas präzis gepackt werden konnte, aber er war die vertrackte Konstruktion eben von Jugend auf gewöhnt und handhabte sie souverän; gnadenlos durchharkte er sein Gefieder; wenn sich der Kopf den blauschwarzen Füßen näherte, war es, als sehe er auf seine Armbanduhr. Für diesen Kopf gab es keine anatomischen Festlegungen, er konnte überall sein. Auf erotischen Holzschnitten aus Japan – schon wieder fiel mir Japan ein, obwohl der Kakadu doch aus Australien stammt – stecken die Liebespaare, stets vollständig bekleidet, in den aufgeblähten Kimonos derart kunstvoll ineinander, daß man ihre Köpfe und Hände, ihre Füße und Geschlechtsteile in der textilen Aufplusterung wie auf Vexierbildern suchen muß, und genauso war es hier: ein geradezu wüstes Aufschütteln, ein Auseinandernehmen des ganzen Körpers, der Vogelleib verlor gänzlich seine eben noch geglättete Form und sah aus, als habe eine Katze ihn gewürgt, unblutig allerdings, die Federpracht strahlte fleckenlos. Und einen Lidschlag später war jede Feder wieder zurückgekehrt an ihren Platz. Er saß eine Weile unbewegt, als gelte es die neugewonnene Skulptur erst einmal auszukosten, die Rückkehr aus der Erscheinung eines zerfledderten Balges zu endgültig erscheinender Form. Und nun richtete sich, als werde in seinem Innern an einem Faden gezogen, die hellgelbe, bisher fest an den Hinterkopf geschmiegte Krone auf, ein leuchtender Irokesenkamm, der sonnenartig über ihm strahlte. Dann legte er in seinem Königsschmuck den Kopf zurück und stieß einen Schrei aus, eine funkensprühende Kreissäge war auf Beton gestoßen und kreischte bis zum Zerspringen des Sägeblatts.
Ich meinte, die Tür werde nun aufgerissen und jemand hereinstürzen, als sei ich dabei, dem Kakadu Gewalt anzutun, aber nichts rührte sich. Von fern drang es weiter rondohaft in den Salon, man war diese Schreie hier gewöhnt, sie waren in diesem Haus eine andere Form von Stille, ein Zeichen, daß weiter nichts geschah. Ich trat an den Käfig, der Kakadu hopste auf seiner Stange etwas zurück. Nein, sein Auge war kein Knopf, es war nicht stumpf, es glitzerte wie ein Teertropfen im Schnee, ich stellte mir vor, daß alles, was dies Auge sah, an ihm kleben blieb wie winzige Fruchtfliegen. Nach der Lärmeruption fand der Kakadu zu einer eleganten