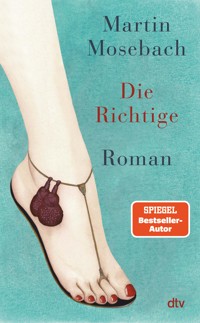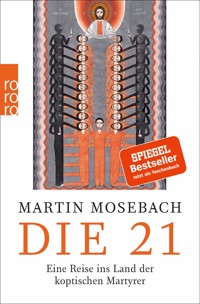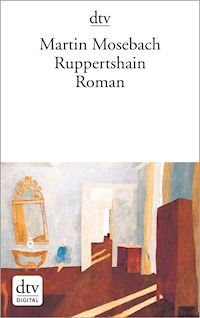Hanser E-Book
Martin Mosebach
Das Blutbuchenfest
Roman
Carl Hanser Verlag
Der Autor dankt dem internationalen Kolleg Morphomata der Universität Köln und dem Deutschen Literaturfonds für Gastfreundschaft und Unterstützung.
Die Übersetzung aus dem Satyricon des Petronius auf Seite 207 stammt von Michael von Poser.
ISBN 978-3-446-24538-9
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2014
Schutzummschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Umschlagabbildung: Nikolaus Heidelbach
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Inhalt
Erstes Kapitel Ivana, schaumgeboren
Zweites Kapitel Rettet Jugoslawien!
Drittes Kapitel Epiphanie einer Assistentin
Viertes Kapitel Bosnische Einkreisung
Fünftes Kapitel Ein Arbeitsessen
Sechstes Kapitel Vorsicht mit der Karaffe
Siebtes Kapitel Die Pflicht der Mestrovic
Achtes Kapitel Triumph des Ahnungsvermögens
Neuntes Kapitel Die Würde im Dunkeln bewahren
Zehntes Kapitel Die Erfindung eines Festes
Elftes Kapitel Schön sauber
Zwölftes Kapitel Der philosophische Augenblick
Dreizehntes Kapitel Die Machtergreifung der Krähen
Vierzehntes Kapitel Unter Männern
Fünfzehntes Kapitel Die Rückkehr zur Ordnung
Sechzehntes Kapitel Die Vergebung der Schildkröte
Siebzehntes Kapitel Tragödien und ihre Vermeidung
Achtzehntes Kapitel Löckchen drehen
Neunzehntes Kapitel Nur geliehen
Zwanzigstes Kapitel Die Billetts verkaufen sich wie geschnitten Brot
Einundzwanzigstes Kapitel Nichts anzuziehen
Zweiundzwanzigstes Kapitel Liebe, Liebe, laß mich los
Dreiundzwanzigstes Kapitel Kains Welt
Vierundzwanzigstes Kapitel Bosnische Idylle
Fünfundzwanzigstes Kapitel Schwarze Folklore
Sechsundzwanzigstes Kapitel Erste Hilfe
Siebenundzwanzigstes Kapitel Der dünne Film der Wirklichkeit
Achtundzwanzigstes Kapitel Bleibe im Lande …
Neunundzwanzigstes Kapitel Die Weisheit Ägyptens
Dreißigstes Kapitel Ein gerettetes Bankett
Einunddreißigstes Kapitel Die Welt schwankt wie eine Hängematte
Zweiunddreißigstes Kapitel Im Schatten der Blutbuche
Dreiunddreißigstes Kapitel Rotzoffs Fest
Das Blutbuchenfest
Erstes Kapitel
Ivana, schaumgeboren
Die Markies verließ um fünf Uhr das Haus, um fünf Uhr morgens wohlgemerkt, denn ihr Flug nach Berlin ging um halb sieben. Wie stets brach sie ein wenig zu früh auf, denn sie war eine überlegene Planerin ihres Lebens und bezog auch eigene Schwächen in ihre Berechnungen mit ein. Dazu gehörte, bei Aufbrüchen immer etwas Wichtiges zu vergessen, das Taxi umkehren lassen zu müssen und noch einmal in die Wohnung zurückzukehren. Ihre Angestellten, die jungen Mädchen in der Agentur, wußten genau, wann wirklich Ruhe einkehrte, eben nicht, wenn Frau Markies mit Gepäck ins Taxi eingestiegen war, sondern etwa zwanzig Minuten später, nachdem sie noch einmal in der Tür gestanden hatte und in Eile, aber zielstrebig einen Schriftwechsel heraussuchen ließ. Danach war es, als falle ein eiserner Reifen von den Mädchen ab, der sie bis dahin spannungsvoll aneinandergeschmiedet hielt; es war nicht so, daß jede Arbeit gleich aufhörte, nur der Galeerentakt der gemeinsamen Ruderschläge wurde nicht mehr vorgegeben, und so driftete das Büro unmerklich auseinander, bis schließlich alle Mädchen in ihre privaten Telephonate versunken waren und die Vorgänge auf den Bildschirmen nur noch mit geschickt gesetztem Fingertipp am Laufen hielten, spielerisch, wie man die Kugel eines Flipperautomaten in Bewegung hält.
Auch in diesen trüben Morgenstunden kehrte Frau Markies noch einmal um, ohne besorgt sein zu müssen, sie könne außer Atem geraten. Ihre Stirn zeigte keine Schweißtropfen, das nußbraune Haar lockte sich lässig, wie von mildem Sommerwind durchpustet, der japanische weite Mantel aus fein plissierter schwarzer Seide umwehte sie mit dem appetitlichen Rascheln von zerknülltem Butterbrotpapier. Aber dann trat um so tiefere Ruhe ein, als die Bürostunden erst gegen zehn Uhr begannen. Die weißen Lilien in den Vasen blühten dem Sonnenaufgang entgegen. Im Entreé hing noch eine Ahnung des Parfums von Frau Markies. Sie bevorzugte sehr schwere Düfte, die auch gut zu ihr paßten, denn sie selbst begann schwer zu werden und entsprach vollständig dem Anspruch von Fülle und Sattheit und Sommernachtwärme solcher Parfums, obwohl sie sich beim Essen und Trinken durchaus ein Regime auferlegte.
Jetzt atmete die Wohnung, die sich ans Büro anschloß, erst einmal aus. Die Wohnung kam gleichsam mit sich ins reine, zumal Frau Markies auch bei solchen frühen Aufbrüchen keine Unordnung zurückließ. Sogar das ungemachte Bett war nicht zerwühlt, sondern verriet nur am Abdruck des Kissens, daß ihr Kopf darauf geruht hatte. Das Licht drang weich in die Räume vor, erst grau, dann weiß, dann rosig, dann wieder weiß werdend, zur Tagesobjektivität vorstoßend, das Stimmungshafte hinter sich lassend.
Ein Schlüssel drehte sich im Schloß, dann ein zweiter, dann ein dritter. Frau Markies’ Wohnungstür war armiert wie ein Gefängnistor. Sie genoß das Schnurren und Schnappen der Schlösser und das schwere Zufallen des Türflügels als akustischen Beweis ihrer Sicherheit. Es war die Putzfrau Ivana. Sie ließ die Türflügel aufschwingen, planmäßig um acht Uhr. Die junge Frau trat ein und rief, während sie in die noch nicht aufgelöste Parfumwolke, die geistige Gegenwart von Inge Markies hineinschnupperte: »Hallo, ich bin’s«, so hatte sich das eingespielt. Frau Markies verabscheute es, wenn unversehens jemand vor ihr stand. Sie war schreckhaft und konnte dann für einen Augenblick die Beherrschung verlieren. Als keine Antwort kam, drückte Ivana die Mobilnummer von Frau Markies. Da meldete sich auch schon deren warm-dunkle, dabei scharf artikulierende Stimme wie aus großer Nähe. Sie war inzwischen aber in Berlin gelandet und saß schon im Taxi. Ivana hatte mit Frau Markies ihre Erfahrungen. Eine davon war, daß die Dame selbst es liebte, unversehens im Zimmer zu stehen. Das jedenfalls wäre in der nächsten Stunde wohl ausgeschlossen, obwohl Ivana ihrer Arbeitgeberin vieles zutraute und für möglich hielt, daß sie mit geheimen Mächten im Bunde stehe; diesen Verdacht hatte Frau Markies zu nähren verstanden, indem sie auch Ivana, nicht nur ihre Kunden und die Mädchen im Büro, gern belehrte, sie verfüge über »das Herrschaftswissen«, und Ivana hatte bisher keinen Anlaß, daran zu zweifeln. Ein starker Herrschaftswillen ruft bei den Beherrschten freilich auch die Neugier hervor, dessen Grenzen auszuerproben. Wer herrschen will, muß anwesend sein.
Ivana ging in das große helle Badezimmer von Frau Markies und ließ warmes Wasser in die Wanne. Das Fenster war in der unteren Hälfte mit Milchglas versehen, durch die obere drang ungebrochen das Sonnenlicht ein. Wie viele moderne Menschen ließ Frau Markies, deren Umgebung sonst von teurer Sparsamkeit geprägt war, in ihrem Badezimmer einen gewissen Luxus zu. Spiegel bedeckten die Wände, um den Körper der hier Badenden von allen Seiten zu präsentieren. Ein heller feinporiger Stein – um Gottes willen kein Marmor! – umgab die tiefen ovalen Waschbecken und die Badewanne. In der kühlen Sachlichkeit der Umgebung prunkte ein altertümlicher Schminktisch aus einer Theatergarderobe mit von vielen Birnen besetztem Messing-Kippspiegel. Hier war jener Wald von Flaschen und Tiegeln aufgestellt, der für Frau Markies’ Wohlbefinden unabdingbar war. Aber diese Flaschen ließ Ivana unberührt. Sie wußte nicht recht, was darin war, und hielt ihren Inhalt für etwas Medizinisches; wer wußte schon, woran Frau Markies im geheimen litt. Sie nahm nur die Badeölflasche, aus der sie es schwerflüssig türkis in den Wasserstrahl rinnen ließ. Ivana kickte ihre Sandalen zur Seite und begann sich auszuziehen. Sie trug einen schwarzen Jogginganzug – ihr »Pol Pot«-Kostüm, wie Frau Markies nie versäumte zu sagen, Ivana lachte dann ein bißchen mit, ohne zu wissen, was »Pol Pot« wohl sei, die Assoziation hätte ihr aber bestimmt nicht mißfallen. Schon als sie sich das Oberteil über den Kopf zog, begann sich ihr Geruch im Raum zu entfalten, ein kräftiger gesunder, keineswegs schweißig abgestandener, für sie höchst bezeichnender Dunst, etwas entfernt Landwirtschaftliches war auch dabei, obwohl sie längst nicht mehr wie zu Hause in Bosnien mit Ziegen und Kühen umging, sondern mit Staubsaugern und chemischen Putzmitteln. Jetzt war sie nackt. Die Spiegel zeigten sie von allen Seiten. Wer dabeigewesen wäre, hätte sie studieren können, ohne um sie herumzugehen. Ihr Körper war von unauffälliger Vollkommenheit. Sie war nicht groß, dem zeitgenössischen Ideal der Langbeinigkeit, das oft nur durch Staksigkeit erfüllt wird, vermochte sie nicht gerecht zu werden. Schenkel und Waden waren rund und schön geschwungen, Knie und Fußgelenke sehr schmal, das Hinterteil war nicht klein und nicht groß, aber breit genug, um einen deutlichen Einschnitt der Taille entstehen zu lassen. Der Bauch war weich, wenige aschblonde Löckchen kräuselten sich darunter, die Schulter schmal und abfallend, die Brüste nicht groß, kegelförmig stehend mit kirschroten Warzen darauf.
Ivana wich ihrem vielfältigen Bild nicht aus. Sie wandte den Kopf und sah sich von rechts und links, aber wie eine Fremde, ohne Gefallen oder gar Mißfallen. Die kritische Überprüfung der eigenen Erscheinung, die so viele Frauen belastet, war ihre Sache nicht, und da gab es wahrlich auch nichts zu kritisieren, wenn man nicht an den kleinen roten Händen hätte herummäkeln wollen, die von Kindheit an gearbeitet hatten, ohne doch breit und hart zu werden, sondern eine leicht feuchte Patschigkeit bewahrten. Wie unerschrocken sie damit zupackte. Nie hätte sie bei ekelhaften Arbeiten Gummihandschuhe getragen. Sie kannte überhaupt die Empfindung des Ekels nicht. In einen stinkenden Mülleimer oder in die blutigen Eingeweide eines geschlachteten Tiers griff sie mit der Geste moralischer Überlegenheit über den Dreck, den sie durch Entfernung an seinen Platz verwies. Jetzt prüfte sie mit den Zehen die Wassertemperatur. Es war schön warm. Ihre kleinen Füße hatten kräftig rote Fersen und Zehen; die stachen um so mehr ab, als die Haut sonst am ganzen Körper blühend weiß war, nicht durchsichtig, nicht blaß, nicht farblos, sondern von starkfarbigem Weiß, und überhaupt ergab sich jetzt am frühen, aber schon voll entwickelten Morgen das reizvollste Farbspiel: das türkise Wasser, der schillernde, darauf treibende Schaum, der weißhäutige Körper mit seinen rötlichen Akzenten, der nun eintauchte in Lichtkaskaden, Wasserspritzern, Flimmern, zugleich wohlige Wärme, ja Hitze, die zur frühmorgendlich leichten Frostigkeit aufs angenehmste paßte und Ivanas Stirn feucht werden ließ.
Denn jetzt ist der Augenblick gekommen, auch ihr Gesicht zu betrachten, jetzt, wo es vom Schaum wie von einer gestärkten Halskrause umgeben, wie abgeschlagen auf der Wasseroberfläche lag. Sie reckte den Oberkörper noch einmal in die Höhe, um sich in zeitloser, ja ewigkeitlicher Frauengeste mit geneigtem Kopf das Haar im Nacken zusammenzufassen. Sie nahm ein Gummiband, um die Locken am Hinabfallen ins Wasser zu hindern. Es ist oft beklagt worden: In den schönsten Momenten ist niemals ein Maler oder Photograph zur Stelle. Und es gab in ihrem Leben auch sonst keinen Zusammenhang, in dem ein anderer sie genießerisch hätte betrachten können. Sie lebte nicht mehr wie ihre Mutter, die möglicherweise niemand je nackt gesehen hatte, die es auch beim Wechseln der Kleider stets verstand, im Ablegen des einen Stückes das andere schon halb angelegt zu haben, die übrigens bis heute einen starken Duft nach frischem Basilikum an sich hatte, ohne daß Ivana hätte sagen können, ob die Mutter sich wohl mit gequetschten Blättern dieses um das Haus herum reichlich wachsenden Krauts einrieb. Ein Badezimmer hatte es ohnehin zu Hause nicht gegeben. Im Sommer übergoß man sich mit Wasser, hinter einem Mäuerchen im Hof, wo auch die Pumpe stand, Männer und Frauen getrennt natürlich, im Winter bei hohem Schnee stand der Waschzuber in der Küche. Inzwischen hatte Ivana für den Einbau eines Badezimmers im Elternhaus gesorgt, ein Duschbad mit Kacheln aus Deutschland, auf kleinem Raum freilich und nicht für voyeuristische Feste geeignet. Und die fanden auch in dem Souterrainzimmerchen, in dem sie in Frankfurt mit ihrem Mann wohnte, nicht statt – wann auch? Wenn sie beide erschöpft von der Arbeit kamen, hätte auch einem feuriger verliebten Paar sehr selten der Sinn nach Liebesinszenierungen gestanden. Aber man sollte die Nüchternheit von Ivanas Eheleben nicht auf die Umstände ihrer Frankfurter Arbeitslast schieben. Sie war nicht die Frau, die Freude daran gehabt hätte, sich irgendeinem Mann zu zeigen, gar verliebte Stimmung, erotische Spannung zu erzeugen. Sie kannte Frauen, die so etwas machten, aber sie schüttelte darüber verständnislos den Kopf, wie es ein zehnjähriger Junge getan hätte: den bemerkenswert großen, nicht eigentlich weiblichen, vielleicht nicht einmal lebendig menschlich wirkenden Kopf. Die hellenische Antike hat ein Schönheitsideal begründet, das in der Natur kaum anzutreffen ist und, wenn es sich dann doch einmal verwirklicht, gar nicht unbedingt schön erscheint. Die berühmte griechische Nase gehört dazu, die den Sattel gerade aus der Stirn wie die Schiene eines Gladiatorenhelms hervorgehen läßt, die weit auseinanderstehenden großen Augen, das muschelförmige große Kinn, auf dem das Gesicht wie auf einem stabilen Fundament ruht. Ein Maskengesicht hatte Ivana, welche Wirkung sich noch dadurch verstärkte, daß sie zu Starre und Finsternis neigte, zum Grübeln über erlittenes Unrecht und zur Verweigerung, das werbende Lächeln ihres Gegenübers zu erwidern.
In der duftenden öligen Wärme und im Spiel der Sonnenflecken löste sich diese Starre. Ivana lächelte. Sie lächelte sogar lieblich, ohne unmittelbaren Anlaß. Dies Lächeln gehörte nicht zu einem durch den Kopf ziehenden kleinen Gedanken, es wurde gleichsam von der ganzen Hautoberfläche hervorgebracht. Eine andere Möglichkeit zu sein tat sich auf. Sie plätscherte in der Wärme. Sie öffnete und schloß die Schenkel. Schaumfetzen bedeckten die aus dem Wasser ragenden Knie, das Wasser schwappte gegen den Badewannenrand. Kurz stellte sie sich vor, wie lustig es wäre, hier eine regelrechte Überschwemmung anzurichten, das Wasser über den Rand treten zu sehen, die Schwelle des Badezimmers überflutend, ein nicht mehr geheimzuhaltendes Bad zu nehmen, sondern im Zentrum eines zerstörerischen Wasserfalls zu sitzen. Diese nach parfümierten Kerzen, Tee und Lavendel duftende Wohnung mit den Lilienstaubwölkchen, die könnte man ganz einfach davonschwimmen lassen.
Es war nicht Ivanas Art, ihre Kunden schädigen zu wollen, das muß der Vorstellung dieses morgendlichen Bades unbedingt hinzugefügt werden. Dies Bad gehörte in ihre Spezialbeziehung zu Frau Markies. Woanders hätte Ivana sich nicht ohne weiteres in die Wanne gelegt, wenn man von Wereschnikows Wohnung absieht, aus verwandten Gründen nebenbei. Inge Markies hatte das Zeug zur echten Befehlshaberin. Sie hatte Ivana augenblicklich durch ihre Sicherheit, Genauigkeit und Distanziertheit beeindruckt. Es gab nie einen Zweifel, was sie erwartete. Sie prüfte mit einem Blick das Ergebnis, es gab mit ihr keine Debatten und keinen Raum für Mißverständnisse. Ivana war ein Homo hierarchicus, von ihrer grundsätzlich anarchischen Disposition einmal abgesehen; wo sie Führungskraft vorfand, erkannte sie das an.
Aber Frau Markies hatte dies beträchtliche Kapital, diesen Bewunderungsvorschuß verspielt, letztlich durch einen Mangel an Selbstbeherrschung. Sie hielt eine kleine Schwäche nicht genügend im Zaum, die aber wie Ameisen, Termiten und Holzwürmer die Basis ihrer Autorität zernagte. Es war für sie immer ein Angang, mit einem oft erfolglosen inneren Kampf verbunden, Bargeld aus der Hand zu geben. Überweisungen am Bildschirm verliefen bei ihr beinahe schmerzlos, sie hinterließen höchstens eine flüchtige Unlust oder eine lästige Taubheit, ein jähes Zusammenfallen der Vitalität, das schnell überwunden wurde, aber dies Öffnen der Handtasche, das Hervorholen und Abzählen von Scheinen, das widerstand ihr. Dies Verschwindensehen des eigenen Geldes in einer fremden Tasche, das war für sie mit einer unbeherrschbaren Empörung verbunden; aufs Gesicht trat nur die schlechte Laune, als sei sie mit der zu bezahlenden Leistung unzufrieden, das machte die Wirkung auf Ivana freilich nicht besser. Und oft genug konnte Frau Markies sich nicht einmal zu solch widerwilliger Leistung überwinden. Wenn sie spürte, daß es ein Tag war, an dem sie Schonung verdiente, fand sie die Kraft zu strahlendem Lächeln und bat Ivana, bis zum nächsten Mal auf das Geld zu warten. Lange dauerte es nicht, bis Ivana die Gesetzmäßigkeit dieses Vorgehens durchschaute, das sie psychologisch gewiß nicht weiter deutete. Es war das Ergebnis, worauf es ankam: Die Bewunderung schlug in Verachtung um. Das war natürlich sehr grob; man hätte auch amüsiert reagieren können, denn zum Schluß war das Geld, mit einer gewissen Verspätung, ja dann doch immer da, aber Zwischentöne waren nicht die Sache von Ivana. Sie sah die Welt schwarz und weiß, meistens also schwarz, denn ein fleckenloses Weiß ist selten.
In der Seifenschale lag ein großes Stück schwarzer Seife, Ivana nahm es und ließ es sich über den Körper gleiten, den sie dafür leicht aus dem Wasser hob. Als sie mit den Händen den Seifenschaum, der nach Weihrauch und einer bitteren südlichen Pflanze roch – es war Ivana, als kennte sie diesen Geruch aus den trockenen Gestrüppwäldern der heimischen Berge –, leicht streichelnd über ihren Brüsten verteilte, stutzte sie. War da nicht etwas anders als gewohnt? Waren die Brustwarzen, die ausdrucksvoll aus dem Wasser ragten – warum sah das kein Mensch! –, nicht ein wenig angeschwollen? Bemerkte sie in den Brüsten nicht ein feines, bis dahin unbekanntes Ziehen? Die Frauen, die sie kannte, sprachen oft von irgendwelchen delikaten Beschwerden, die meist gar nichts weiter bedeuteten; sie konnte da nie mitreden, denn ihr fehlte niemals etwas, von einer Neigung zu Schnupfen in langen Wintern einmal abgesehen. Es war ihr augenblicklich klar, was diese kleinen Symptome bedeuteten, da bedurfte es keiner weiteren Diagnose. Das Unvermeidliche war eingetreten. Sie war schwanger.
Es war ein guter Augenblick, um diese Gewißheit zu erlangen. Als der Arzt sie bestätigte, vermochte er Ivana nicht zu überraschen. Die Visite beim Arzt war nur ein teures Ritual, sie war in Deutschland nicht versichert. Und Ivana empfand zutiefst unrituell, darin lag vielleicht der schroffeste Gegensatz zum Rest ihrer Familie. In der Badewanne von Frau Markies, umgeben von der Luft eines sonnigen Luxus, eingehüllt in die Wärme und in den Lichtzauber der auf den kleinen Wellen tanzenden Flimmerpünktchen, war ihr bei dieser neuen Gewißheit schläfrig zumute wie nach größerem Blutverlust. Es regte sich weder Freude noch Widerstand.
Die Schwangerschaft war die zu erwartende Folge der Eheschließung, eine späte wohlgemerkt. Vier Jahre lebte sie nun schon verheiratet und schlief mit Stipo in einem engen Bett, da waren die Gelegenheiten, ein Kind zu empfangen, auch wenn nicht eigens angestrebt, unvermeidlich. Stipo war genau der Mann und hatte sich nach der Hochzeit auch darin bestätigt, den sie nicht hatte heiraten wollen. Es gab wenig oder nichts, was ihm ernsthaft vorzuwerfen war. Wenn sie ihn von sich wegstieß, weil er mit Zigaretten- und Schnapsatem zu ihr ins Bett kam, glaubte sie eher einer Pflicht zu genügen, als wirklich angewidert zu sein. Stipo war nicht der Mann, den sie wollte, aber wen wollte sie statt dessen? Bei der Antwort: Niemanden, wäre ihr unheimlich gewesen. Einer mußte es sein, denn Nonne wollte sie nicht werden, und die Lebensform der unverheirateten Frau war in ihrer Elternwelt nicht vorgesehen.
Stipo hingegen hatte Ivana gewollt und keine sonst. Sein ausgeprägtes Profil, die große pfeilgerade Nase, der stets halbgeöffnete Mund, mit dem er, was seine Augen sahen, aufschnappen zu wollen schien, waren seit langem und ausschließlich auf sie gerichtet, in einem Maße ihr zugewandt, zu ihr strebend, daß für einen Hinterkopf nicht mehr genügend Masse vorhanden war. Alles an diesem Schädel wurde nach vorn gezogen, hinten war er platt wie ein Brett. Er war aus unbedeutender Familie; nun, das machte nichts, der Sohn einer Witwe, da gab es keinen belastenden anspruchsvollen Anhang. Er war ein starker Mann mit Riesenhänden. Er konnte einen Backstein zerbrechen – nicht jeden, immer klappte es nicht, aber manchmal schon, wenn der Stein bereits einen Sprung hatte, dennoch eine beeindruckende Leistung, aber er gehörte nicht zu der Schar der anderen jungen Männer in seinem Alter mit ihren Prahlereien, Schlägereien, Saufereien, ihrer Fixiertheit auf jede erdenkliche Art von Frau – verächtliche Neigungen in Ivanas Augen, deren Abwesenheit aber ebenso verächtlich war. Jede Art Männerinteresse hatte Ivana scharf weggezischt wie eine wütende Gans. Ihre Drohung tätlich zu werden war glaubwürdig, und so hatte sich ein Cordon Sanitaire des Respekts um sie gebildet, den niemand zu verletzen wagte, bis auf Stipo eben, der einfach immer dablieb, der durch keine Nichtbeachtung beleidigt, durch kein wegwerfendes Wort zu entmutigen war, im übrigen schlau genug, niemals unmißverständlich zu werben. Sie galten in der Familie und in weiterem Umkreis schon als Paar, bevor sie auch nur ein einziges vertrauliches Wort gewechselt hatten. Ivana, der Willensmensch: Hier war sie eigentümlich willenlos. Es war, als habe sie sich selber als Kampfpreis für den zähesten Freier gesehen, als habe das gesamte Liebesannäherungsgeschäft ausschließlich auf der männlichen Seite zu liegen und als sei ihr Part nur gewesen, die sich nahe am Ziel Wähnenden zu entmutigen. Man konnte ihrer Familie ein Verwurzeltsein in altertümlichen Anschauungen gewiß nachsagen, aber diese Haltung, aus der Ivana nicht herausgefunden hatte, so unwohl sie sich dabei auch fühlte, die war allein ihre Sache. Geradezu ohnmächtig und wenig erbaut hatten Vater und Mutter zusehen müssen, wie alles auf einen Schwiegersohn Stipo zutrieb und wie Ivana durch Indifferenz und regelrechte Meinungsverweigerung die Zwangsläufigkeit dieser Entwicklung noch verstärkte. Erleichtert war sie dann, als der große Schritt endlich getan war und das ihr im Himmelsbuch vorgezeichnete Schicksal, wie immer es aussah, endlich seinen Lauf nahm.
Das Badewasser wurde kühler. Die Sonne schien nicht mehr ins Badezimmer, denn sie war höhergestiegen und stand jetzt über dem Haus. Der Schatten vertiefte die Farben. Als Ivana die Beine anzog, sich mit den Armen auf dem Badewannenrand abstützte und unter Anspannung der unter der weichen Bauchdecke verborgenen kräftigen Muskulatur – noch ging das! – aus der Wanne aufstand, war es ein Rauschen und Sprudeln. Der Körper wuchs aus den bewegten Wogen hervor, schien selbst aus herabströmendem Wasser zu bestehen, glänzend wie Porzellan, der leider nicht anwesende Betrachter hätte sich vorstellen können, er erlebe, wie sich das Wasser zur Gestalt ballte. Ein großes Handtuch aus Waffelpiqué hüllte Ivana ein. Sie empfand lustvoll, wie das steife Piqué sich vollsaugte und schlapp und lappig wurde. Ivana stieg in ihren schwarzen Jogginganzug. Sie war noch barfuß, als sie draußen den Schlüssel im Schloß hörte. Das erste junge Mädchen traf ein, ein blöndlich-zartes Ding, sehr lieb zu jedermann, aber in Ivanas Augen das unnützeste Wesen der Welt.
Zweites Kapitel
Rettet Jugoslawien!
Solange ich Wereschnikow kannte, ließ er in seiner ausdrucksvollen, keineswegs gedämpften Suada stets eine Fülle großer Namen fallen, Leute, die mit ihm in beständiger freundschaftlicher Verbindung standen, jeden seiner Zeitungsartikel studierten und ihn wie einen Sohn und Bruder liebten. Boutros Ghali und Henry Kissinger waren nicht die kleinsten unter ihnen; als ich ihn bei Merzinger traf, hatte er, wie er fallenließ, gerade mit Jack Lang telephoniert und dessen »rückhaltlose Bewunderung für seine Arbeit« entgegengenommen – welche Art Arbeit, wurde mir nie wirklich klar, denn er war wohl, wenn ich das richtig sah, in keinerlei Apparat eingebunden; keine Universität, kein Institut, keine Redaktion besaß das Recht auf seine Mitwirkung; er war frei in der schönsten Weise, kein Galeerensklave wie der Normalmensch heutzutage. Bei Merzinger erschien er immer spät, stets von Maruscha begleitet; in dem meist bis zum letzten Platz gefüllten Lokal »machten sie Entrée«, um einen altmodischen, zu den beiden aber perfekt passenden Ausdruck zu gebrauchen. Wereschnikow mit seinem großen, bedeutenden, dabei durchaus hübschen Kopf – hübsch paßt nicht, ich weiß schon, hübsch ist zu diminutiv, es war eine männliche, eigentümlich tragische Schönheit um ihn. Er war nachlässig auf die englische Art gekleidet, mit großen alten Tweed-Jacketts und kamelhaarfarbigen Rollkragenpullovern, und eine würdige Folie, ein seriöser maskuliner Hintergrund für Maruscha – da kam ihm sogar zugute, daß er zugenommen hatte. Selbst bei Merzinger, wo die meisten Gäste an ihren Anblick gewöhnt waren, ließ sie, wenn sie sich zwischen den Tischen hindurchwand, die Gespräche in sich zusammensinken, für einen Augenblick nur, in dem die Männer sie aus den Augenwinkeln ansahen und die Frauen einen ärgerlichen oder ironischen Blick auf ihre Begleiter warfen, die sich so wenig im Griff hatten.
An Wereschnikows Ernst kam diese Welle verhohlener Aufmerksamkeit aber nicht heran. Merzinger hielt im Vorraum der Küche stets ein Tischchen für besondere Gäste bereit, die das Vorrecht besaßen, nicht reservieren zu müssen. Dies Tischchen wurde dann irgendwo dazwischengezwängt. Niemals gesellte sich das Paar, das »hohe Paar« ist man versucht zu sagen, zu den Stammtischbrüdern am Eingang. Keiner der Herren wäre auf den Einfall gekommen, sie dorthin einzuladen, aber diskret begrüßt wurden die beiden. Wereschnikow nahm diese Grüße mit edler Schwermut entgegen, während Maruscha jedem, der ihr zunickte, ein Zauberlächeln schenkte. Die Bildschöne war gutmütig und frei von jedem Stolz; jeder Mann, den sie wiedergrüßte, durfte sich in der Vorstellung wiegen, es sei das einfachste Ding der Welt, mit ihr in ein Gespräch zu kommen, sowie der feierliche Beau an ihrer Seite einmal abwesend wäre. Sie hatte einen auffällig-unauffälligen Stil; zunächst hätte ich gar nicht sagen können, worin der bestand, dann achtete ich darauf, und es war geradezu zum Lachen: Alles an ihr war immer und unfehlbar sandfarben, in verschiedenen Tönungen freilich, keineswegs monochrom, das wäre zu durchschaubar gewesen; aber diese Vielzahl an immer neuen, immer flaumfrischen Mänteln, Hosen, Pullovern, Strickjacken, die ihren blühendweißen Körper mit weichen Wellen von Saharasand umgaben, die war schon verblüffend. Es war dann irgendwann auch klar und wurde von ihr in diesem Sinn sogar ausgesprochen, daß dieser viele seidige, kaschmirige, wollene Sand von ihr auf Wereschnikow hin komponiert war – die Frau an der Seite eines solchen Geistes hatte ihre Eleganz zu zügeln, unsichtbar zu machen. Sie durfte nicht schmuckbehängt wie die Madonna von Pompeji auftreten – ein Stil, der Maruscha eigentlich lag, nur eben nicht, wenn sie mit Wereschnikow war. Aber närrisch machen konnte einen die sandige Pracht in ihrer Gesetzmäßigkeit schon. Eine Beschränktheit kennt auch der Gescheiteste, so auch sie, die wahrlich keine dumme Frau war, wenn auch ungebildet, aber allein die selbstironische Offenheit, mit der sie das eingestand, hatte im Grunde schon etwas Gebildetes, mehr mußte gar nicht geleistet werden. Sie war mir die liebere von beiden, was vielleicht schon herauszuhören war. Wereschnikows vertrauter Umgang mit den Großen der Erde, den ich ihm von Herzen gönnte, hatte ihn in solche Höhen gehoben, daß die Lebenslasten von Zwergen wie mir ihm nur ein stummes Wiegen des Hauptes abforderten; dieser Mann mit seinen tausend Verbindungen war zu zerstreut, mich einmal irgendwo vorzustellen oder zu empfehlen oder nur einen Rat zu geben, wohin sich am klügsten zu wenden sei. Nun weiß jeder, daß die Welt des Geistes, in Deutschland jedenfalls, streng fraktioniert ist: Die Literaten verstehen nichts von Musik, die Musiker nichts von Malerei, und daß Wereschnikow sich inkompetent fühlte, einem stellungslosen Kunsthistoriker mit allerdings immerhin »Cum laude«-Promotion – »Tintoretto in den Dogentestamenten des Cinquecento« – weiterzuhelfen, durfte ich ihm nicht einmal verdenken. Ich bekam deshalb zunächst gar nicht mit, daß mich angehen sollte, was er weitschweifig als seine gegenwärtige Beschäftigung entwarf, die Vorbereitung eines großen Kongresses im Auftrag der Unesco, des deutschen Außenministeriums, der EU-Kommissionen und anderer hochmögender Institutionen: eine Tagung, die sich mit den Fundamenten der Gemeinsamkeit der feindlichen Parteien auf dem Balkan, genauer in der Republik Jugoslawien befassen sollte, friedensfördernd selbstverständlich, antiseparatistisch, den Status quo des gemeinsamen Staatswesens stärkend. Ich wußte gar nichts über Jugoslawien, erinnerte mich aber, daß uns auf dem Gymnasium von den Geschichtslehrern zwei Staaten im Mittelmeerraum als Modell für die europäische Zukunft vorgestellt worden waren; zwei Staaten, in denen ganz verschiedene Völker in Frieden und Prosperität zusammenlebten: der Libanon und eben Jugoslawien.
»Diese Skepsis ist am Platz«, sagte Wereschnikow mit leidender Autorität, aber sie sei eben auch billig: Niemand Vernünftiges wünsche einen Zerfall Jugoslawiens. Er habe englische, französische, amerikanische Stimmen des allerhöchsten Ranges in strengster Vertraulichkeit dazu gehört. Ein Zerfall Jugoslawiens komme für die Mächte des Westens nicht in Frage, sei auch anachronistisch, ein Rückfall in den Postkutschen-Nationalismus. Es müsse den streitenden Parteien behutsam, aber nachdrücklich vermittelt werden, daß die Weltgesellschaft keinen Zerfall des jugoslawischen Staates wünsche – allein schon zur Vermeidung von Nachahmungen –, noch dulden werde, daß man sich mithin auf die basisdemokratischen Werte irgendwie einigen müsse. Man müsse sich irgendwie vertragen. Er sagte mir das so streng, als sei ich selbst der Balkan-Separatist, der hier zur Ordnung gerufen werde, dabei hatte ich zu dem Thema, in dem Wereschnikow offenbar höchst bewandert war, keine Meinung. Maruscha auch nicht, die Champagner bestellte, während wir Männer beim Bier saßen – Wereschnikow trank übrigens niemals viel und bestellte sein Bier, um davon zwei Schluck zu nehmen, dann wurde es allmählich warm, während der Schaum zusammenfiel.
Ganz plötzlich waren wir dann bei mir; der Kongreß über »die Würde in den verschiedenen Balkan-Kulturen, über den katholischen, den orthodoxen, den muslimischen, den atheistisch-philosophischen, den demokratisch-libertären, den reformsozialistischen Würdebegriff unter Teilnahme der maßgebenden Autoritäten aller betroffenen Gruppen« sollte von Begleitveranstaltungen reich umrahmt werden: Musik, Literatur, Malerei des Balkans sollte Jugoslawien als eindrucksvolle Kulturnation präsentieren. Auch hier liefen die Vorbereitungen, nur die Finanzierung war noch nicht gesichert. Das sei sein steter Kampf. Wereschnikow sprach in männlich beherrschter Anklage: Er müsse alles, aber auch alles allein machen, alles allein anschieben, alles allein auf die Beine stellen und zum Schluß sogar noch selbst das Geld herbeischaffen. Seine Exposés stießen stets auf Begeisterung und Bewunderung, aber dann hieß es, gleichsam im Postscriptum, daß angesichts der angespannten Haushaltslage – nun, ich wisse schon: Er möge bitte selber nach »Drittmitteln« Ausschau halten. Wieso Drittmittel? Wer war hier der dritte? Er kannte noch nicht einmal den zweiten, der sollte offenbar gänzlich ungeschoren davonkommen. Unversehens, aus der Klage heraus, wandte er sich mir zu, als sei das, was er gesagt hatte, nur die Vorbereitung auf seinen großen Vorschlag gewesen.
Er plane im Kontext des Kongresses auch eine Ausstellung jugoslawischer Kunst, der ganz großen Kunst der Zwischenkriegszeit, als das »jugoslawische Projekt«, wie er sagte, noch jung und hoffnungsvoll gewesen sei – »Könnten Sie mir nicht ein Exposé für eine repräsentative Mestrovic-Ausstellung schreiben?« Nachdem er das triste Schicksal seiner Exposés zuvor geschildert hatte, war das hoffnungsvolle, ja enthusiastische Glimmen, das jetzt in seinen Augen lag, eine Überraschung. Maruscha lächelte sphinxhaft, das sah bei ihr besonders reizvoll aus, weil bei ihr die feierliche und geheimnistuerische Würde der üblichen Sphinx ganz wegfiel. Nur das innere Wohlbehagen am Besitz eines Geheimnisses, das kein schreckliches war, lag auf ihren rosigen Lippen. Ich fragte mich, woher Wereschnikow seine Selbstbeherrschung nahm, angesichts und im unbestrittenen Besitz von Maruscha irgendeinen anderen Gedanken fassen zu können, als sie unablässig auf diese Lippen und überallhin zu küssen. Seine Nüchternheit hatte geradezu etwas Wissenschaftliches, wie die eines korrekten Gynäkologen, dem die Schönheit oder Häßlichkeit einer Patientin gleichermaßen unsichtbar zu sein hat. Oder hatte hier die Gewohnheit schon ihr schlammiges, lähmendes Werk begonnen? Indem er mir seinen Vorschlag machte – »Nein, im Ernst, ohne Spaß, ich brauchte so ein Exposé lieber früher als später« –, hatte er jedenfalls mit der Gewohnheit gebrochen, seine eigenen Angelegenheiten »wie einen Raub zu hüten« – um es mit dem heiligen Paulus zu sagen, nein, da sollte nun womöglich gar ein handfester Auftrag vergeben werden …
»Die Kunst-Seite meines Kongresses interessiert die Sponsoren übrigens komischerweise am meisten, für Kunst ist viel mehr Geld da als für Philosophie.« Mestrovic sei die ideale Figur – gegenwärtig im Westen beinahe unbekannt, obwohl in Nordamerika gestorben, aber ein gesamteuropäischer Künstler, Rom, Paris in der Biographie, wenn man ihn auf eine Formel bringen wolle … Er zögerte, ich staunte, über Kunst hatte ich Wereschnikow noch nie reden hören, ihm genügte es, sich von einem lebenden Kunstwerk begleiten zu lassen, von Maruscha, der Milch-und-Blut- und Milch-und-Honig-Katze.
»Ethno-Art-déco«, sagte Wereschnikow, der Ausdruck war ihm zugefallen, er war noch nicht einmal stolz darauf. Ich hatte nicht die blasseste Vorstellung von Mestrovic. Und an Nationalkünstlern der aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangenen »jungen slawischen Nationen« fesselte mich nichts. Dabei hätte mir klar sein müssen, daß ich mein Kunsthistorikerleben, sollte jemals Geld dabei herausspringen, wohl kaum im Tintoretto-Pferch würde zubringen können. Es galt gerade für einen wie mich, die Augen nach neuen Weidegründen offenzuhalten. Ich ließ nicht durchblicken, ob mir Mestrovic etwas sagte, und Wereschnikow fragte mich auch nicht. Wer weiß, wo er den Namen aufgeschnappt hatte. Er war in Exposé-Laune. Exposés durften nicht zu detailliert sein, wenn sie gelesen werden sollten. Sie mußten vor allem das Vertrauen erzeugen, daß der Autor schon Bescheid wisse und mit Sicherheit aus seinen Skizzen ein großes Werk realisieren werde – »die meisten Leute können sich ohnehin einen Plan nicht in die Realität übersetzen, sonst würden nicht so viele idiotische Filme gedreht und so viele erbärmliche Häuser gebaut«. Er werde mir selbstverständlich hier »an diesem Tisch und in dieser Minute« – eine solche Präzision hätte mich aufhorchen lassen müssen – nicht garantieren, daß mein Exposé »in vollem Umfang« umgesetzt werde … Ich beeilte mich, ihm zu versichern, daß ich »den Betrieb kennte« – gerade an solcher Kenntnis fehlte es mir – und keine wirklichkeitsfremden Erwartungen hegte. Was er brauche, sei das Konzept einer großen Ausstellung: Angabe der Werke, die in Frage kämen, Versicherungs- und Transportkosten, geeignete Ausstellungshalle – »Aber bitte groß denken, es kann und muß eine große Sache werden, sonst paßt sie nicht in den Rahmen.« Das traute er mir jedenfalls zu – er kenne meine Arbeit, kenne mich aus vielen Gesprächen, schätze mich, das waren seine Ausdrücke, und ich fragte mich nur ganz kurz, worauf sich das beziehen mochte –, hatte er meine Doktorarbeit, die ich ihm in törichtem Stolz überreicht hatte, etwa doch gelesen? Worauf sonst mochte er sich beziehen – in meiner Gegenwart hatte immer er monologisiert –, aber es ist ein Reflex der großen Monologisten, ihre gehorsamen Zuhörer für besonders gescheit zu halten. Tatsächlich gibt es eine Kunst des intelligenten Zuhörens, ermutigenden Kopfnickens, bestätigender Einwürfe, der Hingerissenheit des Gesichtsausdrucks. Übrigens verlangte Wereschnikow davon kaum etwas. Unruhig und desorientiert wirkte er auf mich, solange ein anderer sprach; jedem, der nicht selbst dem stolzen und unabhängigen Volk der Monologisten angehörte, mußte schnell klar sein, daß keines seiner Worte zu Wereschnikow hinübergelangte, daß man sein Thema offenbar nicht packte, daß man zu langweilig und blaß von ohnehin unwesentlichem Zeug sprach, zu leicht, um in Wereschnikows Bewußtsein einzusinken. Wenn Wereschnikow wirklich einmal zum Zuhören verdammt war, was leider auch vorkam – etwa bei Sitzungen, die seine Exposés zum Gegenstand hatten –, gelang es ihm inzwischen mühelos, abzuschalten und zugleich auf die Entstehung eines Risses in der Lückenlosigkeit fremder Rede zu achten. Sowie er beim andern Bedenken oder eine Absence oder eine kleine Ratlosigkeit wahrnahm, hatte er den verbalen Fuß sofort in der Tür.
»Lassen Sie ihn nur machen«, sagte Maruscha und legte ihre Hand auf die meine, und diese Berührung ließ ein Wohlgefühl in mich einströmen, das Wereschnikow, der diese beiden Hände zerstreut betrachtete, mir offenbar nicht neidete. Maruschas Hände waren so delikat wie die Hände aus der Spülmittelreklame im Fernsehen, die mit polierten Fingernägeln in warme Seifenlauge eintauchen und im flüssigen Element wie zarte Meerestiere spielen, während das Weinglas sich von selbst in funkelndes Kristall verwandelt. Sie war seine beste Mitarbeiterin, wußte er das? Nahm er sie oft genug mit zu den Sponsoren-Besprechungen? Und durfte man nicht sicher sein, daß Maruscha sich niemals ihrer Erfolge rühmen würde, aus gutem Geschmack, aber auch aus Intelligenz, denn das hätte ihr Gegenüber zum Nachdenken im falschen Moment geführt?
Ich hatte nur Wereschnikows Visitenkarte in der Tasche, als er aufbrach; als ich ihm versprach, über Mestrovic nachzudenken, wandte er sich schon zum Gehen.
»Nicht nachdenken«, antwortete er mit der geistigen Strenge eines väterlichen Seelenführers über die Schulter hinweg, »tun! Ich warte!«
Ein Auftrag. Aus der unerwartetsten Richtung, woher die großen Lösungen oft zu kommen pflegen. Als sie Merzinger verließen, passierten sie noch Rotzoffs Tischchen. Rotzoff gehörte zu den Stammgästen.
Dieser Mann hatte das Scheitern zu seinem Triumph gemacht; er wurde hier mit widerwilligem Respekt betrachtet. »Ich habe versucht, neue Blumen zu erfinden, neue Sterne, neues Fleisch, neue Sprachen … ich habe vermutlich übernatürliche Kräfte … – im Ernst! Damit ist nicht zu spaßen … aber ich habe meine Phantasie begraben … ich bin wieder auf dem Boden … Ich!« Wenn er das sagte, sah er sein Gegenüber mit nachdenklicher Sanftheit an, wie ein Reisender, der von lebensgefährlicher Fahrt zurückgekehrt ist, und fuhr dann fort: »Ich! Haben Sie mal darüber nachgedacht, was das heißt?«
Inzwischen war an seinem Tischchen schon viel getrunken worden. Merzinger brachte gelegentlich ein großes Weinglas, das er schwenkte. Dann steckte er seine lange Nase hinein, als wollte er ameisenbärartig den Wein erschnuffeln, nahm keinen Schluck und reichte den angeschnuffelten Wein weiter. Rotzoff roch gleichfalls daran, roch vermutlich nichts; – auch wenn ihm, wie er schmerzverliebt berichtete, nicht eben gerade mit erhitzten Drähten die Schleimhäute der Nase verödet worden wären, hätte er nichts gerochen, behaupte ich, denn das Zerstäubt-Atmosphärische war seine Sache nicht, er war der Mann der harten Effekte, und so kippte er denn den gereichten Kelch herunter: es sei ihm längst gleichgültig, wovon er Kopfschmerzen bekomme.
Maruscha verabscheute ihn, natürlich auf ihre Weise. Ein überirdisches Speziallächeln kam auch ihm zu, aber am Tisch hatte sie mir noch gesagt: »Der Mann ist nicht schön«, das war das schärfste, was aus ihrem Munde zu hören war – »nicht schön«, damit war der Betroffene geradezu aus dem Kreis der beseelten Lebewesen gewiesen, und er wurde diesem Urteil sofort gerecht, denn er hatte sie wie ein hungriger Schäferhund angestarrt und ihr Lächeln, als sei es ein Stück Wurst, aufgefangen und gefressen, nur um, kaum daß sie den Raum verlassen hatte, eine rüde obszöne Bemerkung zu machen – man muß sie nicht wiederholen, sie läse sich schlimmer, als wenn man sie nur hörte. Übrigens war Maruscha in solchen Sachen nicht zimperlich. Von ihrer alten Freundin Kasia, der großen Dame im Armenasyl, hatte sie viel Gepfefferteres gehört und stets herzlich darüber gelacht; nur sie selbst übernahm nichts davon, eine innere Stimme riet ihr davon ab. Obszönität war lustig, aber sie paßte nicht zu ihr, so hatte sie für sich entschieden. Und auch Rotzoff wollte sich nicht weiter mit ihr befassen – »er stehe nicht auf solche triumphierende Stutenweiblichkeit«, sein Fall seien »kaputte, perverse Kinder, halbe Knaben« – jetzt war es an ihm, erwartungsvoll um sich zu schauen.
Mit Meistern wie Mestrovic, mit Bildhauern, schon gar des zwanzigsten Jahrhunderts, hatte ich mich bisher nicht beschäftigt. Mein Modell-Bildhauer war Michelangelo, ein Wüterich gegen die Materie, ein Kämpfer mit Felsbrocken, die er wie einen persönlichen Feind selbst ausgesucht hatte, um sie kleinzukriegen, ihnen gleichsam das Knie in den Nacken zu setzen und sie wie eine eisenharte Nuß zu knacken. Vasaris Wort von den wie Bäcker mit Mehl bestäubten Bildhauern war mir im Gedächtnis, eine Kunst der Körperkraft war das, die breite Handgelenke von Maurern brauchte, wenig unterschieden von Steinbrucharbeitern und Straßenpflasterklopfern. Um so grotesker mein Vergleich: Das Bildhauer-Berserkertum des jugoslawischen Meisters Mestrovic war der Strohhalm, der sich mir gegenwärtig darbot, nach diesem Strohhalm mußte ich greifen. Und ich begann denn auch sofort die Vorstellung einzuüben, eine große Skulpturenausstellung vorzubereiten und mich probeweise für »die Skulptur an sich« zu begeistern: Denn wenn man ohne Enthusiasmus anfängt, dann werden noch nicht einmal die schäbigsten Berechnungen aufgehen. Ich muß mich begeistern; für die Dogentestamente – eine trockene Lektüre – habe ich mich seinerzeit auch begeistert. Die Autorität, die mir Wereschnikow ohne weiteres zusprach, so wie er sich selbst bei allem, was Geld bringen mochte, für zuständig hielt, die meinte ich, kaum daß ich allein war, auch schon zu besitzen – in mir sah ich das Instrumentarium des Urteilens, Wägens, Kategorisierens, Bewertens in professioneller Vollständigkeit ausgebreitet: Jedem Bildhauer auf Erden, eingeschlossen Mestrovic – hieß er nicht Ivan? –, war ich gewachsen. Ich sah bereits wie ein Bildhauer. Ich ertastete mit den Augen die parkenden Autos auf ihre plastischen Valeurs hin, ich erkannte skulpturale Schönheiten in den Steinpfosten meines Gartentores, ich sah den Sandhaufen einer Baustelle als massig-kraftvolle Plastik. Das war schon das Ergebnis des Heimwegs durch die Nacht: Der Vollmond schien so hell und scharf und goß als kosmischer Bildhauer weißes Licht und Schattenschwarz über alle Gegenstände. Die Erde gebar Skulpturen, die meinem Blick bisher verborgen geblieben waren.
Drittes Kapitel
Epiphanie einer Assistentin
Das Mädchen in der S-Bahn, mir schräg gegenüber auf der anderen Seite des Ganges, saß da nicht auch ein Bildhauermodell? Was war ein geeignetes Bildhauermodell? Ich neigte dazu, während ich das hellblonde, sehr weißhäutige, zarte Geschöpf diskret betrachtete, es zunächst zum Gegenteil zu erklären. Der Bildhauer würde doch eine gewisse Masse bevorzugen, die raumverdrängend – Raum in Besitz nehmend wirken könnte. Aristide-Maillol-Frauen waren die Idealmodelle, gewichtig, aber exakt geformt, mit bedeutenden Hinterteilen, aber scharfem Tailleneinschnitt, kräftigen, aber präzis geschwungenen Schenkeln und Waden. Dieses kleine, in Wahrheit gar nicht so kleine Mädchen hingegen war zwar nicht gerade ein Giacometti-Modell – das war immerhin auch ein Bildhauer, ein Anti-Bildhauer vielleicht, der wie der Tod den Menschen das Fleisch und Fett von den Knochen fraß –, nein, da war viel sanft-kindliche Körperlichkeit, wenn auch noch nicht weiblich-mütterlich ausgebildet, und, was mich überhaupt darauf brachte, sie in solche Überlegungen einzubeziehen, das waren ihre männlichen, ihrem Körper entgegenwirkenden Kleider: eine mit braun-grauen Tarnflecken bedruckte weite Militärhose, die einem kräftigen Soldaten gepaßt hätte, durch einen breiten schwarzen Ledergürtel über der schwanenhalsdünnen Taille zusammengezogen, dazu die schweren geschnürten Lederstiefel; das alles sah aus, als wäre sie in irgendeinem Bett ohne Kleider aufgewacht und hätte sich genommen, was da herumlag, und diese formlosen, jedenfalls ihren Formen nicht entsprechenden Klamotten, ja, die umgaben sie wie wegzuschlagender Stein einen schlanken Nymphenkörper. Über dem Gürtel trug sie nur zwei leichte Unterhemdchen übereinander, mit fadendünnen Trägern, die ein bißchen in die Haut der Schultern einschnitten: Dieser Oberkörper mit den kleinen Brüsten und dem langen schlanken Hals stieg aus dem Männerkleiderhaufen empor. Es war wie eine fortgesetzte Bewegung von unten nach oben, aber zugleich neigte sich der kleine Kopf mit dem nachlässig hinten zusammengeklammerten farblosen Haar auch wieder hinab in schönem Bogen. Weil ich ihr Gesicht noch nicht sah, war dieser lange Hals in seiner Feinheit das auffälligste an ihr. »Ihre Haut war so durchscheinend, daß man den Rotwein, den sie trank, ihre Kehle hinabrinnen sah.« Wer hatte sich diese anatomische Absurdität ausgedacht? Jetzt kam sie mir höchst wahrscheinlich vor.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!