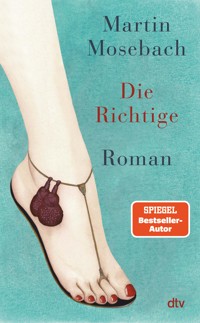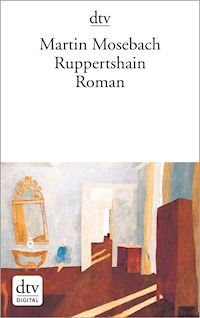9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Roman, in dem exzellent präsentierte Charaktere gelingen: Stephan Korn ist vielleicht eine der besten Schilderungen einer deutsch-jüdischen Existenz zwischen den Zeiten.« Die Presse »Ein Roman, in dem exzellent präsentierte Charaktere gelingen: Stephan Korn ist vielleicht eine der besten Schilderungen einer deutsch-jüdischen Existenz zwischen den Zeiten.« Die Presse Als Stephan Korn bei Kriegsende nach Frankfurt am Main zurückkehrt, findet er eine fremde, schrecklich veränderte Welt vor. Umso leidenschaftlicher flüchtet er sich in das Bett seiner ehemaligen Kinderfrau Agnes, wo er sich kindlichen Regressionen hingibt. Nach wie vor schlägt die Amme den deutsch-jüdischen Fabrikantensohn in den Bann ihrer magischen Kräfte. Aber auch zwiespältige Gefühle stellen sich ein. Auf seine Umgebung wirkt Stephan betörend – und Agnes ist nicht die einzige Frau, die sein Leben entscheidend beeinflußt. Da ist zum Beispiel noch Florence, die aus falschen Indizien die richtigen Schlüsse zu ziehen pflegt, und die schöne, wilde Baltin Aimée, mit der Stephan eine heftige Affäre eingeht. Nur das kleine Engagement, andere zu lieben, bringt er nicht auf. Eine rätselhafte Mattigkeit umgibt ihn. Der Roman zeichnet das authentische Bild einer Generation, deren Jugend durch Krieg und Nachkriegszeit unwiderruflich geprägt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Martin Mosebach
Das Bett
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ungekürzte, vom Autor neu durchgesehene Ausgabe
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© 2002 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40119-7 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-13069-1
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Erster Teil - AGNES
I.
II.
III.
IV.
Zweiter Teil - STEPHAN
I.
II.
III.
IV.
Dritter Teil - FLORENCE
I.
II.
III.
Nachwort
Für Peter Schermuly
»Ich bin ein blinder Maler, müssen Siewissen, so wie Beethoven taub war.«
Charles Bonnetti
Erster Teil
AGNES
I.
Daß meine Mutter in der Sonntagsmesse fast niemals zur Kommunion ging, mußte damit zusammenhängen, daß sie nur selten beichtete.
Sie war sehr andächtig während des ganzen Ritus, an dem wir gewöhnlich erst nach dem Ende der Predigt teilnahmen. Sie schlug sich an die Brust, sie machte ihre Kreuzchen und lag auf den Knien, aber sie blieb während der Kommunion, für die ich noch zu klein war, bei mir und ging nicht nach vorn, und das sicher nicht, um mich nicht ohne Schutz zurückzulassen. Außerdem gab es genug Frauen, die ihre kleinen Kinder mitnahmen, wenn sie zum Altar gingen, das bemerkte ich sehr wohl, und ich wußte auch, daß den Unvorbereiteten der Empfang der heiligen Speise verboten war.
Meine Mutter war also unvorbereitet, sie hatte in der letzten Zeit nicht gebeichtet, meistens lag die letzte Beichte überhaupt schon weit zurück. In ihrem Gesicht war kein Bedauern zu lesen darüber, daß ihre nachlässige religiöse Pflichterfüllung sie nun von der Kommunion ausschloß. Wir warteten noch ein Weilchen und verließen dann die Bank noch vor dem Segen.
So sehr meine Mutter also dem Altarsakrament Verehrung entgegenbrachte, eine Verehrung, die ihr verbot, es ungesühnt zu empfangen, so wenig Verlangen nach der Hostie schien sie zu besitzen. Habe ich sie überhaupt ein einziges Mal kommunizieren sehen? Und doch muß es vorgekommen sein, denn es fanden sich mehrere Bildchen zur Erinnerung an die Osterkommunion zwischen den Sterbezetteln in ihrem Gesangbuch.
Wann meine Mutter gebeichtet hatte, erfuhr ich schnell, aus ihrem eigenen Mund, sie erzählte beim Mittagessen immer ganz genau, was sie am Vormittag alles unternommen hatte, und sie hielt es niemals für nötig, ihre Beichte mit schamhafter Diskretion zu behandeln, sie berichtete darüber wie über einen Aufenthalt beim Friseur.
In ihrem Sinn für das Praktische legte sie ihre Beichte gern auf einen Vormittag, an dem sie in der Stadt Besorgungen machte und deshalb in die Nähe einer anderen als unserer Gemeindekirche kam. Stellte ich mir deshalb ihre Bußakte, wenn sie erzählte, daß sie heute morgen »schnell beichten« gewesen sei, immer als etwas Flüchtiges, Huschendes vor, das im Gegensatz stand zu der unbeweglichen Ruhe des lange Stunden im Beichtstuhl ausharrenden, absolvierenden Beichtvaters? Es war gewiß schwierig, einem Wesen wie meiner Mutter gründlich und vollständig zu vergeben, wenn sie auf eine kleine Weile ihre Einkaufspäckchen im Stich ließ und sich wispernd in das dunkle Kästchen setzte. Dann sagte sie ihre Sünden auf, aber was waren das für Sünden? Ich sah meine Mutter jeden Tag viele Stunden lang, und es wäre mir schwergefallen, ihre Sünden aufzuzählen. Sie sorgte doch dafür, daß ich meinen Pflichten nachkam und brav war, konnte das eine Sünderin? Ich vermutete, daß meine Mutter das ähnlich sah. Wenn sie schließlich zur Beichte ging und ihre Untaten, die nun zum Teil schon länger als ein Jahr zurücklagen, dem Priester ins Ohr flüsterte, dann müssen ihr diese Geständnisse ganz unreal vorgekommen sein, gerechtfertigt nur, weil sie zur vollständigen Ausübung einer alten Zeremonie gehörten. Dabei waren alte Sünden ohnehin die einzigen, die sie hätte bekennen können. Sie hatte keine neuen Sünden, denn sie erlebte ihre Gegenwart schuldlos wie ein neugetauftes Kind. Eine Sünde bei sich zu erkennen war für sie mit der intellektuellen Leistung verbunden, eine ihrer spontanen Handlungen in das Korsett eines moralischen Gesetzes zu schnüren, und sie empfand immer als unbefriedigend, daß all die gewichtigen Gründe ihrer Taten, die zu ihrer vollständigen Erklärung beitrugen, in diesem Korsett keinen Platz finden sollten. Immerhin, die Beichte war nun einmal eine entscheidende Voraussetzung für die Kommunion, Reflexionen über ihren Sinn konnten daran nichts ändern. Und dennoch vermute ich, daß die geringe Sehnsucht meiner Mutter nach der Eucharistie auch damit zusammenhing, daß die Kirche vor dieses höchste Glück des Menschen eine Schranke gesetzt hatte, die meiner Mutter offenbar nicht einleuchten wollte. Wenn ein missionarisches Argumentieren ihre Sache gewesen wäre, hätte sie vielleicht sogar versucht, den verräterischen Judas, der sich auf dem Schnitzaltar des Domes während der ersten Spendung der Kommunion beim letzten Abendmahl mit seinem prallen Geldsäckchen ungespeist vom Abendmahlstisch davonstahl, zum Bleiben zu bewegen und allenfalls einen Schluck aus dem Kelch taktvoll zu verweigern. Sie war es, die mich auf diesen Altar aufmerksam machte und mir die geschnitzten Messerchen und Gäbelchen der Apostel zeigte, ihr kleines Tischtuch mit den erhabenen Falten, das gebratene Osterlamm, das seinen Kopf noch auf den Schultern trug, und den kleinsten Apostel, der an der Seite des Herrn Jesus eingeschlafen war wie mein kleiner Bruder an der meinen, wenn wir im Auto von Spaziergängen im Wald zurückkehrten. Über der heiligen Tischgesellschaft saß eine große Frau mit starrem Blick, die eine kleinere Frau auf dem Schoß hatte, die wiederum einen ernsten Säugling vor sich hinhielt, und links davon war ein Engel mit einer Waage zu sehen. In jeder Waagschale saß ein nackter Mensch. Die eine hing tief unten, die andere schwebte hoch oben, obwohl sich in diese Schale auch noch ein Teufelchen gesetzt hatte. Daß der leichte Mensch der böse war, konnte ich mit dem Wort von der »Last der Sünden« nicht vereinen, obwohl mir einleuchtete, daß der kleine Teufel nicht viel wog. Judas war wohl auf dem Weg zur Waagschale. Obgleich er schwer genug war, sich durch sein eigenes Gewicht das Genick zu brechen, würde er dort die Schale nach oben schnellen lassen vor lauter Leichtigkeit. Schwere Sünden, leichte Sünden – das blieben mir beständig unauflösliche Rätsel.
Am Sonntag gingen wir nicht nur in die Kirche, sondern auch in den Wald. Wir liefen in der Kälte ein bißchen herum und atmeten die frische Luft. Der Wald war einförmig, überall wuchsen halbhohe Tannenbäume. Dann und wann traten die Bäume zurück und boten einen Blick auf einen anderen Wald, der jenseits des Tales lag. Im Wald stand ein Wirtshaus, bei dem wir haltmachten und Kuchen aßen. Die Eltern saßen dann noch eine Weile am Tisch und sprachen über den Kaffee. Ich ging schon hinaus, denn im Vorraum der Gaststube gab es einen Gegenstand, den ich liebte und immer wieder betrachten mußte. In einem großen Glaskasten saßen sieben ausgestopfte Eichhörnchen zusammen an einem sorgfältig gedeckten Tisch mit deutlich gefalteter Tischdecke. Um ihre Hälse waren gestickte Servietten gebunden, in den kleinen Pfoten hielten sie Messerchen und Gäbelchen. Auf dem Tisch stand eine Wasserkaraffe und eine Menage mit Essig und Öl, Pfeffer und Salz. Die Gruppe mochte das Werk eines längst gestorbenen Forstgehilfen sein, geschaffen an langen Winterabenden in der Waldeinsamkeit. Gewiß, bei diesem Mahl nahmen nur sieben Gäste teil, es gab auch kein Lamm, sondern kleine Spiegeleier auf den Tellern, keines der Eichhörnchen war an der Brust seines Nachbarn eingeschlafen, alle waren hellwach und blickten sich konzentriert aus ihren hart funkelnden Glasaugen an, so daß es wohl keinem gelungen wäre, sein Portemonnaie zu ergreifen und sich heimlich davonzumachen. Aber die Verwandtschaft, die zwischen der Eichhörnchengesellschaft und den das Abendmahl haltenden Jüngern bestand, war doch groß. Ich sah eine Reihe von Personen um einen Tisch versammelt, und es kam mir vor, daß es zwischen den Aposteln und den Eichhörnchen mehr Verbindendes als Trennendes geben mußte, nachdem sich die sonst so verschiedenen Wesen erst einmal zu Tisch gesetzt hatten.
Ich war ein Tagträumer, und wenn ich erst einmal eine unbestimmte Empfindung hatte, und ich war ungestört, so ergänzte ich mir in flüchtigen Bildern, was mir zur Erklärung meiner Empfindung fehlte. Nachdem ich die speisenden Eichhörnchen schon in die Gesellschaft der Apostel versetzt hatte, wuchs ihnen eine Heimat, eine Stadt, eine Lebensgeschichte wie von selbst zu, während die Eltern sich noch in der Gaststube unterhielten und wärmten.
Diese sieben Eichhörnchen stammten nämlich aus der schönen Stadt Ephesus und waren die Enkel eines alten Schuhflickers, der dort in einem Häuschen am Rande der Stadtmauer gelebt hatte. In dieses Häuschen waren nach seinem Tode die sieben Eichhörnchen eingezogen und führten sich gegenseitig den Haushalt. Das war eine schlimme Wirtschaft, denn die sieben Eichhörnchen waren alle miteinander schlechte Menschen. Das erste war groß und stark, herrisch und grausam, und die anderen fürchteten sich vor ihm wegen seines jähen Zorns. Das zweite war mager und wendig, dabei ein selbstsüchtiger Vielfraß, das alle anderen wegen der kleinsten Haselnuß verfolgte mit bohrendem Neid. Das dritte hatte den schönsten Schnurrbart, aber einen ewig ruhelosen Blick, eine aufdringliche Schmeichlergebärde, es war bar jeder Scham, ein berüchtigter Wollüstling. Das vierte war fein und elegant, von verwundendem Spott, von glänzendem, aber unfruchtbarem Geist, es schmähte den Himmel Tag und Nacht und glaubte an gar nichts. Das fünfte war ein Finsterling, hohläugig und fluchend, voll nachtschwarzer Lästerungen, es stank aus dem Maul und übergoß die anderen mit seiner Verzweiflung. Das sechste hatte eine spitze Nase, es konnte aus schwarz weiß machen, aus gerade krumm, aus Unrecht Recht, es hatte die hurtigste Art zu lügen und war ungerecht auch dann, wenn es ihm nichts nützte. Das siebente platzte fast aus seinem Fell, es würgte noch in sich hinein, wenn es schon fast erstickte, nichts war vor ihm sicher, was nicht angebunden war, sein gieriges Herz war so verwundet, wenn es etwas hergeben sollte, daß es am liebsten auch noch seinen Dreck gefressen hätte.
Solcher Art waren die sieben Eichhörnchen von Ephesus. Ihr Leben in dem kleinen Haus ihres Großvaters am Rande der Stadtmauer sah aber so aus: Zu jeder Stunde des Tages drang Geschrei, Gestöhn und Gezeter aus dem Häuschen. Die Fensterläden klapperten vor dem Ansturm der leidenschaftlichen Flüche, die sich die sieben bei jeder Gelegenheit ins Gesicht schrien. Da sie das Häuschen niemals verließen, mußten sie sich alle Bosheiten gegenseitig antun, und so stark ihre Hauptlaster auch entwickelt waren, hatte doch jedes noch andere, schwächere Laster, die es für die Tücken seiner Brüder empfindlich machten. So war das zornige auch blind, das wollüstige auch dumm, das gierige war auch schläfrig, das verzweifelte war unvorsichtig, das neidische konnte nicht rechnen, das ungläubige war verrückt und das ungerechte hatte ein schlechtes Gedächtnis. Die Epheser verspotteten diesen Haushalt und rühmten ihre Klugheit, die sie darauf achten ließ, in jeder Wohnung nur einen einzigen schlechten Menschen wohnen zu lassen, oder, wenn dieser Mensch verheiratet sein wollte, allenfalls zwei, und wenn der alten, verwitweten Großmutter der Undank nicht gleichgültig gewesen wäre und sie nicht jeden Tag ein Körbchen mit Spatzeneiern vor dem Haus am Rand der Stadtmauer abgestellt hätte, dann wären die sieben Eichhörnchen bald elend Hungers gestorben.
Eines Tages, als sie wieder zankend beieinander saßen, kam die Großmutter zur Tür herein und sagte mit ernster Stimme: »All eure Bosheit kann euch nicht nützen, wenn ihr so wie bisher in diesem Häuschen zusammen bleibt. Geht hinaus in die Welt und guckt euch nicht um; Beutel zu schneiden, Kopfnüsse zu setzen und Vogeleier zu trinken gibt es überall auf Erden, und der schlechte Mensch ist am stärksten allein.« Da sahen die sieben Eichhörnchen sich an, hielten im Streit inne, und das erste sagte: »Die Alte ist kein Dummkopf.« Darauf das dritte: »Sie ist schlauer als wir.« Das sechste: »Das sollten wir niemandem erlauben.« Das zweite: »Dann heißt es gepackt und abgereist.« Das fünfte: »Aber vorher dem verfluchten Häuschen die Scheiben eingeschlagen.« Das siebente: »Über das Glück, nicht mehr in eure Fratzen sehen zu müssen.« Das vierte aber sagte: »Hört mich an. Wenn wir uns nun trennen, dann laßt es uns auch so wirksam tun, daß uns kein Zauber jemals wieder zusammenführt. Wir wollen unser letztes Mahl hier mit den Spatzeneiern der Großmutter halten und uns daran erinnern, daß sie allein an unserem langen Zusammenwohnen die Schuld trägt, weil sie es uns erlaubt hat, das Häuschen niemals zu verlassen.« Diese Worte weckten einen großen Zorn in den anderen sechs Eichhörnchen, und da half der Alten kein Zetern und kein Bitten, sie schlugen sie tot und warfen sie in die Grube. Dann beschlossen sie in Einigkeit, wie das letzte Mahl vorzubereiten sei, und verfuhren dabei so: Das erste sollte die Eier in die Pfanne schlagen, das zweite sollte die Tellerchen auf den Tisch stellen, das dritte sollte Messerchen und Gäbelchen daneben legen, das vierte sollte die Gläser nicht vergessen, das fünfte sollte die Fenster verrammeln, damit kein Sonnenstrahl auf den Tisch fiel, das sechste sollte servieren, das siebente sollte ihnen das Essen segnen. Als alle ihre Arbeit getan hatten und sich um den Tisch im dunklen Zimmer versammelt hatten, stand also das siebente auf und sprach: »Ihr könnt euch denken, wie weh es mir tut, auf jedem eurer Teller ein Spiegelei zu sehen, das eigentlich mir zugekommen wäre und das euch im Halse stecken bleiben möge. Wer von euch das Ei weich liebt, dem möge ein hartes Ei auf dem Teller sein, wer von euch sich aber auf ein hartes gefreut hat, der soll sich vor einem zerlaufenen ekeln. Wem vor Eiern übel wird, dem soll sein Nachbar noch eines antragen, und wer sich nach einem weiteren verzehrt, der soll glotzend auf seinem Speichel herumkauen. Wem sein Ei nicht schmeckt, den verachte ich, wem es aber schmeckt, den will ich mit meinem Haß verfolgen.« Als die anderen Eichhörnchen das hörten, platzten sie fast vor Ärger und Entzücken, denn so sehr die Verwünschungen ihres Bruders die Kraft besaßen, die Wirklichkeit zu verwandeln und ihre Spiegeleier ungenießbar zu machen, so sehr bereitete es ihnen Freude, das siebente in solchem Grimm zu erleben. »Sooft ich ein Spiegelei esse, will ich mich an deine bittere Galle erinnern«, rief das erste. »Sooft ich ein Spiegelei esse, will ich mich freuen, daß ich euch nie wiedersehe«, rief das zweite. »Sooft ich ein solches esse, will ich die tote Großmutter hassen und euch, daß wir sie so spät umgebracht haben«, rief das dritte. »Sooft ich ein Spiegelei esse, sollt ihr anderen keines haben und hungern und dursten«, rief das vierte. »Sooft ich ein Spiegelei esse, will ich mir euren Tod vorstellen, bis daß er eintritt«, rief das fünfte. »Sooft ich eines esse, will ich lachen und Sachen machen, von denen ihr hören sollt«, rief das sechste. Das siebente rief: »Sooft ich ein Spiegelei essen werde, will ich nicht aufhören, bis ich es ganz und gar verschlungen habe, und wenn ich die ganze Welt retten könnte, so ich nur innehielte, ich würde doch nicht innehalten.« Als es das gesagt hatte, da wurde der Himmel schwarz. Die Wolken teilten sich, und ein Blitz sauste auf die Erde, schlug das Dach des Häuschens entzwei, fuhr mitten in das Zimmer, wo die sieben Eichhörnchen tafelten, zerstörte das ganze Haus und senkte die bösen Gesellen tief in die Erde, wo schon die tote Großmutter lag. Das Volk von Ephesus, dem die rauchgeschwärzten Trümmer des Häuschens an der Stadtmauer nicht geheuer waren, veranstaltete mit seinen Priestern Prozessionen an den bösen Ort, und welch ein Schrecken überkam die Bürger, als sich bei den ersten Tropfen geweihten Wassers, die auf den unheiligen Boden fielen, die Erde öffnete und in einer Höhle die sieben toten Eichhörnchen in den entsetzlichsten Verrenkungen, wie sie das strafende Feuer eben angetroffen hatte, allen Augen sichtbar wurden.
Möglicherweise waren sie damals schon ausgestopft worden. Obwohl ihr Anblick auch dem ahnungslosen Betrachter heilsame Schauder hervorrufen mußte, war es eine richtige Entscheidung gewesen, den Glaskasten zwar allsonntäglich zu zeigen, aber ihn doch nicht gleich in der Kirche aufzustellen, weil die große Anzahl der Bösewichter das rechte Gleichgewicht mit den Erlösten wohl gestört hätte.
Nicht jeder aber nutzte die Zeit, um Lehren aus dem Anblick der Eichhörnchen zu ziehen. Meine Mutter und mein Vater zum Beispiel kamen aus der Gaststube, wo sie Kuchen gegessen hatten, und betrachteten die sieben Tiere mit spöttischem Lächeln. Sie setzten sich dann völlig unbekümmert in ihr Auto, fragten mich, ob ich die Eichhörnchen recht schön gefunden hätte, setzten die großen Tüten voll gesammelter Pilze und Maronen neben sich auf den Boden und schüttelten ihre Arme, die leicht geworden waren von der Sünden Last.
Der Monsignore, bei dem meine Mutter beichtete, hatte ein köstlich gepflegtes langes Schnurrbarthaar, das durch das Gitter hindurch die Pönitenten in der Nase kitzelte, wenn er sie über die Eigenheiten ihrer Sünden ausforschte. Seine spitzen Ohren standen in die Höhe und waren zuweilen das einzige, was von ihm im Dunkel seines verhängten Gelasses zu erkennen war, wenn sich sein schwarzer Kopf langsam bewegte und ein fast bis zur Unsichtbarkeit gefilterter Lichtstrahl seinen Umriß mit einer fahl leuchtenden Aura umgab. Auch das weiße Tuch, auf das er seine Wange stützte, hatte eine kleine Leuchtkraft, ein mattes Phosphoreszieren, das den Hintergrund bildete zu der rosa Kralle, mit der er das Tuch festhielt. Meine Mutter schien in die Eigenheiten des Prälaten schon lange eingeweiht.
»Der Dichter!« rief der Bischof aus, als meine Mutter ihren Beichtvater erwähnte, »eine ungewöhnliche Begabung. Nun, jetzt ist er alt, den ›Hauskaplan Seiner Heiligkeit‹ kann ihm keiner nehmen, da werden wir ihm bald, ohne uns etwas vorzuwerfen, einen Ruhestand in Würde gönnen dürfen.«
Wenn aus diesen Worten eine vorsichtige Distanz herauszuhören war, dann vermochten sie dennoch nicht, bei meiner Mutter die Autorität ihres Beichtvaters zu beeinträchtigen.
Sie war seine Tochter, aber keine aufsässige, schlimme Tochter, sondern eine nachsichtige, eine Tochter, die sich ihre eigenen Gedanken macht, die aber niemals dabei den Respekt vor dem väterlichen Haupt vergißt, wenn sie es aus der Ferne betrachten darf. In dieser Gesinnung ließ sie die Einkaufspakete ohne Furcht vor den auf Warnungstafeln genannten Taschendieben in ihrer Kirchenbank, in der sie die Wartezeit vor dem Beichtstuhl verbracht hatte, indem sie in ihrem Gebetbuch blätterte, das, vollständig wie ein Photoalbum, die Bilder der bereits gestorbenen Verwandten enthielt. »Das sieht eigentlich trauriger aus, als es war«, dachte meine Mutter und klappte das Buch zu, nahm ihre kleine Handtasche und stand auf, um in den Beichtstuhl hinüberzugehen, denn das rote Birnchen über der linken Tür war erloschen und aus der Pendeltür war eine kleine Frau mit einem steilen grünen Hut getreten, der aussah wie der Kopfputz einer gotischen Büßerin, die sich in aller Öffentlichkeit der Hoffart bezichtigt. Meine Mutter öffnete die Tür in Gedanken an ihre Vorgängerin, die auffällig lange im Beichtstuhl geblieben war. Ein schneller Blick gab ihr die Vorstellung ein, daß diese Frau ganz anderes gebeichtet hatte als die Teufeleien, die sie beständig ausheckte. »Daß die sie ja nicht bestärken«, dachte meine Mutter, während sie niederkniete und Bernsteinlicht sie durch die gelben Glasscheiben der Türen umfloß, denn sie war der festen Überzeugung, daß ein alter Kirchenmann viel zu arglos sei, um den Selbstbetrug verstockter Sünder zu vereiteln, »und wem hilft das? Worauf muß sich die Reue denn schließlich beziehen?« Ihre Gedanken verloren sich, denn obwohl man ihr die Doktrin der Poenitenz vorgetragen hatte, stellte sie oft fest, daß sich die Fäden der Argumentation leicht verhedderten, wenn man sie auf eigene Faust wiederholen wollte.
Dann bemerkte sie, daß der Monsignore geradezu zappelig geworden war. Seine kleinen Augen blitzten im Dunkeln, er sah, was völlig unüblich war, meiner Mutter ins Gesicht: »Wollen Sie nicht beginnen?« flüsterte er gereizt.
»Ja, ja«, flüsterte meine Mutter also, »ich war in Gedanken. Ich bin bereit, wir können anfangen. Es wird auch nicht so lange dauern wie bei der Frau mit dem grünen Hut, die Sie eben dringehabt haben, ich habe nämlich diesmal nichts gemacht, überhaupt nichts.« Das heilige Eichhörnchen bewegte sich drohend und schweigend in seinem schwarzen Käfig und richtete die Ohren auf in mühsamer Beherrschung, meiner Mutter schien es, als wäre es vor Wut beinahe geplatzt. Dann flüsterte es: »Hab ich dir nicht gesagt, du sollst nicht lauschen? Hab ich dir nicht das letzte Mal schon verboten zu lauschen?« – »Ich hab überhaupt nicht gelauscht«, sagte meine Mutter. »Ich habe in meinem Gebetbuch die Photographien angesehen und sonst nichts. Es hat ja einfach so lang gedauert bei der Frau. Der Sonnenstrahl ist durch die Kirchenfenster von den sieben das Herz Mariens durchbohrenden Schwertern bis zur Mütze des Kaiphas gewandert. Ich hatte zum Schluß überhaupt kein Licht mehr.«
Der Priester hatte sich abgewandt, horchte in konzentrierter Haltung, die den Bekenntnissen meiner Mutter galt, und hörte statt dessen einstweilen nur das Schnappen des Brillenetuis. »Bitte«, flüsterte der Prälat. »Ich bin soweit.« – »Ich auch«, antwortete meine Mutter. »Ich bin fertig. Ich habe doch schon gesagt, ich habe diesmal nichts gemacht. Ich habe keine Sünden zum Aufzählen.« – »Das gibt es nicht«, sagte der Priester. »Doch«, sagte meine Mutter, »ich muß es ja wissen. Sind Sie es, der nicht gesündigt hat, oder bin ich es?« – »Welche Vermessenheit«, sagte der Monsignore, »welche religiöse Blindheit! Du weißt nichts vom Augustinus? Natürlich nicht. Man hat dich nicht unterwiesen, und du hast auch von selbst nichts gelesen, und du weißt nicht, daß jeder heilige Einsiedler, der allein in der Thebaïs sitzt, jeden schlimmen Tag, den Gott werden läßt, sieben Todsünden begeht.« Meine Mutter stutzte. Wieso sieben Sünden, wo der heilige Asket doch allein war? Nun gut, der brave Mann mochte seine Freude daran finden, jeden Tag irgendein Gelübde zu brechen, aber dann noch von einem heiligen Mann zu reden, schien ihr schönfärberisch. Bei einem Heiligen vermutete sie jedenfalls eine eher niedrige Anzahl der Rückfälle, die sie übrigens nicht nur der durchgeistigten Sittenstrenge der Eremiten – manche freilich waren Familientäuscher und Heiratsscheue – zuschrieb, sondern vor allem einem Gesetz der Gewohnheit, das für jeden Menschen galt, nur für sie selbst nicht. Sie begann jeden Tag mit einer neuen Bereitschaft, sich überraschen oder enttäuschen zu lassen. Der Schlaf löschte alle Erinnerung an den vorigen Tag einfach aus. Dennoch machte die Strenge des Beichtvaters mit seinen zornig zitternden Ohren sie nachdenklich.
Erschien es ihr immer noch sinnvoll und geboten, Genofefa Hauff aufgenommen und ihr insbesondere die Beaufsichtigung der Kinder anvertraut zu haben? »Kinder können noch am besten mit den Wahnsinnigen«, hatte sie meinem ratlosen Vater erklärt, der nach dem Einzug der Genofefa in unserer Etagenwohnung nur noch selten sein Zimmer verließ. Dabei war er es, der von dem Schicksalsschlag, der Genofefas Eltern getroffen hatte, derart bewegt sprach, daß meine Mutter kurzerhand in der Klinik, in der man das Mädchen mit Elektroschocks wieder zu Verstand zu bringen versuchte, anrief und sie für kurze Ferien zu uns einlud. Die Eltern des Mädchens, die auf dem Lande in einer kleinen, altmodischen, einem Gutshof nicht unähnlichen Fabrik Pappkartons herstellten, hatten zu meiner Mutter ein ähnliches Vertrauen wie zu dem Professor, der ihr Kind seinen strapaziösen elektrischen Verfahren unterwarf, obwohl diese Kur während des Aufenthaltes der jungen Verrückten bei uns ausgesetzt werden mußte. Sie brauchten nur die resolute Stimme meiner Mutter am Telephon zu hören, um jenen professionell-heiteren Umgang mit ihrem höchstpersönlichen Kummer darin wiederzufinden, den sie auch bei den Ärzten kennengelernt hatten.
Auf Genofefa muß die Entschlossenheit, mit der meine Mutter sie aus der Anstalt abholte, eine ähnliche Wirkung gehabt haben wie auf ihre Eltern, nur daß der Wahnsinn ihr andere Kombinationen ermöglichte, als sie in dem Vorstellungsvermögen der braven Geschäftsleute vorgesehen waren. Genofefa erzählte meinem Bruder und mir, kaum daß sie nach ihrer Ankunft mit uns allein gelassen wurde, meine Mutter, die sie aus ihrer vergitterten Zelle geführt hatte, und der Oberarzt, der ihr die schönen Elektroschocks so regelmäßig zufügte, unterhielten »ein problematisches Liebesverhältnis«, das bereits einen umfangreichen Briefwechsel hervorgebracht habe, den sie uns mit leichter Mühe rekonstruieren könne. Meine Mutter und der Oberarzt lebten ihre Liebe, nach den eifrigen Worten Genofefas, auf zahllosen Reisen aus, immerfort waren die beiden unterwegs. In Bahnhofswartesälen, in den Eingangshallen verkommener Hotels und an den Fußgängerüberwegen der großen Straßenkreuzungen saßen sie auf ihren Koffern und schrieben ihre Briefe, die sie dann einander übergaben, mit kleinen Geschenken, die sie am Wegesrand aufgelesen hatten, einem alten Schuh, einer zerstörten Trompete oder einem Schnuller aus feinem Gummi. Eine solche Liaison meiner Mutter leuchtete mir und meinem Bruder sofort ein, obwohl wir sie tagaus, tagein sahen und all die Reisen, von denen Genofefa uns berichtete, gar nicht stattfinden konnten.
Wir fanden es vielmehr selbstverständlich, daß meine Mutter sich zu uns setzte, um mit uns zusammen zuzuhören, wenn Genofefa die von ihr selbst hergestellte Kopie eines Liebesbriefs meiner Mutter an den Oberarzt vorlas und die zum Verständnis erforderlichen Erklärungen, den Ort der Niederschrift und die Antwort des Oberarztes, je nach unseren Fragen, hinzufügte. Wir bewunderten Genofefas wildes großes Gesicht, wenn sie schrie und sang, und wir verstanden die Bemerkung meiner Mutter, Genofefa sei einmal ein schönes Mädchen gewesen, als sei die Schönheit des Menschen nur eine vorbereitende, vorübergehende Phase, die ihn zu Wildheit und Großheit führen sollte. Genofefa wuchs schon dadurch, daß sie sich mit weit auseinandergespreizten Beinen vor uns aufstellte und sich dabei die Kämme herausriß, die meine Mutter ihr unter beruhigendem Zureden ins Haar gesteckt hatte. Dann wankte sie von einem Bein auf das andere, legte den Kopf in den Nacken und schüttelte ihre großen Locken aus, während mein Bruder und ich auf kleinen Kissen aus unseren Gitterbetten vor ihr auf dem Boden saßen und sie ebenso aufmerksam betrachteten wie die als Nikolaus verkleidete Kinderärztin am St. Nikolaustag.
Und war sie nicht eine andere Art Nikolaus mit ihrer dunklen Stimme und mit dem Stampfen der Füße, als sei sie eine Schauspielerin in Hosenrolle, die recht bubenhaft wirken wolle? Genofefa ging über das exaltierte Betragen von Laienschauspielern weit hinaus. Ihr Gesang stieg aus den Tiefen ihres Bauches, bewegte ihren großen Busen, der ihm durch feinschwingende Vibration noch mehr Klangfülle gab, und stieg dann aus ihrem Mund zur Zimmerdecke auf. Den Kopf hatte sie so weit zurückgeworfen, daß ihr Körper wie ein Rohr war, eine fleischerne Flöte, über deren Öffnung der Wind bläst und sich seine Melodien spielt. Er war ein gelegentlich gurgelnder, dann wieder hallender Gesang von vollständiger Freiheit der Komposition, aber mit einem Text in gebundener Rede, der uns Zuhörern erlaubte, an einem roten Faden durch das Auf und Ab des befremdlichen Liedes zu finden.
Das Lied von Genofefa spielte auf allerälteste Umstände an, vor dem Beginn der blutigen Geschichte, im Garten Eden, wo die Menschen, wie wir wußten, nackt unter den Bäumen umhergelaufen waren und sich an den Händen gehalten hatten. Auf den Flügeln eines Altars im Dom waren die beiden abgebildet, wie sie in puppenhafter Blöße ein Wäldchen verließen, um sich auf einer kleinen Wiese zu zeigen. Ihre Körper waren glatt und rund und gleich. Adam war nur an seinem kurzen Haar, Eva an ihren lang auf die Schulter fallenden Locken zu erkennen, alles andere war noch in ihrem Körper unter der sie bekleidenden rosigen Haut verborgen. Eva hielt eine goldene Frucht in der Hand, und ganz offensichtlich stellte das Bild dar, was Genofefa besang, wenn sie sich vor uns aufstellte und den Mund aufmachte:
Als der Adam den Apfel aß
und die Eva den Stiel,
als der Adam schon fertig war,
hat die Eva noch viel.
Meine Mutter hörte dieses Lied ein einziges Mal, es war auch das letzte Mal, daß Genofefa es laut und aus vollem Herzen sang. Sie flüsterte es von da ab in unsere Ohren, wenn sie sich unbeobachtet glaubte, da es, wie sie sagte, laut gesungen den Oberarzt verletze, der in seinem letzten Brief, den er in einem öffentlichen Pissoir geschrieben hatte, während sich draußen meine Mutter mit der Klofrau schlug und biß, bereits angekündigt hatte, er werde mit den Elektroschocks wieder anfangen, wenn Genofefa dieses ihn verletzende und erregende Lied noch einmal anstimme. Genofefa bekam dann einen Webstuhl, es war davon schon die Rede gewesen. Ihre besorgten Eltern ließen ihn in ihrer Villa auf dem Fabrikgelände aufstellen und studierten mit Eifer die Bedienungsanleitung, um sie ihrem verwirrten Kind nahebringen zu können. Genofefa verließ unser Haus mit der Ankündigung, sie werde jetzt Schleier weben, hauchdünne, durchsichtige Schleier, mit Sternengold bestickt und unendlich lang, damit meine Mutter bei ihrer nächsten verliebten Zusammenkunft mit dem Oberarzt im Impfzimmer des Städtischen Schlachthofs gut gerüstet sei. Der Chauffeur ihrer Eltern, ein noch ländlich gebliebener Mensch, sagte »das arme Ding«, als er sie sah, und setzte sie behutsam in das Auto. Sie winkte fröhlich aus dem Wagenfenster mit den Kämmen in der Hand, die sie sich schon wieder aus dem Haar genommen hatte.
Aber erst nach Genofefas Abreise wurde deutlich, daß meine Mutter in Gedanken an das Mädchen ihre Unbefangenheit verloren hatte. »Wenn sie nur das Lied nicht gesungen hätte«, sagte sie zu meinem Vater. Den Briefroman von ihrer Beziehung zu dem Oberarzt, der weit ausführlicher vorgetragen worden war als das Schnadahüpferl, hielt sie für weniger gefährlich, denn sie vermutete, daß die Zusammenhänge für Kinderhirne zu verwickelt gewesen seien. Anders das einprägsame Lied, das mein Bruder und ich gerne sangen und von der ersten bis zur vierten und letzten Zeile auswendig konnten. Der Text dieses Liedes galt allgemein als heikel, wenngleich sein Inhalt nicht frei von Undeutlichkeit war, das Sujet war nun einmal verfänglich. Wer wußte, ob nicht in dem Apfel- und Stielessen Andeutungen verborgen waren, die nur für erwachsene und gereifte Menschen bestimmt waren. Meine Mutter blieb noch lange nachdenklich, wenn sie an Genofefa und ihr Lied erinnert wurde, und diese Grübeleien erhielten neue Nahrung, als sich ihre Kinder mit dem Heranwachsen immer besorgniserregender entwickelten: Als gläubige Rationalistin, die dem Kausalitätsprinzip, wie es ihr in der Devise »Nix kommt von nix« entgegentrat, große Ehrfurcht entgegenbrachte, war sie bei dem Versuch, die bedenklichen Angewohnheiten, die sie bei ihren halbwüchsigen Söhnen entdeckt hatte, zu erklären, auch auf die Begegnung mit der wahnsinnigen Genofefa in der frühesten Kindheit gestoßen. Und es gab bittere Momente, in denen sie sich anklagte, daß es ja schließlich ihre eigene Maßnahme gewesen sei, die die Augen und Ohren der noch unschuldigen Kinder auf diese Rasende und ihren Gesang gerichtet hatte.
Dennoch – war dies Sünde gewesen, sträfliche Leichtfertigkeit, die man sich im Beichtstuhl in tiefer Reue vorwerfen mußte? Für einen guten Vorsatz war es ohnehin zu spät. Genofefa war ja nun schon mehr als zwei Jahre aus dem Haus, was heißt zwei Jahre? Drei, nein fünf Jahre mußten das schon sein, wenn sie richtig rechnete. Es kam ihr bei dieser Zählung zu Hilfe, daß Genofefa seit ihrer Abreise große Geschicklichkeit im Umgang mit dem Webstuhl erworben hatte und Jahr für Jahr eine von ihr selbst entworfene und angefertigte Tischdecke, in die als Muster eine große Sonnenblume eingearbeitet war, meiner Mutter als Geburtstagsgeschenk schickte. Man kann sich vorstellen, wie nachdenklich die Beschenkte wurde, als sie in einem schönen Bildband mit einer Reproduktion von van Goghs Sonnenblumen las, daß auch dieser Meister verrückt gewesen sei. Fünf Decken stapelten sich nunmehr im Wäscheschrank meiner Mutter. – »Mein Gott, wie die Zeit vergeht«, sagte sie laut. Der Prälat sagte: »Bist du dir endlich darüber im klaren, wie hochmütig du gesprochen hast? Ist dir endlich eine von deinen Hauptsünden eingefallen, die du bereit sein könntest zu bereuen?«
Gerade die Erwähnung des Begriffs »Hauptsünde« festigte jedoch in meiner Mutter den Entschluß, die Berufung der Genofefa in unseren Haushalt nicht zu bekennen. Genofefa war nun einmal dagewesen, und man durfte nicht vergessen, daß die Äußerungen der Geisteskranken ihrem Willen entzogen waren, daß andere Mächte durch ihren Mund sprachen: »Sie war ein Sprachrohr!« sagte sich meine Mutter und fühlte das unausdeutbare Schicksal, das die Hauff zu uns geführt hatte.
Nicht, daß meine Mutter ein unbeschriebenes Blatt gewesen wäre. Ihr Sündenbewußtsein war geschärft, sie hatte allerhand auf dem Kerbholz und hatte sich stets darüber Rechenschaft abgegeben. Der Seifengeruch, der im Beichtstuhl herrschte und von dem man nicht wußte, ob er der Schmierseife entstammte, mit der die Kniebank gescheuert worden war, oder einem sehr schlichten Beichtkind, das der seelischen Reinigung die samstägliche körperliche Reinigung vorangeschickt hatte, oder ob er Zeugnis für die asketischen Formen der Körperpflege des Prälaten selbst ablegte, erinnerte sie an die Stätte einer der vernichtendsten Niederlagen ihrer Moral, der im Souterrain gelegenen Küche ihrer längst verstorbenen Eltern, wo sie etwas angestellt hatte, was sie zwar seitdem schon öfter in der Beichte gestanden hatte, das ihr aber immer noch als Inbegriff der Verfehlung vor dem Himmel wie vor den Menschen erscheinen wollte und sich deshalb zu reuigem Bekenntnis immer wieder neu eignete.
Die Jahrzehnte waren nun darüber hingegangen, das Elternhaus war von den Bombenflugzeugen zerstört, aber genauso, wie das Souterrain mit seiner Küche dem Volltreffer unversehrt standgehalten hatte, überdauerte auch die Tat in ihrer Frische die mehrfach über sie dahingegangenen Absolutionen. Da gab es also doch noch etwas zu beichten, selbst wenn bei rücksichtsloser Prüfung die letzten Jahre in fleckenloser Schuldfreiheit dalagen.
Es war Sonntagmorgen kurz nach Neujahr, und es war noch sehr früh. Auf den Apfelbäumen und auf der Zeder lag feiner Rauhreif. Im Haus war es kalt, noch in keinem Zimmer war geheizt, denn mein Großvater mißtraute den Dienstmädchen und verdächtigte sie, mit der Kohle, die schließlich nicht sie bezahlt hätten, allzu verschwenderisch umzugehen. Er bestand darauf, daß nur unter seiner Aufsicht die Öfen angemacht würden, und so kam es, daß seine grundsätzliche Erklärung, er denke nicht daran, die Straße zu heizen, in Wahrheit allzu oft bedeutete, daß er auch in seinem Haus kein Feuer machen ließ, da seine Liebhabereien ihm nur wenig Zeit gönnten, um die Aufsicht über die Kohleneimer schleppenden Mädchen in einem anderen Zimmer als seinem Schreibzimmer auszuüben. Dort herrschte eine angenehme Temperatur, die die Fingergelenke geschmeidig hielt für ihre diffizilen Aufgaben, das Führen einer großen Papierschere nämlich, mit der er die Ränder seiner gesammelten Kupferstiche beschnitt und damit die Blätter auf immer neue Formate brachte. Aus einem Rechteck wurde ein Quadrat, aus einem Quadrat wurde ein Achteck, aus einem Achteck ein Kreis, und wenn man, schnapp, schnapp, aus zwei schließlich kreisrund zusammengeschmolzenen Bildern noch je ein Segment herausschnitt, konnte man diese Kreise zu einer großen Acht zusammensetzen, die aussah, als wohne man der Zellteilung eines Kupferstichs bei. Leben sollte in all das vergilbte Papier fahren, wenn er es wie einen Rosenstock im Herbst stutzte, aber seine rabiaten Schnitte ließen keine Hoffnung auf eine neue Blüte zu. Seine Schwiegersöhne haßten sein Werk. In ihrer Phantasie wuchs das Ausmaß der Werte, die mein Großvater zerstörte, in immer größere Höhen, und zwar je kleiner der Bestand an unbearbeiteten Blättern wurde. Nach seinem Tod war schließlich von einer Sammlung von beinahe europäischer Bedeutung die Rede, die seinem Formwillen zum Opfer gefallen sei, Grundstücke, ja ganze Straßenzüge hätten nun angeblich von den auf Streichholzschachtelgröße reduzierten Ridingern einstmals erworben werden können, vor allem in der schlechten Zeit, in der so viele Menschen mit nichts angefangen hatten, mit einem alten Autoreifen ein Trümmergrundstück eingekauft werden konnte, für eine Zigarette ein Waggon voll Braunkohle. Nein, dafür sei er zu anständig gewesen, zu vornehm, aber zu Hause zu sitzen und mit der Papierschere das Erbe seiner Töchter zu zerstören, dazu sei er sich nicht zu fein gewesen. Für jedes Kind ein Haus auf der Baumschulallee – daraus war nun nichts geworden, trotz all der Sparsamkeit und der sorgfältigen Überwachung der gewissenlosen Dienstmädchen.
Diese Überwachungsgänge nahm er meist vor seiner Morgentoilette vor, da er glaubte, daß man seiner Kontrolle zu so früher Stunde noch nicht gewärtig sein werde. Er verzichtete auf die Rasur, weil er dazu um heißes Wasser bitten mußte, mit der Folge, daß der Herd vor der Inspektion geheizt worden wäre und durch das Klingeln zugleich die Dienstmädchen die Gelegenheit erhielten, das Erforderliche zu tun, um den wahren Stand der Vorräte zu verschleiern. Er steckte daher sein Nachthemd in seine langen Unterhosen, legte einen französischen Offiziersgürtel um seine Hüften, um die Hose vor dem Herabrutschen zu sichern, und setzte den Filzhut auf, den er auf seinen Bergwanderungen zu tragen pflegte. Geräuschlos tappte er durchs Haus, öffnete die Türen der Schlafzimmer seiner Töchter und sah hinein, wischte mit bösem Murmeln Staub in seinem Schreibzimmer und stieg schließlich mit knackenden Knien in die Küche hinab, die zu dieser frühen Stunde blank und leer dalag, die Töpfe gescheuert in den Regalen, die Tische mit weißen Holzplatten, der Herd sauber und kalt in der Mitte und im Hintergrund die Tür zur Vorratskammer. Nachdem er die Küche eine Weile betrachtet hatte, öffnete er diese Tür und atmete die kühle Luft, die ihm entgegenschlug: Dort standen die Stellagen mit Äpfeln und Kartoffeln, das Sauerkraut- und das Gurkenfaß, Marmeladengläser und ein großes Glas mit eingelegten Eiern, in der Ecke ein Faß Apfelwein. Das waren seine Soldaten, er rief sie stumm auf, daß sie sich meldeten, aber selbst, wenn er sicher war, daß alles da war, blieb ein Rest von Mißtrauen in ihm zurück. Dann suchte er aus seinem Schlüsselbund den Schlüssel zum Weinkeller heraus und schloß den hinter der Vorratskammer liegenden Keller auf. War er vorher in seiner Kaserne gewesen, so war er jetzt in seiner Schatzkammer. Er legte den staubigen, flötenschlanken braunen und grünen Flaschen zart die Hand auf und ging von einer zur anderen, gelegentlich eine aus dem Regal nehmend und ihr Etikett wie etwas völlig Neues und Überraschendes studierend. So glich er dem sterbenden Kardinal Mazarin, der zum letztenmal eine Cellini-Bronze betastet, und tatsächlich befiel ihn stets das tragische Gefühl des Abschieds, wenn er seine Unterhosen hochzog, den Keller verließ und wieder sorgfältig abschloß. Diesen Augenblick, in dem ihr Vater nach seiner Patrouille das Souterrain wieder verließ, soll meine Mutter abgewartet haben, um in aller Ruhe die geplante Tat auszuführen.
Nun war das Gedächtnis meiner Mutter lückenhaft, die Welt formte sich ihr nach ihren eigenwilligen Grundvorstellungen. Sie empfand als Kausalität, was sich in Wahrheit nur für sie allein verständlich aneinanderknüpfte. Ihr radikaler Regionalismus hatte in ihrer Vorstellung den engen Kreis ihrer Herkunft längst zum Zentrum der Erde gemacht. Wenn sie zum Beispiel das Faß Apfelwein erwähnte, das im Vorratsraum hinter der Küche stand und jedes Jahr von den Vettern an der Mosel in das Haus der Großeltern geschickt wurde, so gebrauchte sie stets das moselanische Wort, als müsse jeder den Dialekt ohne weiteres verstehen, und in ihrem Wörterbuch würde es stets heißen: »Apfelwein ist ein schwächeres, blasseres Wort für Fietz«, und nicht etwa: »Fietz heißt auf mosel-fränkisch Apfelwein.«
So war ihr, wenn sie an ihre Tat dachte, nur im Gedächtnis geblieben, daß sich in der Küche niemand aufgehalten hatte. Bei dem vor ihren Augen erscheinenden Bild der leeren Küche fielen ihr sofort die morgendlichen Gänge ihres Vaters ein, die sie behalten hatte, weil sie in der geschilderten Kostümierung stattfanden, die ihr als besonderer Ausdruck der Männlichkeit und zugleich der Lächerlichkeit vorkam. Nie hat sie von daher die Angewohnheit verloren, typisch männliche Verhaltensweisen mit Hohn zu bedenken. Die leere Küche war mit diesen Kontrollen derart verbunden, daß sie sich ein Eindringen in das Souterrain nur noch als Überlisten ihres wachsamen Vaters vorstellen konnte. Dabei ist es unwahrscheinlich, daß meine Mutter, die den Morgenschlaf damals wie heute liebte, sich vor Tau und Tag erhoben haben soll, um ihren sichernden Vater abzupassen.
Es gab auch andere Gelegenheiten, bei denen niemand in der Küche war, Sommernachmittage, an denen ein Gewitter aufzog, während die Dienstmädchen sich zu einer Dampferfahrt aufgemacht hatten, die älteren Schwestern aus dem Hause waren, die Großmutter bei ihrer Tante saß und der Großvater in schweren Stiefeln die Höhen des Siebengebirges abschritt. Nur an einem solchen sich unendlich dehnenden Nachmittag, an dem die Uhren tickten und die Bienen summten, konnte aus dem Überdruß am Alleinsein und aus einem aus der Langeweile gewachsenen kleinen Hunger in meiner Mutter der heiße Wunsch entstanden sein, sich umzusehen, langsam aufzustehen, das verabscheute Häkelknäuel in sein Körbchen zu legen, den Atem anzuhalten und zu lauschen.
Meine Mutter war längst fort. Sie stand in der dämmerigen Diele und blickte hinauf, wo ein bißchen Licht aus dem bunten Glasfenster des Treppenhauses auf die Stufen fiel und grüne Pflanzen standen. Die Türe zum Souterrain war ein schwarzes Loch. Meine Mutter tastete sich im Dunkeln voran. Unten ging es um eine Ecke, wo verschiedene Besen standen, und dann leuchtete ihr die Küche entgegen, deren Reinlichkeit ihre Helligkeit noch verstärkte. Obwohl die Küche halb unter der Erde lag, war sie heller als die Wohnzimmer, die große Fenster hatten und doch immer düster waren. In der Küche roch es nach Seife. Der Boden war geschrubbt, und auch die großen Tische waren blank gescheuert. Dies Reinigungswerk hatte etwas Endgültiges, als solle auf diesen Tischen nie wieder Gemüse geschnitten und Fleisch gehackt, als sollten diese Töpfe verkauft und weggebracht werden, als sollte dieser Herd für immer kalt bleiben. Unter Anleitung meiner Großmutter verhielten sich die Dienstmädchen wie die klugen Jungfrauen aus dem Neuen Testament. Sie rüsteten die Küche, wenn sie sie verließen, als ob sie nie wieder dorthin zurückkehren würden, sei es, weil sie bei ihrer Ausflugsdampferfahrt ein sommerlicher Blitz erschlug, sei es, weil ihnen ihre Liebhaber bei Gelegenheit dieser Ausflugsfahrt ein Kind machten, was die fristlose Kündigung nach sich gezogen hätte.
Die Vorratskammer war offen. Meine Mutter wußte, was sie wollte. Sie öffnete einen großen Blechtopf, der im Regal stand und in den ein Muster aus goldenen Blättern und Früchten gestanzt war. Sie nahm den Topf in die Hände und neigte ihn. Am Rand blieb eine dünne Schicht kleben, und nun sah man, daß der Inhalt nicht schwarz, sondern in gehöriger Verdünnung braun war, zart goldbraun. Sie sah in den dunklen Spiegel, hob ihre Hand, steckte den Zeigefinger in die schwarze Masse, zog ihn heraus, betrachtete den großen gold-braunen Tropfen, der zarte Fäden zog, steckte ihn in den Mund und leckte den Finger sorgfältig ab. Die Masse war sehr süß und schmeckte ein wenig muffig. Daß sie an den Topf in der Vorratskammer gegangen war, wurde von niemandem bemerkt. Auch mit einer Briefwaage wäre die Menge des Entnommenen schwer festzustellen gewesen.
Meine Mutter schlug die Hände vors Gesicht. Es kostete sie Mühe zu sprechen. Schließlich flüsterte sie dem Prälaten zu: »Ich habe genascht. Ich habe, obwohl es streng verboten war, aus einem Topf mit rheinischem Apfelkraut genascht.«
Ob meine Mutter mit der Absolution, die sie nun ohne weiteres und ohne besonders drückende Bußauflagen empfing, recht zufrieden war, kann ich nicht sagen. Jedenfalls kehrte ihr aufsässiger Geist schnell wieder zurück, und obwohl ihr die Erleichterung ihres Herzens eigentlich gutgetan hatte und auch einem Bedürfnis nach gelegentlicher Reinigung ihrer Seele entsprach, führte sie in der Kirchenbank, in die sie zu ihren Seidenpäckchen zurückgekehrt war, murrende Selbstgespräche. Sie wisse sehr gut, was sie »ihrem Herrgott« schuldig sei, und bedürfe keiner Hilfestellung von einer Sorte von Priestern, deren Interesse an der Vergangenheit doch keinesfalls nur aus frommer Quelle komme. Eine vergangenheitskritische Stimmung hielt stets eine ganze Weile nach der Beichte noch an: Historiker mit ihren Veröffentlichungen zu den Hintergründen der Korea-Krise fielen ihr genauso anheim wie die Erinnerungen ihrer Schwester an die Studentenzeit. Sie verstieg sich in der Katerstimmung ihrer Beichterlebnisse gern zu einer geradezu schwärmenden Zukunftsgläubigkeit – der Blick nach vorn, das Zutrauen in die gewaltigen Neuerungen der Technik, die Erfindungen auf dem Gebiet der Zahnmedizin erfüllten ihre Reden, während alles, was an Kunst und Literatur erinnerte, mit Verachtung gestraft wurde, weil sie Kunst und Literatur vornehmlich in den Belehrungen ihres Mannes begegnete, der zur Kunst seines Jahrhunderts kein wirkliches Verhältnis gefunden hatte. Ihre Abneigung gegen die Griechen war nie so stark wie unmittelbar nach einer Beichte. Schon ein halbes Jahr nach einem Bußakt konnte sie Details aus dem Peloponnesischen Krieg mit freundlicher Gleichgültigkeit hinnehmen und die Suppe so ungerührt dabei ausgeben, als werde über die leichten Lasten des Alltags gesprochen.
Mein Vater hielt dies für langsam erwachendes Interesse an den Gegenständen seiner Unterhaltung und begann weiter auszuholen, Hintergründe darzustellen, Szenen zu entwerfen, die seine Thesen verständlicher machen sollten. Er ließ sich regelrecht von seinem Thema hinreißen, vor seinem inneren Auge erschienen die Bilder, die seine Wörter in ihm beschworen; und dann riß der Redestrom ab, und der Mund ging noch einige Male stumm auf und zu und gab nur ungeformte Laute von sich, die keinerlei Mitteilungswert besaßen. Er erschien in diesen Augenblicken meiner Mutter als das wahre Gesicht der Geisteswissenschaften: kindisch wirklichkeitsfern und zugleich vergreist. Dabei sprach ihre Aversion gegen die Bücherwelt meines Vaters nicht von ganz unsicherem Instinkt, denn so genau ihr mein Vater alles Gelesene, was er liebte, beim Essen vortrug und oft nur ein Stichwort genügte, um einen kenntnisreichen Vortrag hervorzulocken, so häufig hatte ich den Verdacht, daß er sie eigentlich gar nicht belehren, sondern ihr nur eindrucksvoll vorführen wollte, wie hoch die Mauer war, die sie von ihm trennte.
Ich glaubte diese Methode zum erstenmal festzustellen, als mein Vater während einer ernstlichen Verstimmung zwischen ihnen bei Tisch über die Naturphilosophie Goethes sprach und sie dabei aus den Augenwinkeln beobachtete. Er verwendete schwierige Wörter, die er, wenn sie ihn verständnislos ansah, nur andeutungsweise und wie nebenbei erklärte. Er beantwortete ihre Fragen mit Hinweisen, die sie noch mehr verwirren mußten. Und er aß mit betonter Munterkeit, als er feststellte, daß meine Mutter das Gespräch aufgegeben hatte und kopfschüttelnd und murmelnd den Löffel sinken ließ.
Überhaupt gab es immer Suppen bei diesen Unterhaltungen, die, obwohl meine Mutter immer die gleichen Suppen kochte, stets anders ausfielen, und zwar auf Grund von Versehen oder Unachtsamkeiten. Einmal waren sie sehr dünn, ein andermal sehr dick, dann hatten eigentlich geröstete Brotstückchen hineingehört, dann eine bestimmte Wurst, die im Eisschrank liegengeblieben war; ein Gemüse hatte es nicht gegeben, obwohl es angeblich gerade darauf angekommen wäre. Das Kochen war ein Mysterium, vom Menschen wohl nicht beherrschbar, sondern frei wie Wetter, Wind und Wolken. Mein Vater lobte die Suppe besonders dann, wenn er glaubte, daß meine Mutter ihn nicht verstanden habe. Als kleinem Kind waren mir die Suppen unerträglich, weil sie auch nach langer Zeit des Darinherumlöffelns nicht weniger wurden. Der Appetit meines Vaters war mir nicht geheuer, und ich fürchtete sein Lob, da es meine Mutter dazu verführen würde, bald wieder eine Suppe zu kochen.
Die Feststellung meiner Mutter, daß sie heute gebeichtet habe, hörte mein Vater mit Verlegenheit, da er nicht wußte, was er dazu sagen solle. Er hätte wissen müssen, daß ein Gespräch über religiöse Erlebnisse keinesfalls die Sache meiner Mutter war, da war nichts zu befürchten, denn sie stand unter dem Zwang, bei jeder Erwähnung der Religion eine skeptische oder amüsierte Äußerung folgen zu lassen, die den Gegenstand dem Gelächter preisgab, da blieb für Konfessionen kein Raum.
Tatsächlich begann sie auch gleich, über den Monsignore herzuziehen. Sie zog die Oberlippe bis zur Nase und schnüffelte mit gebleckten Vorderzähnen und gekrausten Augenbrauen herum, wie ich mir ein ungehaltenes, aber würdevolles Nagetier vorstellte. Mein Vater begrüßte die Vorstellung mit dankbarem Lächeln, mich selbst aber überzeugte sie derart, daß ich lange Zeit glaubte, meine Mutter habe bei einem wirklichen Eichhörnchen gebeichtet. Daran war für mich nichts Verwunderliches, denn ich hatte in den Metzgereien kleine Schweine aus Gips gesehen, die blau-weiße Metzgerblusen und schwachrot vom Blut ihrer Artgenossen gesprenkelte Metzgerschürzen trugen und Messer zum Säue-Abstechen in den Zehen hielten. Um ihre dicken Nacken lagen als Girlanden vielreihige Ketten aus kleinen Mettwürsten. Sie blinzelten sich zu und verbanden die äußerste Gefühlskälte mit einer gemütlich stimmenden Neigung zum Lebensgenuß. Warum sollten die Nagetiere nicht eben solche doppelten Anlagen besitzen? Wie ich wußte, waren sie zum Abscheulichsten fähig, was uns die sensible Lehrerin unseres bürgerlichen Stadtteils überhaupt zu schildern vermochte, nämlich zum Singvogelmord. Dazu wollte die geistliche Mahnung zu Besinnung und Einkehr zwar schlecht passen. Mehrere zueinander in Widerspruch stehende Eigenschaften kamen aber in der Tierwelt offenbar vor und mußten hingenommen werden. Die Menschen waren eindeutiger, sie waren gut oder böse, schön oder häßlich, groß oder klein, der Umgang mit ihnen war daher vorzuziehen.
Plötzlich fragte meine Mutter: »Hast du eigentlich Frau Oppenheimer wiedergesehen?« Sie fragte mich mit einem Unterton in der Stimme, aus dem mir deutlich wurde, daß sie damit eigentlich meinem Vater etwas sagen wollte. Es ging ihr nicht darum, ob ich diese Frau gesehen oder nicht gesehen hatte, sondern zunächst und hauptsächlich um ihren Namen, dem sie einen bedeutungsvollen Klang gab. Ich war nur ein Vorwand, aber ein gut gewählter, denn es war möglich, daß ich Frau Oppenheimer gesehen hatte. Ich kannte ihren Sohn aus der Schule, und es kam vor, daß der Junge an den Wochenenden von seinen Eltern mit dem Auto abgeholt wurde, da sie ein Landhaus besaßen und dort am Sonntag Tennis spielten. Ich wußte, daß meine Mutter gern über Frau Oppenheimer sprach, aber immer nur in Andeutungen, die für meinen Vater bestimmt waren und nicht für Kinderohren.
Ob meine Mutter meine Unschuld schützen wollte oder ob sie glaubte, daß ich diese Unschuld schon verloren hatte, aber dennoch nicht auf schlechte Gedanken gebracht werden sollte, weiß ich nicht. Selbst wenn sie nicht mehr an meine Unschuld glaubte, so wußte sie doch wahrscheinlich nicht, wie früh ich sie schon verloren hatte. Bereits bevor ich fehlerlos sprechen konnte, war ich der mächtigen Verführung eines kraftvollen und wilden Geschöpfes erlegen, mit dem ich in meinem Bett Nacht für Nacht engumschlungen lag und mich des Schutzes seiner gelb behaarten Arme dankbar erfreute. Mein Teddybär, der, als ich ihn geschenkt bekam, größer war als ich, war ein fürstlicher Freund und Liebhaber, seine Küsse waren kühl, aber seine körperliche Gegenwart war fordernd und erregend. An seiner Seite erlebte ich die erschreckendsten Abenteuer. Und wenn sie bestanden waren, ertrug ich seine Zärtlichkeiten in der Haltung eines Leibeigenen, der in Wohl und Wehe von seinem Herrn abhängt. Der Weg, den wir nachts zusammen zurücklegten, war weit und gefährlich, und ich brauchte seine Nähe und sein mutiges Brummen, um aufzubrechen, sobald das Licht in meinem Schlafzimmer ausgemacht worden war. Zuerst befahl er mir, mein kleines Nachthemd auszuziehen, dann legte er seinen roten Mantel an und bedeckte auch mich damit, so daß die große Zahl der gehörnten und gepanzerten Scharen, die nahe der Tür aufgestellt waren und uns beobachteten, mich nicht mehr sehen konnten. Auch ich sah sie nicht mehr und weiß daher nicht, wie wir an ihnen vorbeikamen, ob er sie totbiß oder ob sie ihn lauernd, aber tatenlos an sich vorbeiließen, weil sie wußten, daß ich ihnen später und früh genug anheimfallen würde, wenn er einmal nicht da wäre, um mich zu schützen.
Wir waren bald auf der Straße und sahen die Fassaden im weißen Mondlicht, überall üppig blühende Bäume, deren Blütenblätter langsam auf den Boden sanken und das Pflaster mit einem Teppich bedeckten, der sich in feuchten Schmutz überall da verwandelte, wo wir hintreten wollten. Dabei mußten wir weiter, wir durften nicht verweilen, denn jeden Augenblick konnte die eigentliche Todesgefahr aus einem der Hauseingänge herauskommen und den Schicksalskampf erzwingen. Das Schneien der Blütenblätter hielt uns dennoch fest, und der Bär erklärte mir die Häuser und ihre Bewohner, die er teilweise schon getötet hatte, teilweise noch töten würde, wenn sie erwachen sollten und aus dem Fenster nach ihm Ausschau hielten.
Es ist falsch zu sagen, daß die Gefahr dann plötzlich eintrat, denn daß sie jeden Augenblick eintreten konnte, war uns bewußt. Wir erwarteten sie geradezu und hielten uns eigentlich nur deshalb so lange bei den Häusern auf, um ihr Gelegenheit zu geben, endlich zu erscheinen. Dennoch war es wie ein grauenvoller Paukenschlag, als sich in die stille weiße Welt der Schatten eines Fahrrades schob, das niemand anderem gehörte als ihr – Madame Ines Wafelaerts, und schon stand sie selber da zwischen den Mülltonnen ihres Hauseingangs, aber sie sah uns nicht. Es gab zwei Kostüme, in denen sie auftreten konnte: Das eine war eine weitfallende zinnoberrote Jacke und schwarze Keilhosen, ein schwarzer Turban und vor den alterslosen Augen eine schmetterlingsgeformte schwarze Brille, denn sie war früher eine berühmte Rennfahrerin gewesen und hatte mit einem Kongoneger am Kilimandscharo gezeltet; das andere war eine strenge Rotekreuzschwesterntracht mit einer weißen Haube, auf deren Zelluloidstreifen das Rote Kreuz blutig strahlte, dann war sie noch schrecklicher, denn dann trug sie am Fahrradlenker eine Reitpeitsche, die sie für den Kampf gegen mich mit sich führte.
Meistens wechselte sie die Kostüme während des Kampfes. Sie gaben ihr eine Kraft, die sie unverwundbar machte und erschreckend war gegen meine waffenlose Blöße.
Wir standen lange und taten, als ob wir uns unterhielten, um Madame Wafelaerts zu zeigen, daß wir in eine andere Richtung gehen wollten als sie, denn sie hörte uns zu, obwohl sie ihrerseits tat, als füttere sie eine Kohlmeise, von der sie einmal behauptet hatte, daß sie ihr gehöre, um sie wieder einzufangen. Aber dies Idyll war trügerisch, denn bei der geringsten falschen Bewegung würde sie das Fahrrad herumschwenken, mich ins Visier fassen und angreifen.
Nicht immer kam es zum Kampf. Wenn ich viele Stunden unbeteiligt mit dem Bären sprach, dann konnte es sein, daß meine Angst mir ihren Zorn ersparte. Ich war dann zu Tode erschöpft und nicht eigentlich befreit, aber ich war nicht immer gleichermaßen wild auf ihr Blut und mußte deshalb warten. Manchmal aber geschah es, daß der Bär, obwohl ich ihn inständig bat, sich ruhig zu verhalten, eine falsche Bewegung machte, und dann riß sie das Fahrrad herum und fuhr auf uns los, die Augen verborgen hinter den Gläsern und die Reitpeitsche schwingend, um meinen nackten Rücken damit zu treffen. Die todesmutigen Bisse des Bären kosteten sie immer wieder einen Arm oder ein Bein, die aber im Nu wieder nachwuchsen oder, besser, an den Körper zurückflogen und ihre Kampfkraft wiederherstellten. Trotzdem gelang es ihr, die Peitsche ganz frei zu bewegen. Auch der Bär verhinderte das nicht, er biß sie an Stellen, die weit von der Peitsche entfernt lagen, und sie wehrte sich nicht dagegen, sondern ließ es sich gefallen, denn ihr Interesse war meine Züchtigung, gegen die nichts auszurichten war. Als sie sich schließlich aufs Fahrrad setzte, um wieder zurück in ihre Garage zu fahren, lief zwar eine kleine Blutspur hinter ihr her, es war jedoch kein Klagelaut zu hören. Ich aber war todesmatt und reglos in den rot gefärbten Blütenblättern und empfand es nur noch von fern, daß der Bär mich auf seine Arme nahm und seine ernste Aufgabe nun ausführte. Er trug meinen kleinen schwachen Körper auf das Dach des höchsten Hauses, das, als wir uns ihm näherten, zu brennen begann, und sagte mir ein paar höchst rührende Abschiedsworte ins Ohr, die von seiner Liebe zeugten und von seiner kraftvollen Sanftheit. Dann hob er mich hoch und warf mich weit hinein in das Feuer, wo ich liegenblieb, um zu verbrennen, und jenseits der Flammen stand der Bär und winkte mir zu; er nickte ernst mit dem Kopf und verließ mich wieder. Später konnte ich aus dem Feuer noch sehen, daß er sich unten auf der Straße ganz ruhig mit Madame Wafelaerts unterhielt. Sie war nicht mehr gefährlich und fragte überhaupt nicht nach mir, was mich nicht wunderte. Sie hatte durchaus auch nette Seiten und hatte zu meinem Vater sogar einmal, kurz nachdem sie mir einen vergifteten Blick zugeworfen hatte, gesagt, indem sie auf mich zeigte: »O selig, ein Kind noch zu sein.« Mein Vater war gerührt und erfuhr dann noch manches über den Rennsport in den zwanziger Jahren, sie war redselig und freundlich. »Sie ist eine arme alte Frau«, sagte meine Mutter, aber der Hausmeister, der sowohl unsere als auch ihre Heizung versorgte, wußte Besseres: daß sie nämlich einen Glasschrank besitze, der von oben bis unten mit den herrlichsten Preisen gefüllt sei, aus Gold, Silber und Bronze, Vasen, Pokale und Medaillen, eine königliche Pracht. »Sie ist eine Belgierin«, sagte er, um meine Mutter auf diese vorsichtige und taktvolle Weise Lügen zu strafen.
Madame Wafelaerts war ebenso plötzlich aus unserer Straße wieder verschwunden, wie sie vor meinen Augen aufgetaucht war. Wahrscheinlich hatte der Tod sie geholt und sie von ihrem Fahrrad gestoßen, als sie zu neuen Schandtaten ausfuhr. Sie konnte sehr schnell Fahrrad fahren, die rote Jacke wehte im Wind hinter ihr her, und ihre Brille wurde ihr ins Gesicht gepreßt. Auch mein Bär war auf einmal fort. Als er noch einmal wiederkam, trug er um den Hals einen hellblau gehäkelten Kragen, der seinen Kopf, den ich ihm abgerissen hatte, festhielt. Ich wandte mich von ihm ab, seine Verwundung hatte ihn für meine Zwecke unbrauchbar gemacht. Er verschwand dann endgültig und wurde einem lauten, unsauberen Kind geschenkt, das kleiner war als ich. Als ich in späteren Jahren jedoch begann, die Menschen in meiner Umgebung mit anderen Augen anzusehen, stellte ich mit Verwunderung fest, daß die Phantasien und Wünsche, die ich in bezug auf andere zu entfalten begann, eine Wurzel hatten, die ich längst kannte, weil aus ihr auch die Empfindungen gewachsen waren, die mich bei den Erlebnissen mit meinem Bären erfüllt hatten.
Wenn meine Mutter Bratäpfel machte, waren die wirklich kalten Tage schon vorbei. Der Schweiß trat einem auf die Oberlippe, wenn man sie aß, man brauchte frische Luft, ein offenes Fenster, vor dem die Vögel zwitscherten und die ersten grünen Blättchen sich bewegten. Die Aufmerksamkeit meiner Mutter war von Frau Oppenheimer abgekommen, sie nötigte uns, noch etwas zu nehmen, und beschrieb jedem am Tisch, der keinen Bratapfel mehr essen wollte, wie sehr ihre Schwestern in ihrer Jugend gerade solche Bratäpfel geliebt hätten.
Eine der Tanten war Witwe, eine Kriegerwitwe, wie man mir sagte, so daß ich zunächst glaubte, die friedfertige Frau mit den Pudellöckchen über den Ohren sei mit dem Kriegerdenkmal des Dorfes verheiratet, in dem wir über lange Jahre unsere Erdbeeren gekauft hatten. Dort stand zwischen dem Pfarrhaus und der Kreissparkasse ein eiserner Soldat, den die Hoffnungslosigkeit seines kriegerischen Unterfangens düster und wild gemacht hatte, von den Augen war gar nichts unter dem Helmrand zu sehen, er stürmte nach vorn, aber seine übergroßen Stiefel steckten fast bis zu den Knöcheln in matschiger Bronze, die ihm das Vorwärtskommen erschwerte.
Seine Kleider hatten nichts Uniformähnliches mehr, sie schlodderten ihm um den Leib, der aus purer Willenskraft bestand und der in das Zimmer der Tante strebte. Dort würde der Krieger ihr in die Augen sehen, und es stand fest, daß dieser Blick genügte, um auch die Tante in dunkelgrün angelaufene Bronze zu verwandeln. Daß sie den ihr von meiner Mutter so dringend angebotenen Bratapfel ablehnen mußte, war mir klar. Sie stand unter der strengsten Aufsicht und hütete sich, ihren Gemahl durch kleine Disziplinlosigkeiten zu reizen, selbst wenn sie an die Tage dachte, an denen sie für einen Bratapfel allerlei gegeben hätte.
Warum auch die jüngere Schwester meiner Mutter, die angeblich noch viel lieber diese Nachspeise aß, vor allem in ihrer Studentenzeit, sich weigerte zuzugreifen, als ihr die duftende Schüssel geboten wurde, ist mir hingegen nicht gleich klargeworden. Sie wehrte sich übrigens nur schwach.
Ich weiß nicht, ob sie überhaupt etwas sagte oder ob ihre Weigerung nur in einem einverständlichen Blickwechsel mit meiner